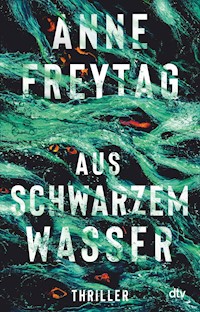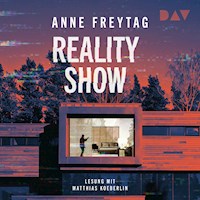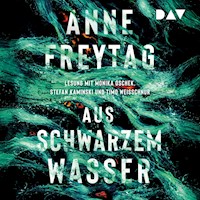9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ONE
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Bestsellerautorin Anne Freytag ist eine der großen und gefeierten deutschen All-Age-Stimmen
Manchmal findet man sich in den unwahrscheinlichsten Momenten ...
Eben hatte Sally noch ein Leben - eine beste Freundin, eine langjährige Beziehung und eine potenzielle WG mit ihrem Bruder. Aber dann kommt alles anders: Pia ist mit ihren Eltern weggezogen, Felix hat überraschend Schluss gemacht, und statt in die erste eigene Wohnung geht es in den zweiten harten Lockdown. Einmal mehr ist Sally eingesperrt mit ihrer Mutter und den drei Geschwistern. Und als wäre das nicht genug, zieht dann auch noch die ein paar Jahre ältere Leni bei ihnen ein. Unter anderen Umständen wären sich die beiden vermutlich nie begegnet. Doch jetzt schleicht Leni sich Stück für Stück in Sallys Gedanken und weiter in ihr Herz. Dabei hatte Sally sich so fest vorgenommen, sie nicht zu mögen ...
Lebensnahe Themen und eine bildgewaltige Sprache - verpackt in einem mit Liebe zum Detail ausgestatteten Hardcover
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 475
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungMittwoch, 02. Dezember, abendsHairy Styles?Brüder und SchwesternMutter unserJurassic ParkThe Show must go onPiller und PuschelTiming ist allesLife sentenceDas Kind braucht einen NamenDonnerstag, 03. DezemberDer Morgen danach. FamilienbandeLittle Miss SunshineAnother Fine Day Ruined by ResponsibilityKüchenpsychologieO Brother, Where Art Thou?Derselbe Tag, abends. Das Schweigen der SallyLove, actuallyA Bath Down Memory LaneDer Teufel trägt PradaLeni. Ohne WorteLeni. Tour de Haus41 Minuten später. True Lies …Leni. Tour de Haus IIZwei Wochen später. Freitag, 18. DezemberAch wie gut, dass Sally weiß …Leni Vidi ViciDie Leiden der jungen SallyLeni. ToastoyewskiAnd so it beginsKurz vorher. Leni. OpfergabenHinterher (ist man immer schlauer)Werthers EchteLeni. Hide and SeekEsskapadenZwei Tage später. Sonntag, 20. DezemberWer im Glashaus sitztAm nächsten Morgen. Montag, 21. DezemberLeni. Dream A Little Dream Of HerDrei Tage später. Donnerstag, 24. Dezember, abendsChristmas (Gri)eve.Joint VentureReady to launchEin Ring, sie zu knechtenAll I want for ChristmasLeni. Unbegrenzte MöglichkeitenFace offTwo’s company, three’s a crowdLeni. MauerfallBenutzeroberflächeWährenddessen. Leni. TrägheitsgesetzFreitag, 25. Dezember, vormittagsDer Morgen danach IILeni. Der Lauf des LebensEnt-TäuschungLeni. TeilchenbeschleunigerKaterstimmung vs. Merry ChristmasLeni. Gemachte BettenIn the PresentDie Taube auf dem DachDer Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringtLeni. TröpfcheninfektionAm selben Abend. Leni. Murphys GesetzGoodbye My FriendSix Words UnderEine Stunde später. NächstenliebeKurz vor Mitternacht. Leni. Q & A1:21 Uhr – Leni. Not everyone’s cup of tea1:55 Uhr KammerspielZwei Stunden später. 3:52 Uhr Back in the SpeiseLeni. Dead Of NightKnock Knock Knocking On Lenis Door4:47 Uhr – Leni. KörperweltenDreieinviertelstunden später. 8:04 Uhr OrganischKurz danach. Leni. MondsüchtigSamstag, 26. Dezember, morgensDer Morgen danach IIILeni. Under the weatherLeni. Time to say goodbyeHigh NoonRollenspielHallellujahVierzig Minuten später. Nicht ohne meine SchwesterAm nächsten Morgen. Sonntag, 27. DezemberDon’t cry for me, Felix WertherDreißig Minuten später. When Sally Met SallyEinen Tag später. Montag, 28. DezemberBed & BreakfastAm selben Abend. Leni. Crippled InsideGleichzeitig. Ausgesprochen gutLeni. Anfang gut, alles gutZwei Wochen später. Mittwoch, 13. Januar, morgensKismetFutur IIDanksagungÜber dieses Buch
Wäre Sallys Leben ein Film, würde sie darin ganz sicher nicht die Hauptrolle spielen. Sie wäre eher der Sidekick – die Tochter, die keine Probleme macht, die Schwester, die Konflikte scheut, die Freundin, die ihre Meinung für sich behält. Sally mag diese Rolle nicht, dennoch füllt sie sie aus. Bis die ein paar Jahre ältere Leni bei ihnen einzieht und das Gefüge durcheinanderbringt. In ihrer Gegenwart fühlt Sally sich zum ersten Mal irgendwie echt. Und ist deswegen mehr hin- und hergerissen denn je. Zwischen dem, was von außen betrachtet richtig zu sein scheint, und dem, was sich in ihrem Inneren gut anfühlt. Ist der Moment gekommen, endlich die Protagonistin ihrer eigenen Geschichte zu werden?
Über die Autorin
Anne Freytag hat International Management studiert und als Grafikdesignerin gearbeitet, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Für ihre Romane wurde die Autorin mehrfach für Literaturpreise nominiert und damit ausgezeichnet – unter anderem dem BAYERISCHEN KUNSTFÖRDERPREIS in der Sparte Literatur. Darüber hinaus gibt es konkrete Pläne zur Verfilmung einzelner Werke. Die Autorin lebt und arbeitet in München.
ANNE FREYTAG
VOM MOND AUSBETRACHTET,SPIELT DAS ALLESKEINE ROLLE
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © 2023 by Anne Freytag
Copyright deutsche Originalausgabe © 2023 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Lektorat: Katharina Runden
Umschlaggestaltung: Kristin Pang unter Verwendung von Illustrationen
von Anja Stiehler-Patschan
Satz: hanseatenSatz-bremen, Bremen
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-4832-2
one-verlag.de
luebbe.de
lesejury.de
Für alle, die auf der Suche nach sich selbst sind.Ihr werdet euch finden – jeden Tag ein bisschen mehr.(Und für dich, Sally. Wir haben viel gemeinsam.)
Mittwoch, 02. Dezember, abends
Hairy Styles?
Ich stehe frierend in der Wanne. Und dann denke ich, dass heutzutage kein Mensch mehr ein Badezimmer in so einem Schwimmbadblau fliesen würde. Schon gar nicht bis unter die Decke. Ein kompletter Raum von Kopf bis Fuß eingekachelt wie ein himmelblauer Schlachthof.
Rasierschaum läuft meine Leiste hinunter – erst die Leiste, dann die Innenseite meines Oberschenkels. Ich schaue in den Spiegel, stehe da mit dem Rasierer in der Hand. Die Haare nass, das Gesicht rot, der Blick skeptisch. Ein Wieso tust du das?, das sich endlos wiederholt. Die Antwort ist einfach, sie ist nur unangenehm. Kurz bevor Felix und ich zusammengekommen sind, hat er in einem Nebensatz erwähnt, dass er niemals mit einer Frau mit Busch ins Bett gehen würde. Kein Witz, genauso hat er es gesagt. Seitdem bin ich komplett haarlos. Abgesehen von denen auf meinem Kopf habe ich nur noch Wimpern und Augenbrauen – was völlig absurd ist, wenn man bedenkt, dass ich es früher kaum erwarten konnte, Schamhaare zu bekommen. Ich habe meinen Körper jeden Morgen unter der Dusche akribisch danach abgesucht. Und dann, als ich endlich eins gefunden hatte – ich war noch nicht ganz vierzehn –, hat sich überhaupt nichts geändert. Irgendwie hatte ich mir echt mehr davon versprochen. Als wäre so ein Schamhaar eine heimliche Eintrittskarte ins Erwachsenendasein. Wie eine Trennlinie zwischen Kind und Frau. War es aber nicht. Ich hatte einfach nur ein Schamhaar.
Ich erinnere mich noch, wie ich damals hier stand, in derselben Wanne, irgendwo zwischen euphorisch und ernüchtert, und darauf gewartet habe, mich anders zu fühlen. Darauf warte ich irgendwie bis heute – mit dem Unterschied, dass ich mir jetzt die Schamhaare wegrasiere, obwohl es juckt und ich kleine Pickel davon bekomme. Mir ist klar, dass es mittlerweile auch andere Möglichkeiten der Enthaarung gibt, aber die kommen nicht infrage, weil meine Schwester sie finden würde und ich mich dann vor ihr rechtfertigen müsste, wieso ich mich dem männlichen Diktat unterwerfe. Als wäre ich da die Einzige. Fast alle, die ich kenne, sind rasiert. Eine ganze Generation gepflegt bis in die Unterhose. Aalglatt und verlogen – und ein paar Tage später stoppelig mit dem unbändigen Drang sich zu kratzen. Und obwohl das alles so ist, und obwohl ich das weiß, und obwohl Felix Schluss gemacht hat, stehe ich trotzdem breitbeinig in der Wanne, mit gekrümmtem Rücken und angespanntem Nacken und entferne jedes noch so kleine Haar in meinem Intimbereich. Und das alles nur wegen einem Satz.
Franny ist da anders. Sie lebt nach der Prämisse love what you love and make no apologies. Ein Zitat von Tennessee Williams, das sie als Postkarte an ihre Zimmertür geklebt hat. Im Vergleich dazu bin ich ein einziger Kompromiss. Unsicherheit versteckt hinter Schlagfertigkeit und Zynismus. Zumindest war ich mal so. Jetzt schweige ich überwiegend. Laut zu sein fiel mir früher leicht – vor allem, wenn ich die richtige Meinung vertrat, wenn ich in der grölenden Masse stand und zu deren Echo wurde. Mama sagt, dass man eine Stimme sein soll und kein Echo, weil Meinungsäußerung ein Privileg ist und die eigenen Ansichten Teil von einem. Menschen, die schweigen, bewegen nichts. Die stehen nur dumm rum und klatschen für andere, sagt sie. Ich weiß, dass sie damit recht hat, aber das macht es nicht einfacher.
Die Wahrheit ist: Ich bin ein Produkt meiner Zeit. Scheinbar unangepasst, weil das alle sind, gegen Dinge, von denen ich nicht besonders viel verstehe, eingeschüchtert, aber gleichzeitig zu unabhängig und stark, als dass ich das zeigen würde. Eine Kompassnadel, die außer Kontrolle geraten ist. Nur dass es keiner mitkriegt. Wie Wut, die man in ein Kissen brüllt.
Ich inspiziere meinen Schambereich (was für ein grauenhafter Ausdruck) und dusche oberflächlich den Schaum ab, dann richte ich mich auf. Meine Zigarette ist inzwischen fast runtergebrannt. Ich nehme sie aus der Seifenschale, die wir zum Aschenbecher umfunktioniert haben – sie passt perfekt auf den Spülkasten –, im Anschluss ziehe ich ein letztes Mal an der Zigarette und werfe die Kippe danach neben mir ins Klo. Ein leises Zischen, dicht gefolgt von einer silbernen Rauchlocke, die wie ein Flaschengeist aus der Schüssel steigt. Zwischen den hellblauen Fliesen sieht die Toilette seltsam nackt aus, so als hätte man vergessen, ihr etwas anzuziehen. Genauso wie das Waschbecken. Und mein Intimbereich.
Ich mustere mich wie ein nacktes Rätsel im Spiegel. Dann tausche ich die Klingen aus, damit Charlie seinen Rasierer wieder benutzen kann, und lege ihn auf den Wannenrand. Ich darf später auf keinen Fall vergessen, ihn aufzuräumen. Sonst weiß Charlie, dass ich ihn verwendet habe.
Der Qualm steht im Bad wie in einer Kneipe. Mama findet es nicht gut, dass wir im Haus rauchen. Eine Weile hat sie noch versucht, es zu unterbinden, aber irgendwann hat sie aufgegeben. Zum einen, weil es nicht besonders glaubwürdig ist, etwas zu verbieten, was man selbst seit jeher tut, zum anderen, weil wir über achtzehn sind und daher von Gesetzes wegen sowieso rauchen dürfen.
Charlie tut es ohnehin nur gelegentlich – eigentlich bloß, wenn er Alkohol trinkt. Bier und Zigaretten gehören für ihn irgendwie zusammen. Es gibt Abende, da raucht er eine halbe Schachtel, dann rührt er wieder wochenlang keine an. Franny sagt, sie wünschte, sie könnte das – Genussrauchen. Aber bei ihr klappt es nicht. Sie will seit Jahren damit aufhören – ihren letzten Versuch hat sie vor vier Tagen gestartet –, aber bisher hat sie es nie geschafft, durchzuhalten. Ein, maximal zwei Wochen, dann knickt sie ein. Ich bin gespannt, wie lang es diesmal dauert.
Ich für meinen Teil habe erst spät mit dem Rauchen angefangen. Meine erste Zigarette hatte ich mit Felix. Man könnte sagen, er hat mich dazu angestiftet. Wobei es fairerweise nicht viel Überredungskunst gebraucht hat. (Felix hat inzwischen wieder aufgehört.) Zu meiner Verteidigung: Ich rauche nicht viel – drei, vielleicht vier Zigaretten am Tag –, und nie in Henrys Beisein.
Mama sagt, früher war es vollkommen normal, vor Kindern zu rauchen. Bevor die Leute so hysterisch wurden. (Ihre Wortwahl, nicht meine.) Vor den 2000ern war Rauchen nicht nur salonfähig, es war der Standard. In Restaurants, in Cafés, in Autos, Zügen, Flugzeugen. Überall. Da wurde nie Rücksicht genommen. Abschätziges Geräusch. In den 50ern haben sogar Schwangere getrunken und geraucht, ohne dass sich jemand darüber aufgeregt hat. Ich sage nicht, dass das richtig ist. Ich sage nur, dass es so war. Und jetzt bist du als Raucher der letzte Abschaum.
Kann sein, dass sie recht hat – ich rauche trotzdem nicht vor Henry. Schließlich kann der nichts dafür, dass wir Idioten sind. Manchmal glaube ich, er ist der Einzige in diesem Haus, auf den das nicht zutrifft. Weil er nicht versucht, jemand zu sein, der er nicht ist. Henry wird nicht anders, wenn andere da sind. Er bleibt einfach er selbst. (Etwas, das ich im Laufe der Jahre verlernt habe.)
Ich greife nach der Handbrause und dusche mich gründlich ab, beuge mich vorn über, entferne letzte Rasiergelreste zwischen meinen Beinen. Dabei bröckelt ein Teil meiner Gesichtsmaske ins gräuliche Badewasser. Ziemlich ekelhaft das alles. Schaum, kleine Härchen, Shampooschlieren.
Im selben Moment versucht jemand, die Tür zum Badezimmer zu öffnen. Die Klinke wird runtergedrückt, aber es ist abgesperrt.
»Sally? Bist du etwa immer noch da drin?«
Charlie.
Er klingt genervt. (Wäre ich an seiner Stelle auch.)
Meine Geschwister und ich teilen uns das Bad. Ein Bad für vier Menschen. Da ist Ärger vorprogrammiert.
»Es sind jetzt schon fast eineinhalb Stunden«, sagt er. »Wofür zum Teufel brauchst du so lang?«
Ich antworte nicht. Charlie und ich stehen uns nah, aber nicht so nah.
»Komm endlich da raus, ich muss duschen.«
»Ich hab noch ’ne Gesichtsmaske drauf«, erwidere ich durch die geschlossene Tür und höre, wie Charlie lacht. Es ist ein unterdrückter Laut, als wollte er nicht, dass ich es mitkriege.
»Scheiße, Sally«, sagt er dann.
Wenn ich lang genug warte, wird er aufgeben. Ich darf nur nicht reagieren, das ist der Trick. Ein paar Sekunden der Stille ertragen. Mehr braucht es nicht. Ich stehe nackt im Badewasser und zähle bis fünf, dann seufzt Charlie resigniert: »Na gut. Dusch ich halt morgen.« Kurz darauf entfernen sich seine Schritte – Fersen, die in den Boden gerammt werden, als wollte er so seinen Ärger akustisch verdeutlichen.
Ich rufe ihm ein »Danke, Charlie!« hinterher, doch da fällt bereits seine Zimmertür ins Schloss. Keine Ahnung, ob er es noch gehört hat.
So etwas wie das eben passiert dauernd – jemand will ins Bad und kann nicht rein. Das Absurde an der Situation ist, dass wir eigentlich zwei Bäder haben: das blaue und das rosa Bad. Letzteres gehört Mama. Sie hat es vor Jahren annektiert. Ich teile alles mit euch – ich habe sogar meinen Körper mit euch geteilt –, aber nicht das Bad. Das istder einzige Ort in diesem gottverdammten Haus, an dem ich meine Ruhe vor euch habe. Was nicht ganz stimmt. Sie hat ihr Schlafzimmer, den Wintergarten und ein Arbeitszimmer (wobei das keine Tür hat, also zählt das vielleicht doch nicht). Rein objektiv betrachtet hat Mama trotzdem mehr als genug Raum für sich. Aber vielleicht ist das wie bei reichen Leuten, die denken auch nicht, dass sie reich sind.
Das rosa Bad ist halbhoch gekachelt, altrosa, etwa bis Schulterhöhe. Es sind noch die Originalfliesen, keine Fünfzigerjahre-Verunstaltung wie in unserem. Außerdem hat ihrs ein Fenster, nicht nur ein Loch in der Wand, das in einen Luftschacht mündet. (Jedenfalls glaube ich, dass es das tut.) Im rosa Bad sieht man von der Wanne aus in den Garten. Die Aussicht hat etwas von einem Kinderbuch: Obstbäume, Beete, Büsche, ein Schuppen, die Gewächshäuser. Im Sommer kann man Glühwürmchen in den Hecken sehen. Als ich klein war, bin ich oft heimlich nach oben geschlichen und habe sie beobachtet, während Mama noch ferngesehen oder im Wohnzimmer gelesen hat.
Wir haben nie woanders gewohnt. Immer hier. Meine Geschwister und ich wurden sogar in diesem Haus geboren – was es irgendwie zu einer Art Familienmitglied macht. Zu einer Tante oder Großmutter, die knarzend unsere Schritte kommentiert. Der Holzboden dehnt sich an heißen Tagen aus und zieht sich abends wieder zusammen. Alles knarrt und quietscht. Hier wurde nie etwas richtig renoviert, immer nur geflickt, gerade so weit in Stand gehalten, dass es nicht auseinanderfällt. Ich liebe dieses Haus. Ich liebe alles daran. Die Risse in den Dielen, die zugigen Kassettenfenster mit ihren porösen Gummidichtungen, die zentimeterdicken Tapetenschichten, die wie Hautlappen an den Wänden kleben – an einer Stelle im Wohnzimmer kann man sie durchblättern wie eine Broschüre. Gestreift, geblümt, weiß.
Mein Zimmer ist das kleinste von allen, dafür ist es das einzige mit Zugang zum Garagendach – oder sollte ich sagen: dem kleinen Vorsprung des Garagendachs. Ich mag es, dort oben zu sitzen. Manchmal klettere ich nachts raus und schaue in den Himmel. Zum Mond und den Sternen. Das fühlt sich dann an, als wäre ich allein auf der Welt. (Wobei es das zugegebenermaßen häufig tut.)
Ich lasse gerade das Badewasser ab, als unten ›The Christmas Song‹ von Nat King Cole beginnt – ein sicheres Zeichen, dass das Essen bald fertig ist. Ich wasche mir den eingetrockneten Rest der Algenmaske vom Gesicht, dann befestige ich die Handbrause in ihrer Vorrichtung und mustere mich ein letztes Mal im Spiegel: Mission accomplished.
Ich frage mich, ob es früher einfacher war, ein Mädchen zu sein. Aber Franny sagt, das war es nicht. Frauen haben Korsetts getragen, Sally. Das Rollenbild, in dem sie sich bewegen konnten, war ungefähr genauso eng. Bestimmt hat sie recht. Und trotzdem reibe ich mich bei meinen Versuchen auf, dem Bild zu entsprechen, das man von mir haben soll. Schön, aber nicht darauf reduziert werden; Feministin, aber ohne Achselhaare – eine Sache, für die ich mich von der Tochter einer Bekannten meiner Mutter blöd anreden lassen musste. Frauen haben nun mal Achselhaare. Sie zu entfernen, erhält patriarchale Denkmuster. Franny saß daneben und hat genickt. Als wären Achselhaare ein Beweis für echten Feminismus und ihr Nichtvorhandensein der beste Weg, eine Mogelpackung zu entlarven. Verbrennt sie, sie hat rasierte Achseln. Obwohl ich das alles für Blödsinn halte, hatte ich Herzklopfen. Als stünde ich vor Gericht. Als müsste ich mich für meine nackten Achselhöhlen verteidigen. Gesagt habe ich nichts. Ein Schweigen mehr auf meiner Liste.
Wann hat das angefangen? Und wieso mache ich mit?
Eigentlich bin ich ganz anders.
Brüder und Schwestern
Ich steige aus der Wanne und trockne mich ab, dann greife ich nach Frannys heiliger Sheabutter. Ich nehme gerade so viel, dass es ihr nicht auffallen wird. Danach stelle ich sie wieder so hin, wie sie vorher stand – zurück in ihren kreisrunden Staubabdruck, das Etikett nach schräg vorne links. Natürlich ahnt Franny, dass ich ihre Creme mitbenutze, aber sie hat mich nie dabei erwischt. Genau so wenig wie ich sie, wenn sie sich mal wieder bei meinen Wattepads bedient, weil sie vergessen hat, welche nachzukaufen. Ich weiß auch, dass Charlie mein Shampoo nimmt, wenn seins leer ist. In diesen Phasen riechen seine Haare so stark nach Lemongrass, dass es keinen Sinn ergeben würde, es zu leugnen. Er benutzt auch meine Zahnpasta, seit er wieder zu Hause wohnt. Der nicht richtig verschlossene Deckel verrät ihn. Charlie schraubt Tuben nie richtig zu. Wieso? Sie ist doch fast zu. Das ist typisch für meinen Bruder. Aber ich sage nichts, immerhin benutze ich seinen Rasierer – den ich nicht vergessen darf, wegzuräumen. Bei diesem Gedanken greife ich danach und lege ihn in seine Schale neben das Gillette Mach3 Rasiergel, das ich ebenfalls mitverwende. Mischief managed.
Ich spüle die Wanne aus, dabei richte ich den harten Strahl der Brause auf den Dreckrand und sehe zu, wie er sich auflöst. Vor Corona habe ich so gut wie nie gebadet – vielleicht mal, wenn ich krank war. Seit ein paar Wochen bade ich jeden Tag. Weil man nicht dauernd nachdenken kann – wobei ich in der Wanne genau genommen kaum etwas anderes tue –, oder kochen, oder telefonieren. (Oder seinen Exfreund auf Social Media stalken.) Ich hätte nicht gedacht, dass man die Schule vermissen kann, aber man kann. Erst war sie geschlossen, jetzt habe ich Abitur. Ein neuer Lebensabschnitt, der sich kein bisschen neu anfühlt.
Vor Kurzem haben wir abends eine Sendung über die Folgen der Pandemie angesehen. Da hieß es, dass Experten vor einem signifikanten Anstieg häuslicher Gewalt warnen, vor Bildungslücken, die nie wieder geschlossen werden können – insbesondere bei Kindern aus bildungsfernen Schichten – und vor einer massiven Zunahme psychischer Erkrankungen bei Jugendlichen, hervorgerufen durch Vereinsamung und Isoliertheit. Ich frage mich, wie es für andere wohl ist. Für Leute ohne Familie, die niemanden haben, der ihnen auf die Nerven geht. Millionen von Menschen zu Hause oder hinter Masken – mit Smartphones als einziger Verbindung zur Außenwelt. Ganze Nationen im Schlafanzug mit sozialen Medien als einzigem Fenster zu den Seelen völlig Fremder. Ich weiß, wie es sich für mich anfühlt – ohne Pia, ohne Felix, ohne jede Art der Interaktion. Vor Corona lag meine Bildschirmzeit bei knapp zwei Stunden pro Tag, jetzt sind es mehr als neun – einen Großteil davon bin ich bei Instagram und TikTok –, die meisten auf Felix’ Profil. Das kann nicht gesund sein.
Und angefangen hat alles mit acht Fällen irgendwo in China. In einer Millionenmetropole, von der ich bis dahin nie gehört hatte. Wuhan. Ich weiß noch, wie Mama, Franny, Henry und ich vor dem Fernseher saßen. Draußen war es kalt – und damit meine ich so richtig kalt. Mit Raureif an den Fensterscheiben und Atemschwaden, wenn man im Windfang des Hauses stand. Wir haben einen veganen Auflauf gegessen – ein matschiger Brei aus Linsen, der keinem so richtig geschmeckt hat. Trotzdem haben wir Franny zuliebe so getan, als wäre er gut. Von der Konsistenz her hatte er etwas von Erbrochenem, was ich natürlich nicht gesagt habe. (Franny hätte es bestimmt gesagt.) Na, jedenfalls saßen wir nebeneinander auf dem Sofa und haben gelacht – über den sich uns nicht erschließenden Nachrichtenwert von acht erkrankten Chinesen. Seltsam, wie sich alles geändert hat. Das Leben, wir, die Sicht auf die Dinge.
Ich nehme eins von Frannys Handtüchern, weil meins zu nass ist, und rubble mir damit die Haare trocken. Irgendwann war es mal weiß, jetzt sieht es aus, als hätte meine Schwester ein kleines Tier darauf geopfert. Franny hat knallrote kurze Haare, die sie ständig nachfärben muss. Man möchte meinen, dass sie nach so vielen Jahren etwas geübter darin wäre – immerhin ist es nur der Ansatz –, aber sie braucht ewig dafür. So wie Franny für alles ewig braucht. Sie denkt die Dinge tot, bevor sie beginnt zu handeln. Aber dann ist sie nicht aufzuhalten. Bei mir ist es genau andersrum. Auch ich bin eine Grüblerin, aber für gewöhnlich erst im Nachhinein – wenn ich den Fehler bereits begangen habe. Und wenn ich dann drinstecke, weiß ich nicht, was ich tun soll. Wie ein Führerscheinneuling, der einmal falsch abbiegt und sich plötzlich auf dem Beschleunigungsstreifen der Autobahn wiederfindet. In solchen Situationen nehme ich mir jedes Mal fest vor, es künftig anders zu machen. Mehr so wie Franny. Nur dass ich es dann doch nicht tue.
Unser großer Bruder ist ein Zwischending. Der denkt manchmal zu viel, aber die meiste Zeit gar nicht. So wie ein Hund, der im Hier und Jetzt lebt. Wenn Charlie müde ist, legt er sich hin, wenn er Spaß haben will, trifft er Freunde, wenn er zocken will, zockt er. Charlie ist nicht dumm, er ignoriert seine Probleme einfach so lange, bis sie weg sind. Was das angeht, hält er es wie unser Großvater (Gott hab ihn selig, ich hab ihn nie kennengelernt): Was ich nicht erledige, erledigt sich von selbst. Das funktioniert erstaunlich gut. Zuletzt hat Charlie diese Strategie bei seiner Exfreundin angewandt – was auch der Grund ist, warum er wieder zu Hause wohnt. Ich schätze, mein altes Kinderzimmer ist die gerechte Strafe, meinte er neulich lachend, als wir zusammen gekocht haben. Laut Nikki – so heißt seine Exfreundin – hat Charlie sie nicht wertgeschätzt. Sie nichtgesehen, waren ihre exakten Worte. Glaub mir, ich hab genug von ihr gesehen, war seine Reaktion darauf. Charlie tut gern so, als wäre ihm das alles egal, aber ich weiß, dass das nicht stimmt – weil ich in dem Punkt genauso bin. Meine Familie denkt, dass ich die Sache mit Felix gut wegstecke. Ich lächele, spiele mit Henry, mache Witze, helfe beim Kochen. Und wenn ich in der Wanne sitze, weine ich. Heimliche Tränen, die das Badewasser verschluckt, als wollte es meine Lügen decken.
Trotzdem freut es mich, dass Charlie wieder zu Hause ist. Ohne ihn war es verdammt ruhig hier. Wie ein Ort, der etwas verloren hat. Einen Teil seiner Seele oder ein Stück Geschichte.
Wir hatten immer eine enge Verbindung, Charlie und ich. Als ich klein war, hat er mich überall mit hingenommen. (Sogar dann, wenn seine Freunde dabei waren.) Bei Franny war das anders – obwohl die nur zwei Jahre älter ist als ich und nicht wie Charlie, sieben. Aber sie ist eben auch zwei Jahre klüger und zwei Jahre erfahrener. Und nur, weil sie akzeptiert hat, dass es mich gibt, ist sie noch lange kein Fan von mir. Franny und ich hatten früher genau zwei Dinge gemeinsam: unsere Anschrift und unseren Familiennamen. (Und unseren Vater, bei dem wir so getan haben, als gäbe es ihn nicht.) Abgesehen davon gehörte alles Franny. Es waren ihre Freunde, ihr Zimmer, ihr Leben.
Franny und ich stehen uns auch jetzt nicht wirklich nah, aber es ist besser geworden. Ich glaube, es hat damit angefangen, dass ich meine Tage bekommen habe und nicht mit Mama, sondern mit ihr darüber reden wollte. (Nicht, dass ich überhaupt darüber reden wollte, aber bei Franny war es mir weniger peinlich.) So gesehen hat meine erste Periode mich in die Sphären meiner Schwester gespült. Ich glaube, die Tatsache, dass ich mich ihr anvertraut habe, war für sie wie ein spätes Anerkennen ihrer immer da gewesenen Überlegenheit. Natürlich waren es auch danach trotzdem noch ihre Freunde, ihr Zimmer und ihr Leben – so eine Periode ändert schließlich nicht alles –, aber immerhin hatte ich danach eine Daseinsberechtigung und wurde nicht länger nur für Botengänge missbraucht.
Zu meinem dreizehnten Geburtstag hat Franny mir einen Hamster geschenkt. (Meine Schwester hat mir davor nie etwas geschenkt, immer nur alibihalber auf irgendeiner Gemeinschaftskarte unterschrieben.) Dexter war klein und schwarz, und ich habe ihn geliebt wie verrückt. Er war irgendwann so zutraulich, dass er von sich aus auf meine Hand geklettert ist, wenn ich sie in seinen Käfig gehalten habe. Und dort ist er dann eingeschlafen. Ein kleiner schwarzer Haufen auf meiner Handfläche. Damals dachte ich, dass es kein glücklicheres Wesen als ihn gibt. Manchmal saß ich stundenlang da und habe mich nicht bewegt, nur damit er schlafen konnte.
Als Dexter ein paar Jahre später gestorben ist, hat meine Mutter mir zum Trost ein Steiff-Stofftier gekauft. Einen braun-weißen Hamster namens Goldy. (Nicht ich habe ihn so genannt, es war die Artikelbezeichnung.) Mama hat ihn mir überreicht und gesagt: Der bleibt dir für immer, mein Schatz. Den musst du nicht beerdigen. Unsere Mutter ist mehr der Katzentyp – Haustiere, die sich um sich selbst kümmern. Wir haben zwei: Morpheus und Marlon, beide rot getigert. Marlon ist die meiste Zeit draußen und streunt in der Nachbarschaft herum. Manchmal kommt er zum Fressen nach Hause und lässt sich streicheln. Doch wenn er es sich aussuchen kann, ist er nebenan bei Frau Appeldorn. Was den Aufwand angeht, unterscheidet Marlon sich nicht übermäßig von einem Steiff-Stofftier. In der Welt meiner Mutter war Goldy also der perfekte Hamster. Morpheus dagegen ist überwiegend zu Hause. Aber er fällt nicht weiter auf, weil er meistens irgendwo herumliegt und schläft – am liebsten in meinem Zimmer oder in der Küche vor dem Kachelofen. Oder er rollt sich in Mamas Schoß ein, wenn sie abends einen ihrer Krimis schaut. Ich glaube, das liebt sie am meisten an ihm – wie gern er mit ihr schmust, dass er aber ansonsten keinerlei Ansprüche an sie hat. Morpheus will einfach nur schlafen und gestreichelt werden. Dann ist er glücklich.
Als ich sechzehn war, habe ich mir einen Wellensittich gekauft – den habe ich noch. Pete. Er hat türkises Gefieder und ein dickes Gesicht. Wäre ich ein Wellensittich, würde ich ein bisschen aussehen wie er. Pete badet gern. Er liegt dann in seiner Wasserschale und wälzt sich hin und her. Ich mag es, ihm dabei zuzusehen. Bevor ich Pete hatte, wusste ich nicht, dass Wellensittiche gern baden – und vielleicht tun es auch nicht alle, vielleicht mag es auch einfach nur Pete. Tagsüber lasse ich ihn in meinem Zimmer herumfliegen. Und wenn ich zweimal klatsche, geht er freiwillig in seinen Käfig zurück. Ich finde das ziemlich cool.
Meistens, wenn ich nach dem Abendessen zurückkomme, sitzt er auf dem Fensterbrett und schaut nach draußen. Und dann denke ich, dass ich ihn freilassen sollte, so sehnsüchtig, wie er in den Garten blickt. Aber ich würde ihn zu sehr vermissen. Ich liebe Pete. Deswegen sperre ich ihn ein. Seltsame Logik.
Franny sagt, dass Tiere sehr viel mehr Wesen haben, als Menschen ihnen zugestehen, und dass ein Großteil den Begriff Lebewesen mehr auf den Akt des Atmens bezieht als auf die charakterlichen Eigenschaften. Aus diesem Grund lebt sie vegan.
Mama findet das alles komplett verrückt. Sie sagt, dass es ein Kreislauf ist, und dass Menschen eben Tiere essen. Sie sagt, dass das immer so war. Und dass sie auch genau dafür gezüchtet werden. Ungefähr dann fangen Franny und sie an zu streiten.
Als ich den Deckel meines Deos aufschraube, dringen ihre Stimmen durch den Fußboden. Ich kann nicht verstehen, was sie sagen, aber die Tonlage weist auf den Anfang einer weiteren Auseinandersetzung hin.
Normale Familien gucken Diskussionsrunden im Fernsehen, Mama und Franny erledigen das lieber live beim Abendessen.
Ich frage mich, worum es diesmal geht.
Mutter unser
Als ich wenig später die Küche betrete, sitzen alle bereits am Tisch. Mama telefoniert, Franny verteilt Pasta und Henry den Salat, während Charlie mürrisch auf sein Handydisplay schaut – sein Pandemiegesicht. Im Hintergrund singt Nat King Cole ein weiteres Mal ›A Christmas Song‹. Dieses Lied spielt unsere Mutter seit Tagen rauf und runter. Hört euch doch nur mal diese Stimme an, die ist wie flüssiges Karamell.
Ich bin ehrlich gesagt ganz froh um die Weihnachtsmusik. In den Wochen davor lief fast ausschließlich das Radio. Coronazahlen, Pressekonferenzen, Söder, der wortgleich seine Lieblingssätze wiederholt, Einspieler von der Kanzlerin, Neues zum Impfstoff. Mama ist vollkommen besessen von den Zahlen – vor allem den Inzidenzen. Sie notiert sie mit religiöser Verlässlichkeit jeden Abend während der 19 Uhr Nachrichten in ihr kleines schwarzes Buch. (Einer der vielen Ticks unserer Mutter.)
Wenn ich sie in einem Wort beschreiben müsste, wäre es unkonventionell. Sie hat vier Kinder von drei Männern, war aber mit keinem von ihnen verheiratet. Wieso hätte ich einen von ihnen heiraten sollen? Ich wollte Kinder und keinen Mann, meinte sie mal. Sie sagte es, als wäre es das Normalste der Welt – vermutlich, weil es das für sie ist.
Unsere Mutter ist Programmleiterin in einem Sachbuchverlag, überwiegend Biographien von irgendwelchen Leuten, die mir nichts sagen. Dafür bist du noch zu jung, mein Schatz. Oder zu ungebildet, das könnte auch sein. Ich habe noch im Ohr, wie sie dabei lacht.
Mama sitzt einen Großteil des Tages in ihrem chaotischen Arbeitszimmer und raucht eine Zigarette nach der anderen – American Spirit, weil die gesünder sind. Ihr Arbeitszimmer ist abgegrenzt, aber offen zur Küche – war wohl mal ein separater Essbereich. Meistens, wenn man sich etwas zu trinken holt, hört man sie nebenan im Qualm irgendwas murmeln oder leise fluchen. Meine Geschwister und ich haben uns daran gewöhnt. Es ist einfach ein weiteres Geräusch, so, wie wenn der Geschirrspüler läuft oder die Waschmaschine beginnt zu schleudern oder eine der Türen knarzt.
Das Haus, in dem wir wohnen, hat früher der Großmutter unserer Mutter gehört. Sie ist früh gestorben. Mama hat sich bis zuletzt um sie gekümmert. Eleanor war mir der wichtigste Mensch auf der Welt, hat sie bei der Beerdigung gesagt. Ich glaube, es war das einzige Mal, dass ich sie habe weinen sehen. Oma Eleanor hat unserer Mutter alles vermacht. Unter anderem dieses Haus – das Mama seitdem so gut wie nie verlässt. Sie hasst es, einkaufen zu gehen, besonders seit der Pandemie. Da sind so viele Menschen. Also erledigen wir das. Manchmal kommt sie mit, aber das passiert wirklich nur ganz selten. Eigentlich nur zu Weihnachten. Da fühlt unsere Mutter sich irgendwie dazu berufen, ein Festtagsessen zuzubereiten. Den Rest des Jahres kümmern wir uns ums Essen, was Mama nur fair findet, immerhin ist das früher ausschließlich an ihr hängen geblieben. Da wart ihr noch zu klein. Das seid ihr jetzt nicht mehr.
Diese Arbeitsteilung ist für uns vollkommen normal – wobei Arbeitsteilung irreführend ist, weil Mama im Haushalt so gut wie gar nichts macht. Wer hat denn die ganze Zeit geschuftet, als ihr klein wart? Das war ich. Außerdem verdient sie das Geld. Meine Arbeit bringt uns alle durch. Und sie baut Obst und Gemüse an. Ich baue nicht nur an – ich mache auch ein und fermentiere. Für meine Geschwister und mich ist es längst selbstverständlich, dass wir uns um so gut wie alles in diesem Haus kümmern – abgesehen von Mamas Zimmer und ihrem Bad. Doch auf Leute, die neu dazukommen, wirkt diese Normalität immer ein bisschen befremdlich: die Freiheit, die wir haben, die wenigen Regeln, die es gibt, die Verantwortung. Aber so ist unsere Mutter. Wie sollen aus euch eigenständige Individuen werden, wenn ich alles für euch erledige? Ich bin eure Mutter, nicht eure verdammte Haushälterin. Außerdem lernt ihr so, im Team zu arbeiten. Zusammen habt ihr acht Arme, wie ein Oktopus.
So wenig Mama sich auf einen Mann hat festlegen wollen, so verbunden ist sie anderen Dingen: ihren Dr. Scholl Sandalen – die trägt sie sogar im Winter, ich weiß auch nicht, warum ich immer so warme Füße habe –, ihrer Zigarettenmarke – es müssen die gelben American Spirits sein, nicht die blauen, nicht die grünen, die gelben –, ihrer Frisur – ein kinnlanger Bob, der wegen ihrer gewellten Haare immer ein bisschen unordentlich aussieht. Meistens schneidet sie ihn selbst nach – es sieht so oder so furchtbar aus, wieso sollte ich einem Friseur dafür auch noch Geld geben?
Mama mag es unkompliziert. Sie trägt Jeans und T-Shirts, im Sommer auch mal ein Leinenhemd. Wenn sie nicht arbeitet, kümmert sie sich um ihre Pflanzen und Setzlinge. Das ist auch der Grund, warum sie fast immer schwarze Ränder unter den Fingernägeln hat und wieso neben allen Wasch- und Spülbecken im Haus Nagelbürsten herumliegen. (Mit Ausnahme vom blauen Bad, da geht Mama nicht rein. Dafür hat sie in der Küche gleich mehrere.) Bei den meisten davon stehen die Borsten seitlich ab, und die in der Mitte sind von Erde verfärbt. Wir haben einen Wintergarten und zwei Gewächshäuser, in denen unsere Mutter Kräuter und Gemüse anbaut. Sie fermentiert, sie kocht ein und macht Marmelade. Wenn die Apokalypse kommt, sind wir vorbereitet.
Ein paar Monate lang hat Charlie heimlich versucht, Marihuanapflänzchen zu ziehen, aber sie sind fast alle eingegangen. Bei Mama hat es sofort geklappt. Als Pseudo-Hippie, der sie ist, hat sie anfangs nicht mal gemerkt, was sie da neben ihren Tomatenstauden züchtet. Sie hat sich einfach darum gekümmert, so wie um die anderen Pflanzen auch. Als es ihr schließlich klar wurde, war sie eine Mischung aus entrüstet und amüsiert. Das ist eine Sache, die ich an ihr mag: dass sie für gewöhnlich nicht in ihren Launen steckenbleibt. Dafür muss schon was richtig Heftiges passieren. Ich bin in dem Punkt völlig anders. Bei mir genügen Kleinigkeiten, um mir den ganzen Tag zu vermiesen. (Oft weiß ich am Ende nicht mal mehr, was mich ursprünglich geärgert hat.) Mama ist impulsiver. Die kriegt einen kurzen Schreikrampf oder wirft irgendwas durchs Zimmer, und ein paar Minuten später ist alles wieder okay. Aggressiv versus passiv-aggressiv würde Dr. Schneider von meinem Therapiepodcast jetzt sagen.
Als Kind dachte ich, wir wären eine ganz normale Familie, aber im Vergleich zu anderen Familien sind wir es wohl eher nicht. Unsere Herkunft zum Beispiel. Es gibt einen jahrzehntelangen Streit darüber, woher die Bernards, also unsere Vorfahren, stammen – das eine Lager ist für England, das andere für Frankreich. Die Spuren verlieren sich irgendwo während des Zweiten Weltkriegs. Mama sagt, wir sind Engländer. Um das zu unterstreichen, hat sie uns allen englische Vornamen gegeben – Charles, Franny, Sally, Henry. (Passend zu ihrem: Marianne – natürlich englisch ausgesprochen.) Zwei ihrer Schwestern dagegen beharren darauf, dass wir Franzosen sind – die eine lebt in Paris, die andere in Bordeaux. Sie wiederum haben ihre Kinder nach französischen Schriftstellern benannt. Neben ihnen gibt es noch zwei Schwestern, die sehen es wie unsere Mutter, reden tun sie trotzdem nicht miteinander. Was jedoch nichts daran ändert, dass wir von unserer gesamten englischen Verwandtschaft pünktlich zu allen wichtigen Anlässen Grußkarten erhalten, woraufhin wir dann schuldbewusst – und natürlich viel zu spät – welche zurückschicken. Ich glaube, Karten zu versenden, ist so was wie ein britisches Tourette-Syndrom, eine Art Inselbegabung, die jeder dort hat.
Ich gehe um den Tisch herum und setze mich. Mama greift nach ihrer Zigarette – sie lag bis eben unberührt im Aschenbecher –, dann sagt sie: »Das ist überhaupt kein Problem.«
Erst da bemerke ich, dass sie telefoniert. Normalerweise nimmt Mama ab neunzehn Uhr keine geschäftlichen Anrufe mehr an. Tut man es einmal, tut man es immer, ist ihre Devise. Überstunden sind eine moderne Form der Versklavung. Man entscheidet sich, mitzumachen. Um 19 Uhr beginnen die Nachrichten – damit endet ihr Arbeitstag. Jetzt ist es 20:12 Uhr.
»Wo denkst du hin, es ist nicht zu spät«, erwidert Mama, zieht an ihrer Zigarette und drückt sie dann aus. Ein Teil der Glut glimmt noch. »Du störst gar nicht.«
»Nein, nein«, sagt Franny, während sie veganen Parmesan über ihre Nudeln reibt, »meine Kinder warten nur mit dem Essen auf mich …«
Mama runzelt die Stirn und macht eine Sei-still-Handbewegung in ihre Richtung. »Das war nur meine Tochter«, sagt sie. »Bitte, Leni, sprich weiter.«
Leni Ahlander.
Ich bin ihr nie begegnet, weiß noch nicht mal, wie sie aussieht. Trotzdem mag ich sie nicht – Mama mag sie schon genug für uns beide. Dr. Schneider von meinem Therapiepodcast würde jetzt sagen, dass es sich bei meiner Abneigung gegen Leni Ahlander um etwas Tiefenpsychologisches handelt. Ablehnung in der Kindheit, Neid, Eifersucht, irgendwas in die Richtung. Gut möglich, dass das stimmt. Meine drei Geschwister waren Wunschkinder, ich ein Unfall. Ich weiß erst seit zwei Jahren davon. Eine lustige Randnotiz über einen Samstagabend und einen Stromausfall. Laut unserer Mutter war es das letzte Mal, dass sie und mein Vater miteinander geschlafen haben. Nicht unbedingt der Start, den man sich ins Leben wünscht: als Ende einer Beziehung.
Ein paar Wochen später ist er ausgezogen – noch vor dem ersten Ultraschallbild. Er hatte es wohl ziemlich eilig. Seltsam, dass eine Leerstelle eine so große Rolle spielen kann. Denn mehr ist er nicht. Ein Spermium und ein paar Grußkarten. Die erste kam kurz nach meiner Geburt – eine, wie man sie im Supermarkt an der Kasse bekommt. Vorne drauf ein kleiner blauer Elefant, der in seinem Rüssel ein Fähnchen hält, auf dem in großer Blockschrift Welcome, Baby Boy! steht. Nicht mal das hat er hingekriegt. Er war nicht da und ich der verlorene Sohn.
Diese Gedankenkette löst Leni Ahlander in mir aus. Und dabei kenne ich sie noch nicht mal.
Ich schenke uns Wasser ein – Henry und mir stilles, den anderen mit Sprudel. Während ich einen Schluck trinke, beobachte ich Mama dabei, wie sie einhändig Soße unter ihre Nudeln mischt – Aurorasoße mit Grillgemüse, Charlies Spezialität. Er hat ein Händchen fürs Kochen. Hatte er immer. Dieses Rezept hat er Franny zuliebe vor etwas über einem Jahr veganisiert. Mir ist der Unterschied damals nicht mal aufgefallen. Irgendwas mit eingeweichten Cashews, weißen Bohnen und Sojasahne. Charlie wollte Koch werden. Stattdessen hat er auf Mama gehört und angefangen, Germanistik und Geschichte zu studieren. Er hasst es, aber er zieht es durch. Ich sollte da nicht urteilen – bei ihm ist es Geschichte, bei mir war es der Englisch LK.
Wir fangen an zu essen, unsere Mutter telefoniert weiter. Die anderen scheint es nicht sonderlich zu interessieren – sie sitzen da, als hätten sie Mama stummgeschaltet, jeder in seiner eigenen Welt. Henry isst und spielt währenddessen ein Handyspiel, Charlie schreibt mit jemandem über WhatsApp, und Franny liest einen Artikel bei Spiegel online – ihr Handy liegt auf der Tischplatte, ich erkenne das Logo.
Wir sind wie Quallen, die nebeneinander umhertreiben. Scheinbar im Schwarm und doch losgelöst voneinander. Manchmal fühlt es sich an, als wäre ich eine Statistin in meinem eigenen Leben. Jemand, der ab und zu durchs Bild läuft, damit etwas passiert. Ein Schatten meiner selbst. Es gab mal eine Zeit, in der habe ich meine schlagfertigsten Antworten nicht nur gedacht, ich habe sie ausgesprochen. Rückblickend glaube ich, dass Felix genau das an mir mochte. Die Tatsache, dass ich keinen Wert darauf gelegt habe, was andere von mir halten. Das war damals nicht gespielt, ich war wirklich so. Jemand, der laut lacht, wenn er etwas lustig findet, und die Augen verdreht, wenn etwas idiotisch ist. Es war mir nicht wichtig, ob die Leute mich gut finden – ich fand mich gut, und das hat mir gereicht. Bis zu Mamas Randbemerkung über den Stromausfall und seine Folgen – eine Anekdote wie eine Abrissbirne. Den Rest hat Felix erledigt.
Ich habe einen Vater mit Doktortitel, den ich kaum kenne, eine Mutter, die in meinem Alter die halbe Welt bereist hat, die unverheiratet und unabhängig geblieben ist – wenn es nach ihr geht, die einzigrichtige Lebensweise für eine Frau –, eine Schwester, die vegan lebt, sich für den Klimaschutz einsetzt, politisch aktiv ist und Polyamorie propagiert, weil alles andere verlogene Systeme des Patriarchats sind, und einen Exfreund, der zwar gern noch mit mir ins Bett geht, mich aber danach nicht mehr in den Arm nimmt.
Erst während ich das denke, begreife ich, dass es mir hauptsächlich darum ging: festgehalten zu werden. Und dann frage ich mich, ob man überhaupt noch das eigene Leben lebt, wenn jemand anders dessen Inhalt ist, oder doch nur eine gelogene Version davon.
Jurassic Park
Mama legt das Handy zur Seite, der ›Christmas Song‹ beginnt von vorn.
»Wo waren wir?«, fragt sie.
»Du meinst, vor deinem Telefonat?«, fragt Franny.
Unsere Mutter antwortet nicht, schaut nur auf ihre Komm-zum-Punkt-Art.
»Bei meiner Freundin Simone«, erwidert Franny kauend. Ihr Unterton hat etwas von einer geladenen Waffe – entsichert und bereit zu schießen.
»Richtig«, sagt Mama.
»Wieso? Was ist mit ihr?«, frage ich, woraufhin Charlie den Kopf schüttelt und Henry betreten in seinen Nudelteller schaut.
»Sie ist jetzt mit einer Frau zusammen«, sagt Franny schneidend. »Etwas, das Mama wider die Natur findet.«
»Das habe ich so nicht gesagt«, protestiert sie und richtet ihre Gabel auf Franny. »Ich sage nur, dass es seltsam ist. Das ist alles.«
»Was daran ist bitte seltsam?«, fragt Franny.
»Wir sind uns doch wohl alle einig, dass Sexualität in erster Linie der Fortpflanzung dient«, sagt Mama sachlich. »Und es ist ja wohl ziemlich offensichtlich, was die Natur da vorgesehen hat – ich meine, rein anatomisch betrachtet.«
Ich würde gern etwas darauf erwidern – zum Beispiel, wieso Menschen dann nicht nur zu Fortpflanzungszwecken Sex haben, sondern einfach so? Zum Spaß? Und warum so viele von ihnen verhüten, wenn der eigentliche Sinn in der Zeugung von Nachwuchs liegt? Aber ich tue es nicht. Weil man mit unserer Mutter nicht diskutiert. Man hat ihre Meinung, oder man hat Unrecht.
»Weißt du, was ich nicht verstehe?«, fragt Franny. »Wie jemand, der so klug ist, gleichzeitig so borniert sein kann.«
»Intelligenz und Borniertheit schließen einander nicht aus«, sagt Mama.
»Offensichtlich«, erwidert Franny.
Mama lächelt schwach. »Es wundert mich, dass du Diversität propagierst, gleichzeitig aber andere Ansichten nicht gelten lässt. Meinungsfreiheit ist keine Sackgasse, mein Schatz, sie funktioniert in beide Richtungen.«
Ich lege mein Besteck weg.
»Das stimmt«, sagt Franny, »nur dass das, was du sagst, keine Meinung ist.«
»Sondern?«
»Diskriminierende, rückständige Scheiße.«
Unsere Mutter verdreht die Augen. »Sind wir also wieder bei der Fäkalsprache angelangt, ja?« Sie spießt ein paar Nudeln mit ihrer Gabel auf. »Eine derartige Ausdrucksweise hast du doch gar nicht nötig, Franny. Du kannst denselben Inhalt vermitteln, ohne verbal abfällig zu werden. Damit diskreditierst du dich letztlich bloß selbst.«
Ich spüre, wie mein Körper von angespannt auf alarmbereit umschaltet. Henry zupft an seiner Serviette herum, Charlies Kiefermuskeln treten hervor.
»Das nächste Mal sagst du einfach nur diskriminierend und rückständig. Damit erhöhst du deine Chancen, dass man dir zuhört.«
Franny steht auf, Stuhlbeine schrammen über den Boden. »Die Welt hat sich verändert, Mama«, sagt sie ruhig, während sie zum Kühlschrank geht und eine weitere Flasche Mineralwasser herausholt. »Und eines schönen Tages werden all die Leute mit ihren antiquierten Meinungen aussterben.« Blick zu unserer Mutter. »Genau wie die Dinosaurier.«
»Moment«, sagt Mama. »Du nennst mich einen Dinosaurier?«
»Ich glaube, du kannst nicht mal was dafür«, übergeht Franny ihre Frage und setzt sich wieder. »Du wirst einfach alt und merkst es nicht.«
Danach ist es lange still. (Bis auf den ›Christmas Song‹ im Wohnzimmer.) Die Stimmung hat etwas von einem eisigen Luftzug, der durch die Küche weht. Charlie sitzt angespannt da, Henry schaut in seinen Schoß, Mama starrt Franny an. Die lächelt. Dann greift sie nach dem veganen Käse, reibt noch mehr über ihre Nudeln und isst weiter.
So oder so ähnlich läuft es eigentlich immer. Erst wird diskutiert und danach laut geschwiegen. Eine fragwürdige Familientradition, die allabendlich gepflegt wird. Ich sitze mit eingerollten Zehen am Tisch, die Hände im Schoß zu Fäusten geballt, und dann denke ich, dass die Aussage doch irgendwie idiotisch ist – dass man auf Männer oder auf Frauen steht, weil das so wahllos klingt. Als würde man tendenziell auf jeden Mann und auf jede Frau stehen und nicht nur auf eine handverlesene Auswahl, die im Laufe des Lebens wechselt. Wenn ich auf meine sexuellen Erfahrungen zurückblicke, stehe ich eindeutig auf Männer. Ich habe bisher ausschließlich mit Männern geschlafen – mit zwei davon oft, mit einem nur ein Mal. Trotzdem finde ich Frauenkörper generell ästhetischer. Die Formen. Vor allem Brüste. Ich hatte schon immer was übrig für Brüste. Wenn ich mich selbst befriedige, stelle ich mir meistens Frauen vor. Es sind keine, die ich kenne – jedenfalls nicht beim Namen. Schöne Körper, die ich mir ausmalen kann, wie Kinder in Malbücher. Da wird ein Tiger ja auch einfach mal lila und ein Elefant grün-blau gestreift, und keiner stört sich daran. Pia meinte mal, Fantasien zählen nicht, weil Sex im Kopf nicht echt ist. Für mich ist er genauso echt wie mit einem anderen Menschen. Franny sieht es ähnlich, sie sagt, sexuelle Orientierung sei ein Spektrum. Man ist nicht weniger bisexuell, nur weil man noch nie Sex mit jemandem desselben Geschlechts hatte. Schließlich ist es nicht die Umsetzung, die einen bisexuell macht. Womit sie recht hat.
Die Stille in der Küche kippt ins Bedrohliche, trotz der Musik nebenan. Trotz der Geräusche von Besteck auf Geschirr, von Gläsern, die angehoben und wieder abgestellt werden.
Ich schaue vorsichtig zu Mama. Sie wirkt teilnahmslos, aber das täuscht. Ich kenne ihre Blicke – dieser ist wie Wasser kurz vor dem Siedepunkt. Kühle Augen, hochgezogene Schultern.
Wenig später schiebt sie ihren Teller weg und erhebt sich. Ich trinke das dritte Glas Mineralwasser, Charlie sitzt mir mit verschränkten Armen gegenüber, Henry beginnt, die Teller in den Geschirrspüler zu räumen, Mama macht Tee. Sie steht mit einer Zigarette im Mundwinkel neben dem Spülbecken und löffelt losen Earl Grey in die bauchige Bodumkanne.
Für unsere englische Verwandtschaft grenzt es an Hochverrat, Teebeutel zu benutzen. Menschen, die das tun, sind in ihren Augen kurz vor kulturlosen Halbidioten. Als wären lose Teeblätter die entscheidende Zutat für ein kultiviertes Leben – und ein kleines Säckchen drumrum die Zerstörung der Weltordnung. Wenn es um Schwarztee geht, ist unsere Mutter ähnlich intolerant. Bei anderen Sorten nimmt sie es nicht so genau – grüner Tee, weißer Tee, da ist es ihr egal –, aber Schwarztee ist und bleibt britisches Kulturgut. Als wären die Inder lediglich zum Pflücken und Ernten da – passend zur britischen Überheblichkeit. Rule, Britannia! Ich verstehe von sowas nicht viel – dafür bin ich vermutlich zu sehr in der deutschen Schuld verhaftet.
Als das Wasser kocht, gießt Mama es in die Kanne. Danach riecht es leicht herb und nach Bergamotte, gemischt mit Zigaretten und einem Rest Tomatensoße. Ich will gerade aufstehen, um Teetassen aus dem Schrank zu holen, als Mama sich unvermittelt umdreht und in Frannys Richtung fragt: »Ging es vorhin wirklich um eine deiner Freundinnen, Fran? Oder ging es in Wahrheit um dich?«
Ich halte den Atem an. Es ist, als stünde jemand auf meiner Brust – erst mit nur einem Fuß, dann mit beiden. Wir alle schauen zu Franny.
Im selben Moment klingelt es.
Ein paar Sekunden sind wir wie eingefroren, Spielfiguren, die sich erst wieder neu formieren müssen. Zurück auf Los. Neues Setting: Mutter und vier Kinder; Vorweihnachtszeit; Hintergrundmusik: Nat King Cole; ein gemütliches Familienabendessen.
Mama drückt ihre Zigarette aus. Ihr Blick fragt: Erwartet ihr jemanden?
Ich schüttle den Kopf, die anderen tun es mir gleich.
Es klingelt ein zweites Mal.
Seit Beginn der Pandemie bekommen wir so gut wie nie Besuch. Wenn es mal klingelt, dann ist es ein Paketzusteller. Oder Lieferando. Diesmal ist es weder noch.
Keiner von uns bewegt sich. Dann stehen wir alle.
Man merkt erst, wie abgeschnitten vom Leben man ist, wenn ein Klingeln nach zwanzig Uhr fünf Menschen derart in Aufregung versetzt.
Wir schieben uns zu fünft in Richtung Flur, ich folge Franny, dabei sehe ich mich nach etwas um, womit ich mich im Notfall verteidigen könnte – aber da ist nur Mamas alter Regenschirm. Seine Spitze ist lang, doch der Schirm geht von allein auf. Wenn man damit jemanden angreifen würde, bliebe man einfach im Hausgang stecken, und alles, was man dann noch hätte, wäre ein Sichtschutz.
Charlie schaltet das Licht ein.
Ich habe eindeutig zu viele Filme gesehen. Warum sollte uns jemand überfallen? Es ist gerade mal zwanzig vor neun. Und wer auch immer draußen steht, hat geklingelt. Zwei Mal.
Mama nickt Charlie auffordernd zu, dann öffnet er die Tür.
»Nikki«, sagt er überrascht.
»Hi«, sagt sie. Und dann: »Ich muss mit dir reden.« Blick zu uns. »Allein.«
The Show must go on
Die beiden sind rüber ins Wohnzimmer gegangen. Wir sitzen zu viert in der Küche und schweigen, bis Henry schließlich fragt: »Was macht sie hier?«
»Ich nehme an, sie will euren Bruder zurück«, erwidert Mama trocken. »Bereut wohl, dass sie Schluss gemacht hat.« Sie zieht an ihrer Zigarette, dann fügt sie hinzu: »Ich hoffe, Charlie lässt sie abblitzen.«
Nikki und er waren lange zusammen. Über fünf Jahre. Aber gegen Ende ist sie ihm eigentlich nur noch auf die Nerven gegangen. Die Art, wie sie die Augenbrauen hochgezogen hat, wenn sie sauer war, ihre Stimmlage am Telefon mit Freundinnen, ihr lautes Lachen, ihre langen Haare im Abfluss und auf dem Badezimmerboden, ihre Schminksachen, die überall im Bad herumlagen, ihre Haussocken mit den Noppen, die bei Nikkis schlurfendem Gang auf dem Parkett gequietscht haben, ihre White-Noise-Maschine neben dem Bett – Meeresrauschen, Rascheln von Blättern, gedämpfte Gespräche wie in einem Café.
Wenn Charlie seine Ruhe haben wollte, musste er in den Waschsalon an der Ecke gehen. Irgendwann war er fast täglich dort. Ab und zu habe ich ihn besucht. Mit Kaffee und Süßigkeiten von der Tankstelle. Als ich ihn damals gefragt habe, warum er nicht einfach Schluss macht, hat er gesagt: Weil ich sie noch liebe. Mein Bruder ist viel Show und darunter noch mehr Verletztheit. Ich weiß, wie sich das anfühlt.
Am Ende war es Nikki, die die Reißleine gezogen hat, ein Streit zu viel, eine Randbemerkung, die das Fass zum Überlaufen brachte. Charlie hat nichts deswegen gesagt, aber ich glaube, er wäre gern in der Wohnung geblieben. Blöd nur, dass sein Name nicht im Mietvertrag stand, weil Mama sich damals geweigert hat, für ihn zu bürgen. Sie wollte nicht, dass er mit Nikki zusammenzieht, sie sagte, es wäre ein Fehler. Dumm gelaufen für Charlie. Als er wieder hier ankam – mit einem Koffer, einem Umzugskarton und viel gekränktem Männerstolz –, meinte sie nur: Ich hab’s dir doch gesagt.
Ich mochte Nikki immer gern. Sie ist klug und hat Sinn für Humor. Jetzt darf ich sie irgendwie nicht mehr mögen, weil sie meinen Bruder in den Wind geschossen hat. (Rein objektiv betrachtet, hat er es wahrscheinlich sogar verdient – aber ich bin seine Schwester. Es ist klar, auf wessen Seite ich stehe.)
Als Charlie neulich seine letzten paar Habseligkeiten bei Nikki abgeholt hat, stand eine Waschmaschine in der Küche. Charlie war bei den beiden für die Wäsche zuständig. (Wie sonst hätte er seine ausgedehnten Aufenthalte im Waschsalon an der Ecke rechtfertigen können?) Als ich die Waschmaschine gesehen habe, wusste ich, dass Nikki mich abgeschrieben hat, meinte er später zu Hause. Ein neuer Kerl und eine Waschmaschine.
Einige Tage danach haben Charlie und ich die beiden zusammen gesehen, sie und ihren neuen Stecher. (Charlies Worte, nicht meine.) Sie sind Hand in Hand die Straße runtergegangen. Wie ein Happy End, das Charlies hätte sein können, das sich stattdessen langsam von ihm entfernt. Er hat die Situation nicht weiter kommentiert, aber es hat ihn getroffen, das weiß ich.
Franny meinte später, dass es vielleicht nur eine Phase ist, dass Nikki vielleicht wieder zu ihm zurückkommt. Aber der Typ sah irgendwie nicht aus wie eine Phase. Er sah mehr so aus wie ein bleibender Eindruck. Als wäre Charlie die Aufwärmübung gewesen, ein paar Hampelmänner, bevor dann endlich der Richtige kommt.
Und jetzt sind sie nebenan, mein Bruder und sie, in einem gedämpften Gespräch, das sich fast schon eine halbe Stunde hinzieht. Mama steht auf und macht noch mehr Schwarztee, Franny wischt ein zweites Mal den Esstisch, Henry spielt irgendwas auf seinem Handy. Ich lehne unterdessen am Kühlschrank und frage mich, was als Nächstes kommt. Denn im Gegensatz zu Mama glaube ich nicht, dass Nikki Charlie zurückwill. Sie sah zu verheult aus, als sie hier ankam. Wenn sie ihn wirklich zurückwollte, hätte sie sich die Tränen dann nicht eher für ihn aufgehoben?
Als im selben Moment die Wohnzimmertür knarzt, schauen wir alle in Richtung Flur. Keiner von uns sagt etwas. Ich höre eine geflüsterte Verabschiedung, dicht gefolgt von der Haustür, die sanft ins Schloss gedrückt wird. Kurz darauf betritt Charlie die Küche. Alles steht still – bis auf den Rauch von Mamas Zigarette. Ich versuche, etwas im Gesicht meines Bruders zu erkennen. Aber es ist zu blass. Er steht farblos im Türrahmen, nur seine Augen sind blau.
»Also?«, sagt Mama. »Was wollte sie?«
Charlie antwortet nicht.
Ein paar Sekunden steht er einfach nur da, mit hängenden Schultern und leerem Blick. Dann schluckt er und sagt: »Nikki ist schwanger. Es ist von mir.«
Piller und Puschel
Nikki ist schwanger. Es ist von mir.
Seine Worte explodieren zwischen uns. Zwei Sätze, die schlagartig allen Sauerstoff aus der Küche saugen.
Ich starre Charlie an, meinen verplanten großen Bruder. Und dann versuche ich mir vorzustellen, wie er einen Säugling auf dem Arm hält. Ein kleines Lebewesen, das schreit und ihm auf die Schulter kotzt – wässrigen Milchbrei, den er mit einem Mulltuch wegwischt. Manche Dinge passen zusammen, andere nicht. Bei Charlie und Nikki war es beides. Erst haben sie zusammengepasst, später nicht mehr. Und jetzt werden sie Eltern.
Das Schweigen zwischen uns wird immer größer, so groß, dass es den Raum zu sprengen droht. Ich halte den Atem an, ein Moment wie unter Wasser. Die Asche von Mamas Zigarette fällt zu Boden. Sie lässt sie liegen.
Irgendwann räuspert sie sich und fragt: »Und das ist sicher?«
Ich schaue zu Charlie, er nickt minimal. »Sie war beim Frauenarzt«, sagt er tonlos. »Der Fötus hat einen Herzschlag.«
»Das meinte ich nicht«, erwidert Mama. »Ich meinte, dass es von dir ist.«
Charlie ist bleich, seine Haut sieht aus wie Wachs.
»Nikki ist in der fünfzehnten Woche, also …«
Der Satz bleibt unvollendet. Mama schließt die Augen.
Als ich zur Welt kam, war mein Vater zehn Jahre älter als Charlie. Und damit irgendwie ein fertiger Mann – ganz im Gegensatz zu meinem halbfertigen Bruder. Der ist mehr wie ein großer Junge, der ab und zu kifft und studiert. Ich frage mich, wie sein Kind ihn später mal wahrnimmt. Ob er eine Rolle in seinem Leben gespielt haben wird, oder ob er auch nur eine Leerstelle war, so wie unsere Väter – mal abgesehen von Lennard.
Manchmal wüsste ich gern, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn Dr. Alexander Lüdtke ein aktiver Bestandteil davon gewesen wäre und nicht nur an meiner Zeugung beteiligt. Aus dem Jetzt betrachtet war er bloß jemand, der zu einem passenden Zeitpunkt des Zyklus seinen Samen in meine Mutter gespritzt hat. Das ist kein Versuch meinerseits, besonders abgebrüht rüberzukommen, das mit dem Samen-Spritzen meine ich. Das habe ich aus einem Aufklärungsbuch. ›Mutter sag, wer macht die Kinder‹ von Janosch. Steck den Piller in die Puschel und spritz den Samen rein, stand da. Das Buch war ein Geschenk von einer alten Bekannten unserer Mutter. Ich erinnere mich noch an ihren perplexen Gesichtsausdruck, als ich sie damals gefragt habe, wieso wir das da unten nicht Piller und Puschel nennen. Mamas Blick war eine Mischung aus verständnislos und amüsiert. Was zum Henker sind Piller und Puschel?, wollte sie wissen. Woraufhin ich ihr das Buch gereicht und auf die Textpassage gezeigt habe. Erst hat sie den Kopf geschüttelt, danach hat sie laut gelacht, mir das Buch zurückgegeben und gesagt, wir können es nennen, wie wir wollen.
Wäre Dr. Alexander Lüdtke geblieben, wäre alles anders gewesen. Andere Geschwister, andere Freunde, andere Interessen. Diese Komponenten hätten ein anderes Ich aus mir gemacht. Eine Version, die womöglich auch jetzt irgendwo tief in mir vergraben ist, und die vielleicht eines Tages zum Vorschein kommt, weil andere Wendungen mich letztlich doch noch zu dem Ich machen werden, das ich andernfalls schon viel früher geworden wäre. Solche Gedanken beschäftigen mich oft. Gedanken wie verfilzte Haare. Ich versuche mir dann eine Sally mit Vater vorzustellen. Einem Vater, der zu Schulspielen kommt und auf dem Weihnachtsbasar Plätzchen verkauft, so wie der von meiner Grundschulfreundin Hanna. Der hatte Strickpullover mit Norwegermuster und hat dauernd Hannas Hand gehalten. Ich war wahnsinnig neidisch auf sie. Auf ihre Bilderbuchfamilie, von der meine nicht weiter hätte weg sein können.
Ich habe Mama jahrelang mit Fragen gelöchert. Wie mein Vater war, ob Franny ihm ähnlicher ist als ich, ob Mama denkt, dass er mich mögen würde, wenn er wüsste, wie ich bin. Fragen, die Kinder stellen, die nicht wissen, woher sie kommen. Mein Vater ist nicht tot, er lebt nur woanders. Mit einer anderen Frau und anderen Kindern – Kindern, bei denen er geblieben ist. Für mich ist er ein Fremder. Ein Adressbucheintrag in meinem Handy – Dr. Alexander Lüdtke und dahinter in Klammern: (Papa). Ich habe auch seine Postanschrift und seine E-Mail-Adresse. Ich könnte ihm schreiben. Oder ihn anrufen. Aber ich tue weder das eine noch das andere. Weil er sich auch nie bei mir gemeldet hat.