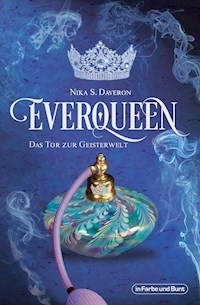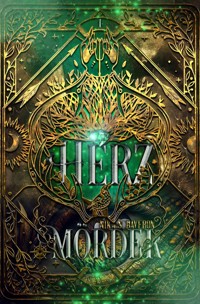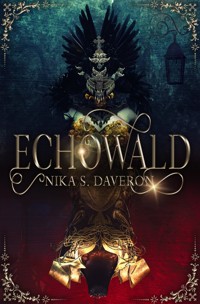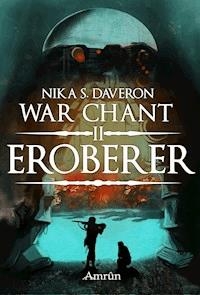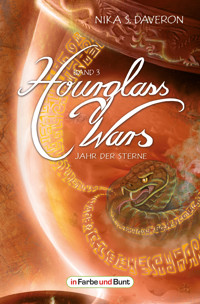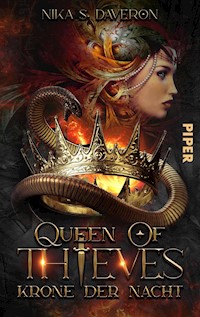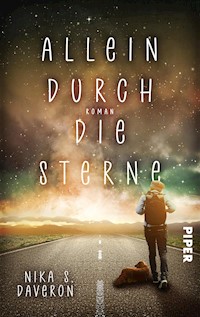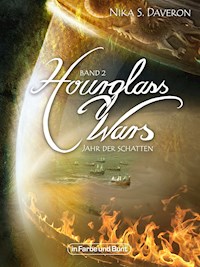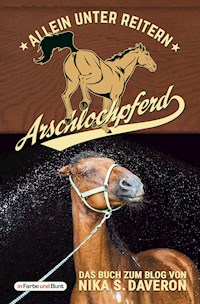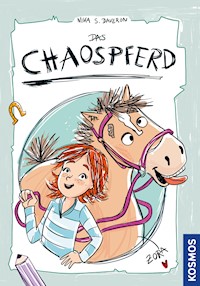Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amrun Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: War Chant
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Die junge Gladiatorin Harbinger lebt auf Odyssey, wo sich die Menschen nach der großen Flutkatastrophe ein neues Heim geschaffen haben. Doch die Insel ist zerfressen von Machtgier und das totalitäre System der Sieger macht den Bewohnern das Leben schwer. Unfreiwillig wird Harbinger in den erbitterten Freiheitskampf der Rebellen hineingezogen, muss aber erkennen, dass es in dieser Welt kein Gut und Böse gibt, sondern alles seine Schattenseiten hat. Der furiose Auftakt der dystopischen Reihe von Nika S. Daveron. Die Fortsetzung findet ihr in WAR CHANT Band 2: Eroberer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 477
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
War Chant I
Sieger
© 2015 Amrûn Verlag Jürgen Eglseer, Traunstein
Covergestaltung: Christian Günther
Lektorat: Katja Lehmann Korrektorat: Jessica Idczak
Alle Rechte vorbehalten
ISBN –978-3-95869-239-8
Besuchen Sie unsere Webseite:
http://amrun-verlag.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Für Hanna
Auf drei Euro, Kunlun, die Mötz und dreihundert weitere Jahre!
beginn
Mein Leben auf Odyssey begann wie das aller anderen, in einer Institution, die es nur auf dieser Insel gibt: der Behörde für Namen und Werdegang. Ein so unspektakulärer Name für etwas, das ein ganzes Leben bestimmt. Man geht dorthin, wenn man das sechste Lebensjahr erreicht hat; was nicht dem Tag entspricht, an dem man geboren wurde. Nein, man wird pünktlich zum Jahreswechsel ein Jahr älter.
Somit sprechen die Erwachsenen in der Regel von Jahrgängen. Wenn man also auf den Straßen hörte, dass sich eine alte Frau über den 2189er Jahrgang beschwerte, dann waren ihr die siebenjährigen Kinder ein Graus.
Ich war ein 2190er und damit alt genug, zur Behörde zu gehen, denn ich hatte den Brief erhalten, der irgendwann während des sechsten Lebensjahres ins Haus flattert. Natürlich ging ich nicht allein, sondern an der Hand meiner Mutter, die mich niemals aus den Augen ließ. Gemessen an den meisten Eltern auf Odyssey hatte meine Mutter Kinder wirklich gern und kümmerte sich um sie. Und nicht nur sie, auch mein Vater tat das. Allerdings in einem sehr beschränkten Maß, denn er war Schrotthändler. Das ist auf Odyssey wohl der anstrengendste Beruf, den es gibt.
Das, was in der Behörde geschah, war zu simpel, obwohl es unser ganzes Leben bestimmte. Dort saß ein Beamter, der uns unseren Namen und unseren Beruf gab. Mehr tat er nicht.
Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, wie es in der Behörde für Namen und Werdegang aussah: ein muffiges Blechding mit einem Kerl hinter einer Glasscheibe. Er trug die graue Uniform der Sieger und rauchte, dass mir von dem ganzen Qualm die Augen tränten.
Rauchen ist teuer, der Mann musste also sehr reich sein. Dass er noch hier saß, bedeutete, dass er wohl immer noch nicht genug Geld hatte, um sich zur Ruhe zu setzen, aber gerade genug, um sich den Luxus von Zigarren leisten zu können.
Da stand ich nun, die Hand meiner Mutter fest im Griff, den Blick zu Boden gerichtet, wie sie es mir eingeschärft hatte, und wartete. Mom schwor Stein und Bein, dass aufmüpfige Kinder gemeine Namen bekamen. Ein Mädchen von gegenüber hatte den zuständigen Beamten angeblich frech angeschaut, woraufhin er ihr den Namen Aphthae epizooticae verpasst hatte, was Maul- und Klauenseuche bedeutete. Und nicht nur das, er hatte ihr außerdem den gefährlichen Job eines Tauchers zugewiesen, sodass sie mittlerweile nur noch selten auf der Straße anzutreffen war. Ihre Tage verbrachte sie nun in der Taucherschule, was sich vielleicht nett anhört, aber in Wirklichkeit harter Drill ist. Wir Kinder nannten sie Apha, weil wir Mitleid hatten.
Schon als Kind fand ich es merkwürdig, dass eine Krankheit als Name zugelassen und dann noch in diesem riesigen Buch verzeichnet war. Wie sollte denn so jemanden ein gutes Schicksal erwarten?
Mein Blick fiel auf das Buch, das vor dem Beamten lag. Es war golden und mit allerhand Steinen und Muscheln beklebt. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie viele Seiten es hatte und wie viele Buchstaben darin stehen mochten. Was Buchstaben waren, wusste ich, doch lesen konnte ich natürlich nicht. Und je nachdem, was dieser Mann gleich mit mir anstellte, würde ich es auch nie lernen.
Das schwere Buch schien aus vielen Einzelteilen zu bestehen. Die Seiten waren uneben und teilweise zusammengeklebt, wahrscheinlich bestand es aus vielen Papierfetzen, die über Jahrzehnte hinweg zusammengetragen worden waren. Wahllos schlug er eine Seite auf und blickte auf meinen Scheitel hinab. »Guck mich ma‘ an, Kleine«, krächzte er und blies mir eine Ladung Qualm ins Gesicht. Ich hielt die Luft an und wartete darauf, dass der ätzende Gestank sich verzog. Aber ich gehorchte ihm. Er blickte mir mit seinen schwarzen Knopfaugen direkt ins Gesicht, seine Wangen warfen furchtbar viele Falten und seine Haut war grau wie ein Regentag. Überall schlängelten sich rote Äderchen über seine Wangen und er bleckte die Zähne, als er lächelte.
»Süß«, sagte er zu niemand Bestimmtem. Vielleicht zu meiner Mutter. Dann wandte er sich wieder dem Buch zu, nahm einen Stift zur Hand und blätterte weiter durch die Seiten. Das alte Papier raschelte unter seinen Fingern. Was er wohl suchte? Plötzlich hielt er an einer Stelle weit hinten im Buch an und deutete mit dem Stift auf einen Punkt, den ich natürlich nicht sehen konnte, denn meine Mutter und ich sahen das Heiligtum der Behörde nur von hinten in seinem goldbeschlagenen Umschlag. Ich hörte den Stift über das Papier kratzen, dann öffnete der Beamte einen kleinen, silbernen Kasten neben sich, der mir bis zu dem Moment nicht aufgefallen war, woraus er eine blaue Karte zog.
Die Blaue Karte war fortan der Ausweis des Odyssey-Bewohners, der sie erhalten hatte. Darauf standen der Name und der Beruf sowie der Jahrgang. Mehr nicht. Wer sie verlor, war vogelfrei. Wer mit einer falschen erwischt wurde, war des Todes.
Er reichte mir eine dieser Karten, die er mittlerweile beschrieben hatte. Ich nahm sie mit feuchten Händen entgegen. Weil ich nicht lesen konnte, gab ich sie an meine Mutter weiter, die ziemlich blass wurde.
»Sie ist doch ein Mädchen«, rief sie entrüstet, doch der Beamte kratzte sich ungeniert am Kinn und gähnte. Sie standen einem niemals Rede und Antwort. »Keine Diskussion« war die oberste Dienstvorschrift in der Behörde für Namen und Werdegang.
»Mom«, versuchte ich ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Ich war neugierig geworden. Hoffentlich hatte der Mann mir einen netten Namen gegeben. Mein Beruf interessierte mich nicht so sehr, da es wohl kaum etwas auf Odyssey gab, das Spaß machte. Das hatte ich sogar in meinen jungen Jahren begriffen. Meine Mutter gab mir die Blaue Karte und ich steckte sie in die kleine Umhängetasche, die sie mir vor einigen Wochen gekauft hatte. Sie musste ein Vermögen gekostet haben, weil es eine Schutzhülle für die Karte gab.
»Und?«, fragte ich, als ich erneut ihre Hand nahm und mit ihr nach draußen ging.
Meine Mutter lächelte schwach. »Du heißt jetzt Harbinger«, sagte sie leise.
Den Namen ließ ich mir auf der Zunge zergehen. Harbinger … das bedeutet unter anderem Omen. Und besser als Maul- und Klauenseuche war es allemal. Ich fand ihn eigentlich ganz hübsch. Sehr hübsch sogar, wenn auch nicht unbedingt passend für ein Mädchen.
»Und was noch?«, fragte ich. Dann packte mich die Angst. Vielleicht war ich auch zum Taucher geworden. Bloß nicht Taucher! Die meisten von ihnen starben jung, denn Tauchgeräte gab es auf Odyssey nicht.
Der Wind frischte auf und trug den Geruch von verfaulenden Algen heran, der Odyssey zwar ständig umgab, aber durch den Wind oftmals noch verstärkt wurde. Heute war es so windig, dass man die Bewegungen der schwimmenden Insel sogar spüren konnte.
»Du bist jetzt Gladiator, mein Schatz.«
»Was?« Ich verstand nicht. Vielmehr … ich wollte nicht verstehen. Gladiator? Das war etwas, was wir Kinder zwar immer sein wollten. In der Realität war das aber ganz und gar nicht erstrebenswert, weil es zwar verboten war, einander zu töten, im Umkehrschluss aber nicht bedeutete, dass man nie verletzt wurde. Es war ein Knochenjob, der allerdings, wenn man ein guter Gladiator war (oder einen guten Trainer hatte), auch zu Ruhm und Reichtum führen konnte.
Meine Mutter schwieg und zog mich weiter durch die Gasse, die zurück zum Markt führte. Es war Markttag und mein Vater musste dort irgendwo sein. Er hatte mir versprochen, meine Namensgebung zu feiern. Doch so, wie meine Mutter reagiert hatte, gab es da nichts zu feiern. Ich selbst war auch nicht mehr in Feierstimmung und das, obwohl meine Eltern mir sogar Süßigkeiten versprochen hatten.
Ich starrte einfach auf den Weg, der aus den verschiedensten Materialien zusammengebaut war.
Gladiator … was war denn das für eine Zukunft für ein sechsjähriges Mädchen?
Um die Gladiatoren zu erklären, muss ich wohl auch das System meiner Heimat und der Sieger beschreiben.
Odyssey war ein schwimmender Staat auf einem Ozean, der unendlich war. Und er bestand vollständig aus Müll. Die Insel war eine riesige Plattform aus weggeworfenen Dingen früherer Generationen. Vor bestimmt zweihundert Jahren hatten sich im Pazifik riesige Ansammlungen von Abfall zusammengerottet; erst waren sie nur Strudel, mit der Algenverseuchung bildete sich dann Landmasse. Und die größte davon wurde zum Sammelpunkt der Menschen nach der Flutkatastrophe von 2051.
Außer Odyssey entstanden mit der Zeit noch zwei weitere Müllstaaten: Aquarius und Chandra. Bis vor kurzem habe ich geglaubt, dass es ein Mythos sei, denn niemals sahen wir von unserer Insel aus etwas anderes als Wasser. Somit erweiterte sich Odyssey beständig, es war unser Lebensort und gleichzeitig versorgte es uns. Allerdings mehr mit Materialien als mit Nahrung. Diese beschaffte uns der Ozean, daher war Fischerei unabdingbar, wenn man auf einer schwimmenden Insel lebte.
Neben der Fischerei hielt uns die Filteranlage am Leben, die alles auf der Insel überragte und von jedem Punkt auf Odyssey aus sichtbar war. Sie filterte das Meerwasser, das in Trinkwasser umgewandelt wurde.
Eigentlich hätte man es als einen Neuanfang für die Menschheit bezeichnen können, doch der Mensch strebt nun einmal nach Macht. In einem blutigen Bürgerkrieg dezimierte sich die Bevölkerung auf circa hunderttausend Menschen, 2078 wurde das System der Sieger installiert und es hatte bis heute Bestand. Und obwohl es Wahlen auf Odyssey gab, waren die eine Farce, denn man konnte nur aus den Siegern wählen, die bereits als solche geboren wurden.
Korrekterweise nannte man sie Odyssey Defence Force. Aber eigentlich bestand diese nur aus den Siegern des Bürgerkriegs und deswegen nannten wir sie so.
Wohin Odyssey eigentlich trieb, wusste wohl nur der Wind; allerdings umschmeichelten die Sieger uns ständig mit derPropaganda vom gelobten Land, dem Festland, das wir jedoch niemals zu Gesicht bekamen, und natürlich von der großen Reise, die Odyssey seinen Namen gab.
Um weitere Aufstände zu verhindern, erschufen sie ein strenges System, das fortan unser Leben bestimmte. Dies stand alles in einem Buch geschrieben, welches in der Behörde für Namen und Werdegang normalerweise sicher verwahrt in einem uralten Safe lag.
Das eine Buch schrieb uns also unseren Namen und unseren Beruf vor, das andere die goldenen Regeln – unsere Gesetze, die so verzweigt und weitreichend waren, dass man eigentlich ständig dagegen verstieß. Allerdings kamen die meisten Regeln nie zur Anwendung. So viel Angst besaßen die Sieger noch, dass sie es nicht wagten, die Menschen erneut gegen sich aufzubringen. Stattdessen straften sie nur wirkliche Gesetzesüberschreitungen: Mord und Diebstahl sowie Vergehen, die es eben nur in der Gemeinschaft von Odyssey gab wie der Verlust der Blauen Karte oder eine unautorisierte Namensgebung.
Um den Bürgern Zerstreuung zu bieten, belebten die Sieger die uralte Tradition der Gladiatura wieder. Und es funktionierte tatsächlich: die Menschen verspielten Haus und Hof bei Sieg und Niederlage des einen oder anderen Gladiators. Dass die Kämpfe normalerweise ohne Tote auskamen, verdankten die Gladiatoren der Sorge der Sieger, dass sie die ohnehin schon kleine Bevölkerungsanzahl damit noch weiter dezimierten.
Um auch denjenigen, die Kämpfe verabscheuten, einen Anreiz zu bieten, ihr Geld zu verwetten, schufen sie zusätzlich eine kleine Rennbahn für Hunderennen. Mein Vater hatte mich einmal dorthin mitgenommen und ich fand es traumhaft. Normalerweise gab es keine Tiere auf der Insel, die einfach nur dem Vergnügen dienten. Überhaupt gab es sehr wenige Tiere. Ihnen war es mit der Flutkatastrophe und der Umweltverschmutzung nicht anders ergangen als den Menschen. Nur wenige hatten sich retten können.
Wenn man durch die Straßen von Odyssey ging, haftete einem immer der Gestank von Algen und Müll an. In unserer Straße, ziemlich nah am Wasser, roch es nicht ganz so schlimm. Die Luft war feucht und salzig und es ging ständig ein starker Wind. Erst im Stadtzentrum von Odysseys Hauptstadt, Soyuz, wurde der Wind weniger schneidend, allerdings stank es dort mehr nach verfaulenden Algen.
In der Hauptstadt schlug das Herz der Gladiatura. Der riesige Käfig, die Arena der Gladiatoren, mit nur zwei Eingängen, umgeben von Tribünen für die vielen Zuschauer, thronte auf einem Müllhügel über der Stadt und war bei nächtlichen Kämpfen erstaunlich gut ausgeleuchtet, was irgendein Konstrukt aus Fackeln und Spiegeln sicherstellte.
All diese Dinge wusste ich im Groben bereits mit meinen sechs Jahren, doch was mich in der Gladiatorenschule erwartete, würde für mich ebenso hart werden wie für Apha die Taucherschule.
Meinen ersten Tag vergesse ich wohl nie wieder. Meine Mutter lieferte mich in Soyuz direkt vor der Kaserne ab, deren Haupttor mit glitzernden Glasscherben (echte Edelsteine bekam auf Odyssey sowieso niemand zu Gesicht) reich verziert war.
Staunend blieb ich vor dem Torbogen stehen und starrte nach oben. Die Ornamente bildeten kleine Figuren, die mit ihren Schwertern und Schildern aufeinander loszugehen schienen. Es war erstaunlich, da das Buntglas die Gladiatoren sogar auf die weißen Pflastersteine projizierte. Überhaupt war das Gebäude nobler als jedes Haus, das ich je gesehen hatte, weil wir in einer Gegend lebten, in der die Menschen in verrosteten Hütten hausten. Die meisten ärmeren Familien lebten dort. Und damit die Mehrzahl aller Bewohner von Odyssey.
»Du kommst sofort nach Hause, wenn du hier fertig bist«, schärfte mir meine Mutter ein. »Hörst du … Harbinger?« Der Name ging ihr sichtlich schwer über die Lippen.
»Ja, versprochen«, antwortete ich und wiederholte vorsorglich noch einmal: »Sofort nach Hause kommen.«
»Und du legst niemals die Blaue Karte ab, auch nicht beim Training«, fügte sie hinzu und sah mich streng an.
Ich nickte bekräftigend und ließ mich von ihr küssen. Sie seufzte noch einmal und verschwand dann im dichten Gedränge der Hauptstraße. Ich atmete durch, doch bereute es im selben Moment wieder – die Luft von Soyuz war wirklich eine Qual. Also versuchte ich, durch den Mund zu atmen, und ging den weißen Weg hinauf zur Gladiatorenkaserne.
Schon am frühen Morgen erklangen aus der Ferne Befehle und markerschütterndes Gebrüll. Zwei uniformierte Männer bewachten den Eingang zum Haupthaus. Er bestand aus einem hohen Gittertor, wodurch ich in den Innenhof blicken konnte. Dort standen sich mehrere Fechtpaare gegenüber, die komplizierte Schrittfolgen ausführten.
Ich fürchtete mich nicht direkt, denn Gladiator war nicht unbedingt ein gefährlicherer Beruf als zum Beispiel Taucher oder Schrottsammler. Die kämpften mit unbekannten Krankheiten und Bakterien oder Ermüdungserscheinungen der Lunge. Ich dagegen sollte nur mit anderen Gladiatoren kämpfen. Bei den einstudierten Wettkämpfen kam es fast nie zu Verletzungen. Selten erlag ein siegloser Gladiator seinen Kampfverletzungen, denn das Match wurde normalerweise rechtzeitig abgebrochen.
Viel mehr Angst hatte ich vor meinen zukünftigen Lehrern und den anderen Gladiatorenschülern. Die waren sicher alle viel älter als ich und niemand würde mich ernst nehmen. Ich war schon bei unseren Spielen auf der Straße immer die Kleinste gewesen, und leider auch die Schwächste. Bei einer Kraftprobe hatte ich nicht einmal ein Rohr anheben können.
»Guten Tag«, sagte ich zu den beiden Wächtern mit ihren unbewegten Mienen. Sie trugen die traditionelle Kleidung der Schule und sahen damit selbst ein bisschen wie Gladiatoren aus. Hohe Beinschienen und die klassische Bewaffnung des Standardgladiators, des Murmillo.
Allerdings war der Rest ihres Körpers in eine schwarze Uniform gehüllt und statt des Helms und dem dazugehörigen roten Helmbusch trugen sie rote Embleme an ihrem Kragen, die ihnen bis zum Kinn reichten. Einer der Männer, mit grauen, unfreundlichen Augen, hielt einfach nur die Hand auf und ließ sich meine Blaue Karte reichen. Er warf einen flüchtigen Blick darauf, nickte und gab sie mir zurück. Wahrscheinlich hatte er nur geprüft, ob das Wort »Gladiator« darauf stand und meinen Namen gar nicht beachtet. »Ähm …«, machte ich. »Wo muss ich denn hin?«
Sein Kumpan öffnete bei meinen Worten das Eisentor und ich betrat das Atrium, wie man es in der Gladiatorenschule nannte. Alles war so viel sauberer als jedes Gebäude, das ich je gesehen hatte; sogar sauberer und eleganter als die Behörde.
Ich musste dem Impuls widerstehen, mir verwundert die Augen zu reiben, denn meine Mutter hatte mir eingeschärft, nicht total verschreckt zu wirken. Aber ich war eben sechs Jahre alt und völlig überwältigt von dem, was sich mir hier bot, also blieb mir gar nichts anderes übrig, als große Augen zu machen.
Der Innenhof war mit Sand aufgeschüttet worden, der, wie ich heute weiß, von einer Sandbank stammte, auf die Odyssey vor vielen Jahren aufgelaufen war. Nach einem Sturm löste sich die Insel wieder und übrig blieb der eilig hinübergeschaffte Sand, der den Boden des Käfigs und das Atrium bedeckte.
Niemand nahm Notiz von mir: die Fechter, in unterschiedlichem Alter, waren immer noch voll in ihre Trainingskämpfe vertieft; ein Aufseher, der alle von ihnen überragte, ging durch die Reihen und gab seine Befehle. Seine schwarzen Dreadlocks fielen ihm schwer über den massiven Rücken und reichten beinahe bis über seine Hüfte. Die Arme waren dicke Muskelstränge und seine Haut so schwarz wie das Treibholz, das Odyssey umgab.
Abrupt drehte sich der Mann um und ich erkannte meinen Fehler: Der Ausbilder war kein Mann, sondern eine Frau. Sie trug ein merkwürdiges Brillengestell, bei dem ein Auge komplett abgedunkelt war und sich in der anderen Seite kein Glas befand. Unwillkürlich stellte ich mich gerade hin und wagte es kaum noch zu atmen, als sie mich mit ihrem gesunden, unnatürlich hellen Auge musterte. So jemanden hatte ich noch nie gesehen.
»Was glotzt du so?«, herrschte sie mich an.
Am liebsten hätte ich auf dem Absatz kehrt gemacht und wäre zu meiner Mutter gelaufen. Aber was in diesem Buch stand, war Gesetz. Und darin stand nun einmal, dass ich Gladiator werden sollte. Also hielt ich der großen, schwarzen Frau meine Blaue Karte vor die Nase.
Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht und enthüllte ihre schneeweißen Zähne.
»Niedlich. Die haben ja Humor bei der Behörde.«
Ich war mir nicht sicher, ob es klug war, ebenfalls zu lächeln, aber ich tat es.
»Du bist viel zu klein«, fauchte sie dann und das Lächeln war wie weggeblasen. »Was soll ich denn mit so einer?«
Ich konnte dazu ja schlecht etwas sagen.
»Loire«, brüllte die Frau.
Ein Mann, braun gebrannt, nur mit einer zerschlissenen Stoffhose bekleidet, erschien neben ihr. Sein Körper war
über und über mit Tätowierungen bedeckt. So in etwa stellte ich mir die Seeräuber vor, die es in den Gute-Nacht-Geschichten meiner Mutter immer gab.
»Was kann man mit der anstellen?«, wollte sie wissen.
Der Mann mit dem derben Gesicht musterte mich von Kopf bis Fuß. Ich war nicht mal in der Lage, wirklich Angst zu empfinden, so überwältigend war all das in diesem Moment.
»Nichts. Aber was soll’s, da müssen wir durch. Taugt bestimmt als Sandsack. Und vielleicht mal für den Käfig. Aber nicht für die wichtigen Sachen. Probier’s mit ihr als Retiarius.«
Ich hatte keine Ahnung, wovon der Mann sprach, aber seine Antwort schien der schwarzen Frau zu missfallen, denn sie schnaubte verächtlich.
»Retiarius? Im Leben nicht. Die kriegt kein Netz hoch. Hoplomachus vielleicht. Aber ich glaube, die Lanze kann ich bei der auch vergessen.«
»Falconetta«, versuchte der Mann, den sie Loire genannt hatte, sie zu beruhigen. »Lass sie halt ein bisschennebenher laufen. Wir kriegen sonst Ärger mit der Behörde.«
Die schwarze Frau knirschte mit den Zähnen, als sie sich wieder mir zuwandte. »Harbinger, wie?«
Ich nickte, auch wenn ich erst seit gestern so hieß und mich noch nicht daran gewöhnt hatte, mit diesem Namen angesprochen zu werden. Und ich hatte außerdem kein Wort von dem verstanden, was sie da besprachen. Die seltsamen Begriffe, von denen ich ahnte, dass sie lateinisch waren, sagten mir überhaupt nichts.
»Wer ist deine Mutter?«
»Moanin«, flüsterte ich eingeschüchtert Warum war das wichtig?
»Und dein Vater?«
»Icarus.«
»Der Schrotthändler vom Strand?«
»Den kenne ich«, sagte Loire.
»Ja«, erwiderte Falconetta. »Ich auch.«
Eine Weile berieten sie sich flüsternd. »Komm mit«, zischte sie, wartete gar nicht auf meine Reaktion, sondern zog mich einfach hinter sich her. Ich wurde durch einen Säulengang geführt, der, wie ich heute weiß, zur Umkleidekabine führte. Wie sich später zeigte, sollte ich meine erste Uniform bekommen.
Überhaupt war es ein Wunder, dass die Schule sich das leisten konnte, denn nur die Sieger besaßen Arbeitskleidung, die sich nicht voneinander unterschied und in einer richtigen Schneiderei gefertigt wurde. Aber für die Gladiatoren wurde eben seit jeher sehr viel Geld ausgegeben.
Die Säulen, die das Dach dieses Ganges stützten, waren aus den unterschiedlichen Materialien gefertigt und aufwendig mit Glasscherben verziert. Mal abgesehen von dem unfreundlichen Empfang hatte ich es doch eigentlich ganz gut getroffen, wie ich fand. Besser auf jeden Fall als die arme Apha. Und auch besser als Garina, die links von uns wohnte; die musste nämlich im Wasserwerk in die Lehre. Dort stank es meistens noch ekelhafter als auf den Straßen von Soyuz.
Wir erreichten einen kleinen, geschlossenen Raum, der sogar eine Tür besaß.
»Hier kannst du deine Sachen hinlegen. Ganz oben ist noch ein Fach frei. Deine Blaue Karte legst du auch da rein«, sagte sie und deutete auf ein Regalbrett ganz oben an der Decke.
Ich hatte nicht den blassesten Schimmer, wie ich dort überhaupt etwas hineinlegen sollte, da meine Arme gerade bis zum zweiten Brett reichten.
»Keine Angst«, fuhr die Frau fort. »Hier klaut niemand deine Karte.«
»Meine Mom hat gesagt …«, begann ich, doch da fing ich mir prompt meine erste Ohrfeige von Falconetta. Sie war ein Mensch, dessen Launen sich innerhalb von Sekunden ändern konnten, wie ich leider erst später begriff.
»Deine Mutter hat hier nichts zu melden. Klar?«
Mit Tränen in den Augen nickte ich.
»Und geheult wird hier auch nicht!«, tobte sie los. Die Brille mit dem einzelnen, dunklen Glas zitterte auf ihrer Nasenspitze. »Ich kann heulende, kleine Mädchen nicht ausstehen, also reiß dich zusammen!«
Ich schluckte meine Tränen hinunter und versuchte, die Frau nicht anzusehen, um sie nicht erneut zu reizen.
»Los, leg deine Sachen ab«, verlangte sie von mir.
Allerdings hatte sie mir noch keine Uniform gereicht und nackt vor sie hinstellen wollte ich mich nicht. Falconetta knirschte mit den Zähnen und riss unsanft mein Jäckchen hinunter. Der kleine Knopf, den meine Mutter aus einem Möwenknochen gezaubert hatte, fiel zu Boden, doch bevor ich mich danach bücken konnte, hatte sie ihn unter ihren schweren, eisenbeschlagenen Stiefeln zermalmt.
Mir musste ein erstickter Laut entwichen sein, denn Falconetta schlug erneut zu, dieses Mal auf die andere Wange. Nicht fest, aber so, dass man sich ordentlich erschreckte.
»Ich sage es nicht noch einmal«, fauchte sie.
Gehorsam zog ich meine restlichen Klamotten aus, zuletzt die wollenen Kniestrümpfe, die mir meine Mutter gestrickt hatte.
Falconetta nahm all diese Kleidungsstücke und reichte sie mir, nachdem sie sie ordentlich zusammengefaltet hatte. Oben drauf lag die Umhängetasche mit meiner Blauen Karte. »Bring sie nach oben.«
Wie denn? Ich kam ja kaum über das zweite Fach hinaus. Aber das traute ich mich nicht zu sagen. Um nicht völlig unschlüssig auf dem kalten Boden herumzustehen (und noch dazu splitterfasernackt), griff ich nach einem Brett an der Wand und überprüfte seinen Halt. Das schien stabil zu sein, also stieg ich hinauf. Damit war ich der obersten Reihe immer noch nicht wirklich näher gekommen, daher sah ich mich nach dem nächsten Brett um.
Falconetta hatte unterdessen einen kleine Tonscherbe gezückt, die sie mir nun hinhielt. Ich ließ zu, dass sie sie auf meinen Kleidungsstapel legte, während ich mich mit der anderen Hand am Regalboden festhielt.
»Da. Das hängst du auf den kleinen Haken an deinem Fach.«
Wahrscheinlich stand darauf mein Name. Woher sie die Scherbe so schnell hatte, wusste ich nicht.
Mit dem Kleinod auf dem Stapel war es noch viel schwerer, die Regale zu erklimmen, denn ich hatte ja keine Tasche mehr, in die ich es stecken konnte.
Die Trainerin beobachtete jeden meiner zögerlichen Versuche, die obere Reihe zu erreichen, während ich mich dazu zwang, nicht nach unten zu sehen. Gar nicht so einfach, doch irgendwie verfiel ich mit steigender Höhe in eine Art Rausch. Ich wollte es schaffen.
Der Raum war hoch und eckig wie ein Turm, nur dass er ein Sonnensegel statt einem Dach besaß. Die Wände ragten unerreichbar hoch vor mir auf und ausgerechnet unter der Decke sollte mein Fach sein.
Noch zwei Reihen. Ich konnte den kleinen Haken für die Tonscherbe an meinem Holzkasten schon erkennen, als ich das nächste Brett erklomm. Es knackte unangenehm unter meinem Fuß. Ich versuchte, nach dem Holzbrett über mir zu greifen, bekam es sogar zu fassen. Doch dann knackte es wieder und lauter als zuvor. Ich fühlte, wie das Brett unter meinen Füßen nachgab, und klammerte mich noch stärker an das Fach über mir. Meine Kleider fielen zu Boden und ich hörte das Scheppern der Tonscherbe auf den Fliesen.
Es knirschte noch einmal unheilvoll, dann rauschte das gesamte Konstrukt abwärts. Einen Moment schien ich in der Luft zu schweben, dann fiel ich wie ein Stein zu Boden. Ich fühlte weiche Wolle, Holz und Staub, und dann kam der Aufprall. Schmerz durchfuhr meinen ganzen Körper, lang und beißend.
Etwas Schweres lag auf meinen Beinen und ich konnte kaum atmen. Meine Lungen krampften sich zusammen, als ich versuchte, Luft zu holen. In meinem Kopf hämmerte es unbarmherzig und mir wurde schwarz vor Augen.
Ich konnte kaum lange bewusstlos gewesen sein, denn als ich wieder zu mir kam, beugte sich Falconetta über mich und zerrte meine Lider auseinander. Kopfschüttelnd wuchtete sie ein paar der Holzbretter von mir herunter.
»Kannst du dich bewegen?«, fragte sie unwirsch.
Ich konnte nicht mal sprechen! Wie konnte diese gemeine Frau überhaupt annehmen, dass ich irgendetwas konnte? Ich atmete tief durch. Probehalber bewegte ich meine Hände und meine Füße, was verdammt wehtat.
Der Schmerz raubte mir abermals die Sicht, doch als ich die Augen öffnete, huschte ein Grinsen über Falconettas Gesicht.
»Andere Kinder hätten nach einer Leiter verlangt oder mir blöde Fragen gestellt.« Sie tätschelte meinen dunklen Schopf und grinste noch breiter. »Du gefällst mir, Kleine.«
Sie zog mich auf die Füße und begutachtete meinen Körper. »Ich hole dir was zum Desinfizieren. Merk dir das gut, ich verschwende normalerweise keine Medizin an Kinder.«
Ich war viel zu verblüfft von ihren Worten und ihrem plötzlichen Sinneswandel, sodass ich weder antworten noch weinen konnte, obwohl jeder Zentimeter meines Körpers schmerzte.
In der Tür blieb die Gladiatorentrainerin stehen. Ihre Stimme wurde mit einem Mal eiskalt. »Und bis ich wiederkomme, hast du diesen Saustall bereinigt. Ich rate dir, das ernst zu nehmen.«
An meinem ersten Tag lernte ich die erste Regel der Gladiatorenschule kennen: Falconettas Launen sind unberechenbar. Und: Ihr Lieblingskind zu sein hat mehr Nachteile als Vorteile.
Am Ende des Tages hatte ich noch kein Schwert in der Hand gehalten, dafür aber splitterfasernackt die Umkleide der Gladiatoren neu aufgebaut. Der Wiederaufbau geschah unter Anleitung meiner Trainerin, die mir hin und wieder Werkzeug reichte oder aber, wenn ich mich sehr blöd anstellte, selbst Hand anlegte. Erst danach hatte sie mir meine Uniform ausgehändigt. Zu dem Zeitpunkt hatten mich schon alle anderen Schüler nackt gesehen.
»Scham ist hier fehl am Platz«, hatte sie mir eingeschärft und mich in meiner neuen Uniform nach Hause geschickt. Auf die war ich wirklich stolz, aber ich vermisste unwillkürlich die weiche Wolle meiner Jacke, die meine Mutter extra für mich angefertigt hatte. Nur meine Blaue Karte und die Umhängetasche nahm ich mit nach Hause, allerdings mit knurrendem Magen, trockener Kehle und schmerzenden Gliedern, denn Essen gab es nur für Gladiatoren, die ihr Training absolviert hatten, während ich meine Zeit damit verschwendet hatte, die Umkleide neu zu dekorieren. Am Tor versprach Falconetta mir außerdem, mir die Frisur einer Novizin zu verpassen, und ich war mir nicht wirklich sicher, ob ich das wollte.
Meine Schrammen hatte sie nach dem Unfall erstklassig versorgt. Normalerweise war ich es gewöhnt, dass Wunden mit Wasser ausgespült und hin und wieder auch mit Seife ausgewaschen wurden. Doch jetzt trug ich einen nagelneuen Verband um den Arm und roch stark nach Falconettas Desinfektionsmittel. Niemand konnte sich eine professionelle Behandlung durch einen Arzt leisten, deswegen kam ich mir so merkwürdig vor wie noch nie in meinem Leben.
Mein jüngerer Bruder - er war vier und hatte noch keinen Namen - saß vor dem Haus auf den hellen Holzplanken, die mein Vater noch vor meiner Geburt neben der Haustür angebracht hatte. Dort saß an warmen Tagen meistens die ganze Familie zusammen und nahm um einen kleinen Tisch herum ihre Mahlzeiten ein.
Er winkte mir euphorisch zu. Weil der Name Harbinger zu schwer für ihn war, hatte er kurzerhand »Bing« daraus gemacht und brüllte das durch die ganze Straße. Einige der Nachbarn, aufgescheucht durch sein Geschrei, musterten mich jetzt genauer, denn die Uniform verriet sofort, dass ich nun die Gladiatorenschule besuchte. Alle ignorierten meine Verletzungen, aber das war normal.
Viele Bewohner von Odyssey hatten diese Mentalität – über die schlimmen Dinge sprach man nicht, außerdem bewegte man sich damit sowieso immer am Rande der Legalität.
Die nette alte Frau von schräg gegenüber allerdings schüttelte missbilligend den Kopf, bevor sie in ihrer Hütte verschwand.
»Wie siehst du denn aus, Bing?«, fragte mein Bruder und deutete ehrfürchtig auf den Verband. »Hast du schon gekämpft?«
»Nee«, meinte ich, »mir ist ein Regal auf den Kopf gefallen.«
Als ich unser windschiefes Häuschen betrat, traf meine Mutter beinahe der Schlag. Sie ließ vor Schreck den Rost fallen, auf dem wir sonst unser Essen zubereiteten, und eilte zu mir herüber.
»Was haben sie mit dir angestellt?«, rief sie ängstlich und zog mich an sich.
»Nichts, das war meine Schuld«, nuschelte ich in ihre Schürze. War es auch, wenn es nach Falconetta ging.
Meine Mutter glaubte mir nicht.
»Ich fasse es immer noch nicht, dass ein kleines Mädchen wie du …« Der Rest ging in einem lauten Schniefen unter. Sie wandte sich von mir ab und versuchte, den Rest unseres Abendessens zu retten.
»Setz dich zu deinem Bruder raus, mein Schatz«, sagte meine Mutter, als sie den Fisch, der vorhin in die Glut gefallen war, abgewaschen hatte. »Dein Vater ist auch gleich da.«
Aus ihrer Schürze klaubte sie ein Stück Zucker und reichte es mir. Zucker zum Lutschen gab es so selten und er kostete so viele Muscheln. Wahrscheinlich hatte sie heute auf dem Markt Schlange für das kleine Stück gestanden.
Ich stopfte es mir gierig in den Mund, ging durch den engen Flur zurück und kniete mich neben meinem Bruder an den Tisch. Auf der Straße herrschte reges Treiben, weil die meisten Bewohner der Häuser um diese Uhrzeit nach Hause kamen.
»Wann kämpfst du im Käfig, Bing?«, fragte mein Bruder aufgeregt. Der Kerl konnte nie still sitzen und rutschte auch jetzt hin und her.
»Noch nicht«, antwortete ich ihm. »Ich muss doch erst mal üben.«
»Ach ja …«, rief er und schlug sich vor die Stirn. »Aber wenn … kriegst du dann ein Schwert?«
»Weiß nicht. Es gibt ja auch Gladiatoren ohne Schwert.«
Mein Bruder und ich waren einmal sonntags mit im Käfig gewesen. Einmal im Jahr gab es freien Eintritt für alle Bewohner von Odyssey. Die einzelnen Dörfer werden an unterschiedlichen Tagen eingeladen, sodass es nicht zu voll wird. Und nachdem unser Dorf bei den Matches gewesen war, hatten wir Kinder wochenlang »Gladiator« gespielt und uns mit Stöcken und Eisenstangen grün und blau geschlagen. Gallant, der auch in meiner Straße wohnte, hatte eine üble Narbe davongetragen, als ihn ein anderer Junge am Kinn erwischt hatte.
Danach hatte es solchen Ärger gegeben, dass wir es nicht mehr wagten, öffentlich zu spielen, daher taten wir es heimlich.
»Du musst einer von denen mit Schwert werden«, behauptete mein Bruder. »Die sind viel toller als diese komischen …«
Ich musste gegen meinen Willen lachen.
»Ich kann mir das aber nicht aussuchen. Das machen die, die uns trainieren.«
»Sind die nett?«
»Geht so.«
In der Ferne hörte ich das wohlbekannte Glockengeläut. Mein Vater kam heim. Er hatte an seinem großen Karren eine ganze Reihe von Glocken und Klingeln angebracht, sodass jeder wusste, wenn der Schrotthändler durch ihre Straße kam. Er hatte nicht nur den Karren, sondern auch ein zweites Grundstück direkt neben unserem, wo er seine Sachen lagerte und teilweise reparierte. Allerdings war das eher ein hoffnungsloser Versuch, mehr Geld dabei herauszuschlagen, weil er zwei linke Hände hatte und die gefundenen Sachen meisten eher verschlimmerte. Aber mit Karren und Lagerplatz gehörte er auf jeden Fall zu den besser verdienenden Händlern seiner Gilde.
Große Teile im Norden von Odyssey waren quasi Freiwild für die Schrotthändler der Insel, denn dort wurde ständig neues Zeug angespült. Jeden Tag fuhr mein Vater am frühen Morgen mit seinem Handkarren hinaus und blieb bis zum späten Abend. Dass er an diesem Tag so früh nach Hause kam, lag sicherlich daran, dass ich meinen ersten Tag in der Gladiatorenschule gehabt hatte.
Mein Bruder sprang auf und stürmte meinem Vater entgegen. Ich fühlte mich dafür viel zu schwach. Jetzt, wo ich saß, war mein Körper plötzlich bleischwer.
Mein Vater schob den beinahe leeren Karren auf den Hof, während mein Bruder um ihn herumsprang, weil er nicht die Aufmerksamkeit bekam, die er wollte.
Mein Vater bugsierte das schwere Gefährt unter das Dach und eilte mit meinem Bruder im Schlepptau auf mich zu. »Da bist du ja schon«, rief er und küsste meine Stirn, bevor er mich übertrieben in die Arme nahm. Ich zuckte bei der Berührung zusammen, denn meine Rippen taten höllisch weh.
»Was ist dir denn passiert?«, fragte er verwundert, als er die Verbände sah.
»Nichts Schlimmes«, behauptete ich. Aus irgendeinem Grund war es mir peinlich, zu erzählen, dass ich noch nicht einmal trainiert hatte. »Sie passen ja gut auf uns auf«, fügte ich hinzu, als ich seinen Blick bemerkte.
Mein Vater schüttelte missbilligend den Kopf. »Das mag ja ein ehrenhafter Beruf sein, aber ein Kind in deinem Alter …«
Was mit Kindern in meinem Alter war, sollte ich nicht mehr erfahren, denn meine Mutter trat aus der Tür, um ihn zu begrüßen. In der linken Hand balancierte sie eine Schale aus Plastik, in der unser Fisch lag, und in der anderen hielt sie eine Flasche mit abgebrochenem Hals, aus der wir immer Wasser tranken. Die spitzen und scharfen Kanten hatte sie abgeschliffen, sodass wir uns nicht schneiden konnten.
Mein Vater nahm ihr die Sachen ab und stellte sie auf den Tisch. Als ich den Fisch roch, knurrte mein Magen laut.
»Gibt es da in der Schule nichts zu essen?«, fragte mein Bruder.
»Nein, heute nicht«, antwortete ich. »Aber morgen bestimmt«, fügte ich schnell hinzu, als ich seinen mitleidigen Blick sah. Mein Vater ließ sich neben mir zu Boden sinken und strahlte mich regelrecht an.
»Ich habe dir etwas mitgebracht.«
Neugierig sah ich zu ihm auf.
»Rechte oder linke Hand?«
Das Spiel spielte er immer mit uns und wir wussten beide, dass er das Geschenk in seinen Händen hin und herwechselte, sodass wir beim ersten Mal stets daneben lagen.
»Links«, sagte ich.
Natürlich war das Geschenk nicht in der linken Hand und ich musste noch einmal raten, sodass ich erst beim zweiten Mal die Überraschung bekam: Eine zierliche Kette kam zum Vorschein, an dem eine von seinen Glocken hing, allerdings war sie viel kleiner als die meisten, die er am Wagen hatte.
»Damit du mich auch hörst, wenn du später nach Hause kommst. Die klingelt, wenn ich fertig mit der Arbeit bin.«
Ich lachte und schlang meine Arme um seinen Hals. »Aber du kommst doch viel später als ich«, antwortete ich.
»Aber doch nicht, wenn du im Käfig bist. Du weißt doch, dass sie da ganz spät anfangen«, sagte mein Vater.
»Dad, ich bin doch noch gar nicht so weit.«
»Aber wenn du es bist, dann wird dir das Glockengeläut fehlen. Du mochtest das schon, als du noch ein ganz kleines Baby warst«, neckte er mich und piekte mich in die Rippen.
Normalerweise fing ich an zu kichern, doch dieses Mal tat es richtig weh.
Mit einem Mal wurde das Gesicht meines Vaters ganz ernst. »Pass gut auf dich auf, Harbinger.« Dann, wieder etwas milder: »Sonst muss ich kommen und auf dich aufpassen und das wäre dir sicher sehr unangenehm. Und deinen Lehrern auch.«
Mein Bruder lachte darüber, doch das gutmütige Gesicht meines Vaters sah nicht so aus, als ob er scherzte.
Der nächste Schritt meines Gladiatorenlebens ging einher mit meiner neuen Frisur, die ich ganz fürchterlich fand. Als Novizin wurde einem ein Seitenscheitel gezogen und die dünnere Seite des Haares komplett abgeschnitten. So verlor ich die Hälfte der tollen haselnussbraunen Locken, auf die ich so stolz war, und konnte zudem noch den Wind an meinem Ohr spüren. Der Rest blieb auf der anderen Seite, während die kahle Seite … nun ja … eben kahl blieb.
Nur fertig ausgebildete Gladiatoren mit mindestens zehn Siegen durften sich die Haare schneiden lassen, wie sie es wollten.
Falconetta und ihr Assistent Loire verunstalteten uns aus zwei Gründen. Erstens: Um uns jegliche Eitelkeiten zu nehmen, solange wir noch Novizen waren. Zweitens: Um sich von anderen Schulen abzuheben.
Ihre Schule war bei weitem nicht die einzige Gladiatorenschule auf Odyssey, nur hatte ich das Glück, dass meine Mutter mich genau dort abgeliefert hatte und nicht etwa in einer anderen Kaserne. Denn Falconetta und Loire waren eigentlich noch recht manierlich zu ihren Gladiatoren.
Sie waren hart, aber fair und sie kümmerten sich wirklich um den talentierten Gladiatorennachwuchs. Was meine Trainerin in mir sah, begriff ich damals nicht. Eigentlich hatte ich nicht viel mehr getan als einen Umkleideraum zu ruinieren, aber sie war der festen Überzeugung, dass mich das zu einem guten Gladiator machte.
Am zweiten Tag, nachdem mir Falconetta eigenhändig die traditionelle Frisur ihrer Gladiatorenschule verpasst hatte, reichte sie mir ein Abzeichen, das mich ebenso als Schülerin auswies wie Frisur und Uniform.
Hastings stand darauf. Es war der Name ihrer Schule und sie war stolz darauf. Uns Schülern verbot sie, auch nur irgendwelche ungebührlichen Scherze über die Gladiatura oder den Käfig zu machen. Nicht einmal mit den Mundwinkeln zucken durften wir, sobald vom Handwerk der Gladiatoren die Rede war, obwohl wir eine Menge blöde Scherze über die Gladiatura und die Gladiatoren an sich kannten. Die machte man aber besser nicht, wenn Falconetta in Hörweite war. Wer diese Regel übertrat, konnte sich warm anziehen. Ich habe schon Schüler in vollem Gladiatorenstaat zwanzig Runden in der sengenden Mittagshitze um den Gebäudetrakt laufen sehen.
Spaß verstand die Gladiatorentrainerin schon, nur leider verfügte sie nicht über einen Humor, der mit Sechsjährigen kompatibel war. Sie selbst war eine ehemalige Thraex und hocherfolgreich im Käfig gewesen. 777 Siege hatte sie gefeiert. Eine stattliche Anzahl, die heute wohl kaum jemand erreichen konnte, weil es verboten war, mehr als einmal pro Woche in den Käfig zu steigen. Loire war Essedarius gewesen, der Beachtliches mit seinen Wurfspeeren leisten konnte.
Falconetta teilte mich einer Anfängergruppe von Thraex zu, was im Widerspruch zu dem stand, was sie bei meinem Eintreten in die Schule gesagt hatte. Warum sie das tat, wusste ich nicht, allerdings hatte ich dort genug damit zu tun, mich selbst zu behaupten, also fragte ich nie danach. Irgendetwas wird sie sich wohl dabei gedacht haben. Und ich hatte auch keine Zeit mehr zu fragen, weshalb sie sich zuvor so dagegen gewehrt hatte, mich zu einem Thraex zu machen, denn mein Training schritt unerbittlich voran.
»Der Thraex«, dröhnte die tiefe Stimme meiner Trainerin durch das Atrium, »ist eigentlich der Antiheld der antiken Gladiatura. Er heißt Thraker und ist der Gegner des Guten, des Murmillo, und damit einer der ältesten Gladiatorentypen.« Solche Weisheiten gab sie stets zum Besten, wenn wir übten, aber auch der Theorieunterricht kam nicht zu kurz.
Man lehrte uns eine Menge lateinische Worte, denn die Aufzeichnungen zur Gladiatura waren detailliert vorhanden. Allerdings ausschließlich in Latein. Und da es keine adäquaten Übersetzungsmöglichkeiten für die Fachbegriffe gab, setzt sich die tote Sprache bis heute durch.
Ich lernte, wie man die verschiedenen Gladiatorengattungen unterschied und wie sie hießen. Und das auf die schmerzhafte Tour. Wer die Waffe nicht benennen konnte, bekam damit eine hinter die Ohren. Gladius, Lancea und Marculus gehörten fortan zu meinem festen Vokabular.
Als Thraex besaß ich ein gebogenes Schwert, das wir Sica nannten, und hohe, bis zu den Oberschenkeln reichende Beinschienen. Ein kleines, rechteckiges Schild schützte mich vor den ärgsten Stößen und mein gesteppter Armschutz konnte durchaus einen Schlag mit dem Schwert aushalten. Mein Helm mit einem Greifenkopf vervollständigte das Ensemble.
Hastings besaß sogar Gladiatorenausrüstungen in Kindergröße, denn darauf legte Falconetta Wert. Wer noch nie Kampfgewicht hatte tragen müssen, erlebte bei seinem ersten Kampf im Käfig eine unangenehme Überraschung. Davon war sie fest überzeugt.
Meistens trat der Thraex einem Murmillo gegenüber, der entgegengesetzt bewaffnet war – er trug das Gladius, ein langes, traditionelles Schwert, und einen viel größeren Schild, doch dafür keine so hohen Beinschienen, sondern nur welche, die bis zu den Knien reichten. Die Manica, eine Schiene aus Leder und Leinen, trug er allerdings auch, sodass seine Schwerthand geschützt blieb.
Diese Unterschiede sorgten dafür, dass die Gladiatura fair war und spannende Kämpfe geboten wurden, obwohl niemand dabei ums Leben kommen sollte, was aber nicht hieß, dass die Kämpfe unblutig oder ungefährlich waren.
Wie ich nach einiger Zeit erfuhr, trug Falconetta ihre Brille nicht zum Spaß. Sie hatte ein Auge verloren, aber keine Lust, eine Augenklappe zu tragen. Das war eine übliche Gladiatorenverletzung, denn das Visier eines Gladiatorenhelms hält nicht ewig stand und worauf zielten gegnerische Gladiatoren automatisch? Auf den Kopf! Wir mussten uns diese Verletzungen ansehen, auch aus der Nähe, denn nur so entkam man dem Schicksal, dasselbe zu erleiden. Dies behauptete zumindest Falconetta.
So verbrachte ich nun meine Vormittage nach dem Aufwärmen im Sand des Atriums und übte mich mit Holzschwertern und Holzschilden gegen meine viel älteren Mitschüler. Nach den Kampfübungen war Sport an der Reihe und das war verdammt anstrengend, wenn man schon den ganzen Morgen mit einem Schwert herumgefuchtelt hatte. Anschließend durften wir uns waschen und etwas essen. Danach konnten wir uns ein wenig ausruhen und am Nachmittag widmeten wir uns der Theorie.
Die ersten paar Wochen hatte ich eine Menge Mühe damit, nach dem Essen wach zu bleiben. Meine Muskeln und Gelenke schmerzten und mein Körper schrie nach Schlaf. Trotzdem zwang ich mich, die Augen offen zu halten, weil ich mir nicht ausmalen wollte, was Falconetta mit mir anstellte, wenn ich den Unterricht verschlief.
Viel zu lachen hatten wir während unserer Ausbildung nicht. Vor allem ich nicht, denn die Gruppe, mit der ich lernte, war ausgesprochen gemein zu mir. Nicht nur, weil ich die Kleinste war, sondern auch, weil sich alle um einen Jungen geschart hatten und ihn regelrecht anbeteten. Tamarando hieß er und war schon zehn Jahre alt, was einem in meinem Alter wie ein riesiger Altersunterschied vorkommt.
Tamarando tat alles dafür, dass ich mich in meiner Gruppe unwohl fühlte. Zuerst hatte er mich nur kritisch beäugt, aber das sollte sich ändern. Vielleicht zwei Monate nach meinem Eintritt in die Schule baute er sich während des Trainings vor mir auf.
»Was willst du hier, Baby?«, fragte er mich.
»Dasselbe wie du«, gab ich trotzig zurück. Schließlich war mir schon aufgefallen, dass er dafür sorgte, dass die anderen nichts mit mir zu tun haben wollten.
»Merke ich nichts von«, entgegnete er höhnisch. »Du lässt dich von Saratoga abschlachten.«
Saratoga war das Mädchen, mit dem ich gerade übte, und sie war gut. Aber kein Wunder, sie war auch schon elf! Elf! Sogar älter als er. Noch zwei Jahre und sie durfte in den Käfig.
»Du hast doch vorgestern auch gegen sie verloren«, entgegnete ich. Stimmte auch, er hatte verloren … und wie! Ich hätte schwören können, dass er kurz vor vorm Heulen gewesen war. Und das als Junge!
Sein sonst so braungebranntes Gesicht lief rosa an, was ihn mit seinen blonden Haaren wie ein Schweinchen aussehen ließ. Kurz dachte ich, dass er auf mich losgehen wollte, doch dann trat sein Übungspartner neben ihn und reichte ihm das Holzschwert.
»Lass uns weitermachen«, sagte der andere Junge mit den großen, grünen Augen und den langen, braunen Locken. Auf den ersten Blick sah er mir sogar irgendwie ähnlich, vor allem, weil wir alle dieselbe Frisur hatten. Crimson hieß er und war in Tamarandos Jahrgang.
Saratoga, die die Unterbrechung nicht guthieß, zerrte mich am Arm zurück auf meine Position. »Weiter, sonst kriegen wir Ärger«, sagte sie ruppig.
Mehr Schüler gab es in unserer Gruppe nicht. Falconetta war bekannt dafür, nie mehr als eine Handvoll Thraex auszubilden. Allerdings konnte man generell auch nicht so viele aktive Gladiatoren betreuen, zumal die wirklich wichtigen Aufgaben auf Odyssey liegenbleiben würden, wenn man jeden zum Gladiator machte.
Eigentlich war ich wirklich privilegiert, denn ich genoss den Luxus einer Gratismahlzeit am Tag, hatte ein geregeltes Leben und bekam sogar einen recht hohen Lohn. Ich hatte die Chance auf Berühmtheit und noch mehr Geld. Ich hätte also eine strahlende Zukunft vor mir gehabt.
Zwei Jahre später
Mein Bruder hatte bereits Anfang des Jahres seinen Namen erhalten. Man hatte ihn Savage getauft, was nichts anderes hieß als »Der Wilde«. Im negativen Sinne. Auch sein Werdegang hatte meinen Eltern einiges an Kopfzerbrechen bereitet. Savage war zum Schmied bestimmt worden.
Schmiede sind zwar angesehene Leute, doch die giftigen Dämpfe, die sie einatmen, sind auch nicht besser als die Belastung eines Tauchers. Die Materialien waren niemals sauber und das verkürzte ihre Lebenserwartung immens. Natürlich nicht bei allen, doch es war mehr als nur ein Gerücht, dass die Schmiede selten lange lebten. Außerdem war die Arbeit verdammt hart.
Doch all die geheimen Vorwürfe meiner Eltern an die Behörde nützten nichts, denn einen Tag, nachdem Savage seinen Namen erhalten hatte, ging er zum hiesigen Schmied in die Lehre. Der fertigte Bauteile für Motoren an. Bald hing Savage der ungesunde Husten an, wie der Ruß seinen Kleidern und seiner Haut.
An einem Sonntag, ich weiß es noch ganz genau, denn sonntags war mein einziger freier Tag, saß ich mit ihm auf der kleinen Veranda und starrte in die Wolken, die sich düster zusammenballten und ein Gewitter verkündeten.
Apha hatte sich zu uns gesellt, denn sie ging erst abends wieder auf Tauchstation und hasste es inbrünstig, dass sie mittlerweile von allem ausgeschlossen wurde, da wir Kinder gerade zu diesem Zeitpunkt zusammenhingen.
Wir überlegten gerade, was wir mit unseren vier Muscheln anstellen sollten, als beinahe alle Geräusche auf der Straße verstummten. Zuerst fiel uns das nicht auf, bis Savage uns darauf aufmerksam machte.
»Was ist denn da los?«, fragte Apha und hielt sich eine Hand über die Augen, um besser sehen zu können.
Die Straße, die zu unserem Haus führte, schlängelte sich in der anderen Richtung einen Hügel hinauf, der mit rostigen Hütten gesäumt war. Dort oben gab es eine Farm für Mais, die irgendein findiger Bauer hochgezogen hatte. Wie er das geschafft hatte, wusste keiner, denn die Pflanzen wuchsen in einem merkwürdigen Algengemisch.
Vom Hügel her hörten wir laute Stimmen. Es klang nach einem hitzigen Streit.
»Bing«, sagte mein Bruder, der mich immer noch so nannte. »Was war das?«
»Weiß nicht. Vielleicht hat der Farmer mal wieder Ärger mit seinen Gesellen. Da sind doch zwei Jungs in die Lehre geschickt worden. Du weißt doch, was das für ein Spinner ist«, antwortete ich desinteressiert. Der Farmer war ein bekannter Choleriker, der sich nicht scheute, seine Lehrlinge in der Öffentlichkeit zu schlagen.
Gelangweilt spielte ich an der Kette, die mein Vater mir geschenkt hatte, und ließ die Glocke klingeln.
»Das ist nicht so wie sonst«, beharrte mein kleiner Bruder. »Er hat Recht! Hörst du das nicht?«, fragte Apha und hielt meine Hand fest.
Eisenharter Gleichschritt klang über die Metallplatten, mit denen man die Straße zusammengezimmert hatte, zu uns herüber.
Ein paar Männer erschienen am Hügelkamm und trabten im Stechschritt die Straße hinunter. Gegenüber wurden ein paar Fensterläden zugeschlagen.
An der Spitze der kleinen Truppe erkannte ich, als sie näher kamen, einen Mann. Er hatte graue Haare und ein helles, stechendes Auge, das mich unwillkürlich an Falconetta denken ließ. Das andere Auge wurde von einer glänzenden Augenklappe aus Lack verborgen. Der Mann gehörte zur Behörde und war ein Sieger. Das sah man an den vielen Abzeichen, die er an seiner Uniform drapiert hatte. Ich hatte auf Fotografien in der Stadtbibliothek von Soyuz schon Militärfotos aus früheren Zeiten gesehen. Der Mann sah so ähnlich aus, nur dass seine Uniform komplett schwarz statt grau war und dadurch gleich furchteinflößender wirkte.
Riesige Tierschädel zierten seine Schultern. Einige davon waren direkt am Stoff befestigt, die anderen baumelten an langen Eisenketten davon herab. Auch seine Schirmmütze war mit Knochen bestückt. Ein metallener Totenkopf prangte in der Mitte.
Er hieß seinem Trupp, stehenzubleiben, und kam nun alleine zur Veranda. Apha war an mich herangerückt und mein Bruder saß stocksteif da, als erwarteten sie beide von mir, dass ich mit diesem Mann sprach. Ich? Im Leben nicht!
»Ist deine Mutter zu Hause, Kleines? Oder dein Vater?« Er lächelte zwar, aber es erreichte seine Augen oder vielmehr sein eines Auge nicht. Trotz seiner imposanten Insignien sah er gar nicht so alt aus. Ich schätzte ihn auf Mitte zwanzig, da er noch keine Falten hatte. Merkwürdig war jedoch, dass seine Haare bereits ergrauten, soweit ich das trotz seiner Schirmmütze beurteilen konnte.
»Nein«, antwortete ich mutig. »Die sind ausgegangen.«
Er lächelte abermals. »Dein Vater ist Schrotthändler, oder?«
Mein Bruder nickte an meiner Stelle.
Ich war vorübergehend zu Stein erstarrt. Klasse … wenn ich mich so im Käfig benahm, fehlte mir schneller ein Arm oder ein Bein, als ich Piep sagen konnte.
»Kommen sie heute noch wieder?«, erkundigte sich der Mann freundlich. Zumindest so freundlich, wie man sein konnte, wenn man nicht mal richtig lächelte.
»Weiß ich nicht«, sagte ich, obwohl ich genau wusste, dass meine Eltern niemals über Nacht wegblieben.
Der Mann sah mich durchdringend an und reichte mir eine Karte. Dann kam ihm wohl die Erkenntnis, dass ich überhaupt nicht lesen konnte.
»Darauf steht mein Name. Ich bin Centurio Crawford. Kannst du dir das merken, mein Kind?« Odyssey hatte nicht nur das Gladiatorensystem des Römischen Reichs übernommen, sondern auch seine Centurios. Das wusste ich inzwischen dank Falconettas Unterricht.
Ich musterte ihn noch einmal. Sein glattes Gesicht, das graue Haar, der stechende Blick. Also sagte ich erst nur: »Ja.« Dann aber: »Warum soll ich das meinen Eltern geben?«
Das Lächeln wurde eine Spur breiter, bevor es ganz erlosch. Das hatte ich bei Falconetta schon beobachtet, die so aussah, kurz bevor sie mir eine Ohrfeige verpasste.
»Weißt du …«, begann er, schien einen Moment zu überlegen und lächelte dann wieder. »Gib sie deiner Mutter. Vielleicht möchte sie ja eines Tages mit mir reden. Ganz unverbindlich natürlich.«
Ich hatte keine Ahnung, wovon der Mann sprach. Warum sollte meine Mutter mit ihm sprechen wollen? Kannte sie diesen schrecklichen Centurio etwa?
»Nicht vergessen, ja?«, schärfte er mir ein.
Ich nickte nur und stopfte die Karte in meine Umhängetasche, die auch meinen Ausweis sichtbar für jedermann präsentierte. Der Blick des unheimlichen Mannes wanderte zu der Schrift mit den goldenen Buchstaben.
»Gladiator, eh?«, machte er. Knirschte er gerade mit den Zähnen?
Abrupt gab er seinen Männern ein Handzeichen und wandte sich zum Gehen. Wir wagten erst wieder durchzuatmen, als wir seine Uniform nur noch aus der Ferne sehen konnten.
»Was war das denn für einer?« Apha hatte als erste die Sprache wiedergefunden.
»Bestimmt einer von der Odyssey Defence Force. So ein ganz wichtiger«, sagte mein Bruder. Manchmal erstaunte es mich, was er alles so wusste. »Der Schmied spricht ständig über sie und das nicht gerade nett.«
»Ist das nicht riskant?«, fragte ich erstaunt.
»Blödsinn. Bei dem Lärm, der in der Schmiede herrscht, versteht man doch kaum etwas. Leute auf der Straße können gar nicht hören, was da gesprochen wird.«
»Aber so einer war doch noch nie hier«, warf Apha ein und brachte uns so zum eigentlichen Thema zurück.
»Sie wollen jetzt verstärkt wieder auf Patrouille gehen«, klärte mein Bruder uns auf.
Solche Dinge bekam ich in meiner Gladiatorenschule nicht mit. Wir sprachen nie über das, was außerhalb geschah. Ich wusste im besten Fall, wie die Matches im Käfig am vorhergehenden Abend ausgegangen waren.
»Warum?«, fragte ich nach.
»Da gab es irgendeinen Vorfall am Markt. Vorgestern. Mehr weiß ich doch auch nicht«, murmelte Savage. »Die Frau vom Schmied hat drüber geredet. Aber nur ganz kurz. Hab nur was von Markt und Bewaffneten mitbekommen, dann hat sie mich weggescheucht, weil sie mich beim Lauschen erwischt hat. Kann ich doch nichts für.« Er zuckte mit den Schultern.
»Nein, kannst du auch nicht«, erwiderte ich und strich ihm über den blonden Schopf.
Allerdings nahm ich mir vor, dieser Sache auf den Grund zu gehen. Denn ich hatte das Gefühl, wenn ich meiner Mutter die Karte gab, dann würde etwas Unwiderrufliches seinen Lauf nehmen. Und daher entschied ich mich, dass es klüger wäre, damit zu warten.
Herauszufinden, was auf dem Markt geschehen war, stellte sich als ganz schön schwer heraus, wenn sowieso niemand mit einem sprach. Tamarando hatte dafür gesorgt, dass nicht nur in unserer Gruppe, sondern auch bei den Murmillos und den Essedarii keiner mehr mit mir sprach.
Ich war unendlich dankbar, als sich Crimson beim Mittagessen plötzlich neben mich setzte und dann noch Saratoga ihren Teller neben meinen stellte. Prompt schmeckte mir auch das pappige Maisbrot viel besser.
»Du kommst direkt vom Meer, oder?«, fragte mich Saratoga, die in ein paar Wochen das erste Mal im Käfig antreten durfte.
»Ja«, antwortete ich unsicher. Ich war überhaupt nicht daran gewöhnt, während der Mahlzeiten zu sprechen, sodass ich mich kaum traute, etwas zu sagen.
»Da ist die Luft viel besser, oder?«, hakte sie nach.
Ich nickte.
Saratoga war ein großes, schlankes Mädchen, deren bronzefarbene Haut einen starken Kontrast zu ihren blonden Haaren bildete. Die vielen Knochenanhänger, Fetische, verrieten sie als Anhängerin des Voodoo, der größten Religionsgruppe auf Odyssey. Ich hatte keine Ahnung, warum sie sich plötzlich nach über zwei Jahren für mich interessierte.
»Du sitzt hier immer allein?«, fragte Crimson, als hätte er das nicht mitbekommen.
»Ja«, steuerte ich einsilbig zum Gespräch bei. So was Blödes … jetzt hielten sie mich bestimmt für doof.
»Gib nichts darauf, was Tamarando tut«, versuchte mich Saratoga aufzumuntern. »Der kriegt sein Fett noch früh genug weg. Dann, wenn er im Käfig um Gnade winseln muss. Ich habe noch nie einen schlechteren Thraex gesehen.« Sie zuckte mit den Schultern und schob ihren Stuhl ein Stück zurück.
»Meinst du? Ich war ja noch nicht im Käfig. Vielleicht bin ich schlechter.« Ich war acht Jahre alt und ich versuchte nicht, ihr Komplimente zu entlocken. Damals besaß ich noch eine erschreckende Ehrlichkeit und wenn ich so etwas sagte, dann meinte ich das auch. Ich hielt mich für verdammt schlecht. Tamarando hatte mich schon ein paar Mal besiegt. Beim wöchentlichen Schaukampf, wo wir vor der versammelten Schule gegeneinander antraten, hatte ich keine Chance gegen ihn gehabt. Dass das auch daran lag, dass ich eben erst acht Jahre alt war, darauf kam ich damals nicht.
»Quatsch«, meinte Crimson. »Du bist gar nicht so schlecht, nur sehr klein für einen Thraex.«
Das stimmte, ich war kaum gewachsen in den letzten zwei Jahren. Da kam ich ganz nach meiner Mutter, die nicht größer als 1,60m war.
»Wenn du willst, zeig ich dir ein paar Tricks«, sagte Saratoga. »Sind nur ein paar Kleinigkeiten, aber die helfen wirklich.«
Saratoga kam mir schon so erwachsen vor, obwohl sie auch erst dreizehn Jahre alt war. Aber mit dreizehn war man auf Odyssey ja beinahe schon volljährig.
»Das wäre nett«, entgegnete ich und lächelte schüchtern zu ihr auf.
Dabei war ich nur in ungewohnter Umgebung so zurückhaltend. Bei uns auf der Straße hatte ich eine große Klappe, die mich ständig in Schwierigkeiten brachte. Feigling konnte man auch dazu sagen. Oder Großmaul.
»Das können wir auf dem Heimweg machen«, plauderte Saratoga munter weiter. »Die Hälfte des Weges kann ich mit dir gehen. Ist nur ein kleiner Umweg.«
»Wo wohnst du denn?«, fragte ich, um nicht völlig unhöflich zu wirken.
»Da, wo sie Obst ziehen. Bei den Gewächshäusern. Du kennst es bestimmt. Das Glas flimmert richtig in der Sonne. Mein Vater ist Obstbauer.«
»Ja, das kenne ich«, erwiderte ich. »Das muss toll sein!« Die Gewächshäuser waren für mich regelrechte Tempel, denn sie waren groß und hoch und besaßen eine eigene Wasseranlage. Ich hatte immer angenommen, dass die Obstbauern wohlhabende Leute waren, aber Saratoga wirkte ganz normal. Naja, so normal man eben war, wenn man den ganzen Tag nichts anderes lernte, als anderen Leuten die Rübe einzuschlagen.
»Was sind deine Eltern?«, fragte mich Crimson.
»Mein Vater ist Schrotthändler.«
Mitleidiges Schweigen.
»Meine Mutter ist Bäckerin«, versuchte ich es erneut. Das Gespräch verebbte trotzdem, als wäre keinem von ihnen wirklich wohl, mit mir im Gespräch gesehen zu werden. Um die Stille zu überbrücken, fragte ich Crimson nach seinen Eltern.
»Mein Vater ist Bibliothekar.«
»Was, echt? Das ist ja toll!«, rief ich aus, nur um mich gleich für meinen Ausbruch zu schämen, als um uns herum die meisten Schüler verstummten und mich komisch ansahen.
»Möchtest du mal mitkommen? Sonntags, meine ich«, fragte er.
»Also … ja, schon …« Das wurde jetzt unangenehm. »Ich kann nicht lesen.«
Saratoga grinste. »Kann ich auch nicht. Na und?«
Für den Kommentar war ich wirklich sehr dankbar, denn ich kam mir deswegen schrecklich ungebildet vor. Mein Vater und meine Mutter konnten beide lesen. Mein Vater hatte es von seinem gelernt und er hatte es wiederrum meiner Mutter beigebracht. Sie hatten aber nie Anstalten gemacht, es mich zu lehren.
»Trotzdem kann man da viel sehen. In vielen Büchern gibt es auch Bilder«, bekräftigte Crimson sein Angebot. »Ich kann auch nicht wirklich lesen. Nur so ein paar Worte. Dad hat’s mir nie anständig zeigen können, weil ich dafür noch zu klein war. Und wenn ich jetzt nach Hause komme, habe ich auch keine Lust mehr dazu.« Er grinste schief. »Ein ziemliches Dilemma.«
»Braucht eh keiner«, behauptete Saratoga. »Jedenfalls kein Gladiator. Was gibt’s da groß zu lesen?«
Darüber musste ich kichern, was allerdings Falconetta auf den Plan rief.
Ihre Wangen glühten regelrecht vor Ärger und sie funkelte uns wütend an.
»Was gibt’s hier zu kichern?«
Sie hasste es, wenn wir nicht den nötigen Ernst zeigten.
»Wir haben nur darüber gelacht, dass wir nicht lesen können«, klärte Crimson sie auf.