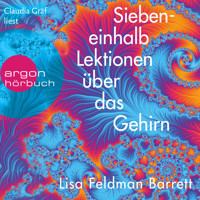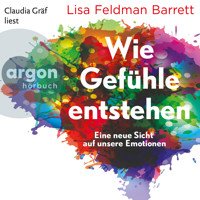9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Die Freude, Freund:innen wiederzusehen, die Angst, einen geliebten Menschen zu verlieren – unsere Empfindungen scheinen automatisch in uns aufzutauchen, sich in unserem Gesicht und in unserem Verhalten auszudrücken und unabhängig von unserem Willen einfach zu «geschehen». Dieses Verständnis von Emotionen gibt es bereits seit Platon. Was aber, wenn es falsch ist? Die renommierte Psychologin und Neurowissenschaftlerin Lisa Feldman Barrett zeigt auf der Grundlage neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse, dass unsere Vorstellungen von Emotionen auf dramatische Weise veraltet sind – und dass wir den Preis dafür zahlen. Feldman Barrett behauptet: Emotionen sind nicht universell in unseren Gehirnen und Körpern vorprogrammiert; vielmehr sind sie psychologische Erfahrungen, die jeder von uns auf der Grundlage seiner einzigartigen persönlichen Geschichte, Physiologie und Umwelt konstruiert. Diese neue Sichtweise hat zentrale Folgen: Denn wir haben größeren Einfluss auf die Entstehung, Art und Intensität unserer Gefühle, als wir denken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 859
Ähnliche
Lisa Feldman Barrett
Wie Gefühle entstehen
Eine neue Sicht auf unsere Emotionen
Über dieses Buch
Was wäre, wenn alles, was Sie über Lust, Wut, Trauer und Freude zu wissen glauben, falsch ist?
Wir werden von unseren Gefühlen «übermannt», wir sind ihnen «ausgeliefert», sie «überkommen» uns, wir werden von ihnen «hinweggeschwemmt» – bereits die Art, wie wir über Gefühle sprechen, legt nahe, dass wir sie für etwas halten, das unabhängig von uns und unserem Verstand existiert.
Doch sind unsere Gefühle wie Liebe, Freude, Trauer und Angst wirklich universell, laufen sie automatisiert, ohne unser Zutun, ab? Lisa Feldman Barrett sagt: nein! Unser Gehirn konstruiert unsere Gefühle. Dass wir fühlen können, ist angelegt, aber wie wir fühlen, ist überwiegend erlernt und hängt von unseren Erfahrungen und unserem Umfeld ab. Eine gute Nachricht, denn sie bedeutet, dass wir einen viel größeren Einfluss auf unser Gefühlsleben haben, als wir bisher dachten – und das hat weitreichende Folgen für unseren Alltag, unsere Beziehungen, unsere Gesundheit und selbst unser Rechtssystem.
«Eine faszinierende Reise in die Welt unserer Emotionen, die unsere bisherigen Annahmen auf den Kopf stellt. Unbedingt empfehlenswert!» Leon Windscheid
«Was Lisa Feldman Barrett über unsere Wahrnehmungen und Emotionen zu sagen hat, ist atemberaubend.» Elle
Vita
Lisa Feldman Barrett (Jahrgang 1963) ist Professorin für Psychologie an der Northeastern University und lehrt außerdem an der Harvard Medical School und am Massachusetts General Hospital in den Bereichen Psychiatrie und Radiologie. Gemeinsam mit dem Stanford-Professor und Psychologen James Gross gründete sie die Society for Affective Science, die sich der Förderung der Grundlagen- und angewandten Forschung zum Thema Emotionen und Affekt widmet. Darüber hinaus ist sie Mitbegründerin und Chefredakteurin der Zeitschrift Emotion Review. Lisa Feldman Barrett lebt in Boston. Ihr Buch «Siebeneinhalb Lektionen über das Gehirn» erschien 2023 bei rororo.
Elisabeth Liebl übersetzt aus dem Französischen, Englischen und Italienischen. U.a. übertrug sie Malala Yousafzai, Amaryllis Fox, Tiziano Terzani und Bob Woodward ins Deutsche.
Impressum
Die englische Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel «How Emotions Are Made» bei Houghton Mifflin Harcourt, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juli 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«How Emotions Are Made» Copyright © 2017 by Lisa Feldman Barrett, Illustrations by Aaron Scott
Redaktion Friederike Moldenhauer, Hamburg
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Covergestaltung zero-media.net, München,
nach dem Original von Pan Macmillan, UK
Coverabbildung Shutterstock
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-644-01548-7
www.rowohlt.de
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Vorwort von Leon Windscheid
Einführung: eine 2000 Jahre alte Hypothese
1 Die Suche nach dem «Fingerabdruck» der Gefühle
2 Emotionen sind konstruiert
3 Der Mythos der universellen Emotion
4 Der Ursprung der Gefühle
5 Konzepte, Ziele und Worte
6 Wie das Gehirn Gefühle macht
7 Emotionen als soziale Realität
8 Ein neues Menschenbild
9 Wie Sie mit Ihren Emotionen umgehen können
10 Emotionen und Krankheiten
11 Emotionen vor dem Gesetz
12 Ist ein knurrender Hund wütend?
13 Vom Gehirn zum Geist: neue Grenzgebiete
Anhang A: Grundlegendes über das Gehirn
Anhang B: Ergänzung zu Kapitel 2
Anhang C: Ergänzung zu Kapitel 3
Anhang D: Belege für die Konzeptkaskade
Danksagung
Stichwortverzeichnis
Bibliografie
Bildnachweis
Für Sophia
Vorwort von Leon Windscheid
Als der Termin endlich feststand, spürte ich das angenehme Kribbeln der Vorfreude, das immer dann in mir aufsteigt, wenn ich einen Star interviewe. In diesem Fall war es besonders schwer gewesen, an einen Termin zu kommen: Beyoncé ist schließlich nicht irgendwer, sondern eine Frau von Weltruhm. Doch dann war der Tag endlich da. Wegen der Pandemie konnten wir uns nur via Zoom sehen, aber immerhin. Den Moment, in dem ich den Laptop aufklappte und in ihre klugen, wachen Augen sah, werde ich nicht vergessen. Die Vorfreude war längst einer treibenden Aufregung gewichen, die meine Zunge schneller galoppieren ließ, als meine Englischkenntnisse es erlauben, und so verhaspelte ich mich bei den ersten Fragen, wurde rot und röter. Aber ihre Antworten waren so unglaublich spannend, dass ich das Gefühl bekam, ihre Weisheit durch die Glasfaserkabel auf dem Grund des Atlantiks direkt in meinen Kopf zu saugen.
So klingt es ungefähr, wenn ich bei meinen Bühnenauftritten dem Publikum von meinem Gespräch mit Lisa Feldman Barrett erzähle. «Stellt euch vor, ihr wärt Musikfans. Und dann schreibt ihr Beyoncé, fragt nach einem Interview, und sie sagt zu. Lisa Feldman Barrett ist für mich das, was für Musikfans Beyoncé ist.» Am Anfang dachte ich, die Menschen könnten enttäuscht sein, dass ich nicht tatsächlich mit Beyoncé gesprochen habe. Doch meine Begeisterung für Lisa Feldman Barretts Forschung steckt das Publikum an.
Das beruhigt mich ein wenig. In einer Zeit, in der es «alternative Fakten» geben soll, in der Menschen an Verschwörungstheorien glauben und sich unter Aluhüten in Rage schwurbeln, braucht die Welt die Wissenschaft mehr denn je. Lisa Feldman Barrett gehört weltweit zu den meistzitierten Forschenden und steht auf den Listen der einflussreichsten Psychologinnen und Psychologen ganz oben. Ihre Arbeit liefert so wertvolle Erkenntnisse, dass sie aus meiner Sicht so viel Ruhm und Anerkennung bekommen sollte wie Beyoncé.
Lange Zeit war es gängige Überzeugung, dass Gefühle als Reaktion auf äußere Erlebnisse entstehen, dass wir ihnen ausgeliefert sind und sie uns komplett mitreißen können. Erst durch die Lektüre dieses Buches – und auch der «Siebeneinhalb Lektionen über das Gehirn» von Lisa Feldman Barrett – wurde mir klar, dass die neueste Forschung ganz andere Erkenntnisse gesammelt hat und wir viel mehr Kontrolle über unsere Gefühle haben, als wir denken.
Unser Gehirn erschafft unsere Emotionen, um uns zu helfen, mit unserer Umgebung und ihren Herausforderungen umzugehen. Lisa Feldman Barrett zeigt, dass dieser Prozess auf Erfahrungen basiert, auf unserer jeweiligen eigenen Geschichte. Das wirft unglaublich spannende Fragen auf. Wenn unser Gehirn unsere Emotionen konstruiert, welche Möglichkeiten haben wir dann, in diesen Prozess einzugreifen, sodass wir weniger ängstlich oder weniger wütend sein können? Und welche Konsequenzen hat eine solche neue Vorstellung auf unsere Gesellschaft, auf die Justiz oder medizinische Diagnosen? Lisa Feldman Barretts Forschung stellt die eigenen Vorstellungen gehörig auf den Kopf: Und was könnte es Besseres geben?
Ich hatte Lisa Feldman Barretts Bücher auf Englisch gelesen und stellte irgendwann erstaunt fest, dass es noch gar keine deutsche Ausgabe gab. Ich rief sofort meinen Verlag, Rowohlt, an und wies auf die Bücher hin. Rowohlt machte sich gleich an die Übersetzung, und ich freue mich, dass nun auch eine große Leserschaft in Deutschland meinen persönlichen Superstar entdecken kann.
Voilà, willkommen an der Pforte zum spannendsten Ort in diesem Universum: unserem Gehirn.
Einführung: eine 2000 Jahre alte Hypothese[1]
Am 14. Dezember 2012 fand an der Sandy Hook Elementary School in Newton, Connecticut, der tödlichste Amoklauf an einer US-amerikanischen Schule statt. Ein einzelner Schütze tötete 26 Menschen, 20 von ihnen noch Kinder. Einige Wochen nach diesem schrecklichen Vorfall saß ich vor dem Fernseher, als Dannel Malloy, der Gouverneur von Connecticut, seine Rede zur Lage des Bundesstaates hielt. Während der ersten drei Minuten, als er den Menschen für ihr Engagement dankte, sprach er mit lauter, lebhafter Stimme. Dann brachte er die Rede auf die Tragödie in Newton:
Hinter uns allen liegt ein schwerer, dunkler Moment. Was in Newton geschah, ist nichts, was wir in Connecticuts schönen Städten je für möglich gehalten hätten. Und doch zeigte sich an diesem schwärzesten Tag in unserer Geschichte auch das Beste in uns. Lehrer und eine Schulpsychologin gaben ihr Leben, um die Schüler zu schützen.[2]
Bei diesen letzten Worten konnte man hören, wie die Stimme des Gouverneurs leicht zitterte, was vermutlich allen entging, die nicht aufmerksam zuhörten. Mich aber erschütterte dieses kaum merkliche Beben. Mein Magen zog sich zusammen, die Tränen flossen. Die Kamera schwenkte ins Publikum. Auch dort waren einige Zuschauer in Schluchzen ausgebrochen. Gouverneur Malloy hielt kurz inne und sah zu Boden.
Emotionen, wie ich und der Gouverneur sie zeigten, scheint etwas Urtümliches auszuzeichnen: ein uns angeborenes Verhalten, das sich reflexhaft einstellt und auf andere Menschen übergreift. Wird eine emotionale Reaktion ausgelöst, läuft sie vermutlich bei allen mehr oder weniger auf die gleiche Weise ab. Ich litt ebenso wie der Gouverneur oder die Menschen, die ihm zuhörten.
Auf diese Weise betrachtet die Menschheit Trauer und andere Gefühle seit 2000 Jahren. Andererseits: Wenn die Menschheit in den Jahrhunderten wissenschaftlicher Entdeckungen eines gelernt hat, dann, dass die Dinge nicht immer so sind, wie sie scheinen.
Die althergebrachte Geschichte der Emotionen besagt: Wir alle haben Gefühle, die uns vom ersten Atemzug an begleiten. Es handelt sich dabei um klar abgegrenzte innere Phänomene, die unserer Erkenntnis zugänglich sind. Sobald etwas in der Außenwelt passiert, ob nun ein Schuss fällt oder flirtende Blicke ausgetauscht werden, so melden sich auch schon unsere Emotionen schnell und automatisch, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Und unser Gesichtsausdruck spiegelt diese Gefühle mit einem Lächeln, Stirnrunzeln, finsteren Blicken und anderen, klar dekodierbaren Zeichen. Unsere Stimme lässt unsere Gefühlslage erkennen, wenn wir lachen, schreien oder weinen. Unsere Körperhaltung verrät unsere Emotionen mit jeder Geste, jeder hängenden Schulter.
Auch die moderne Wissenschaft erzählt eine Geschichte, die zu dieser Sicht der Dinge passt. Ich nenne sie die klassische Auffassung der Emotionen. Die Geschichte besagt Folgendes: Das leise Zittern in Gouverneur Malloys Stimme löste, beginnend in meinem Gehirn, eine Kettenreaktion aus. Eine Reihe von Neuronen – nennen wir das Ganze der Einfachheit halber den «Trauer-Schaltkreis» – wurde aktiv und bewirkte, dass sich mein Gesicht und mein Körper auf eine bestimmte, spezifische Weise verhielten. Meine Stirn runzelte sich, ich kniff die Brauen zusammen, meine Schultern sackten zusammen, ich fing an zu weinen. Dieser angebliche Schaltkreis löste noch weitere körperliche Reaktionen aus: Meine Herz- und Atemfrequenz beschleunigten sich. Meine Schweißdrüsen traten in Aktion. Meine Blutgefäße zogen sich zusammen.[3] Die Gesamtheit dieser Bewegungen in und an meinem Körper ist, so wird angenommen, ein «Fingerabdruck», der für die Trauer einzigartig ist. So wie Ihr Fingerabdruck etwas Einmaliges ist.
Die klassische Auffassung von den Emotionen geht davon aus, dass wir viele solcher Emotions-Schaltkreise im Gehirn haben. Jeder dieser Schaltkreise soll eine ganz bestimmte Art von Veränderung verursachen, seinen typischen Fingerabdruck. Ein nerviger Kollege also triggert Ihre «Wutneuronen»: Ihr Blutdruck steigt. Sie schauen finster, brüllen, und Ihnen wird heiß. Eine beunruhigende Geschichte in den Nachrichten aktiviert die «Angstneuronen»: Ihr Herz fängt an zu rasen, Sie erstarren, und Panik überkommt Sie. Da wir Wut, Glück, Überraschung und andere Gefühle als eindeutig benennbare Zustände wahrnehmen, scheint es nur vernünftig anzunehmen, dass jeder Emotion ein ebenso klar definiertes Aktivitätsmuster in Gehirn und Körper entspricht.
Die klassische Auffassung betrachtet unsere Emotionen als Artefakte der Evolution, die vor langer Zeit dazu beigetragen haben zu überleben und nun ein festes Element unserer biologischen Natur geworden sind. Insofern sind Emotionen universell: Menschen jeden Alters, jeder Kultur und in jedem Teil der Welt erleben Trauer mehr oder weniger so, wie Sie das tun – und mehr oder weniger so, wie es unsere hominiden Verwandten taten, als sie vor einer Million Jahre die afrikanische Steppe durchwanderten. Ich sage «mehr oder weniger», weil niemand ernsthaft annimmt, dass sich Gesichter, Körper und Gehirne exakt gleich verhalten, wenn ein Mensch traurig ist. Auch Ihre Herz- und Atemfrequenz, Ihr Blutdruck reagieren nicht jedes Mal gleich. Vielleicht runzelt sich Ihre Braue ja mehr oder weniger stark, abhängig von Zufall oder Gewohnheit.[4]
Emotionen sollen also eine Art brachialer Reflex sein, der häufig im Gegensatz zu unseren rationalen Überlegungen steht. Der primitive Teil Ihres Gehirns möchte Ihrem Boss entgegenschleudern, dass er ein Volltrottel ist, aber Ihre überlegte Seite weiß, dass Sie dann vermutlich gefeuert werden, also halten Sie sich zurück. Dieser innere Kampf zwischen Emotion und Vernunft, der angeblich unser Menschsein ausmacht, ist eines der großen Narrative der westlichen Zivilisation. Ohne die Ratio wären Sie nur ein emotionales Tier.
Diese Sicht der Dinge hat sich in verschiedener Form über Jahrtausende gehalten. Platon glaubte eine Version, ebenso wie Hippokrates, Aristoteles, Buddha, René Descartes, Sigmund Freud und Charles Darwin. Auch heute beschreiben berühmte Denker wie Steven Pinker, Paul Ekman und der Dalai Lama Gefühle auf der Grundlage dieser klassischen Sicht. Wir finden sie in nahezu jeder Einführung in die Psychologie wieder, die Studierende an der Uni lesen, sowie in den meisten Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln über Emotionen. In jedem Klassenzimmer an Amerikas Grundschulen hängen Poster, die die universelle emotionale Sprache des Gesichts darstellen: Lächeln, Zornesfalte und Schmollmund. Facebook hat mehrere Emoticons designen lassen, die sich auf Darwins Schriften stützen.[5]
Die klassische Auffassung der Emotionen durchzieht auch unsere gesamte Kultur. Fernsehserien wie Lie to Me und Daredevil beruhen auf der Annahme, dass sich unsere innersten Gefühle auf unsere Herzfrequenz und unseren Gesichtsausdruck niederschlagen. Die Sesamstraße oder der Pixar-Film Alles steht Kopf lehren Kinder, dass Emotionen eindeutig zu identifizierende innere Ereignisse sind, die sich in Gesicht und Körper widerspiegeln. Firmen wie Affective bieten Unternehmen ihre Dienste an, um per «Emotionsanalyse» ihren Kunden emotional auf die Spur zu kommen. In der National Basketball Association (NBA) setzen beispielsweise die Milwaukee Bucks darauf, die «psychische, charakterliche und persönliche Verfassung» eines Spielers sowie die «Teamchemie» offenzulegen, indem man den Gesichtsausdruck der Betreffenden analysiert.[6] Selbst die Ausbildung von FBI-Agenten basiert auf dieser klassischen Sicht der Gefühle.[7]
Diese Auffassung prägt ebenso unsere sozialen Institutionen. Das amerikanische Rechtssystem geht davon aus, dass Gefühle ein Teil unserer animalischen Natur sind, der uns unvernünftige und mitunter gewaltsame Handlungen begehen lässt, wenn wir ihn nicht mit unseren rationalen Gedanken unter Kontrolle halten. Die medizinische Forschung untersucht die gesundheitlichen Auswirkungen von Wut in der Annahme, es gebe ein einziges Reaktionsmuster im Körper, auf das diese Bezeichnung zutrifft. Menschen mit den mentalen Störungen – vor allem Kinder und Erwachsene, bei denen eine Störung des Autismus-Spektrums festgestellt wurde – lernen, anhand der Gesichtskonfiguration Emotionen zu identifizieren. Das soll ihnen helfen, mit anderen Menschen zu kommunizieren und Bindungen zu ihnen aufzubauen.
Und doch … trotz des ehrwürdigen intellektuellen Stammbaums der klassischen Auffassung von Emotionen und trotz ihres gewaltigen Einflusses auf unsere Kultur und Gesellschaft gibt es massenhaft wissenschaftliche Belege dafür, dass diese Sicht der Dinge nicht stimmen kann. Selbst nach gut einem Jahrhundert konnte die Forschung nicht einen einzigen einmaligen Fingerabdruck für auch nur eine Emotion identifizieren. Wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihren Probanden Elektroden ins Gesicht kleben, um zu messen, wie Gefühle den Tonus der Gesichtsmuskulatur verändern, dann stoßen sie auf Variation und Vielfalt, nicht auf Einheitlichkeit. Die gleiche Vielfalt – also das Fehlen eines einmaligen Fingerabdrucks – zeigt sich bei der Messung der Zusammenhänge zwischen Gehirn und Körper. Sie können wütend sein, ohne dass Ihr Blutdruck steigt. Sie können Angst haben, ohne dass die Amygdala beteiligt ist, die man historisch als Sitz der Angst im Gehirn betrachtet.
Sicherlich liefern einige Hundert Experimente Belege für die klassische Auffassung. Doch Hunderte mehr wecken Zweifel an diesen Belegen. Die einzig vernünftige wissenschaftliche Schlussfolgerung ist meiner Ansicht nach, dass Emotionen nicht das sind, was wir üblicherweise über sie denken.
Was also sind Emotionen? Wenn die Wissenschaft die klassische Auffassung beiseiteschiebt und sich die Daten ansieht, dann zeigt sich eine radikal andere Erklärung für unsere Gefühle. Kurz gesagt: Wir haben herausgefunden, dass unsere Emotionen keineswegs angeboren sind, sondern aus grundlegenden Bausteinen bestehen. Es handelt sich nicht um universelle Reaktionsmuster, sondern variieren von Kultur zu Kultur. Sie werden nicht getriggert, sondern erzeugt. Sie sind äußere Anzeichen einer Kombination aus den physischen Eigenschaften unseres Körpers, einem flexiblen Gehirn, das sich auf seine Umgebung einstellt, und der Kultur, in der wir aufwachsen, denn diese ist Teil unserer Umgebung. Emotionen sind real, aber nicht im selben objektiven Sinn wie Moleküle oder Neuronen – eher auf eine Weise, wie Geld real ist – also keineswegs eine Illusion, sondern ein Produkt der Übereinkunft zwischen Menschen.[8]
Diese Auffassung, die ich Theorie der konstruierten Emotion nenne, bietet eine ganz andere Interpretation dessen, was in mir aufgrund der Rede von Gouverneur Malloy passierte. Als Malloys Stimme bebte, wurde in meinem Gehirn nicht der Schaltkreis für Trauer getriggert, der eine charakteristische Serie körperlicher Veränderungen auslöste. Ich habe in diesem Augenblick Trauer empfunden, weil ich, die ich in einer bestimmten Kultur groß wurde, vor langer Zeit gelernt habe, dass «Trauer» etwas ist, das auftreten kann, wenn bestimmte körperliche Empfindungen mit einem schrecklichen Verlust zusammenfallen. Mein Gehirn griff auf die Bruchstücke früherer Erfahrungen zurück, zum Beispiel mein Wissen um andere Amokläufe und meine diesbezügliche frühere Trauer, und sagte unverzüglich voraus, was mein Körper tun sollte, um mit dieser Tragödie fertigzuwerden. Diese Voraussage war die Ursache für mein Herzjagen, mein rotes Gesicht und den Knoten in meinem Magen. Sie brachte mich zum Weinen, was mein Nervensystem beruhigte. Die dabei entstehenden Empfindungen wurden als Moment der Trauer sinnhaft.
So gesehen, hat mein Gehirn meine emotionale Erfahrung konstruiert. Meine Bewegungen und Empfindungen waren kein Fingerabdruck von Trauer. Bei anderen Voraussagen hätte sich meine Haut abgekühlt, statt heiß zu werden, und mein Magen hätte sich nicht verkrampft. Und doch hätte mein Gehirn die dadurch entstehenden Empfindungen als Trauer erkennen können. Und nicht nur das: Das klopfende Herz, das rote Gesicht, der verkrampfte Magen und die Tränen hätten auch in Verbindung mit einer anderen Emotion Sinn ergeben, bei Wut oder Angst zum Beispiel. In einer anderen Situation – bei einer Hochzeit vielleicht – hätten die gleichen Empfindungen zu Freude oder Dankbarkeit werden können.
Wenn Ihnen diese Erklärung unsinnig vorkommt oder kontraintuitiv, dann – glauben Sie mir – verstehe ich Sie vollkommen. Nach der Rede von Gouverneur Malloy, als ich mich wieder gefasst hatte und meine Tränen trocknete, erkannte ich, dass ich, ganz egal, was ich als Wissenschaftlerin über Emotionen weiß, ich diese doch so erlebe, wie es die klassische Auffassung sieht. Meine Trauer fühlte sich an wie eine sofort erkennbare Welle körperlicher Veränderungen und Gefühle, die mich als Reaktion auf eine Tragödie, einen Verlust, überwältigten. Wäre ich keine Wissenschaftlerin, die auf Experimente setzt, um zu beweisen, dass Emotionen konstruiert und nicht ausgelöst werden, würde ich ebenfalls dieser unmittelbaren Erfahrung vertrauen.
Die klassische Auffassung von Emotionen bleibt, obwohl die Belege gegen sie sprechen, aus dem einfachen Grund faszinierend, weil sie sich intuitiv erschließt. Und weil sie beruhigende Antworten auf so grundlegende Fragen bietet wie: Woher kommen wir, entwicklungsgeschichtlich betrachtet? Sind wir für unser Handeln noch verantwortlich, wenn wir unter dem Einfluss von Emotionen stehen? Und offenbaren unsere Erfahrungen wirklich exakt, was in der Außenwelt vorgeht?
Die Theorie der konstruierten Emotion beantwortet diese Fragen anders als die klassische Auffassung. Diese andere Theorie der menschlichen Natur ermöglicht, uns auf eine neue, wissenschaftlich besser fundierte Weise zu sehen. Die Theorie der konstruierten Emotion passt vielleicht nicht dazu, wie Sie Ihre Gefühle bisher erlebt haben. Möglicherweise verletzt sie sogar Ihre tiefsten Überzeugungen, wie der Geist funktioniert, woher der Mensch kommt und warum wir so handeln und fühlen, wie wir es tun. Aber diese Theorie erklärt viele wissenschaftliche Resultate in puncto Emotionen, vor allem auch solche, die in eklatantem Widerspruch zur klassischen Auffassung stehen.
Warum aber sollte es Sie überhaupt interessieren, welche Theorie der Emotionen zutreffend ist? Nun, weil der Glaube an die klassische Auffassung Ihr Leben auf eine Weise beeinflusst, die Ihnen vermutlich noch nicht einmal bewusst ist. Denken Sie nur mal zurück an Ihren letzten Aufenthalt am Flughafen, als Sie durch die Sicherheitskontrolle gingen, wo schweigsame Sicherheitsmitarbeiter Ihre Schuhe durchleuchteten und einschätzten, ob von Ihnen eine terroristische Bedrohung ausgeht oder nicht. Vor nicht allzu langer Zeit geschah dies auf Basis eines Verfahrens namens SPOT (Screening Passengers by Observation Techniques). Anhand von Gesichtsausdruck und körperlichen Bewegungen sollten die Kontrolleure abschätzen, ob und welches Risiko Sie für Ihre Mitreisenden darstellen, denn Miene und Körpersprache sollten Ihre innersten Gefühle verraten. Die Technik funktionierte nicht, kostete den Steuerzahler in den USA aber 900 Millionen Dollar. Wir sollten die wissenschaftliche Seite unserer Emotionen verstehen, damit Flughafenangestellte uns nicht aufgrund einer fehlerhaften Einschätzung von Gefühlen festnehmen – oder ihnen umgekehrt die entgehen, die tatsächlich eine Bedrohung darstellen.[9]
Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in der Praxis Ihres Hausarztes und klagen über Druck in der Brust und Atemnot. Das könnten Symptome eines Herzanfalls sein. Aber wenn Sie eine Frau sind, schickt er Sie vermutlich mit der Diagnose «Angststörung» wieder nach Hause. Sind Sie aber ein Mann, denkt Ihr Arzt an einen Herzinfarkt, und Sie erhalten die lebensrettende Behandlung. Resultat? Frauen über 65 sterben öfter an Herzinfarkten als Männer. Die Wahrnehmung des medizinischen Personals und der Patientinnen selbst ist geprägt von der klassischen Auffassung, sie könnten Emotionen wie Angst sehen, und dass Frauen emotionaler sind als Männer … mit tödlichen Folgen.[10]
Die klassische Sicht der Emotionen ist sogar für Kriege verantwortlich. Der Golfkrieg im Irak brach nur deshalb aus, weil Saddam Husseins Halbbruder dachte, er könne die Emotionen der amerikanischen Unterhändler lesen. So gab er Saddam Hussein die Information, dass die Amerikaner nicht wirklich vorhätten, den Irak anzugreifen. In dem darauffolgenden Krieg verloren 175000 Iraker und unzählige Opfer der Koalitionskräfte ihr Leben.[11]
Wir befinden uns, so glaube ich, mitten in einer Revolution, was unser Verständnis von Gefühlen, Verstand und Gehirn angeht – eine Revolution, die uns vermutlich dazu zwingen wird, wesentliche Grundsätze unserer Gesellschaft zu hinterfragen: Wie gehen wir mit geistigen und körperlichen Krankheiten um? Wie steht es um unser Verständnis persönlicher Beziehungen? Was ist unser Ansatz bei der Kindererziehung? Und letztlich: Was ist unser Bild von uns selbst? Diese intellektuelle Revolution war und ist auch in anderen wissenschaftlichen Disziplinen zu beobachten, als Jahrhunderte des gesunden Menschenverstands mit einem Mal über den Haufen geworfen wurden. Die Physik entwickelte sich von Isaac Newtons intuitiven Einsichten über Zeit und Raum hin zu Albert Einsteins komplexeren Ideen und schließlich weiter zur Quantenmechanik. In der Biologie hatte man die Welt in sauber geschiedene Arten mit ihrer jeweiligen Idealform eingeteilt, bis Charles Darwin kam und das Konzept der natürlichen Selektion vorstellte.
Wissenschaftliche Revolutionen werden meist nicht durch den Urknall plötzlicher Entdeckungen ausgelöst, sondern schlicht dadurch, dass wir lernen, bessere Fragen zu stellen. Wie entstehen Gefühle, wenn sie nicht nur getriggerte Reaktionen sind? Warum unterscheiden sie sich so sehr, und warum haben wir so lange geglaubt, sie besäßen einen unverwechselbaren Fingerabdruck? Diese Fragen sind an sich schon höchst interessant. Aber sich für das Unbekannte zu interessieren, ist schließlich nicht nur Wissenschaftlersache. Es gehört zu jener Art von Abenteuerlust, die uns als Menschen mit ausmacht.
Daher möchte ich Sie einladen, sich in den folgenden Kapiteln mit mir auf diese Abenteuerreise zu begeben. In Kapitel 1 bis 3 erkunden wir die neue Wissenschaft von den Emotionen – wie Psychologie, Neurowissenschaften und verwandte Disziplinen sich von der Suche nach dem emotionalen Fingerabdruck abwenden und stattdessen fragen, wie Gefühle konstruiert werden. In Kapitel 4 bis 7 erfahren wir dann, wie Gefühle tatsächlich entstehen. Kapitel 8 bis 12 schließlich gehen der Frage nach, welche praktischen Implikationen diese neuen Erkenntnisse für den Alltag haben und was sie für unsere hergebrachte Haltung zu Gesundheit, emotionaler Intelligenz, Kindererziehung, persönlichen Beziehungen, Rechtssystemen und letztlich der menschlichen Natur im Allgemeinen bedeuten. In Kapitel 13 sodann beschäftigen wir uns mit der Frage, was die neue Theorie der Emotionen über das uralte Rätsel zu sagen hat, wie das menschliche Gehirn den menschlichen Geist hervorbringt.
1Die Suche nach dem «Fingerabdruck» der Gefühle
Es war in den 1980er-Jahren, als ich noch dachte, ich würde als angehende Psychologin in meinem Doktorandenprogramm an der University of Waterloo Einblick in das Handwerk der Psychotherapie erhalten und eines Tages meine Klientel in einer schicken Praxis therapieren. Ich wollte Wissenschaft konsumieren, nicht produzieren. Jedenfalls hatte ich nicht die Absicht, mich einer Revolution anzuschließen, um grundlegende, seit Platons Tagen geltende Überzeugungen in Bezug auf den Geist über den Haufen zu werfen. Aber manchmal hält das Leben eben Überraschungen für uns bereit.
Ich schrieb gerade an meiner Dissertation, als mir erste Zweifel an der klassischen Sicht der Emotionen kamen. Zu jener Zeit untersuchte ich, was die Gründe für ein geringes Selbstwertgefühl waren und wie diese zu Angststörungen oder Depressionen führen konnten. Unzählige Versuche zeigten, dass Menschen depressiv reagieren, wenn sie ihren eigenen Idealen nicht gerecht werden. Entsprechen sie jedoch den Vorstellungen anderer Menschen nicht, werden sie ängstlich. Meine erste Untersuchung im Graduiertenprogramm sollte dieses wohlbekannte Phänomen replizieren, bevor ich mich daranmachte, darauf aufbauend meine eigenen Thesen zu überprüfen. Im Verlauf dieses Experiments wollte ich zunächst also herausfinden, ob meine freiwilligen Versuchspersonen eher ängstlich oder eher depressiv reagierten. Zu diesem Zweck verwendete ich eine anerkannte Checkliste von Symptomen.[12]
Ich hatte vor meiner Doktorarbeit schon viele deutlich kompliziertere Experimente durchgeführt, das nun anstehende sollte daher ein Kinderspiel sein. Stattdessen ging es nur schief. Meine Probanden berichteten nämlich nicht wie erwartet über ängstliche oder depressive Gefühle. Also versuchte ich es mit einem weiteren Experiment, das ich vorhatte zu veröffentlichen. Auch dieses war ein Flop. Ich versuchte es wieder und wieder. Jedes Experiment nahm Monate in Anspruch. Nach drei Jahren hatte ich den gleichen Fehler acht Mal in Folge reproduziert. In der Wissenschaft kommt es relativ häufig vor, dass sich Experimente nicht replizieren lassen, aber acht Fehlschläge – das ist schon Rekord. Meine innere Kritikerin höhnte: «Nicht jede ist für die Wissenschaft geschaffen.»
Als ich jedoch die von mir gesammelten Daten durchging, fiel mir auf, dass alle acht Experimente eine Gemeinsamkeit aufwiesen: Viele meiner Probandinnen und Probanden waren nämlich nicht gewillt oder nicht fähig, zwischen ängstlichen und depressiven Gefühlen zu unterscheiden. Stattdessen gaben sie an, entweder beides oder weder das eine noch das andere zu verspüren. Nur sehr selten gab ein Versuchsteilnehmer an, er hätte nur eines dieser Gefühle erlebt. Das ergab einfach keinen Sinn! Jeder weiß doch, dass Angst und Depression Emotionen sind, die sich vollkommen verschieden anfühlen. Wenn Sie ängstlich sind, sind Sie aufgewühlt, zittrig, und Sie machen sich Sorgen, dass etwas Schlimmes geschieht. In der Depression aber ist man getrübter Stimmung und eher träge. Alles scheint einem schrecklich, das Leben ist ein einziger Kampf. Zwei unterschiedliche Emotionen sollten den Körper in zwei ebenso unterschiedliche Zustände versetzen. Aus diesem Grund sollten sie sich anders anfühlen und für jeden halbwegs normalen Menschen ohne Schwierigkeiten zu unterscheiden sein. Doch die Daten besagten eindeutig, dass dies bei meinen Versuchspersonen nicht der Fall war. Die Frage war nur … warum?
Wie sich herausstellte, waren meine Experimente gar nicht schiefgegangen. Mein erster «vermasselter» Versuch ermöglichte mir ganz im Gegenteil sogar eine echte Entdeckung: Meine Probanden unterschieden nicht zwischen ängstlichen und depressiven Gefühlen. Und die folgenden sieben Versuche hatten gleichfalls funktioniert. Sie reproduzierten die Resultate des ersten. Allmählich kam ich dahinter, dass sich der gleiche Effekt auch in den Daten anderer Forschenden zeigte. Nachdem ich den Doktortitel erlangt hatte und Professorin an der Universität geworden war, ging ich diesem Geheimnis weiter nach. Ich leitete ein Forschungslabor, und für entsprechende Untersuchungen sollten Hunderte von Versuchspersonen über Wochen oder Monate ihre Emotionen im Alltag aufzeichnen. Meine Studierenden und ich fragten nach einer enormen Bandbreite von emotionalen Erfahrungen, nicht nur nach Angst und Depression, um herauszufinden, ob sich auch hier bewahrheitete, was ich entdeckt hatte.
Diese neuen Experimente offenbarten etwas, was bisher noch nirgendwo dokumentiert war: Jede der befragten Personen verwendete Begriffe wie «wütend», «traurig» oder «ängstlich», um ihre Emotionen auszudrücken, doch war damit nicht unbedingt dasselbe gemeint. Manche Versuchsteilnehmer trafen feine Unterscheidungen im Gebrauch ihrer Worte: So erlebten sie Traurigkeit und Angst als qualitativ verschiedene Gefühle. Andere hingegen verwendeten Begriffe wie «traurig», «ängstlich» und «depressiv» und meinten damit einfach: «Mir geht es scheiße.» (Oder wissenschaftlicher: «Ich fühle mich unwohl.») Der Effekt ließ sich auch für angenehme Gefühle wie Glück, Ruhe und Stolz nachweisen. Nachdem wir über 700 US-amerikanische Testpersonen befragt hatten, war klar, dass sich die Menschen massiv darin unterschieden, wie sie ihre emotionale Erfahrung differenzierten.
Eine erfahrene Innenarchitektin sieht fünf Schattierungen der Farbe Blau und unterscheidet sie in Azur, Kobalt, Ultramarin, Königsblau und Cyan. Für meinen Mann dagegen ist das alles einfach «blau». Meine Studierenden und ich hatten in puncto Gefühle eine ähnliche Entdeckung gemacht. Ich nenne das: emotionale Granularität.[13]
Und hier nun kommt die klassische Sicht auf Emotionen ins Spiel. Hinsichtlich der emotionalen Granularität müssen dieser Theorie zufolge unsere inneren emotionalen Zustände korrekt gelesen werden. Wer zwischen verschiedenen Gefühlen unterscheiden kann und dafür Wörter verwendet wie «Freude», «Traurigkeit», «Angst», «Abscheu», «Erregung» oder «Ehrfurcht», muss für jede dieser Emotionen die physischen Signale oder Reaktionen erkennen und sie korrekt interpretieren. Menschen mit einer niedrigen emotionalen Granularität, die Wörter wie «ängstlich» und «depressiv» gleichsetzen, können diese Signale also nicht erkennen.
Ich begann mich zu fragen, ob ich den Leuten zu mehr emotionaler Granularität verhelfen konnte, indem ich ihnen beibrachte, ihre emotionalen Zustände exakt zu erkennen. Der Schlüsselbegriff ist hier «exakt». Wie aber kann eine Wissenschaftlerin wissen, ob jemand, der von sich sagt: «Ich bin glücklich» oder «Ich bin ängstlich», auch exakt ist? Offensichtlich brauchte ich einen Weg, um eine Emotion objektiv zu messen und sie dann mit dem zu vergleichen, was die Versuchsperson über ihr Befinden sagt. Fühlt sich eine Probandin ängstlich und die objektiven Kriterien bestätigen, dass sie sich tatsächlich in einem Zustand der Angst befindet, dann erkennt sie ihre eigenen Gefühle exakt. Würden die objektiven Merkmale allerdings darauf hindeuten, dass sie depressiv, wütend oder begeistert ist, dann wäre ihre Wahrnehmung nicht exakt. Mit einem objektiven Test wäre der Rest ganz einfach. Ich könnte einen Menschen fragen, wie er sich fühlt, und dann seine Antwort mit seinem «realen» emotionalen Zustand vergleichen. Dann könnte ich seine offenkundigen Fehler korrigieren, indem ich ihm beibringe, die Signale zu erkennen, die eine Emotion von der anderen unterscheiden. Auf diesem Weg ließe sich seine emotionale Granularität verbessern.
Wie die meisten Studierenden der Psychologie hatte ich gelesen, dass jede Emotion ein klar umrissenes Muster physischer Veränderungen aufweist – eben wie ein Fingerabdruck. Jedes Mal, wenn Sie eine Klinke anfassen, hängt die Beschaffenheit der Fingerabdrücke, die Sie darauf hinterlassen, davon ab, wie fest Ihr Griff war, wie glatt die Oberfläche ist und wie warm und zart Ihre Haut in dem Moment ist. Nichtsdestotrotz weisen Ihre Fingerabdrücke insgesamt eine ausreichende Ähnlichkeit auf, um Sie eindeutig zu identifizieren. Ebenso soll der «Fingerabdruck» von Emotionen von Mal zu Mal ähnlich genug sein, um deren eindeutige Identifizierung zu erlauben, ungeachtet der Person bzw. ihres Alters, Geschlechts, ihres Temperaments oder Kultur. In einem Forschungslabor müssten Wissenschaftler also in der Lage sein, aufgrund physikalischer Messungen von Gesicht, Körper und Gehirn eines Menschen klar beurteilen zu können, ob jemand traurig, glücklich oder ängstlich ist.
Ich war mir sicher, dass diese emotionalen Fingerabdrücke die objektiven Kriterien liefern würden, die ich brauchte, um Emotionen zu erheben. War die wissenschaftliche Literatur korrekt, dann würde es ein Leichtes sein, die emotionale Exaktheit von Menschen einzuschätzen. Nur lief das nicht so, wie ich erwartet hatte.
Der klassischen Auffassung von Emotionen zufolge ist unser Gesicht der Schlüssel, der uns hilft, Emotionen objektiv und exakt einzuschätzen. Eine erste Stütze für diese Idee finden wir in Charles Darwins Buch Der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei Tieren und Menschen. Der große Forscher erklärt darin, dass Emotionen und ihr Ausdruck ein uralter Part der universellen menschlichen Natur sind. Alle Menschen überall auf der Welt sollen Emotionen mithilfe des Gesichts ausdrücken und am Gesichtsausdruck erkennen können, ohne dies erlernt zu haben.[14]
Also, dachte ich, sollte mein Labor doch in der Lage sein, Gesichtsbewegungen zu messen, den wahren emotionalen Zustand der Versuchspersonen einzuschätzen, ihn mit deren Aussagen zu vergleichen und so abklären zu können, inwieweit die eigene Einschätzung richtig war. Machten die Probanden ein verdrießliches Gesicht, behaupteten jedoch, nicht traurig zu sein, könnten wir ihnen zeigen, wie sie ihre wahren Emotionen erkennen können. Fall gelöst.
Die menschliche Gesichtsmuskulatur besteht aus 42 kleinen Muskeln pro Gesichtshälfte. Das Mienenspiel, das wir täglich an uns und anderen wahrnehmen (Zwinkern, Blinzeln, Grinsen, Grimassieren, hochgezogene Brauen, gerunzelte Stirn), entsteht, wenn mehrere dieser Muskeln sich kontrahieren bzw. entspannen und dabei das Bindegewebe und die Haut in Bewegung versetzen. Selbst wenn Ihr Gesicht dem bloßen Auge vollkommen ruhig erscheint, ziehen Ihre Gesichtsmuskeln sich zusammen und entspannen sich wieder.[15]
Abb. 1.1: Muskulatur des menschlichen Gesichts
Der klassischen Auffassung von Emotionen zufolge zeichnet sich jedes Gefühl im Gesicht durch ein besonderes Bewegungsmuster aus, den «Gesichtsausdruck». Wenn Sie glücklich sind, sollten Sie demzufolge lächeln. Sind Sie wütend, runzeln Sie die Stirn. Diese Bewegungen gehören angeblich zum Fingerabdruck der entsprechenden Emotionen.
In den 1960er-Jahren haben der Psychologe Silvan S. Tomkins und seine Protegés Carroll E. Izard und Paul Ekman diese Theorie im Labor überprüft. Sie erstellten Fotoserien von Menschen, die ausgeklügelte Posen einnahmen wie in Abb. 1.2. Diese Posen sollten die sechs sogenannten Basisemotionen darstellen, die ihrer Ansicht nach einen biologischen Fingerabdruck besaßen: Wut, Angst, Abscheu, Überraschung, Traurigkeit und Glück. Die Schauspieler, die dafür fotografiert wurden, wurden gründlich instruiert. Sie sollten diese Emotionen so deutlich wie möglich ausdrücken. (Möglicherweise kommen Ihnen diese Bilder übertrieben oder künstlich vor, aber das ist Absicht, denn Tomkins glaubte, dass sie so die stärkste Signalwirkung für eine bestimmte Emotion entfalteten.)[16]
Abb. 1.2: Fotos aus den Studien zu den menschlichen Basisemotionen
Mit gestellten Fotos wie diesen versuchten Tomkins und seine Mitarbeitenden herauszufinden, wie gut die Probanden emotionalen Ausdruck «erkannten», genauer gesagt, wie gut sie Bewegungen des Gesichts als Ausdruck von Emotionen decodieren konnten. Hunderte publizierter Experimente setzten danach auf die gleiche Technik, die auch heute noch als Goldstandard gilt. Eine Testperson erhält eine Karte, auf der neben dem Foto verschiedene Bezeichnungen für emotionale Zustände angegeben sind wie in Abb. 1.3.
Abb. 1.3.: Methode zur Untersuchung von Basisemotionen
Dann kreuzt der Proband an, was in seinen Augen am besten zutrifft. In diesem Fall ist die intendierte Emotion «Überraschung». Eine weitere Methode verwendet Karten mit zwei Fotos wie in Abb. 1.4. Dazu kommt ein kurz beschriebener Sachverhalt. Dann muss der Proband ankreuzen, welches Gesicht am besten zu dieser Situation passt. In diesem Fall ist es das Gesicht auf der rechten Seite.[17]
Abb. 1.4: Methode zur Untersuchung von Basisemotionen: Man wählt das Gesicht aus, das am besten zur Story passt.[18]
Diese Methode – die ich hier «Basisemotionsmethode» nennen will – revolutionierte die wissenschaftliche Untersuchung dessen, was Tomkins’ Team «Emotionserkennung» nannte. Forschende konnten zeigen, dass Menschen in aller Welt den Gesichtern die gleichen Emotionsbezeichnungen (natürlich in ihrer Sprache) zuordneten. In einer berühmt gewordenen Studie reisten Ekman und seine Kollegen nach Papua-Neuguinea und führten Studien mit den Ureinwohnern vom Volk der Fore durch, die bis dato kaum Kontakt mit der westlichen Welt gehabt hatten. Selbst dieser Stamm in einer entlegenen Weltregion konnte, wie erwartet, die Gesichter den emotionalen Bezeichnungen und Sachverhalten zuordnen.[19] Später führten andere Wissenschaftler ähnliche Studien in vielen anderen Ländern wie beispielsweise Japan und Korea durch. In jedem Fall konnten die Testpersonen die gezeigten Grimassen bzw. das Lächeln den vorgegebenen Bezeichnungen bzw. Geschichten korrekt zuordnen.[20]
Aus diesen Resultaten schlossen die Forschenden, dass die Emotionserkennung universell ist: Ganz egal, wo Sie geboren werden oder aufwachsen, Sie können jederzeit den Gesichtsausdruck eines US-amerikanisch aussehenden Menschen, wie er auf den Fotos dargestellt ist, identifizieren. Der Gesichtsausdruck kann aber nur dann universell verstanden werden, überlegte man weiter, wenn er auch universell produziert wird: Der Gesichtsausdruck musste also ein verlässlicher diagnostischer Fingerabdruck der jeweiligen Emotion sein.[21]
Andere Wissenschaftler hingegen empfanden die Basisemotionsmethode als zu indirekt und subjektiv, um tatsächlich emotionale Fingerabdrücke zu liefern, weil sie ja einzig und allein auf dem menschlichen Urteil beruht. Daher wurde eine objektivere Technik entwickelt, die Gesichts-Elektromyografie (EMG), bei der es nicht auf die menschliche Einschätzung ankommt. Dabei werden Elektroden auf dem Gesicht angelegt, um die elektrischen Signale abzunehmen, die die Gesichtsmuskulatur zur Bewegung anregen. So kann präzise aufgezeichnet werden, welche Bereiche des Gesichts sich wie, wie stark und wie oft bewegen.[22] Eine typische Studie verläuft wie folgt: Man befestigt Elektroden über den Augenbrauen, an der Stirn, an den Wangen und am Kiefer der Testperson, während diese Filme oder Fotos ansieht, sich an bestimmte Erlebnisse erinnert oder sich etwas bildlich vorstellt. All diese Aktivitäten sollen Emotionen hervorrufen. Die elektrische Muskelaktivität wird aufgezeichnet, und es wird berechnet, wie sich jeder Muskel bei jeder einzelnen Emotion bewegt. Wenn die Probanden denselben Gesichtsmuskel auf dieselbe Weise bewegen, wenn sie eine bestimmte Emotion erleben – finsterer Blick bei Wut, Lächeln bei Glück, hängende Mundwinkel bei Trauer –, und zwar nur, wenn sie diese Emotion fühlen, dann könnte die Bewegung zu einem Fingerabdruck gehören.[23]
Wie sich zeigte, stellte die Gesichts-Elektromyografie für die klassische Sicht der Emotionen eine ernsthafte Herausforderung dar. Denn Studie um Studie ergab, dass die Muskelbewegungen eben nicht verlässlich anzeigen, ob jemand wütend, traurig oder ängstlich ist. Sie lieferte keine vorhersagbaren Fingerabdrücke für jede Emotion. Bestenfalls kann die Gesichts-EMG zwischen angenehmen und unangenehmen Gefühlen unterscheiden. Und es kam noch schlimmer: Die Gesichtsbewegungen, die in diesen Studien aufgezeichnet wurden, ließen sich nicht verlässlich den Fotos zuordnen, die für die Basisemotionsmethode produziert wurden.[24]
Abb. 1.5: Gesichts-Elektromyografie
Sehen wir uns doch kurz an, was diese Resultate uns sagen. Hunderte von Experimenten haben gezeigt, dass weltweit Menschen Emotionsbezeichnungen dem Ausdruck von Emotion zuordnen können, der von Schauspielern dargestellt wurde, die diese Emotionen nicht fühlten. Doch dieser Gefühlsausdruck kann nicht widerspruchsfrei und spezifisch mit objektiven Messungen der Gesichtsmuskulatur erfasst werden, wenn Menschen diese Emotionen tatsächlich fühlen. Natürlich bewegen wir alle ständig unsere Gesichtsmuskeln, und wenn wir uns gegenseitig ansehen, können wir in einigen dieser Bewegungen mühelos Emotionen erkennen. Doch von einem rein objektiven Standpunkt aus betrachtet, aufgrund der Messung nur der Muskelbewegung, lassen sich diese Bewegungen den Fotos nicht eindeutig zuordnen.
Nun ist vorstellbar, dass die Gesichts-EMG zu beschränkt ist, um all die sinnhaften Veränderungen in einem Gesicht abzubilden, die sich bei einer emotionalen Erfahrung einstellen. Möglicherweise befestigt ein Wissenschaftler nur sechs Elektroden auf jeder Seite des Gesichts, bevor die Testperson sich unwohl fühlt. Das sind unter Umständen zu wenige, um die Bewegungen aller 42 Gesichtsmuskeln sinnvoll aufzuzeichnen. Daher verwenden Forschende auch eine alternative Technik, die man Facial Action Coding System (FACS, dt. Gesichtsbewegungs-Kodierungssystem) nennt. Hierfür klassifizieren Fachleute aufwendig die individuellen Gesichtsbewegungen eines Menschen.[25] Das ist zwar weniger objektiv als die Gesichts-EMG, da nun doch wieder menschliche Beobachter beteiligt sind. Aber dieses Vorgehen ist doch objektiver als die Basisemotionsmethode mit der Zuordnung von Worten zu gestellten Fotos. Aber auch die Bewegungen, die mit dem FACS beobachtet werden konnten, lassen sich nicht widerspruchsfrei den einzelnen Fotos zuschreiben.[26]
Die gleichen Ungereimtheiten zeigen sich bei Kindern. Wenn Gesichtsausdrücke universell sind, dann sollten Babys noch mehr als Erwachsene in der Lage sein, Ärger durch Stirnrunzeln und Trauer durch hängende Mundwinkel zu signalisieren, weil sie ja zu jung sind, bereits gelernt zu haben, was sozial angemessen ist. Beobachten Forschende jedoch Babys in Situationen, die bestimmte Emotionen auslösen sollten, machen die Kinder nicht das erwartete Gesicht dazu. Die Entwicklungspsychologinnen Linda A. Camras und Harriet Oster und Kollegen zeichneten Videos von Babys aus verschiedenen Kulturkreisen auf.[27] Man verwendete einen knurrenden Gorilla (um Angst zu erzeugen) bzw. hielt die Kinder am Arm fest (um Wut hervorzurufen). Camras und Oster setzten das FACS ein und fanden heraus, dass der Gesichtsausdruck der Babys sich in beiden Fällen nicht unterschied.[28] Doch als später Erwachsene die Videoaufzeichnungen ansahen, identifizierten sie den Gesichtsausdruck beim Knurren des Gorillas als «Angst» und den beim Festhalten des Armes als «Zorn». Und das selbst dann, wenn Camras und Oster die Kindergesichter elektronisch ausblendeten! Die Erwachsenen unterschieden Furcht von Zorn aufgrund des Kontexts, ohne Gesichtsbewegungen auch nur zu sehen.[29]
Verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Neugeborene und kleine Kinder bewegen ihr Gesicht durchaus auf sinnvolle Weise. Sie machen die unterschiedlichsten Gesichter, wenn sie situationsbedingt interessiert, verwirrt oder durch Schmerz irritiert sind. Auch dann, wenn sie etwas riechen oder schmecken, was ihnen nicht behagt.[30] Aber sie zeigen keine klar unterscheidbaren, «erwachsenen» Gesichtsausdrücke, wie sie auf den Fotos der Basisemotionsmethode dargestellt werden.[31]
Wie Camras und Oster haben auch andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen festgestellt, dass man sehr viel Information schlicht dem Kontext entnimmt. So montierte man Fotos von Gesichtern auf andere Körper, beispielsweise ein wütendes Gesicht zu einer schmutzigen Windel. Die Testpersonen identifizierten die zugehörige Emotion immer anhand des Körpers, nicht anhand des Gesichts: In diesem Fall war es Ekel, nicht Ärger. Gesichter sind in steter Bewegung. Dabei verlässt sich Ihr Gehirn auf viele Faktoren zugleich – Körperhaltung, Stimme, die ganze Situation, Ihre Lebenserfahrung –, um festzustellen, welche Bewegungen aussagekräftig sind und was sie bedeuten.[32]
Wenn es also um Emotionen geht, dann spricht das Gesicht nicht für sich selbst. Die gestellten Bilder der Basisemotionsmethode entstanden ja nicht aufgrund der Beobachtung von Gesichtern in der Realität. Wissenschaftler legten diese Posen fest. Sie ließen sich von Darwins Buch inspirieren und baten Schauspieler, sie darzustellen. Seitdem wird einfach davon ausgegangen, dass diese Gesichter universeller Ausdruck von Emotion sind.[33]
Aber sie sind eben nicht universell. Um dies zu verdeutlichen, führte mein Forschungslabor eine Studie durch und verwendete dabei Bilder von echten Emotionsexperten: versierten Schauspielerinnen und Schauspielern. Die Fotos entnahmen wir dem Buch In Character: Actors Acting, ein Lehrbuch für Schauspieler sozusagen. Darin werden Emotionen dargestellt, die zu einem bestimmten Szenario passen.[34] Wir haben unsere Testpersonen aus den USA in drei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe las nur das Szenario, zum Beispiel: «In seinem ruhigen, von Bäumen beschatteten Viertel in Brooklyn wurde er soeben Zeuge einer Schießerei.» Die zweite Gruppe sah nur das Foto vom Gesicht wie das von Martin Landau, das zu dem oben beschriebenen Szenario gehört. (Abb. 1.6, Mitte) Eine dritte Gruppe las das Szenario und bekam die zugehörigen Gesichter gezeigt. In allen drei Gruppen erhielten die Probanden eine kurze Liste von Emotionsbezeichnungen, mithilfe derer sie einschätzen sollten, was sie gerade gesehen bzw. gelesen hatten.[35]
Das Schuss-Szenario ordneten 66 Prozent der Testpersonen, die nur das Szenario oder dieses und Landaus Gesicht zu sehen bekommen hatten, als furchterregende Situation ein. Von den Testpersonen, die nur Landaus Gesicht zu sehen bekamen, also ohne jeden Kontext, schätzten nur 38 Prozent seinen Gesichtsausdruck als Angst ein, 56 Prozent sprachen von Überraschung. (Abb. 1.6 vergleicht Landaus Gesichtskonfiguration mit den Fotos der Basisemotionsmethode, die für «Angst» und «Überraschung» stehen. Sieht Landau nun ängstlich oder überrascht aus? Oder vielleicht beides?)
Abb. 1.6: Der Schauspieler Martin Landau (Mitte), flankiert von den Fotos der Basisemotionsmethode für «Angst» (links) und «Überraschung» (rechts)
Andere Fotos, die Angst zeigen sollten, unterschieden sich massiv vom Gesicht Landaus. So zeigte Melissa Leo Angst für das Szenario: «Sie fragt sich, ob sie ihrem Mann sagen soll, dass man über sie redet, weil man sie für lesbisch hält. Und zwar bevor er es von jemand anderem hört.» Leos Mund ist geschlossen, die Mundwinkel zeigen nach unten. Sie runzelt ganz leicht die Brauen. Fast drei Viertel unserer Testpersonen, die nur ihr Gesicht sahen, meinten, darin Trauer zu erkennen. Bekamen sie hingegen das Szenario zu lesen, schätzten 70 Prozent der Probanden ihren Gesichtsausdruck als Angst ein.[36]
Diese massiven Unterschiede zeigten sich bei jeder Emotion, die wir untersuchten. Eine Emotion wie «Angst» kennt keinen einzigartigen Gesichtsausdruck, sondern ruft eine Reihe von extrem diversen Gesichtsbewegungen hervor, die sich je nach Situation unterschieden.[37] (Überlegen Sie mal: Wann hat ein Star je einen Oscar gewonnen, weil er oder sie die Mundwinkel hängen ließ, um Trauer darzustellen?)
Das erscheint uns vermutlich selbstverständlich, sobald wir unsere eigenen emotionalen Erfahrungen betrachten. Wenn Sie ein Gefühl wie Angst erleben, dann bewegen Sie Ihr Gesicht vermutlich auf die unterschiedlichste Art und Weise. Kauern Sie sich auf dem Sofa zusammen, wenn Sie einen Horrorfilm sehen, dann legen Sie vielleicht sogar die Hände über die Augen. Sind Sie sich nicht sicher, ob der Mensch, der vor Ihnen steht, Ihnen vielleicht etwas antun will, dann verengen Sie die Augen möglicherweise zu Schlitzen, um das Gesicht des anderen besser zu analysieren. Lauert die Gefahr möglicherweise hinter der nächsten Ecke, dann reißen Sie die Augen auf, um das periphere Sehen zu verstärken. «Angst» hat also keine klare physische Form. Vielfalt ist hier die Norm. Glück, Traurigkeit, Ärger und alle anderen Emotionen, die Sie kennen, bilden jeweils eine eigene Kategorie mit höchst unterschiedlichen Gesichtsbewegungen.[38]
Wenn diese Bewegungen innerhalb einer emotionalen Kategorie wie «Angst» so unterschiedlich ausfallen können, dann fragen Sie sich vielleicht, warum es uns so natürlich vorkommt, dass ein Gesicht mit weit aufgerissenen Augen Angst ausdrückt. Die Antwort ist klar: Es handelt sich um ein Stereotyp, eine Klischeevorstellung, die symbolhaft darstellt, was man in unserer Kultur für «Angst» hält. Diese Stereotype lernen wir schon im Kindergarten: «Menschen, die die Brauen runzeln, sind wütend.» Oder: «Menschen mit hängenden Mundwinkeln sind traurig.» Das sind kulturelle Kürzel bzw. Konventionen. Sie sehen sie in Zeichentrickfilmen, in der Werbung, auf Puppengesichtern, in Emojis – ein endloser ikonografischer Strom von Klischees. Man findet sie in Lehrbüchern für Psychologie. Therapeutinnen vermitteln sie ihren Klienten. Und die Medien verbreiten sie in der gesamten westlichen Welt. «Halt, jetzt warten Sie mal», werden Sie jetzt vermutlich denken. «Meint sie vielleicht, dass unsere Kultur diese Bilder geschaffen hat und wir sie einfach lernen?» Ja … genau. Und die klassische Sicht der Emotionen schreibt diese Stereotype fort, als wären sie tatsächlich der authentische Fingerabdruck der Emotionen.
Natürlich ist jedes Gesicht Instrument der sozialen Kommunikation. Manche Gesichtsbewegungen transportieren Sinn, andere nicht. Bislang wissen wir recht wenig darüber, wie ein Individuum herausfindet, was denn nun der Fall ist. Außer vielleicht, dass der Kontext (Körpersprache, soziale Situation, kulturelle Erwartungen etc.) irgendwie von Bedeutung ist. Wenn Gesichtsbewegungen eine psychische Botschaft vermitteln sollen – zum Beispiel durch das Heben einer Augenbraue –, dann wissen wir nicht, ob die Botschaft immer für eine Emotion steht. Wir wissen noch nicht einmal, ob sie immer dasselbe ausdrückt. Wenn wir alle wissenschaftlichen Resultate zusammennehmen, so können wir nicht mit Gewissheit behaupten, dass zu jeder Emotion ein eindeutig abgrenzbarer Gesichtsausdruck gehört.
Für meine Suche nach dem einzigartigen Fingerabdruck der Emotion benötigte ich folglich eine verlässlichere Quelle, als das menschliche Gesicht es ist. Also nahm ich den Körper ins Visier. Vielleicht gab es ja aussagekräftigere Veränderungen bei Herzfrequenz, Blutdruck und anderen Körperfunktionen, die den gesuchten Fingerabdruck lieferten, sodass Menschen ihre Emotionen exakt erkennen können.
Die Vorstellung, dass es einen quasi körperlichen Fingerabdruck geben könnte, fand massive Unterstützung durch eine berühmt gewordene Studie, durchgeführt von Paul Ekman, dem Psychologen Robert W. Levenson und ihrem Kollegen Wallace V. Friesen. Die Ergebnisse wurden 1983 in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Science veröffentlicht.[39] Die Forscher verbanden ihre Testpersonen mit Geräten, die Veränderungen im autonomen Nervensystem messen sollten: Herzfrequenz, Körpertemperatur, Hautleitfähigkeit (eine Messgröße für abgesonderten Schweiß).[40] Zusätzlich zeichnete man Unterschiede in der Spannung der Armmuskulatur auf, die vom motorischen Nervensystem gesteuert wird. Dann wurden bei den Versuchspersonen Gefühle wie Wut, Traurigkeit, Angst, Abscheu, Überraschung und Glück ausgelöst, um die Veränderungen zu beobachten, die sich bei den jeweiligen Emotionen einstellten. Nachdem Ekman und seine Kollegen die Daten analysiert hatten, gelangten sie zu dem Schluss, dass es bei den körperlichen Reaktionen eindeutige und widerspruchsfreie Änderungen gab, die man den einzelnen Emotionen zuordnen konnte. Die Studie schien für jede untersuchte Emotion im Körper einen objektiven, biologischen Fingerabdruck festzustellen. Noch heute ist sie ein Klassiker der wissenschaftlichen Literatur.[41]
Allerdings wurden die Emotionen in der Studie von 1983 auf eine kuriose Weise ausgelöst: Die Testpersonen sollten eine der Gesichtsposen aus der Basisemotionsmethode nachahmen und halten. Um Trauer auszulösen, sollte die Versuchsperson zehn Sekunden niedergeschlagen gucken. Um Ärger hervorzurufen, sollte sie ein finsteres Gesicht machen. Als Hilfsmittel durften die Testpersonen einen Spiegel verwenden, während Ekman sie anleitete, wie sie ihre Gesichtsmuskulatur bewegen sollten.[42]
Die Vorstellung, dass eine bewusst eingenommene Gesichtskonfiguration einen emotionalen Zustand herbeiführen kann, ist bekannt als Facial-Feedback-Hypothese. Wenn Sie Ihrem Gesicht einen speziellen Ausdruck verleihen, dann verursacht das angeblich jene spezifischen physiologischen Veränderungen, die körperlich mit der darzustellenden Emotion in Verbindung stehen. Versuchen Sie es ruhig mal selbst. Legen Sie zehn Sekunden lang die Stirn in Falten und ziehen Sie die Mundwinkel nach unten. Sind Sie jetzt traurig? Setzen Sie ein breites Lächeln auf. Fühlen Sie sich nun glücklicher? Die Facial-Feedback-Hypothese wird kontrovers diskutiert. Ob sich auf diese Weise eine ausgeprägte emotionale Erfahrung herbeiführen lässt, ist hochumstritten.[43]
In der Studie von 1983 jedenfalls untersuchte man körperliche Veränderungen, während die Probanden die entsprechenden Muskelkonfigurationen einnahmen. Das ist als Ergebnis schon bemerkenswert: Nur eine spezielle Konfiguration einzunehmen bewirkte, dass sich die Aktivität des peripheren Nervensystems veränderte, obwohl die Probanden in aller Ruhe in einem bequemen Sessel saßen. Ihre Fingerspitzen erwärmten sich, wenn sie finster dreinblickten (Ärgerpose). Der Herzschlag beschleunigte sich, wenn sie finster dreinschauten, mit aufgerissenen Augen starrten (Angstpose) oder die Mundwinkel nach unten zogen (Trauerpose). Dies geschah jeweils im Vergleich zu den Posen für Glück, Überraschung und Abscheu. Bei den übrigen beiden Kennzahlen für Hautwiderstand und Armspannung zeigten sich keine emotionsabhängigen Veränderungen.[44]
Trotzdem braucht es noch einige weitere Schritte, bevor Sie behaupten können, den Fingerabdruck einer Emotion im Körper entdeckt zu haben. Zum einen müssen Sie zeigen, dass die Reaktion bei einem Gefühl wie, sagen wir mal, Ärger anders ausfällt als bei einer anderen Emotion. Sie müsste also für den Ärger spezifisch sein. Und hier gerät die Studie von 1983 in schweres Fahrwasser. Sie zeigte zwar eine gewisse Spezifität für Wut, nicht aber für die anderen Emotionen. Das heißt, dass die körperlichen Signale der verschiedenen Gefühle einander zu ähnlich waren, um einen Fingerabdruck zu ergeben.
Außerdem müssen Sie belegen, dass es für Ihre Resultate keine andere Erklärung gibt. Dann und nur dann können Sie von sich behaupten, einen körperlichen Fingerabdruck für Wut, Traurigkeit und das restliche emotionale Spektrum gefunden zu haben. Für die Studie von 1983 gibt es eine andere Erklärung, denn die Testpersonen erhielten genaue Anweisungen, wie sie ihr Gesicht verändern sollten.[45] Diesen Anweisungen konnten im Westen sozialisierte Menschen sicher mühelos entnehmen, welche Emotion ausgedrückt werden sollte. Allein dies kann die Herzfrequenz und andere körperliche Veränderungen beeinflussen, wie Ekman und seine Kollegen es beobachtet haben. Diese Tatsache war zu dem Zeitpunkt, als die Studie durchgeführt wurde, noch nicht bekannt.[46] Eine alternative Erklärung lieferte ein weiteres Experiment, das Levenson und seine Kollegen bei einem indonesischen Stamm durchführten – den Minangkabau von Westsumatra.[47] Die Testpersonen, die freiwillig an diesem Experiment teilnahmen, hatten weniger Ahnung von westlichen Emotionen und zeigten auch nicht die gleichen physiologischen Reaktionen wie die westlichen Probanden.[48] Sie gaben auch weniger häufig an, die erwartete Emotion zu fühlen, als das im Westen der Fall gewesen war.
Nachfolgende Untersuchungen setzten auf verschiedene Methoden, um die entsprechenden Emotionen herbeizuführen, konnten die Erkenntnisse der Studie von 1983 über die physiologischen Veränderungen aber nicht wiederholen. Häufig verwenden Experimente Horrorfilme, tränenreiche Filmdramen oder ähnliches Material, um bestimmte Gefühle wachzurufen, während Herzfrequenz, Atmung und andere Körperfunktionen aufgezeichnet werden.[49] Viele dieser Studien entdeckten eine enorme Variabilität, was die diesbezüglichen Veränderungen anging. Es wurde also kein eindeutiges körperliches Reaktionsmuster erkennbar, das die Emotionen voneinander unterscheiden würde.[50] In anderen Studien zeigten sich zwar bezeichnende Muster, aber auch hier galt: Die verschiedenen Studien stellten eben auch verschiedene Muster fest, selbst wenn sie die gleichen Filmaufnahmen verwendeten.[51] Anders ausgedrückt: Konnten Studien anhand der Körperreaktionen Ärger von Traurigkeit von Angst unterscheiden, so ließen sich die Ergebnisse trotzdem nicht replizieren: Eine Instanz von Wut, Traurigkeit oder Angst, wie sie in der einen Studie ausgelöst wurde, unterschied sich von der Instanz dieser Gefühle in der anderen Studie.
Steht man vor einer derart enormen Anzahl verschiedener Experimente wie hier, fällt es schwer, ein stimmiges Fazit zu ziehen. Glücklicherweise gibt es in der Wissenschaft eine Methode, mit der man die Gesamtheit aller Daten analysieren und zu einem einheitlichen Schluss gelangen kann: die «Metaanalyse». Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durchkämmen eine große Anzahl von Primärstudien verschiedener Forschenden, um deren Resultate dann statistisch auszuwerten.
Nehmen wir mal eine vergleichsweise einfache Frage: Ist eine erhöhte Herzfrequenz zwingend Teil des körperlichen Fingerabdrucks von Glück? Statt nun eine eigene Studie durchzuführen, können Sie eine Metaanalyse anderer Studien erstellen, bei denen während einer glücklichen Erfahrung die Herzfrequenz gemessen wurde, selbst wenn dies nur nebenbei geschah (zum Beispiel, wenn die Studie den Zusammenhang zwischen Herzinfarkten und Sex untersucht, ohne auf den emotionalen Faktor einzugehen). Sie suchen sich also alle relevanten wissenschaftlichen Aufsätze zusammen, extrahieren die statistischen Daten und analysieren sie in der Gesamtheit, um Ihre Hypothese zu testen.
Was nun das Zusammenspiel von Emotionen und autonomem Nervensystem angeht, so wurden seit 2000 vier maßgebliche Metastudien durchgeführt. Die größte untersuchte 220 physiologische Studien an nahezu 22000 Testpersonen.[52] Keine der vier Metastudien fand einen widerspruchsfreien und spezifischen emotionalen Fingerabdruck im Körper. Stattdessen ergab sich, dass das körpereigene Orchester innerer Organe viele höchst unterschiedliche Symphonien spielt, wenn es um Glück, Angst und allen übrigen Emotionen geht.[53]
Diese Schwankungsbreite lässt sich auch in einem Versuch feststellen, der in dieser Form von verschiedenen Forschungslaboren in aller Welt durchgeführt wird. Dabei müssen die Probanden schwierige Aufgaben erfüllen, wie um jeweils 13 Zähler rückwärts zählen oder über ein polarisierendes Thema wie Abtreibung oder Religion diskutieren, während sie gleichzeitig verspottet werden. Die gestellte Aufgabe macht ihnen Schwierigkeiten, die Versuchsleiterin äußert ihre Unzufriedenheit über ihre schlechte Leistung und kritisiert oder beleidigt sie. Werden alle Versuchspersonen wütend? Nein.[54] Und noch wichtiger: Bei denen, die wütend werden, schlägt sich die Wut in unterschiedlichen körperlichen Parametern nieder. Manche Menschen kochen vor Wut, andere wiederum weinen. Wieder andere werden ganz ruhig und denken nach oder ziehen sich zurück. Jedes Verhalten (Toben, Weinen, Überlegen, Rückzug) ist von einem unterschiedlichen physiologischen Muster im Körper begleitet. Dies ist Physiologen bereits bekannt, die den Körper um seiner selbst willen studieren.[55] Selbst geringfügige Veränderungen der Körperhaltung – wie Sich-Zurücklehnen versus Sich-Vorbeugen mit gekreuzten Armen – können die physiologischen Reaktionen der wütenden Person vollkommen verändern.[56]
Wenn ich auf Tagungen die Resultate dieser Metaanalysen vorstelle, reagieren manche Zuhörerinnen und Zuhörer ungläubig: «Wollen Sie damit sagen, dass in einer frustrierenden, demütigenden Situation nicht jeder mit Wut reagiert, sodass sein Blutdruck steigt, seine Hände schwitzen und seine Wangen sich röten?» Und meine Antwort lautet: «Ja. Genau das will ich sagen.» Tatsächlich konnte ich schon zu Beginn meiner Karriere im Publikum die unterschiedlichsten Ausdrucksformen von Wut beobachten, denn es gab Anwesende, denen diese Resultate wirklich nicht passten. Manche rutschten unruhig auf ihren Stühlen hin und her. Andere schüttelten schweigend den Kopf. Einmal schrie mich ein Kollege an, wobei sein Gesicht krebsrot wurde und er mit dem gestreckten Zeigefinger in die Luft stach. Ein anderer Kollege fragte mich in mitfühlendem Ton, ob ich schon je echte Angst gespürt hätte, denn wenn ich je ernsthaft verletzt worden wäre, würde ich auf so eine absurde Idee gar nicht erst kommen. Ein weiterer Kollege meinte, er würde meinem Schwager (einem Soziologen, den er kannte) berichten, ich würde der Wissenschaft von den Emotionen schaden. Mein «schlagendstes» Beispiel ist ein sehr viel älterer Kollege, gebaut wie ein Footballspieler, der mich um gut 30 Zentimeter überragte. Er ballte die Faust und bot mir an, mich ins Gesicht zu schlagen, um mir zu veranschaulichen, wie echter Ärger aussieht. (Ich lächelte und dankte ihm für sein ausgeklügeltes Angebot.) In all diesen Fällen demonstrierten meine Kollegen die Bandbreite an möglichen Zornesäußerungen sehr viel effektiver, als meine Präsentation dies je hätte tun können.
Was aber bedeutet es, dass vier Metaanalysen, die für Hunderte von Experimenten standen, im autonomen Nervensystem keinen widerspruchsfreien, spezifischen Fingerabdruck für die einzelnen Emotionen finden konnten? Es heißt jedenfalls nicht, dass Emotionen ausgedacht oder körperliche Reaktionen vom Zufall bestimmt sind. Es heißt, dass zu verschiedenen Gelegenheiten, in verschiedenen Kontexten, in verschiedenen Studien bei dem gleichen Individuum ebenso wie bei verschiedenen Individuen sich die gleiche emotionale Kategorie in verschiedenen körperlichen Reaktionen zeigen kann.[57] Vielfalt, nicht Einheitlichkeit, ist die Norm. Diese Resultate passen zu dem, was Forschende der Physiologie schon seit mehr als 50 Jahren wissen: Verschiedene Verhaltensweisen weisen bei Herzfrequenz oder Atmung verschiedene Muster auf, die ihre einzigartige Dynamik unterstützen.[58]
Trotz des hohen Einsatzes an Zeit und finanziellen Mitteln konnte die Forschung nicht für eine einzige Emotion einen distinktiven körperlichen Fingerabdruck entdecken.
Meinen ersten beiden Versuchen, den objektiven Fingerabdruck von Emotionen (im Gesicht und im Körper) zu entdecken, war also kein Erfolg beschieden. Doch wie heißt es so schön: Manchmal, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich ein Fenster. Mein Fenster war die unerwartete Erkenntnis, dass eine Emotion nun mal kein Ding ist, sondern eine Kategorie einzelner Instanzen und dass jede Kategorie eine enorme Vielfalt aufwies. Wut zum Beispiel kann viel vielgestaltiger sein, als die klassische Sicht der Emotionen vorhersagt oder erklären kann. Wenn Sie wütend sind, toben und fluchen Sie dann oder kochen Sie eher still vor sich hin? Zahlen Sie verbal mit gleicher Münze zurück? Reißen Sie die Augen auf und runzeln Sie die Stirn? In all diesen Fällen kann Ihr Blutdruck hochschnellen, unverändert bleiben oder abfallen. Vielleicht hämmert Ihnen das Herz in der Brust, vielleicht auch nicht. Ihre Hände fangen an zu schwitzen oder bleiben trocken … was immer Ihren Körper in dieser Situation am besten darauf vorbereitet zu handeln.
Wie aber meisterte Ihr Gehirn diese so verschiedenen Ausdrucksformen der Wut, ohne den Überblick zu verlieren? Woher weiß es, welche Reaktion der jeweiligen Situation angemessen ist? Wenn ich Sie fragen würde, wie Sie sich in den beschriebenen Kontexten jeweils fühlen würden, würden Sie dann, ohne groß nachzudenken, eine differenzierte Antwort geben wie «gereizt» oder «enerviert» oder «stocksauer» oder «rachsüchtig»? Oder würden Sie in jedem Fall nur «wütend» sagen oder vielleicht noch «Ich würde mich mies fühlen»? Woher wissen Sie jetzt die Antwort auf diese Frage? Für diese Rätsel ist die klassische Sicht auf Emotionen blind.
Was ich zu jener Zeit nicht wusste: Als ich mich mit Emotionskategorien und der Frage, warum sie in sich so unterschiedlich waren, auseinandersetzte, wandte ich unbewusst ein biologisches Denkmodell an, das man Populationsdenkennennt.[59] Erstmals angewandt wurde es von Darwin. Eine Kategorie wie eine Tierart ist diesem Modell zufolge eine Population einzigartiger Individuen, die sich voneinander unterscheiden und die nicht durch einen irgendwie gearteten Fingerabdruck geprägt sind. Die Kategorie kann als Gruppe nur abstrakt und statistisch beschrieben werden.[60] So wie keine US-amerikanische Familie tatsächlich aus 3,13 Menschen besteht[61], so muss auch kein einzelnes Vorkommnis von Ärger (Instanz) einem durchschnittlichen Ärgermuster gehorchen (wenn wir denn ein solches identifizieren könnten). Keine einzige Instanz muss notwendigerweise dem flüchtigen Fingerabdruck des Ärgers ähneln. Was wir Fingerabdruck genannt haben, könnte ein schlichtes Klischee gewesen sein.
Sobald ich mir den Ansatz des Populationsdenkens zu eigen machte, veränderte sich meine ganze wissenschaftliche Landschaft. Plötzlich war die Vielfalt kein Fehler mehr, sondern normal, ja sogar wünschenswert. Ich setzte meine Suche nach einer objektiven Methode, die erlaubte, Emotionen voneinander zu unterscheiden, fort, aber der Charakter meiner Suche hatte sich geändert. Meine Skepsis war allmählich gewachsen. Nun blieb mir nur noch ein Ort, an dem ich nach diesen Fingerabdrücken suchen konnte. Es war an der Zeit, mich dem Gehirn zuzuwenden.[62]
Die Wissenschaft studiert seit Langem Menschen mit Gehirnschäden (Läsionen), um die Emotionen bestimmten Teilen des Gehirns zuzuordnen. Hat eine Person, bei der ein bestimmtes Gehirnareal geschädigt ist, Schwierigkeiten, ein bestimmtes Gefühl (und zwar nur dieses eine) zu erleben oder wahrzunehmen, dann wäre dies ein Beleg dafür, dass dieses Gefühl von den Neuronen in diesem Areal abhängig ist. Das ist ein bisschen so, als wollte man herausfinden, an welcher Sicherung welche elektrischen Geräte in Ihrem Haus hängen. Anfangs sind alle Sicherungen drinnen, und alles funktioniert perfekt. Dann legen Sie einen Schalter um (was im Netzwerk einer Läsion gleichkommt) und stellen fest, dass das Licht in der Küche nicht mehr brennt. Nun wissen Sie, welche Funktion diese Sicherung hat.
Die Suche nach dem Sitz der Angst im Gehirn ist hierfür das Paradebeispiel, denn viele Jahre lang sah die Wissenschaft in der Angst das Paradigma einer Emotion, die sich einer bestimmten Gehirnregion zuordnen lässt – nämlich der Amygdala (Mandelkernkomplex), einer Gruppe von Nuclei, die man tief im Schläfenlappen findet.[63] In den 1930er-Jahren brachte man die Amygdala erstmals mit Angst in Verbindung, als Heinrich Klüver und Paul C. Bucy die Schläfenlappen von Rhesusaffen entfernten. Da sie keine Amygdala mehr hatten, näherten sich die Tiere nun ohne Zögern unbekannten Objekten sowie Tieren, wie Schlangen oder fremden Affen, denen sie vor der Operation spontan aus dem Weg gegangen wären. Klüver und Bucy schrieben dieses Verhalten der «Abwesenheit von Angst» zu.[64]
Bald darauf nahmen andere Wissenschaftler Menschen mit geschädigter Amygdala in den Blick, um herauszufinden, ob diese Patientinnen und Patienten Angst erleben und wahrnehmen konnten. Die meiststudierte Fallgeschichte ist die einer Frau, die als «SM