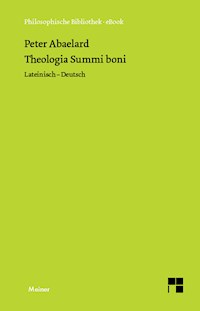Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Schätze der christlichen Literatur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Die tragische Liebesgeschichte zwischen dem berühmten Theologen Peter Abaelard und der jungen Adligen Heloise hat seit dem 12. Jahrhundert viele Generationen berührt. Ihr beider Glück ist ihnen durch Mißgunst verwehrt. Später, ins klösterliche Leben zurückgezogen, beginnen sie einen Briefwechsel, der heute Weltliteratur gehört: Leidenschaftlich, und doch Trost im Glauben findent, verbindet sie ihr unauslöschbares, seelisches Band, bis zu ihrem Tode.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 483
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Schätze der christlichen Literatur
Band 31
Inhalt.
Einleitung.
I. Brief: Abaelard an einen Freund (Die Leidensgeschichte).
II. Brief: Heloise an Abaelard.
III. Brief: Abaelard an Heloise.
IV. Brief: Heloise an Abaelard.
V. Brief: Abaelard an Heloise.
VI. Brief: Heloise an Abaelard.
VII. Brief: Abaelard an Heloise.
VIII. Brief: Abaelard an Heloise.
IX. Brief: Heloise an Abaelard.
X. Brief: Abaelard an Heloise (Begleitschreiben).
XI. Brief: Abaelard an Heloise (Mit einer Predigtsammlung).
XII. Brief: Abaelard an Heloise (Abaelards Glaubensbekenntnis).
Einleitung.
DIE Übersetzung dieser Briefe ist entstanden in einer Zeit, da körperliches Leiden mir ein selbständiges wissenschaftliches Arbeiten unmöglich machte. Ich las und übersetzte anfangs zu meiner eigenen Unterhaltung und Übung; doch je mächtiger diese Urkunden der Liebe und des geistigen Verkehrs zweier so hochherziger Menschen mich selber anzogen, desto lebhafter regte sich der Wunsch, auch anderen sie zugänglich zu machen. Unsere kirchengeschichtliche Literatur enthält so manchen edlen Schatz, der in staubiger Hülle vergessen in den Bibliotheken aufgespeichert steht – so manches Schriftdenkmal, das in seiner fremden Sprache nur zum Gelehrten redet, während es ans Licht gezogen und verständlich gemacht manchem ernstergerichteten Leser Genuß und Erbauung zu bieten vermöchte.
So sind auch die Briefe, die von Abaelard und Heloise auf uns gekommen sind, in Deutschland wenigstens, nur wenig bekannt, obwohl die beiden zu jenen Liebespaaren von weltgeschichtlichem Rufe gehören, deren Namen unauflöslich miteinander verbunden sind, wie Hero und Leander, Tristan und Isolde, Dante und Beatrice. Im Ausland dagegen und besonders in Frankreich schenkte man diesen Briefen frühzeitig Aufmerksamkeit, und namentlich die eigentlichen Liebesbriefe wurden mannigfach dichterisch bearbeitet und romanhaft ausgeschmückt – jedoch nicht zu ihrem Vorteil: man vergleiche die Bearbeitungen, die diesem Gegenstand durch einen Pope und Colardeau – bei uns durch eine formvollendete poetische Übersetzung Bürgers eingeführt – zuteil geworden sind, mit unserem Original, und man wird leicht gewahr werden, um wie viel edler und, bei aller Leidenschaftlichkeit, keuscher dieses letztere ist als jene pikanten Leistungen.
Eine sehr elegante, dabei meist textgemäße französische Übersetzung der Briefe gibt O. Gréard in seinem Buche: „Lettres complètes d’Abélard et d’Héloise, Paris, Garnier Frères.“ Der französischen Übersetzung ist der lateinische Text in der Rezension von Viktor Cousin beigegeben, die auch unserer Übersetzung zugrunde liegt.
Im Jahre 1844 ist eine deutsche Übersetzung des Briefwechsels erschienen von Moriz Carrière1, und dieses Werk würde meine Übersetzung überflüssig machen, wenn es überhaupt noch im Buchhandel zu haben wäre. Da es jedoch gänzlich vergriffen ist – ich selbst habe es nur nach langwierigen Bemühungen zu Gesicht bekommen – und eine neue Auflage nicht in Aussicht steht, so glaubte ich mich zu dieser neuen Veröffentlichung berechtigt. – Carrière schickt seiner Übersetzung eine ausführliche, ebenso gelehrte wie geistvolle Einleitung voraus, in der er mit dem Feuer einer edlen Begeisterung Abaelards philosophischen und theologischen Standpunkt darstellt. Diese Einleitung bildet nahezu ein Drittel des ganzen Buches, so daß eigentlich in ihr der geistige Schwerpunkt desselben zu sehen ist. Ich meinerseits beschränke mich in dieser kurzen Einleitung auf das, was dem Leser zum Verständnis der Briefe notwendig ist – zumal uns in den Briefen Abaelard doch mehr als Mensch, weniger als Gelehrter entgegentritt.
Die hier veröffentlichte Briefsammlung umfaßt im ganzen zwölf Briefe. Dabei ist als erster Brief mitgezählt das unter dem Namen der „Leidensgeschichte“ (historia calamitatum) bekannte Schriftstück, das in Form eines Briefes, der an einen unbekannten Freund Abaelards adressiert ist, das vielbewegte Leben des letzteren schildert bis zu dem Zeitpunkt, wo er in den großen Streit mit Bernhard von Clairvaux eintritt – also ein Stück Autobiographie, das die Einleitung zu dem folgenden Briefwechsel bildet.
Überhaupt wurde dieser Brief die Veranlassung zu der ganzen folgenden Korrespondenz: über ein Jahrzehnt war seit der Trennung der Liebenden vergangen, und allem Anschein nach hatte während dieser ganzen Zeit jeder Verkehr zwischen ihnen aufgehört. Da kam durch einen Zufall jener Brief Abaelards in die Hände Heloisens und weckte „der alten Wunde unnennbar schmerzliches Gefühl.“ Die Geschichte der Leiden des geliebten Mannes, zu denen er auch mit vollem Recht seine Liebe zählte, facht den Funken, der noch immer in ihrem Herzen glimmt, zur hellen Flamme an, und noch einmal durchlebt sie in der Erinnerung alle Freuden und alle Leiden einer hohen Liebe. Aus der Hochflut dieser neuerwachten Gefühle heraus sind die Briefe II und IV geschrieben: eine Beichte sondergleichen, ein Herzensaufschrei in den unmittelbarsten, leidenschaftlichsten, kühnsten Lauten, die je über Frauenlippen gekommen sind. Im Vergleich mit diesen Ergüssen hat man von jeher die Antwortschreiben Abaelards auffallend ruhig und kühl gefunden. In der Tat gleicht er in seinen Briefen (III und V) dem starren Felsenriff, das unbewegt und fühllos bleibt, mitten in den ewig wiederholten Umarmungsversuchen der Wogen. Man hat ihm aus dieser Kälte schwere moralische Vorwürfe gemacht, ja an sein Verhalten auch schon allgemeine philosophische Betrachtungen darüber angeknüpft, wie verschiedenartig die beiden Geschlechter lieben. So besonders Johannes Scherr in seiner geistreich-extremen Weise (Menschliche Tragikomödie, Bd. 2, „Heloise“). Die Art, wie Abaelard Heloisens hungriges Herz abzuspeisen sucht, wie er der Frau gegenüber, mit der er einst so wenig geistlich verfahren war, nun ganz die Sprache des Geistlichen, des orakelnden Heiligen und Propheten führt, macht im ersten Augenblick einen peinlichen, unangenehmen Eindruck, und hat sogar stellen-weise etwas Empörendes. Allein der Ton, den er anschlägt, ist keine angenommene Maske; was er an Heloise schreibt, sind nicht bloß fromme Phrasen, sondern es ist ihm bitterer Ernst; er ist wirklich bekehrt, er bereut und sieht von diesem Standpunkt aus sein und Heloisens äußeres Mißgeschick für eine gnädige Fügung Gottes zur Rettung ihrer Seelen an. Sodann ist allerdings das Gefühl, das in Heloisens Herz eben jetzt in neuen Flammen erwachte, in ihm gänzlich erstorben. Er macht daraus kein Hehl; er sucht die einst Geliebte darüber nicht hinwegzutäuschen. Seine Wahrhaftigkeit ist seine Entschuldigung. Wo aber eine Liebe erloschen ist, da wird niemand glühende Liebesbriefe erwarten.
Man wird solche aber auch nicht erwarten, wenn man die Verschiedenheit des Lebenswegs und der weiteren Geschicke der einst in Liebe Verbundenen in Betracht zieht. Heloise war einst wider ihren Willen und wider ihre Natur ins Kloster gegangen, nur aus Gehorsam gegen den geliebten Mann. Sie hatte damit ein Opfer gebracht, dem ihre Natur nicht gewachsen war. Ruhe hatte sie jedenfalls nicht gefunden hinter den Klostermauern. Zwar brachte sie es durch ihre geistige und sittliche Energie dahin, daß sie in den Ruf besonderer Heiligkeit kam, aber man lese ihre erschütternden Selbstanklagen im vierten Brief, um einen Einblick in dies ruhelose unbefriedigte Herz zu gewinnen. Aus solchem Gemütszustand heraus sind jene leidenschaftlichen Ergüsse begreiflich, denen gegenüber Abaelards Auslassungen und beichtväterliche Ermahnungen freilich kalt erscheinen. Ferner ist zu bedenken: mit dem Eintritt ins Kloster war Heloisens Leben eigentlich abgeschlossen; neue gewaltige Eindrücke, durch die die alten verwischt worden wären, erwarteten die Klosterfrau nicht mehr. Sie zehrte von einer kurzen Vergangenheit. Was sie aber mitbrachte von Erinnerungen an die Welt, von Lebenseindrücken, das alles war für sie beschlossen in dem Namen Abaelard. Dieser Name, ihr Ein und Alles, lebte in ihrem Herzen und mit ihm die Liebe, und so bedurfte es nur eines zündenden Funkens, um die zusammengesunkene Glut aufs neue zu entfachen. – Abaelard dagegen war aus dem friedlichen Port des Klosters, wohin auch er sich geflüchtet hatte, mehrmals wieder hinausgeschleudert worden auf die hochgehenden Wogen des Lebens und der Händel dieser Welt. Er hatte in seinem Beruf, der zwar große Aufregungen und gehässige Verfolgungen, aber auch glänzende Triumphe mit sich brachte, einen gewissen inneren Halt und Befriedigung gefunden. Jedenfalls aber war sein Leben so reich an erschütternden neuen Eindrücken und packenden Erlebnissen, daß jene eine Erinnerung an seine Liebe, jenes Erlebnis mit Heloise notwendig davor erblassen mußte. Er fühlt sich überhaupt zu der Zeit, da unsere Briefe geschrieben wurden, als ein gehetztes Wild, das von allen Seiten bedroht ist. Er bittet Heloise und ihre Nonnen um ihre besondere Fürsprache im Gebet; er ist ein wegmüder Mann, hat Todesgedanken und will im „Paraklet“, dem Kloster, das er Heloisen eingeräumt, begraben sein. Daß er in dieser Verfassung andere Briefe schrieb, als Heloise, wird man begreiflich finden. Will man ihm etwas anrechnen, so mag man ihm einen Vorwurf daraus machen, daß er einst das Opfer einer geheimen Ehe (wiewohl dies immer noch besser war als die damals unter Klerikern ganz gewöhnlichen wilden Ehen) – und das noch größere Opfer des Klostergelübdes von Heloise angenommen hat.
Nicht ohne Rührung liest man, wie Heloise nun im sechsten Brief die Stimme des Herzens, die bei Abaelard kein Echo zu wecken vermocht hatte, zu bezwingen sucht – „wiewohl wir nichts so wenig in der Gewalt haben wie unser Herz“ – und um dennoch den Verkehr mit Abaelard aufrecht zu erhalten, auf das wissenschaftliche Gebiet übergeht. Sie verlangt von Abaelard Aufschluß über die Entstehung des Mönchswesens, und bittet ihn um Abfassung einer Klosterregel mit besonderer Rücksicht auf das weibliche Geschlecht. – Auf beide Anliegen bleibt Abaelard die Antwort nicht schuldig, sondern er legt sie nieder in zwei ausführlichen Abhandlungen (Briefe VII und VIII), von denen namentlich die zweite nach unseren Begriffen eher ein Buch als ein Brief zu nennen wäre. Ich habe sie dennoch beide in ihrem ganzen Umfang aufgenommen, weil sie in kultur- und kirchenhistorischer Beziehung von allgemeinerem Interesse sind und besonders in die Anschauungen des Mittelalters und in den Betrieb des Klosterwesens einen lebendigen Einblick gewähren.
Bezeichnend für Abaelard ist es, daß er am Schluß seiner Klosterregel im Geiste Benedikts den Nonnen die Beschäftigung mit der Wissenschaft aufs nachdrücklichste anbefohlen hatte. Im neunten Briefe nun schreibt Heloise an Abaelard, daß sie in dem Bestreben dieser seiner Vorschrift Folge zu leisten, vielfach auf Hindernisse stoßen, da es ihnen oftmals am nötigen Verständnis fehle und sie über einzelne Fragen nicht ins reine kommen. Und so legt sie ihm denn zweiundvierzig Fragen zur Beantwortung vor, die meist im Zusammenhang mit der Bibellektüre, wie sie von den Nonnen betrieben wurde, stehen. Diese Fragen sind uns samt den Antworten Abaelards überliefert; doch habe ich sie selbstverständlich nicht in unsere Briefsammlung aufgenommen. Denn dieses Frag- und Antwortbuch entbehrt jedes persönlichen Charakters und ist von ausschließlich wissenschaftlichem Interesse. – Die Briefe X und XI sind Begleitschreiben Abaelards zu literarischen Sendungen an Heloise. Der zehnte Brief ist dadurch interessant, daß er ein Schreiben Heloisens an Abaelard rekapituliert, in dem sie über den Mißstand klagt, der in Beziehung auf die gottesdienstlichen Gesänge in ihrem Kloster herrsche. Abaelard verfaßte infolge dieser Anregung selbst eine größere Anzahl von Hymnen zum gottesdienstlichen Gebrauch für die Nonnen und hängte dieser Sammlung in seinem Begleitschreiben den üblichen gelehrten Zopf an. – Der elfte Brief ist ein kurzes Billet, das Abaelard mit einer Sammlung eigener Predigten an Heloise sandte. – Der zwölfte Brief endlich enthält das Glaubensbekenntnis Abaelards. Offenbar hatte er es für nötig befunden, die Freundin über seine Rechtgläubigkeit zu beruhigen, die von seinen Gegnern so lebhaft bestritten wurde. Der Brief ist durch eine Schrift seines treuen und streitbaren Schülers Berengar auf uns gekommen; das darin enthaltene Bekenntnis klingt für unsere Begriffe sehr orthodox. – Auch an diese Briefe hat man schon die Torturschraube der Echtheitsfrage angelegt, allein ohne Erfolg: wenn irgendeine Urkunde aus dem Mittelalter, so tragen sie den Stempel der Echtheit an sich. –
Zum Verständnis der Briefe ist es nötig, ein kurzes Wort über die hauptsächlichsten Sätze und Lehren Abaelards zu sagen. Wir sehen aus der Selbstbiographie, welchen Reiz literarische Kämpfe, wissenschaftliche Disputationen und Erörterungen für Abaelard hatten. Es scheint damals überhaupt unter der studierenden Jugend eine wahre Disputierwut geherrscht zu haben. Alles und nichts bewies man mittels der dialektischen Methode und vielfach glaubte man wohl auch damals, „wenn man nur Worte hörte, es müsse sich dabei auch etwas denken lassen.“ Abaelard war ein geborenes Disputiergenie, und schon als junger unerfahrener Schüler machte er mit seiner Streitsucht den Lehrern zu schaffen.
Auf dem Gebiete der Philosophie war zu jener Zeit die Kardinalfrage, über der die Gelehrten sich in zwei Lager teilten, die Frage nach dem Verhältnis der Allgemeinbegriffe zu den Einzeldingen (z. B. Menschheit – Mensch). Der Streit ging zurück bis auf Plato und Aristoteles. Nach Plato kommt nur dem Allgemeinen, der Idee wirkliche Existenz zu, während die Einzeldinge nur schwache unvollkommene Abbilder, gleichsam Schatten davon sind. So hat z. B. die Idee, das Urbild der Schönheit (in einer anderen Welt), reale Existenz und alles Einzelne, was wir hier in dieser Welt schön finden, ist nur ein Abglanz dieses Ideals. Im Gegensatz zu dieser Meinung lehrte Aristoteles: reales Sein kommt nur dem Einzelding zu, die Allgemeinbegriffe existieren nur im menschlichen Denken, sind nichts als Kombinationen des menschlichen Verstandes, eben nichts als Begriffe (nomina).
Realismus und Nominalismus wurden nun seit dem elften Jahrhundert die Schlagworte, die die Parteien auf ihre Fahne schrieben, je nachdem sie sich an Plato oder an Aristoteles anschlossen. Der eigentliche wissenschaftliche Begründer des Nominalismus ist Roscelinus; der Hauptvertreter des Realismus Wilhelm von Champeaux. Beide waren Abaelards Lehrer, aber keiner konnte ihm ganz Genüge tun. Mit welcher Kühnheit er Wilhelm von Champeaux nötigte, seine Lehre zu ändern, lesen wir in Abaelards erstem Briefe. Daß diese philosophischen Theorien, je nachdem man sie auf die Theologie anwandte, zu bedenklichen Resultaten führen konnten, sieht man an dem Beispiel Roscelins. Dieser leugnete als konsequenter Nominalist die wirkliche Existenz des Allgemeinbegriffs „Gottheit“ und es blieben ihm nur die drei Einzelwesen Vater, Sohn, Geist als real existierend, während ihm die Einheit in und trotz der Dreiheit verloren ging, so daß er der Ketzerei des Tritheismus (der Dreigötterlehre) beschuldigt wurde. Seitdem war der Nominalismus den Vertretern der Kirchlichkeit verdächtig und anrüchig. Aber auch Abaelard selbst bekämpfte diesen Nominalismus seines ehemaligen Lehrers, und in der schwebenden Frage nahm er seine Stellung in der Mitte zwischen Roscelinus und Wilhelm von Champeaux, indem er lehrte: allerdings sei der Begriff, das Allgemeine Grund und Wesen der Einzeldinge und dürfe nicht bloß (wie die Nominalisten behaupteten) als bloße Abstraktion des Verstandes und Vorstellung angesehen werden. Allein ebensowenig dürfe man den Allgemeinbegriffen eine von den Einzeldingen gesonderte Existenz zuschreiben (wie die Realisten), vielmehr komme das Allgemeine in der Welt der Wirklichkeit nur in Verbindung mit dem Individuellen zur Erscheinung.
War demnach Abaelards philosophischer Standpunkt unter dem Einfluß der Platonischen Ideenlehre eher realistisch (also nach damaligen Begriffen korrekt) zu nennen als nominalistisch, so gingen auch auf dem Gebiete der Theologie seine wissenschaftlichen Bestrebungen nicht etwa auf Zersetzung und Auflösung der kirchlichen Dogmen aus, sondern was die gesamte scholastische Theologie anstrebte, die Vernünftigkeit der bestehenden Dogmen verstandesmäßig nachzuweisen, das wollte auch er. Nur ging er dabei mit einer Kühnheit und Konsequenz zu Werke, die ihm in kurzer Zeit eine scharfe Gegnerschaft erwecken mußte. Schon sein Erkenntnisprinzip drehte die bisherige Anschauung geradezu um. Bis jetzt hatte in der Kirche der Grundsatz gegolten: „credo, ut intellegam“ („ich glaube, damit ich verstehe“), d. h. der Glaube muß dem Verständnis vorausgehen. Abaelard dagegen lehrte, der Ausgangspunkt alles Wissens sei der Zweifel; etwas zu glauben, ohne es zuvor eingesehen, mit dem Verstande durchdrungen zu haben, sei widersinnig und unwürdig.
Am heftigsten wurde Abaelard wegen seiner „Lehre von der Trinität“ angegriffen; in seiner „Leidensgeschichte“ schildert er aufs anschaulichste, wie er das Buch, in dem diese Lehre enthalten war, auf der Synode von Soissons (1121) verbrennen mußte; und noch zwanzig Jahre später, auf der Synode zu Sens, wo er definitiv verurteilt wurde, hielt man ihm diese Lehre als Ketzerei vor. Er lehrte nämlich über die Dreieinigkeit folgendes: Die Substanz der einheitlichen Gottheit werde im einzelnen bestimmt durch die drei Namen Vater, Sohn, Geist. Vater heiße die Gottheit nach der ihr zukommenden Eigenschaft der Allmacht, Sohn nach ihrer Weisheit, heiliger Geist nach ihrer Liebe und Güte. Gott ist also Vater, Sohn und Geist, d. h. er ist allmächtig, weise und gütig. Diese Lehre zeigte eine bedenkliche Verwandtschaft mit der von der Kirche verdammten Trinitätslehre des Sabellius, der die drei Personen der Gottheit als verschiedene Offenbarungsformen der einen Gottheit nahm (Modalismus).
Großen Anstoß mußten auch seine „ethischen Grundsätze“ und die daraus resultierende „Lehre von der Sünde“ erregen. Nach Abaelard kommt für das sittliche Urteil nicht die Tat als ausgeführte in Betracht, sondern die Gesinnung, aus der sie entspringt. Die Kriegsknechte, die den Herrn kreuzigten und glaubten damit etwas Gutes zu tun, haben nicht gesündigt. Andererseits kann Sünde vorhanden sein, wo die sündige Tat noch gar nicht geschehen ist. Eva hatte den Sündenfall bereits in dem Augenblick begangen, als sie den Entschluß faßte, den Apfel zu essen. Alles kommt darauf an, daß einer Liebe hat. „Habe nur Liebe und du magst tun was du willst.“ Das Echo dieser Lehre vernehmen wir in den Briefen wiederholt.
Während Abaelard so sehr den tiefen Ernst der Sünde verkannte, trat er auch mit seiner „Lehre von der Erlösung“ in scharfen Gegensatz zu der Kirchenlehre. In der Kirche war anerkannt die Satisfaktionstheorie des Anselm von Canterbury, wonach Gott durch Hingabe seines Sohnes die erste Sünde getilgt und die Menschheit von dem aus jener Sünde entspringenden ewigen Verderben erlöst hat. Wie kann, ruft Abaelard aus, die verhältnismäßig geringe Sünde durch die unendlich größere gesühnt werden, wie sie sich in der Tötung Gottes darstellt! Vielmehr besteht die Erlösung in einem innerlichen, rein sittlichen Prozeß. Nämlich im Leben, Leiden und Sterben Jesu bekundet sich eine so mächtige Liebe zur Menschheit, daß dieselbe notwendig in uns eine Gegenliebe entzündet von solcher Kraft, daß wir dadurch von der Knechtschaft der Sünde erlöst und Kinder Gottes werden. –
Dies waren die hauptsächlichsten Irrlehren, die man Abaelard zum Vorwurf machte, und solcher einzelner Sätze bedurfte man freilich, wenn man ihn auf Kirchenversammlungen der Ketzerei überführen wollte. Im Grunde aber war der Kampf, in dem Abaelard kämpfte und schließlich fiel, ein viel prinzipiellerer. Es war der große Gegensatz zwischen Dialektik und kontemplativer Mystik, dem er zum Opfer fiel. Die letztere Richtung nahm eben damals durch ihren geistesgewaltigen Vertreter, Bernhard von Clairvaux, einen mächtigen Aufschwung. Er ist der eine der beiden Gegner, die Abaelard am Schluß seiner „Leidensgeschichte“ wie drohende Wolken an seinem Horizont auftauchen sieht, und seinen Machinationen ist er erlegen. Während die Dialektik durch Vermittelung des Verstandes zur Glaubenseinsicht und Gotteserkenntnis zu gelangen strebte, wollte die Mystik die Gottheit unmittelbar erfahren und erfassen. Als den Weg dazu bezeichnet Bernhard die Liebe. „Gott wird erkannt, soweit er geliebt wird“ war sein Grundsatz. Nicht Nachdenken und logische Schlüsse führen in die Nähe Gottes, sondern die Heiligung, deren höchste Blüte die Ekstase ist, die freilich nur wenigen in besonders geweihten Momenten zuteil wird, und mittelst deren sich die Seele zum unmittelbaren Anschauen und Genießen der Gottheit emporschwingt. In diesem Zustand werden ihr Offenbarungen kund, wie sie durch Studium und Wissenschaft niemals erreicht werden.
Dieser gewaltige Mensch, von dem selbst das Haupt der Kirche willig Belehrung annahm, lud den Vielverfolgten zum Entscheidungskampf auf die Synode zu Sens im Jahr 1141. Der langvorbereitete Streich fiel vernichtend auf Abaelards Haupt. Zwar appellierte er von dem Urteil der Synode, das ihn der Ketzerei bezichtigte, an den Papst; allein vergebens. Der päpstliche Spruch lautete auf Exkommunikation, lebenslängliche Klosterhaft und Verbrennung seiner Schriften. Abaelard wollte selbst seine Sache in Rom führen und machte sich auf den Weg. Aber er kam nicht weit. Unterwegs kehrte der müde Wanderer in der Abtei zu Cluny ein; Abt Petrus der Ehrwürdige nahm ihn auf und bot ihm sein Kloster zum dauernden Asyl für die kurze Zeit, die ihm noch vergönnt war, an. Abaelard machte durch die Vermittlung des Petrus seinen Frieden mit der Kirche und mit Bernhard, und hat wenigstens sein letztes Lebensjahr unangefochten im Frieden des Klosters verbracht.
Über seine letzten Lebenstage haben wir einen anschaulichen Bericht von Petrus, den dieser an Heloise schickte. Voll Befriedigung weist der ehrwürdige Abt darauf hin, wie gläubig und kirchlich, wir möchten sagen, wie orthodox der große Gelehrte gestorben sei. Auf uns aber macht der Bericht den wehmütigen Eindruck, daß der einst so geistesmächtige kühne Streiter hingeschieden ist als ein körperlich und geistig gebrochener Mann. Die in Betracht kommende Stelle in dem Brief des Abts Petrus lautet in der Übersetzung folgendermaßen: „Ich erinnere mich meines Wissens nicht, in demütiger Haltung und Gebärde seinesgleichen gesehen zu haben, so daß einem aufmerksamen Beobachter weder Germanus niedriger, noch selbst Martinus ärmer erscheinen konnte. Wiewohl er in der großen Schar unserer Brüder auf meine Veranlassung eine höhere Stellung einnahm, schien er doch in seinem vernachlässigten Gewand der letzte von allen zu sein. Oftmals, wenn er bei Prozessionen nach der Sitte mit mir den anderen voranschritt, wunderte ich mich und mußte staunen, daß ein Mann von solch hochberühmtem Namen sich so sehr gering achten und demütigen könne. Es gibt in unserem Orden Leute, denen ihr geistliches Gewand nicht kostbar genug sein kann; er war in dieser Hinsicht so bescheiden, daß er sich mit dem unscheinbarsten begnügte. So hielt er es auch mit Speise und Trank und mit allen leiblichen Bedürfnissen. Nicht etwa bloß das Überflüssige, sondern alles was nicht unumgänglich notwendig war, verwarf er für sich und andere in Wort und Beispiel. Beständig war er mit Lesen beschäftigt, häufig im Gebet vertieft; sein Schweigen unterbrach er nur, wenn der vertrauliche Verkehr mit den Brüdern oder ein öffentlicher Vortrag über göttliche Dinge im Konvent ihn dazu nötigten. Die himmlischen Sakramente feierte er so oft er konnte, Gott das Opfer des ewigen Lamms darbringend; ja nachdem er durch meine Briefe und Verwendung die päpstliche Gnade wieder erlangt hatte, nahm er fast beständig daran teil. Was soll ich viel Worte machen? Sein Geist, sein Mund, seine Handlungsweise dachte, lehrte und bezeugte allezeit göttliche, philosophische, wissenschaftliche Wahrheiten. Also lebte er mit uns noch eine Zeitlang schlecht und recht, gottesfürchtig und meidend das Böse, und weihte Gott die letzten Tage seines Lebens. Da er an einem starken Hautausschlag und anderen körperlichen Beschwerden litt, sandte ich ihn zur Erholung nach Châlons. In der Nähe der Stadt, am Saônefluß, einer der schönsten Gegenden unseres Burgunder Landes, hatte ich ihm für einen passenden Aufenthalt gesorgt. Hier nahm er die gewohnten Studien wieder auf, so weit die Krankheit es ihm gestattete und saß beständig über den Büchern. Und wie man von Gregor dem Großen erzählt, so ließ auch er keinen Augenblick verstreichen, ohne zu beten, zu lesen, zu schreiben oder zu diktieren. In der Ausübung solch frommer Werke fand ihn bei seiner Ankunft der Heimsucher, von dem das Evangelium spricht, und zwar nicht schlafend wie viele, sondern wachend. Ja wachend fand er ihn und berief ihn zur himmlischen Hochzeit, nicht als eine törichte, sondern als eine kluge Jungfrau. Denn er trug bei sich die Lampe, gefüllt mit Öl, das ist ein Gewissen erfüllt vom Zeugnis heiligen Wandels. Den gemeinsamen Tribut der Sterblichkeit zu entrichten, wurde er stärker und stärker von der Krankheit ergriffen und gelangte in kurzer Zeit zum Ziele. Wie fromm, wie gottergeben, wie ganz katholisch er seinen Glauben und seine Sünden bekannte, mit welcher Inbrunst sein sehnsüchtiges Herz die letzte Wegzehrung und das Unterpfand des ewigen Lebens, nämlich den Leib des Herrn, unseres Erlösers, empfing, wie gläubig er Leib und Seele für Zeit und Ewigkeit ihm empfahl, das bezeugen alle Brüder des Klosters, in dem der Leib des heiligen Märtyrers Marcellus ruht. Also beschloß Meister Petrus die Tage seines Lebens. Er, der durch sein Wissen und sein Lehren fast der ganzen Welt bekannt und überall berühmt war, hat in der Schule dessen, der gesagt hat: „lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig“ – sanftmütig und demütig ausgeharrt, und ist also, das dürfen wir glauben, zu ihm selbst hinübergegangen.“
Ein chronologischer Überblick über das Leben Abaelards und Heloisens ergibt nach dem heutigen Stande der Forschung folgende Daten: Abaelard ist geboren zu Palais bei Nantes im Jahr 1079; Heloise2 geboren zu Paris 1101. Im Jahr 1113 ist Abaelard das Haupt der Pariser Schule. Nach längerer Abwesenheit kehrt er 1117 nach Paris zurück und lernt im Jahr 1118 die damals siebzehnjährige Heloise kennen, ihr Verhältnis dauert während des Jahrs 1118-19. Die Gründung des Klosters „Zum Paraklet“ durch Abaelard fällt ins Jahr 1123. Von 1125 an ist Abaelard im Kloster von St. Gildas. Im Jahre 1129 wird Heloise mit ihren Nonnen aus St. Denis vertrieben. Vom Jahre 1131 stammt die Bulle des Papstes Innozenz II., worin die Überweisung des Parakleten an Heloise bestätigt wird. Aus dem Jahre 1132 ungefähr datiert die „Leidensgeschichte“ (Brief I). Im Jahre 1134 verläßt Abaelard das Kloster St. Gildas. 1136 ist er wieder Lehrer auf dem Berge der heiligen Genoveva. Im Jahre 1141 wird er auf dem Konzil von Sens verurteilt und stirbt 1142 im Kloster zu St. Marcel bei Châlons-sur-Saône. Heloise folgt ihm im Jahre 1163.
Davos, im März 1894.
Dr. P. Baumgärtner.
1 M. Carrière: „Abælard und Heloise. Ihre Briefe und Leidensgeschichte übersetzt und eingeleitet durch eine Darstellung von Abælards Philosophie und seinem Kampf mit der Kirche.“ (Gießen 1844, 2. Auflage 1853.)
2 Über sonstige Personalien Héloïsens sind wir ganz im Dunkeln. Nicht einmal ihre Abkunft steht fest. Es sind darüber schon alle mögliche Vermutungen aufgetaucht: von der Behauptung, sie stamme aus dem Geschlecht der Montmorency, einem der ältesten Adelsgeschlechter Frankreichs – bis zu der Ansicht, sie sei nicht sowohl die Nichte des Kanonikus Fulbert gewesen, als welche sie in den Briefen figuriert, sondern dessen eigene Tochter.
I. Brief.
Abaelard an einen Freund.
Die Leidensgeschichte.
GEWÖHNLICH sind es nicht Worte, sondern handgreifliche Vorbilder, die das menschliche Herz am meisten erregen oder aber zur Ruhe bringen. Darum habe ich mich entschlossen, dir zum Trost die Geschichte meiner Leiden niederzuschreiben, nachdem ich schon durch mündlichen Zuspruch dich aufzurichten versucht habe, als du das letzte Mal bei mir weiltest. Erkenne aus diesen Zeilen, daß das, was du Leiden nennst, im Vergleich mit den meinigen überhaupt keine sind oder doch nur geringfügige Heimsuchungen – und lerne sie geduldig tragen.
Ich bin geboren in der Stadt Palais, an der Grenze der Bretagne, ungefähr acht Stunden östlich von Nantes gelegen. Ein lebhaftes Temperament und ein leichtempfänglicher Sinn für die Wissenschaft war das Erbe meines heimatlichen Bodens oder des Blutes, das in meinen Adern rollte. Mein Vater hatte sich etwas mit Wissenschaft befaßt, ehe er den ritterlichen Waffenschmuck angelegt hatte, und später war er so sehr für das Studium eingenommen, daß er darauf sah, alle seine Söhne zuerst wissenschaftlich auszubilden, ehe sie sich im Waffenhandwerk übten. Und so geschah es auch. Ich war der Erstgeborene, und je mehr er mich als solchen ins Herz geschlossen hatte, desto mehr war er bei mir auf einen sorgfältigen Unterricht bedacht. Die Fortschritte, die ich in den Wissenschaften mit so leichter Mühe machte, spornten meinen Eifer nur an und schließlich war meine Neigung zu ihnen so stark geworden, daß ich allen kriegerischen Glanz samt meinem Erbe und den Vorrechten meiner Erstgeburt drangab und die Jüngerschaft des Mars verlassend mich ganz in den Dienst Minervas stellte. Und da ich allen Systemen der Philosophie die Rüstkammer der Dialektik vorzog, legte ich meine bisherige Waffenrüstung ab und erkor mir statt der Kriegstrophäen die Kämpfe des Geistes. Ich wurde eine Art Peripatetiker, indem ich disputierend die Gegenden durchwanderte, von denen es hieß, daß dort die Kunst der Dialektik besonders ausgebildet sei.
So kam ich denn auch nach Paris, wo von alters her diese Wissenschaft in höchster Blüte stand. Wilhelm von Champeaux, der in diesem Fache einen wohlverdienten Ruf genoß, wurde mein Lehrer. Ich besuchte eine Zeitlang seine Schule und war anfangs ganz wohl bei ihm gelitten; bald aber wurde ich ihm höchst unbequem, da ich von seinen Sätzen einige zu widerlegen versuchte und mir wiederholt herausnahm, ihn mit Gegengründen anzugreifen, wobei ich ihm einigemale sichtlich überlegen war. Auch die bedeutendsten meiner Mitschüler gerieten darüber höchlich in Entrüstung, um so mehr als ich der jüngste war und von allen die kürzeste Studienzeit hinter mir hatte. Und so begann die lange Kette meiner Leiden, die noch immer ihr Ende nicht erreicht haben, und je weiter mein Ruf sich verbreitete, desto heftiger entbrannte der Neid meiner Widersacher. Es geschah, daß ich meinen jugendlichen Kräften Übermäßiges zumutend im Vertrauen auf meine Geistesgaben noch als ganz junger Mann danach trachtete, eine eigene Schule zu gründen und schon faßte ich einen Schauplatz für meine künftigen Taten in die Augen: nämlich Melun, einen Ort, der damals als königliche Residenz von ziemlicher Bedeutung war. Mein Lehrer merkte meine Absicht, und um meine Schule möglichst entfernt von der seinigen zu halten, bot er, so lange ich seine Schule noch besuchte, insgeheim alle Mittel auf, um die Einrichtung meiner eigenen zu verhindern und mir den Ort, den ich gewählt hatte, unmöglich zu machen. Allein er hatte sich mit einigen einflußreichen Herren des Landes verfeindet; mit ihrer Hilfe führte ich meinen Plan zum Ziel, und gerade seine offenkundige Mißgunst verschaffte mir das Vertrauen der Mehrzahl. Gleich durch die ersten Versuche, die ich im Unterrichten machte, bekam ich einen solchen Namen als Meister der Dialektik, daß der Ruhm meiner Mitschüler ja sogar der meines Lehrers selbst zu erbleichen anfing. So wuchs mein Selbstvertrauen immer mehr und ich ruhte nicht, bis ich meine Schule so schnell wie möglich nach Corbeil verlegt hatte, wo wegen der Nähe von Paris meinem Ungestüm zu dialektischen Kämpfen reichlichere Gelegenheit geboten war.
Es dauerte jedoch nicht lange, bis ich infolge von Überanstrengung erkrankte und in meine Heimat zurückkehren mußte. So war ich einige Jahre aus Frankreich sozusagen verbannt und wurde von denen, die sich der Dialektik befleißigten, lebhaft vermißt. Nach Verfluß einiger Jahre jedoch, als ich mich längst wieder erholt hatte, änderte Wilhelm von Champeaux, mein berühmter Lehrer und Archidiakon von Paris, plötzlich seine Lebensweise, indem er in den Orden der regulierten Chorherrn eintrat – man sagte mit der Absicht, auf diese Weise den Schein größerer Frömmigkeit zu erwecken und sich dadurch zu um so höherer Würde aufzuschwingen. Dies gelang ihm denn auch in kürzester Zeit: er wurde Bischof von Châlons, ohne sich jedoch durch diese Umgestaltung seines Lebens von Paris oder von der gewohnten Beschäftigung mit der Philosophie abhalten zu lassen; vielmehr hielt er eben in dem Kloster, in das er sich, um der Frömmigkeit zu pflegen, zurückgezogen hatte, öffentliche Vorlesungen wie früher. Damals kehrte ich zu ihm zurück, um Rhetorik bei ihm zu hören; abgesehen von mancherlei sonstigen wissenschaftlichen Kämpfen, in denen wir uns gegeneinander versuchten, brachte ich ihn durch unumstößliche Beweisgründe dahin, daß er seine von jeher vorgetragene Lehre von den Universalien (Allgemeinbegriffen) abänderte, ja gänzlich aufgab. Seine Lehre von der Gemeinsamkeit der Universalien bestand darin, daß er behauptete, ein und dieselbe Wesensbeschaffenheit liege allen Einzeldingen zugrunde, so daß diesen nach seiner Meinung keine eigentliche Wesensverschiedenheit zukomme, sondern nur eine Mannigfaltigkeit, die von der Menge der hinzutretenden Akzidentien herrühre. Nun änderte er seine Lehre insofern, daß er nicht mehr die Identität der Wesensbeschaffenheit behauptete, sondern nur ihre Indifferenz. Dieser Punkt galt aber bei den Dialektikern von jeher als einer der wichtigsten in der Lehre von den Universalien, so daß selbst Porphyrius in seinen Isagogen bei Gelegenheit der Besprechung der Universalien hierüber keine Entscheidung zu treffen wagt, sondern sich damit begnügt zu sagen: „dies ist ein sehr heikler Punkt.“ Da nun Wilhelm von Champeaux in diesem Punkt seine Lehre geändert, oder vielmehr unfreiwillig aufgegeben hatte, kamen seine Vorlesungen dermaßen in Mißkredit, daß man ihm kaum noch gestattete, überhaupt Dialektik zu lesen, als ob diese ganze Wissenschaft ihren Kernpunkt in der Frage von den Universalien hätte.
Unter diesen Umständen wuchs das Ansehen meiner eigenen Schule nur immermehr. Die eifrigsten Anhänger Wilhelms, die meine Lehre früher am heftigsten bekämpft hatten, kamen nunmehr zu mir; ja, der Nachfolger Wilhelms an der Schule zu Paris bot mir seinen Lehrstuhl an, um sich mit den anderen zu meinen Füßen zu setzen, da wo einst unser gemeinsamer Lehrer geglänzt hatte. Und so war ich denn dort nach kurzer Zeit unbeschränkter Herrscher auf dem Gebiete der Dialektik und als solcher ein Gegenstand unsäglichen Neides und Schmerzes für meinen früheren Lehrer. Außer stande, das Mißgeschick, das ihn betroffen hatte, länger zu tragen, griff er zu unlauteren Mitteln, um mich auch jetzt wieder zu verdrängen. Da er im offenen Kampfe nichts gegen mich vermochte, setzte er auf Grund von allerhand ehrenrührigen Beschuldigungen die Entfernung des Mannes durch, welcher mir seinen Lehrstuhl überlassen hatte, worauf einer meiner Gegner an seine Stelle rückte. Daraufhin kehrte ich nach Melun zurück und begann daselbst zu lehren wie früher, und je unverhüllter sich die Mißgunst Wilhelms gegen mich zeigte, desto mehr trug sie zum Wachstum meines Ruhmes bei – nach dem Dichterwort:
Die Größe macht der Neid zu seinem Ziel, Am schärfsten weht der Sturmwind auf den Höhn.
Bald darauf merkte Wilhelm, daß die Mehrzahl seiner Schüler an der Aufrichtigkeit seiner Frömmigkeit zu zweifeln begann und sich allerhand über seine Bekehrung zuraunte, da er sich nicht im geringsten veranlaßt gesehen hatte, sich aus der Hauptstadt zurückzuziehen. Nun siedelte er mit seinem Konventikel und mit seiner Schule an einen von der Stadt Paris ziemlich entfernten Ort über. Alsbald kehrte ich von Melun nach Paris zurück, in der Hoffnung, nun Ruhe vor ihm zu haben. Da jedoch, wie gesagt, mein Platz noch von meinem Gegner eingenommen war, so ließ ich mich mit meiner Schule außerhalb der Stadt auf dem Berg der heiligen Genoveva nieder, als wollte ich jenen Eindringling belagern. Auf die Kunde davon war Wilhelm unverfroren genug, alsbald nach Paris zurückzukehren; was er noch an Schülern hatte, brachte er samt seiner kleinen Bruderschaft in seinem alten Kloster unter; es sah aus, als wollte er den Posten, den er allein im Feld gelassen hatte, von unserer Belagerung befreien. Allein während er ihm nützen wollte, schadete er ihm nur. Vorher nämlich hatte der gute Mann noch etliche Schüler gehabt, hauptsächlich wegen seiner Vorlesungen über Priscianus, für die ihm ein gewisser Ruf zur Seite stand. Nach der Ankunft des Meisters jedoch verlor er vollends alle und war so genötigt, sein Lehramt aufzugeben, und es dauerte nicht lange, bis auch er, dem Ruhme dieser Welt völlig entsagend, ins Kloster ging. Welche Schlachten auf dem Felde der Wissenschaft meine Schüler nach der Rückkehr Wilhelms mit ihm selbst wie mit seinen Anhängern ausgefochten haben und wie die Gunst des Schicksals in diesen Kämpfen mit mir und den meinigen war, das hat dir längst der weitere Verlauf der Ereignisse gezeigt. Kühnlich, wenn auch bescheidnern Sinnes, darf ich jenes Wort des Aiax auf mich anwenden:
Und fragst du nach dem Ende dieses Kampfs, So sag ich stolz: er hat mich nicht besiegt.
Wollte ich darüber schweigen, die Taten würden für sich selbst sprechen und der schließliche Erfolg würde laut genug für mich zeugen.
Während dieser Vorgänge drang meine geliebte Mutter Lucia in mich, nach Hause zu kommen. Mein Vater Berengar war nämlich ins Kloster gegangen, und meine Mutter hatte das Gleiche im Sinn. Nach Erledigung dieser Angelegenheit kehrte ich nach Frankreich zurück, hauptsächlich mit der Absicht, Theologie zu studieren. In diesem Fache genoß Wilhelm von Champeaux innerhalb seines Bistums Châlons eines ziemlichen Rufes. Die größte Autorität auf diesem Gebiete war jedoch seit lange sein Lehrer Anselm von Laon.
Ich besuchte also die Schule dieses ehrwürdigen Mannes, der freilich seinen Namen mehr einer langjährigen Tätigkeit zu danken hatte als seinem Geist und seiner Bedeutung. Wer über irgendeine Frage im Zweifel war und an seine Tür pochte, um sich Rats zu erholen, der wußte nachher gewiß weniger als vorher. Der Masse der Zuhörer wußte er zu imponieren, wenn man aber unter vier Augen mit ihm sprach, machte er einen sehr dürftigen Eindruck. Er verfügte über eine ungewöhnliche Redegewandtheit, aber es steckte im Grunde wenig dahinter. Das Feuer, das er entzündete, füllte sein Haus nur mit Rauch, statt es zu erleuchten. Er glich einem Baum, der in seinem reichen Blätterschmuck von weitem vielversprechend aussah, und doch wenn man ihn aus der Nähe genauer betrachtete, keine Früchte aufzuweisen hatte. Daher als ich hinzutrat, um Früchte bei ihm zu finden, fand ich in ihm jenen Feigenbaum, den der Herr einst verfluchte, oder jene alte Eiche, mit der der Dichter Lucanus den Pompejus vergleicht, indem er sagt:
Von seinem Namen lebt nur noch ein Schatten, Wie im fruchtbaren Feld der hohe Eichbaum steht.
Nachdem ich dies herausgefunden hatte, blieb ich nicht lange müßig in seinem Schatten liegen, sondern besuchte seine Vorlesungen immer seltener. Einige seiner bedeutendsten Schüler waren nun darüber empört, daß ich einem Lehrer von solcher Bedeutung so wenig Achtung zollte und wußten ihn durch allerlei Ränke und Verleumdungen gegen mich einzunehmen. Eines Tags nach Abschluß einer wissenschaftlichen Besprechung unterhielten wir uns in zwangloser Weise. Einer meiner Mitschüler fragte mich bei dieser Gelegenheit, um mich in Verlegenheit zu bringen, was ich vom Lesen der heiligen Schrift halte. Ich, der ich bis jetzt nur weltliche Wissenschaft getrieben hatte, antwortete, daß es kein ersprießlicheres Studium gebe als das der Bibel, weil diese uns über das Heil unserer Seele unterrichte; nur müsse ich mich darüber höchlich wundern, daß den Gelehrten zum Verständnis der heiligen Schriftsteller nicht der einfache Text und etwa die Glossen dazu genügen, sondern daß sie noch weitere Hilfsmittel nötig hätten. Darüber erhob sich ein allgemeines Gelächter und man fragte mich, ob ich mir getraue, einen solchen Versuch zu machen. Ich erwiderte, daß ich zur Probe bereit sei, wenn sie es darauf ankommen lassen wollten. „Gewiß wollen wir“, antworteten sie mir unter Geschrei und erneutem Gelächter; „man wird Euch zu einem weniger bekannten Text einen Ausleger anweisen und wir werden sehen, wie Ihr Euer Versprechen haltet.“
Sie vereinigten sich nun auf ein höchst schwieriges Kapitel des Propheten Ezechiel; ich nahm den Ausleger an und lud sie schon auf den folgenden Tag zu einer Vorlesung ein. Sie jedoch wollten mich gegen meinen Willen eines Besseren belehren und meinten, eine so wichtige Sache dürfe man nicht übereilen; da ich in diesem Fache doch noch wenig Übung habe, müsse ich mehr Zeit auf die Ausarbeitung meiner Erklärung verwenden. Allein ich antwortete in gereiztem Tone, daß ich gewohnt sei, mich nicht auf eine möglichst lange Frist, sondern auf meinen Verstand zu verlassen, und ich werde überhaupt die ganze Sache aufgeben, wenn sie sich nicht ohne Verzug zu der Vorlesung einfinden wollten, wann ich es wünsche. Zu meiner ersten Vorlesung fanden sich nun allerdings nur wenige ein; die meisten fanden es lächerlich, daß ich – bisher ganz unbewandert im Studium der heiligen Schrift – damit so kurzer Hand verfahren wollte. Denen aber, die meiner Vorlesung anwohnten, gefiel sie so gut, daß sie sie nicht genug loben konnten und mich drängten, meine Erklärung nach dieser meiner Methode fortzusetzen. Als dies bekannt wurde, beeilten sich auch die, die bisher ferngeblieben waren, in die zweite und dritte Vorlesung zu kommen, und waren eifrig darauf bedacht, von dem, was ich am ersten Tag gelesen hatte, sich eine Abschrift zu verschaffen.
Die Folge davon war, daß der alte Anselm von gewaltiger Eifersucht befallen wurde, und da er schon vorher infolge mißgünstiger Einflüsterungen nicht gut auf mich zu sprechen war, verfolgte er mich nun wegen meiner theologischen Vorlesungen gerade so, wie es einst Wilhelm wegen der philosophischen getan hatte.
Für seine beiden bedeutendsten Schüler galten damals Alberich von Rheims und Lotulph aus der Lombardei; jemehr diese von sich selber eingenommen waren, destoweniger waren sie mir hold. Es hat sich nachmals herausgestellt, daß Anselm sich durch ihre Vorstellungen bestimmen ließ, mir die Fortsetzung meiner begonnenen Erklärung am Schauplatz seiner Lehrtätigkeit kurzweg zu untersagen, unter dem Vorwand, es möchten, da meine Erfahrung in diesem Fache noch mangelhaft sei, Verstöße vorkommen, für die er dann verantwortlich gemacht werden würde. Als dies meinen Schülern zu Ohren kam, war ihre Entrüstung über einen so unverblümten Brotneid groß; denn deutlicher konnte sich ja die Eifersucht nicht zu erkennen geben. Je mehr ich übrigens unter solchen Verfolgungen zu leiden hatte, desto größer wurde dadurch mein Ansehen und mein Ruhm.
So kehrte ich denn auch bald nach Paris zurück, und hatte dort den mir schon längst bestimmten und angebotenen Lehrstuhl, von dem ich vertrieben worden war, einige Jahre in ungestörter Ruhe inne; gleich im Anfang meiner Wirksamkeit ging mein Streben dahin, jene Glossen zu Ezechiel zu vollenden, die ich in Laon begonnen hatte. Dieses Werk fand beim Publikum eine äußerst günstige Aufnahme, und man hörte bereits das Urteil, daß meine theologische Begabung in nichts hinter meiner philosophischen zurückbleibe. Die Begeisterung für meine Vorlesungen in beiden Fächern vermehrte die Zahl meiner Schüler ganz erheblich; welcher Gewinn, welcher Ruhm mir daraus erwuchs, das ist auch dir gewiß nicht unbekannt geblieben. Allein das Glück hat von jeher die Toren aufgebläht; die Sicherheit dieser Welt schwächt die Kräfte der Seele und der Geist erliegt dann nur allzu leicht den Lokkungen des Fleisches. So ging es auch mir: schon hielt ich mich für den einzigen Philosophen in der Welt, der von keiner Seite mehr einen Angriff zu fürchten brauche, und ich, der bis jetzt die strengste Enthaltsamkeit geübt hatte, begann nun meinen Leidenschaften die Zügel schießen zu lassen. Je mehr ich in Philosophie und Theologie Fortschritte machte, desto weiter blieb ich mit meinem unreinen Lebenswandel hinter den Philosophen und den Heiligen zurück. Soviel ist sicher, daß die Philosophen und noch mehr die Heiligen, d. h. die, die ihr Leben nach den Geboten der heiligen Schrift einrichteten, ihr Ansehen hauptsächlich ihrer Enthaltsamkeit verdanken. Ich nun war ganz und gar von der Krankheit des Stolzes und der Sinnlichkeit befallen, aber Gott hat mich in seiner Gnade von beiden Übeln geheilt, freilich gegen meinen Willen, und zwar zuerst von der Sinnlichkeit, dann vom Stolz. Von der Sinnlichkeit, indem er mich dessen beraubte, womit ich ihr gefrönt hatte; vom Stolz, der sich auf mein Wissen gründete – denn „Wissen bläht auf“, sagt der Apostel – indem er mich die Demütigung erleben ließ, daß mein berühmtestes Buch verbrannt wurde.
Ich möchte, daß du mit der Geschichte dieser Vorgänge nicht bloß durchs Hörensagen bekannt würdest, sondern durch eine getreue, dem Gang der Ereignisse folgende Darstellung. Vor dem schmutzigen Verkehr mit Buhlerinnen hatte ich von jeher einen Abscheu, andererseits ließ mich mein Studium, das mich ganz und gar in Anspruch nahm, nicht zum Umgang mit edleren Frauen kommen, auch war ich in den Umgangsformen weltlichen Verkehrs nicht bewandert. Da fand das Schicksal, mich scheinbar hätschelnd, in Wirklichkeit aber mir feindlich gesinnt, ein bequemes Mittel, um mich von dem Gipfel meiner Größe herabzustürzen – ja vielmehr die göttliche Liebe wollte mich, der ich in meinem Übermut des Dankes gegen die Gnade Gottes vergessen hatte, durch eine tiefe Demütigung auf den rechten Weg zurückbringen.
Es lebte in Paris eine Jungfrau Namens Heloise, die Nichte eines Kanonikus Fulbert, der ihr zuliebe alles tat, um an ihrer wissenschaftlichen Ausbildung nichts zu verabsäumen. Gehörte sie schon ihrem Äußern nach nicht zu den letzten, so war sie durch den Reichtum ihres Wissens weitaus die erste. Denn je seltener man den Vorzug wissenschaftlicher Bildung bei Frauen findet, destomehr Reiz verlieh sie diesem Mädchen, das sich dadurch bereits im ganzen Lande einen Namen gemacht hatte. Sie, die ich mit allem geschmückt sah, was Liebe zu wecken pflegt, gedachte ich nun durch Bande der Liebe an mich zu fesseln, und zweifelte keinen Augenblick an meinem Erfolg. Mein Name war damals hoch gefeiert und ich stand in der Blüte männlicher Jugendschöne, so daß ich keine Zurückweisung fürchten zu müssen glaubte, wenn ich eine Frau meiner Liebe würdigte, mochte sie sein, wer sie wollte. Von Heloise aber glaubte ich, daß sie sich mir um so lieber ergeben werde, als sie wissenschaftliche Bildung besaß und eine Vorliebe für die Wissenschaften hatte. Ich sagte mir, daß wir infolgedessen selbst in die Ferne schriftlich miteinander verkehren konnten, daß man dabei der Feder manches kühne Wort vertrauen könne, das die Lippe nicht gewagt hätte, und daß uns so allezeit Gelegenheit zum süßesten Gedankenaustausch geboten sei.
Von glühender Liebe zu diesem Mädchen erfüllt, suchte ich nach einer Gelegenheit, um sie durch täglichen Verkehr in ihrem Hause näher kennenzulernen und sie meinen Wünschen gefügig zu machen. Ihres Oheims eigene Freunde waren mir dabei behilflich; ich kam mit ihm überein, daß er mich um eine beliebige Entschädigung in sein Haus aufnehmen sollte, das ganz in der Nähe meiner Schule lag. Ich gebrauchte dabei den Vorwand, daß mir bei meinem Gelehrtenberuf die Sorge für meine leibliche Notdurft hinderlich sei und mir auch zu teuer zu stehen komme. Nun war Fulbert ein großer Geizhals, dabei aber doch darauf bedacht, daß seine Nichte in ihrer gelehrten Bildung möglichst große Fortschritte mache. Beides zusammen verschaffte mir ohne Schwierigkeiten die Einwilligung zu dem, was ich wollte: einerseits war der Alte auf das Geld aus, andererseits versprach er sich von meinem Unterricht einen Vorteil für das Mädchen. Ja, er kam selber meinen Wünschen über alles Erwarten entgegen und leistete unbewußt meiner Liebe Vorschub. Er überließ mir Heloise ganz und gar zur Erziehung und bat mich obendrein dringend, ich möchte doch ja alle freie Zeit, sei’s bei Tag oder bei Nacht, auf ihren Unterricht verwenden, ja, wenn sie sich träge und unaufmerksam zeige, solle ich sie rücksichtslos bestrafen. Ich mußte nur staunen über eine solch grenzenlose Einfalt, die das unschuldige Lamm dem hungrigen Wolf anvertraute. Er gab sie mir also nicht bloß in die Lehre, sondern übertrug mir auch das Recht der Züchtigung. War damit meinen Wünschen nicht Tür und Tor geöffnet? Machte er es mir auf diese Weise doch möglich, ohne daß ich es wollte, mit Drohen und Schlagen zum Ziele zu gelangen, wenn die Worte der Verführung nichts nutzten! Aber ein Zweifaches hielt jeden Verdacht fern von ihm: die Liebe zu seiner Nichte und die allbekannte Unbescholtenheit meines bisherigen Lebens.
Was soll ich weiter viel sagen? Zuerst Ein Haus, dann Ein Herz und Eine Seele. Unter dem Deckmantel der Wissenschaft gaben wir uns ganz der Liebe hin und unsere Beschäftigung bot uns von selbst die Gelegenheit des Alleinseins, wie Liebende sie wünschen. Da war denn freilich über dem offenen Buche mehr von Liebe die Rede als von Wissenschaft, da gab es mehr Küsse als weise Sprüche. Nur allzu oft verirrte sich die Hand von den Büchern weg zu ihrem Busen, und eifriger als in den Schriften lasen wir eins in des anderen Augen; ja, um jeden Verdacht unmöglich zu machen, ging ich einige Male soweit, daß ich sie züchtigte. Aber es war Liebe, die schlug, nicht Grimm; Neigung, nicht Zorn, und diese Züchtigungen waren süßer als aller Balsam der Welt. Kurz: die ganze Stufenleiter der Liebe machte unsere Leidenschaft durch, und wo die Liebe eine neue Entzückung erfand, da haben wir sie genossen. Der Reiz der Neuheit, den diese Freuden für uns hatten, erhöhte nur die Ausdauer unserer Glut und unsere Unersättlichkeit. Je mehr ich ein Sklave der Lust geworden war, desto weniger hatte ich mehr übrig für Wissenschaft und Schule. Es war mir im Innersten zuwider, vor meine Schüler hinzutreten und unter ihnen zu weilen; zugleich war es ein aufreibendes Leben, das ich führte: meine Nächte gehörten der Liebe, die Tage der geistigen Arbeit. Meine Vorträge waren gleichgültig und matt, meine Rede sprühte nicht mehr von Funken des Geistes, erhob sich nicht mehr über das Gewöhnliche. Ich konnte nur noch wiederholen, was ich früher ausgedacht hatte, und wenn ich dann und wann noch imstande war, ein Lied zu dichten, so sang ich vom Lob der Minne, nicht von den Tiefen der Weisheit. Die meisten dieser Lieder leben noch jetzt, wie du wohl weißt, da und dort im Munde des Volkes und werden von denen gesungen, die Gleiches erleben.
Von der Trauer, dem Jammer, den Klagen meiner Schüler als sie entdeckten, daß ich innerlich in dieser Weise in Anspruch genommen, ja gestört sei, kann man sich kaum eine Vorstellung machen. Eine Sache, die so klar am Tage lag, konnte ja unmöglich ein Geheimnis bleiben, und ich glaube fast: nur der Mann wußte nichts davon, dessen Ehre dabei am meisten auf dem Spiele stand, der Oheim des Mädchens selbst. Zwar wurde er mehrmals und von verschiedenen Seiten gewarnt; allein er schenkte solchen Einflüsterungen keinen Glauben und zwar aus den oben genannten Gründen, wegen der unbegrenzten Liebe zu seiner Nichte und wegen der unbezweifelten Reinheit meines Vorlebens. Denn wohl fällt es uns schwer, von denen, die wir lieben, Schlechtes zu glauben, und wahre Liebe weiß nichts von dem schleichenden Gifte des Argwohns. So schreibt auch der heilige Hieronymus in seinem Brief an Sabinianus: „Gewöhnlich erfahren wir selbst es zuletzt, wenn in unserem Hause etwas nicht in Ordnung ist, und wissen nichts von den Fehlern unserer Kinder und Frauen, wenn die Nachbarn schon laut davon sprechen.“ – Aber wenn auch spät, einmal wird es doch offenbar; was alle wissen, bleibt einem einzigen auf die Dauer auch nicht verborgen.
Dies war, nachdem einige Monate verflossen waren, auch das Schicksal unserer Liebe. Ach, wie zerriß diese Entdeckung dem Oheim das Herz! Wie groß war der Schmerz, der die Liebenden selbst durch die nun folgende Trennung traf! Welche Schande, welche Verlegenheit für mich! Mit welcher Verzweiflung erfüllte mich das Unglück des Mädchens! Welche Qualen, welche Trauer über den Verlust meines eigenen guten Leumunds stand ich aus! Jedes von uns beklagte nicht sein eigenes Mißgeschick, sondern nur das des anderen. Allein die körperliche Trennung befestigte nur das Band unserer Seelen und unsere Liebe wurde um so glühender, je mehr die Befriedigung ihr fehlte. Nachdem unsere Leidenschaft einmal die Fesseln der Scham durchbrochen hatte, wurden wir unempfindlich gegen sie, und das Schamgefühl hatte um so weniger Einfluß auf uns, je lockender die Sünde erschien, die wir begangen. Wir erlebten an uns dasselbe, was der Dichter von Mars und Venus erzählt, als sie bei einander überrascht wurden.
Bald darauf fühlte Heloise sich Mutter; in der höchsten Freude benachrichtigte sie mich davon und fragte mich um Rat, was nun zu tun sei. Nachdem wir vorher darüber eins geworden waren, entführte ich sie ihrem Oheim in einer Nacht, da er nicht zu Hause war. Unverzüglich geleitete ich sie in meine Heimat zu meiner Schwester, bei der sie bis zur Geburt eines Knäbleins verblieb, dem sie den Namen Astralabius gab. Fulbert gebärdete sich bei seiner Heimkehr wie ein Rasender; nur wer es selbst mit ansah, kann sich eine Vorstellung machen von der Wut seines Schmerzes und von seiner peinlichen Verlegenheit. Er wußte nicht, was er mir antun, welche Rache er an mir nehmen sollte. Mir nach dem Leben zu stehen oder mir einen leiblichen Schaden zuzufügen – davon hielt ihn die Angst ab, seine vielgeliebte Nichte möchte dies bei den Meinigen zu büßen bekommen. Auch konnte er sich nicht etwa meiner Person bemächtigen und mich mit Gewalt in irgendeinen Gewahrsam bringen. Denn gerade in dem Punkt war ich sehr auf meiner Hut; ich kannte ihn als einen Mann, der sich nicht lange besinnen würde, wenn sich gute Gelegenheit zu einem Wagnis böte. Zuletzt aber bekam ich selbst Mitleid mit dem ungemessenen Schmerz des Mannes, auch machte ich mir Gewissensbisse über die Art und Weise, wie ich ihn um meiner Liebe willen hintergangen hatte, und klagte mich des schwärzesten Verrates gegen ihn an. So ging ich denn zu Fulbert, bat ihn um Vergebung und bot ihm jede beliebige Entschädigung an. Ich beteuerte ihm, daß niemand über meine Tat befremdet sein könne, der die Macht der Liebe einmal erfahren habe und der wisse, wie schmählich von Anbeginn der Welt an selbst die größten Männer durch die Weiber zu Fall gebracht worden seien. Um ihn völlig zu besänftigen, bot ich ihm eine Genugtuung an, die er nicht erwarten konnte: nämlich das verführte Mädchen zu meiner rechtmäßigen Frau zu machen, unter der einen Bedingung, daß unsere Ehe geheim bleiben sollte, damit ich an meinem Ruf keine Einbuße erleide. Fulbert ging darauf ein und er sowohl als seine Freunde gaben mir die Hand darauf und besiegelten durch Küsse den Friedensschluß – nur um mich desto sicherer zu verraten.
Ich kehrte nun in meine Heimat zurück und holte die Geliebte ab, um sie zu meiner Frau zu machen. Aber Heloise war keineswegs damit einverstanden und riet mir aus zwei Gründen dringend von meinem Vorhaben ab: nämlich wegen der Gefahr und wegen der Unehre, der ich mich dadurch aussetze. Sie versicherte mich, Fulbert lasse sich durch keine Genugtuung über das, was geschehen sei, beruhigen. Es zeigte sich später, daß sie recht hatte. Sie fragte mich, wie sie sich meines Besitzes sollte freuen können, wenn sie dadurch meinen Ruhm untergrabe und sich und mich zugleich erniedrige. Wie könnte sie es vor der Welt verantworten, wenn sie ihr eine solche Leuchte entzöge! Wie viel Verwünschungen würden diesem Ehebund nachgesandt werden, welcher Schaden würde der Kirche daraus erwachsen, wie viel Tränen würde die Wissenschaft darüber vergießen! Wie erbärmlich und kläglich wäre es, wenn ein Mann wie ich, geschaffen für die ganze Welt, sich durch ein Weib binden lassen und sich unter ein schimpfliches Joch beugen wollte! Sie verwarf diese Ehe aufs lebhafteste, da sie mir in jeder Hinsicht nachteilig und eine Last sei. Sie hielt mir ferner die geringe Achtung vor, in der die Ehe stehe und die Unannehmlichkeiten, die damit verbunden seien, zu deren Vermeidung der Apostel uns mahnt mit den Worten: „Bist du los vom Weib, so suche kein Weib. So du aber freiest, sündigest du nicht, und so eine Jungfrau freiet, sündiget sie nicht; doch werden solche leibliche Trübsal haben; ich verschonete aber euer gerne.“ – Und noch einmal sagt er: „ich wollte aber, daß ihr ohne Sorge wäret.“ – Und wenn ich weder den Rat des Apostels noch die Warnungen der heiligen Väter vor dem Joch der Ehe annehmen wolle: so möchte ich doch wenigstens auf die Philosophen hören und auf das, was in dieser Hinsicht entweder durch sie oder über sie geschrieben worden sei. Auch die Kirchenväter beziehen sich ja vielfach auf sie, um uns zu warnen. Als Beispiel führte sie den heiligen Hieronymus an, der im ersten Kapitel seiner Schrift „Gegen Jovinianus“ von Theophrastus erzählt, daß dieser in einer ausführlichen Besprechung der unerträglichen Beschwerden und beständigen Aufregungen, die der Ehestand mit sich bringe, schließlich mit den überzeugendsten Gründen zu dem Schluß komme: der Weise sollte überhaupt nicht heiraten. Am Schluß seiner Betrachtungen über jene Äußerungen des Philosophen sagt Hieronymus selbst: „Welcher Christ muß sich nicht beschämt fühlen, wenn er einen Theophrastus also reden hört?“ In derselben Schrift – fuhr Heloise fort – führt Hieronymus das Beispiel Ciceros an. Als dieser sich von Terentia hatte scheiden lassen, redete ihm sein Freund Hircius zu, er solle seine Schwester heiraten; allein er lehnte dies entschieden ab, da er sich nicht zugleich einer Frau und der Philosophie widmen könne. Er sagt nicht einfach „sich widmen“, sondern fügt das Wort „zugleich“ hinzu. Er wollte nichts tun, was ihn verhindert hätte, seine Aufmerksamkeit völlig auf die Philosophie zu beschränken.
Doch ich will davon nicht weiter sprechen, welches Hindernis für deinen gelehrten Beruf eine bürgerliche Ehe wäre. Denke nur an das übrige, was sie in ihrem Gefolge hätte. Was für ein Durcheinander! Schüler und Kammerzofen, Schreibtisch und Kinderwagen! Bücher und Hefte beim Spinnrocken, Schreibrohr und Griffel bei den Spindeln! Wer kann sich mit Betrachtung der Schrift oder mit dem Studium der Philosophie abgeben und dabei das Geschrei der kleinen Kinder, den Singsang der Amme, der sie beruhigen soll, die geräuschvolle Schar männlicher und weiblicher Dienstboten hören? Wer mag die beständige widerliche Unreinlichkeit der Kinder gern ertragen? Reiche Leute wissen sich in dieser Beziehung zu helfen, das gebe ich zu, denn sie sind in ihren fürstlichen Räumen nicht beschränkt, sie brauchen in ihrem Überfluß nicht auf die Kosten zu sehen und die Sorge ums tägliche Brot liegt ihnen fern. Allein die Lage der Philosophen ist eine andere als die der Reichen und wiederum: wer nach irdischen Schätzen trachtet und in die Sorgen dieser Welt verwickelt ist, hat keine Zeit für göttliche oder philosophische Dinge.
Darum haben auch die großen Philosophen der alten Zeit voll Weltverachtung das Leben in der Welt aufgegeben, ja förmlich geflohen, jeden irdischen Genuß sich versagend, um allein in den Armen der Weisheit Ruhe zu finden. Einer der größten von ihnen, Seneca, gibt dem Lucilius folgende Anweisung: „Nicht bloß deine freie Zeit darfst du der Philosophie widmen: ihr zulieb muß man alles andere hintansetzen, nie kann man auf sie zuviel Zeit verwenden. Vernachlässigst du das Studium der Philosophie eine Zeitlang, so ist dies fast ebenso, wie wenn du es ganz aufgeben würdest; denn durch zeitweise Unterbrechung geht der ganze Gewinn verloren. Anderweitigen Ansprüchen müssen wir aus dem Wege gehen und sie fern von uns halten, statt sie zu befriedigen.“ Was noch jetzt unsere Mönche, wenigstens die diesen Namen wahrhaft verdienen, aus Liebe zu Gott tun, das taten in der alten Zeit aus Liebe zur Weisheit die edlen heidnischen Philosophen. Denn in jedem Volke, sei es heidnischen, jüdischen oder christlichen Glaubens, hat es von jeher Männer gegeben, die durch Glauben oder Sittenreinheit über den anderen standen und durch einen besonderen Grad von Enthaltsamkeit und Strenge von der großen Menge geschieden waren.
So gab es bei den Juden von alters her Nasiräer, die sich nach einer besonderen Gesetzesvorschrift Gott weihten; da waren ferner die Söhne der Propheten, die Jünger des Elia und Elisa, die uns im Alten Testament nach dem Zeugnis des heiligen Hieronymus wie Mönche beschrieben werden. Etwas ähnliches waren auch jene drei philosophischen Sekten, die Josephus in seinen „Altertümern“, Kapitel XVIII, aufzählt und teils Pharisäer, teils Sadduzäer, teils Essäer nennt. Bei uns sind die Mönche an ihre Stelle getreten, die entweder das gemeine Leben der Apostel nachahmen, oder nach dem älteren Vorbild das Einsiedlerleben des Johannes. Die Heiden aber hatten dafür, wie gesagt, ihre Philosophen. Denn unter dem Namen „Weisheit“ oder „Philosophie“ verstanden sie weniger den Betrieb der Wissenschaft als eine gottgeweihte Lebensführung; dies lehrt uns die ursprüngliche Bedeutung des Wortes und außerdem auch das Zeugnis der heiligen Väter. So sagt der heilige Augustin im achten Kapitel seines Buches „Vom Gottesstaat“, wo er die verschiedenen Philosophenschulen aufzählt, folgendes: „Der Stifter der Italischen Schule ist Pythagoras von Samos; man sagt, daß von ihm der Name Philosophie herrühre. Früher nämlich wurden Männer, die sich durch tadellose Lebensführung irgendwie über die anderen erhoben, Weise genannt. Pythagoras dagegen sagte, als man ihn nach seinem Beruf fragte, er sei ein Philosoph, d. h. ein Jünger oder Liebhaber der Weisheit; sich einen Weisen zu nennen, hielt er für eine Anmaßung.“