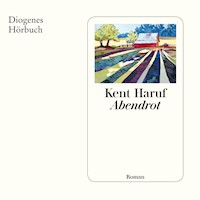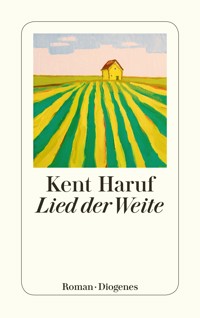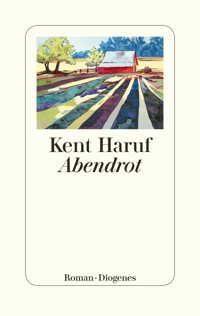
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ein Holt Roman
- Sprache: Deutsch
Holt, eine Kleinstadt im Herzen Colorados. Zwei alte Viehzüchter müssen den Wegzug ihrer Ziehtochter verkraften. Ein Ehepaar kämpft in seinem Trailer um ein Stückchen Würde. Ein elfjähriger Junge kümmert sich rührend um seinen kranken Großvater. So hart das Schicksal auch zuschlägt – die Menschen in Holt sind entschlossen, dem Leben einen Sinn abzutrotzen. Und begegnen einander dabei neu.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Kent Haruf
Abendrot
Roman
Aus dem Amerikanischen von pociao
Diogenes
Für Cathy
und zum Gedenken an meinen Neffen
Mark Kelley Haruf
Bleib bei mir, Herr! Der Abend bricht herein.
Es kommt die Nacht, die Finsternis fällt ein.
Wo fänd ich Trost, wärst du, mein Gott, nicht hier?
Hilf dem, der hilflos ist: Herr, bleib bei mir!
– Henry F. Lyte
Teil 1
1
Sie kamen im schräg einfallenden Licht des frühen Morgens aus dem Pferdestall. Die beiden McPheron-Brüder, Harold und Raymond. Alte Männer, die am Ende des Sommers auf ein altes Haus zusteuerten. Sie gingen über die mit Kies bestreute Zufahrt, vorbei an dem Pick-up und dem am Zaun der Schweinekoppel geparkten Wagen, und traten nacheinander durch das Maschendrahttor. Vor der Veranda kratzten sie sich die Stiefel an dem Sägeblatt ab, das im Boden vergraben war, die Erde ringsum festgetreten und blank, so viele Male waren sie darübergegangen und hatten sie mit Dung aus dem Stall vermischt. Sie stiegen die Holzstufen zur Vorderveranda mit der Fliegengittertür hinauf und betraten die Küche, wo die neunzehnjährige Victoria Roubideaux am Kiefernholztisch saß und ihre Tochter mit Haferbrei fütterte.
In der Küche nahmen sie ihre Hüte ab, hängten sie über die Haken neben der Tür und wuschen sich als Erstes an der Spüle die Hände. Ihre Gesichter waren rot und vom Wetter gegerbt unter einer blassen Stirn, das borstige Haar auf den runden Köpfen eisengrau und steif wie die abstehende Mähne eines Pferdes. Als sie an der Spüle fertig waren, trockneten sie sich nacheinander mit dem Geschirrtuch ab, doch als sie sich am Herd das Essen auftun wollten, wies das Mädchen sie an, sich hinzusetzen.
Muss nicht sein, dass du uns bedienst, sagte Raymond.
Das möchte ich aber, entgegnete sie. Morgen bin ich nicht mehr da.
Sie stand auf, setzte sich das Kind auf die Hüfte und stellte zwei Kaffeetassen, zwei Schalen mit Haferbrei und einen Teller mit gebutterten Toastscheiben auf den Tisch, dann setzte sie sich wieder hin.
Harold saß da und studierte seinen Haferbrei. Man hätte meinen können, dass sie uns wenigstens dieses Mal ein Steak mit Spiegeleiern auftischt. Zur Feier des Tages. Aber nein, Sir, immer nur diese warme Pampe, die ungefähr so schmeckt wie die letzte Seite der nassen Zeitung von gestern.
Wenn ich weg bin, könnt ihr essen, was ihr wollt. Das macht ihr sowieso, ist mir schon klar.
Ja, Ma’am, wahrscheinlich wird’s so kommen. Er sah sie an. Nicht, dass ich’s nicht abwarten kann, bis du gehst. Ich nehm dich nur ein bisschen auf den Arm.
Weiß ich doch. Sie lächelte ihm zu. Ihre Zähne strahlten weiß in dem gebräunten Gesicht, und das dichte schwarze Haar glänzte und fiel ihr gerade bis über die Schultern. Ich bin gleich so weit, sagte sie. Ich will nur noch Katie zu Ende füttern und sie anziehen, dann können wir los.
Gib sie mir, sagte Raymond. Ist sie fertig mit Essen?
Nein, noch nicht, sagte das Mädchen. Aber vielleicht isst sie bei dir noch ein Häppchen. Bei mir dreht sie immer nur den Kopf weg.
Raymond stand auf, ging um den Tisch herum und nahm die Kleine auf den Arm. Dann kehrte er zu seinem Platz zurück, setzte sie sich auf den Schoß, streute Zucker auf den Haferbrei in seiner Schale, goss Milch aus dem Krug dazu, der auf dem Tisch stand, und fing an zu essen, während die Kleine mit dem schwarzen Haar und den runden Bäckchen ihn beobachtete, fasziniert von dem, was er tat. Er hielt sie ganz entspannt und bequem, den Arm um sie gelegt, nahm einen Löffel voll Brei, pustete darauf und bot ihn ihr an. Sie nahm ihn. Er selbst aß auch etwas. Dann blies er auf den nächsten Löffel Brei und schob ihn ihr in den Mund. Harold goss Milch in ein Glas, und die Kleine streckte sich über den Tisch und trank mit beiden Händen, bis sie innehalten musste, um nach Luft zu schnappen.
Was werde ich bloß machen, wenn sie in Fort Collins nicht essen will?, sagte Victoria.
Du kannst uns anrufen, sagte Harold. Wir sind im Nu da, um nach ihr zu sehen. Was, Katie?
Die Kleine sah ihn über den Tisch hinweg unverwandt an. Ihre Augen waren so schwarz wie die ihrer Mutter, wie Knöpfe oder Johannisbeeren. Sie sagte nichts, nahm aber Raymonds schwielige Hand und führte sie zu der Schale mit dem Haferbrei. Als er ihr den Löffel hinhielt, schob sie seine Hand auf seinen Mund zu. Oh, sagte er. Na gut. Er pustete ausgiebig auf den Löffel, blies dabei die Backen auf und bewegte das rote Gesicht vor und zurück, und dann war sie wieder dran.
Als sie fertig waren, brachte Victoria ihre Tochter zunächst ins Bad neben dem Esszimmer, um ihr das Gesicht zu waschen, und anschließend ins Schlafzimmer, um sie anzuziehen. Die McPheron-Brüder gingen nach oben in ihre Zimmer und zogen ihre Stadtkleidung an, dunkle Hosen, helle Hemden mit Druckknöpfen aus Perlmutt, dazu setzten sie ihre guten weißen, handgemachten Bailey-Hüte auf. Als sie wieder herunterkamen, trugen sie Victorias Koffer zum Wagen und hievten ihn in den Kofferraum. Der Rücksitz war bereits mit Kisten voller Kinderkleidung, Decken, Laken, Spielzeug und einem gepolsterten Kindersitz beladen. Hinter dem Wagen stand der Pick-up, und auf seiner Ladefläche, zwischen Reservereifen, Wagenheber, einem halben Dutzend leerer Motorölkanister, ein paar trockenen Süßgrasgarben und einer Rolle rostigem Stacheldraht standen noch der Hochstuhl der Kleinen und ihr Bettchen; die Matratze war in eine neue Plane gewickelt und alles mit orangefarbenem Bindfaden verschnürt.
Sie gingen ins Haus zurück und kamen mit Victoria und der Kleinen wieder heraus. Auf der Veranda blieb Victoria einen Moment stehen, in ihren dunklen Augen schimmerten plötzlich Tränen.
Was ist denn los?, fragte Harold. Stimmt was nicht?
Sie schüttelte den Kopf.
Du weißt doch, du kannst jederzeit zu uns zurück. Das erwarten wir sogar. Wir rechnen damit. Vielleicht hilft’s, wenn du dran denkst.
Das ist es nicht, sagte sie.
Hast du vielleicht vor irgendwas Angst?, fragte Raymond.
Nein, es ist nur, dass ich euch vermissen werde, sagte sie. Ich bin noch nie weggewesen, nicht so. An das andere Mal mit Dwayne kann ich mich nicht mal mehr erinnern und will es auch gar nicht. Sie wechselte die Kleine von einem Arm auf den anderen und wischte sich über die Augen. Ich werde euch vermissen, das ist alles.
Du kannst anrufen, wenn du was brauchst, sagte Harold. Wir sind immer hier, am anderen Ende.
Trotzdem werde ich euch vermissen.
Ja, sagte Raymond. Sein Blick schweifte über die Veranda in den Hof und das braune Weideland dahinter. Über die blauen Sandhügel in der Ferne am niedrigen Horizont. Der Himmel war so klar und leer, die Luft so trocken. Wir werden dich auch vermissen, sagte er. Wenn du weg bist, werden wir wie zwei müde alte Arbeitsgäule sein. Einsam irgendwo rumstehen und immer über den Zaun starren. Er wandte sich um und musterte ihr Gesicht. Ein Gesicht, das ihm jetzt vertraut und lieb war, nachdem sie drei und das Kind unter demselben freien Himmel, im selben, von der Witterung gezeichneten alten Haus gewohnt hatten. Aber du willst trotzdem jetzt aufbrechen, oder?, sagte er. Wir sollten allmählich die Kiste anlassen, wenn wir wirklich los wollen.
Raymond fuhr ihren Wagen, Victoria saß neben ihm, damit sie sich nach hinten umdrehen und Katie in ihrem gepolsterten Kindersitz im Auge behalten konnte. Harold folgte ihnen im Pick-up aus der Zufahrt, über den Fahrweg in westlicher Richtung bis zu der zweispurigen geteerten Landstraße, die nach Norden Richtung Holt führte. Das Land zu beiden Seiten des Highways war flach und baumlos, der Boden sandig, die Weizenstoppeln auf den flachen Feldern glänzten noch immer hell, seit sie im Juli geschnitten worden waren. Hinter den Straßengräben stand der bewässerte Mais zweieinhalb Meter hoch, dunkelgrün und schwer. Die Getreidesilos der Stadt ragten groß und weiß neben den Eisenbahngleisen in der Ferne auf. Es war ein heller, warmer Tag, aus dem Süden wehte ein heißer Wind.
In Holt bogen sie auf den US34 ein und hielten am Gas and Go an, wo die Main Street den Highway kreuzte. Die McPherons stiegen aus und blieben an der Zapfsäule stehen, um beide Wagen aufzutanken, während Victoria hineinging, um ihnen zwei Becher Kaffee, sich selbst eine Cola und der Kleinen eine Flasche Saft zu kaufen. An der Schlange vor der Kasse warteten ein dicker, schwarzhaariger Mann und seine Frau mit einem Mädchen und einem kleinen Jungen. Sie hatte sie oft und zu den unterschiedlichsten Zeiten in den Straßen von Holt gesehen und auch die Gerüchte über sie gehört. Wären die McPheron-Brüder nicht gewesen, dachte sie nun, vielleicht würde es ihr jetzt wie ihnen gehen. Sie beobachtete, wie das Mädchen zum vorderen Teil des Ladens ging, eine Illustrierte aus dem Zeitungsständer vor der großen Fensterscheibe nahm und darin blätterte, mit dem Rücken zu ihnen, als hätte sie nichts mit den anderen am Tresen zu tun. Aber nachdem der Mann die Packung Käse-Cracker und die vier Dosen Limonade mit Essensmarken bezahlt hatte, steckte sie die Illustrierte wieder zurück und folgte dem Rest der Familie nach draußen.
Als Victoria herauskam, standen der Mann und die Frau auf dem geteerten Parkplatz und besprachen etwas miteinander. Sie konnte weder das Mädchen noch ihren Bruder sehen, drehte sich um und entdeckte, dass sie an der Ecke unter der Ampel standen und über die Main Street Richtung Stadt schauten. Sie ging weiter zum Wagen, wo Raymond und Harold auf sie warteten.
Es war kurz nach Mittag, als sie die Ausfahrt der Interstate nahmen und die Ausläufer von Fort Collins erreichten. Im Westen erhob sich das Vorgebirge zu einer blauen Zackenlinie, getrübt von gelbem Smog, der aus dem Süden, von Denver bis hierher geweht wurde. Auf einem der Hügel hatte man ein weißes A auf die Felsen gemalt, ein Überbleibsel aus der Zeit, als die Mannschaften der Universität noch Aggies genannt wurden. Sie fuhren die Prospect Road hinauf, bogen in die College Avenue ein, der Campus mit seinen Backsteingebäuden, der alten Sporthalle und den weichen grünen Rasenflächen lag links von ihnen, und fuhren weiter die Straße hinauf unter den Silberpappeln und hohen Blautannen hindurch. An der Mulberry Street bogen sie erneut ab und dann noch einmal, bis sie das von der Straße zurückgesetzte Apartmenthaus fanden, in dem das Mädchen mit der Kleinen nun wohnen würde.
Sie parkten den Wagen und den Pick-up auf dem Platz hinter dem Gebäude, dann ging Victoria mit der Kleinen hinein, um den Hausmeister zu suchen. Der Hausmeister entpuppte sich als eine Studentin, ähnlich wie sie, nur etwas älter, in Sweatshirt und Jeans, die ihr blondes Haar mit Unmengen von Spray fantastisch in Form gebracht hatte. Sie trat in den Gang, stellte sich vor und erklärte als Erstes, dass sie eine Ausbildung als Grundschullehrerin machte und dieses Semester eine Stelle als Referendarin in einer kleinen Stadt östlich von Fort Collins übernommen hatte. Während sie Victoria in den zweiten Stock führte, redete sie ohne Punkt und Komma. Sie schloss die Tür auf und reichte ihr den Wohnungsschlüssel und einen weiteren für den Haupteingang, dann hielt sie abrupt inne und sah Katie an. Darf ich sie mal halten?
Lieber nicht, sagte Victoria. Sie lässt sich nicht von jedem halten.
Die McPherons trugen die Koffer und Kisten vom Wagen nach oben und stellten sie in dem kleinen Zimmer ab. Dann sahen sie sich um und gingen zurück, um Katies Bett und den Kinderstuhl zu holen.
Die Hausmeisterin stand in der Tür und warf Victoria einen Blick zu. Sind das deine Großväter oder so was?
Nein.
Wer dann? Deine Onkel?
Nein.
Und was ist mit ihrem Daddy? Kommt er auch?
Victoria sah sie an. Stellst du immer so viele Fragen?
Ich versuche nur, nett zu dir zu sein. Ich bin weder neugierig noch unfreundlich.
Wir sind nicht verwandt, sagte Victoria. Sie haben mich vor zwei Jahren gerettet, als ich Hilfe brauchte. Deshalb sind sie hier.
Du meinst, sie sind Prediger.
Nein. Sie sind keine Prediger. Aber sie haben mich gerettet. Keine Ahnung, was ich ohne sie gemacht hätte. Jedenfalls lasse ich nichts auf sie kommen.
Ich bin auch gerettet worden, sagte die Studentin. Jeden Tag im Leben danke ich Jesus dafür.
So habe ich das nicht gemeint, entgegnete Victoria. Von so was habe ich gar nicht gesprochen.
Die McPheron-Brüder blieben den ganzen Nachmittag bei Victoria Roubideaux und der Kleinen und halfen, das Zimmer einzurichten, und am Abend gingen sie alle zusammen essen. Danach kehrten sie zu Victorias Wohnung zurück. Auf dem Parkplatz hinter dem Gebäude stiegen sie aus und verabschiedeten sich in der kühlen Nachtluft. Erneut brach das Mädchen in Tränen aus. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, küsste die alten Männer auf die wettergegerbten Wangen, umarmte sie und dankte ihnen für alles, was sie für sie und ihre Tochter getan hatten. Auch sie umarmten sie und klopften ihr unbeholfen auf den Rücken. Sie küssten die Kleine. Dann traten sie verlegen einen Schritt zurück und wussten nicht, wie sie das Mädchen und die Kleine noch länger ansehen oder was sie sonst tun sollten, außer aufzubrechen.
Ruf uns auf jeden Fall an, sagte Raymond.
Ich rufe euch jede Woche an.
Ja, tu das, sagte Harold, wir wollen wissen, wie es dir geht.
Dann fuhren sie im Pick-up nach Hause. Richtung Osten weg von den Bergen und der Stadt, hinaus auf die stille Hochebene, die sich flach und dunkel unter Myriaden von gleichgültig funkelnden Sternen am Himmel ausdehnte. Es war schon spät, als sie in die Zufahrt einbogen und vor dem Haus hielten. Zwei Stunden lang hatten sie kaum ein Wort miteinander gewechselt. Die Hoflampe auf dem Mast neben der Garage war während ihrer Abwesenheit von selbst angegangen und warf dunkle violette Schatten hinter die Garage, die Außengebäude und die drei verkrüppelten Ulmen in dem von Maschendraht umzäunten Hof vor dem grauen Schindelhaus.
In der Küche goss Raymond Milch in einen Topf, erhitzte sie auf dem Herd und nahm eine Packung Cracker aus dem Schrank. Sie setzten sich an den Tisch unter die Deckenlampe und tranken schweigend ihre heiße Milch. Es war still im Haus. Nicht einmal der Wind draußen war zu hören.
Ich glaub, ich geh ins Bett, sagte Harold. Ich weiß nicht, was ich hier noch soll. Er verließ die Küche, ging ins Badezimmer und kam dann noch einmal zurück. Willst du etwa die ganze Nacht hier verbringen?
Ich komm auch gleich hoch, sagte Raymond.
Na schön, sagte Harold. Wie du meinst. Er sah sich um. Sein Blick schweifte über die Küchenwände, den alten emaillierten Herd und durch die offene Tür ins Esszimmer, wo das Licht vom Hof durch die vorhanglosen Fenster auf den Tisch aus Walnussholz fiel. Fühlt sich jetzt schon leer an, nicht?
Verdammt leer, sagte Raymond.
Ich frag mich, was sie grad macht. Hoffentlich geht’s ihr gut.
Hoffentlich schläft sie. Hoffentlich schlafen sie alle beide. Das wäre am besten.
Ja, stimmt. Harold bückte sich und warf einen Blick aus dem Küchenfenster in die Dunkelheit auf der Nordseite des Hauses, dann richtete er sich wieder auf. Tja, ich geh schon mal nach oben, sagte er. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll.
Ich komm auch bald. Ich will noch ein Weilchen hier unten sitzen.
Aber schlaf nicht hier ein. Morgen tut’s dir dann leid.
Weiß ich. Mach ich nicht. Geh schon vor. Ich komm gleich nach.
Harold machte ein paar Schritte, blieb an der Tür stehen und drehte sich noch einmal um. Glaubst du, in ihrer Wohnung ist es warm genug? Ich hab versucht, mich zu erinnern, aber auf die Temperatur in ihrer Wohnung hab ich nicht geachtet.
Mir kam’s warm genug vor. Als wir da waren, mein ich. Wenn nicht, wär es uns bestimmt aufgefallen.
Du meinst, es war zu warm?
Glaub ich nicht. Wär uns auch aufgefallen. Falls ja.
Ich geh ins Bett. Verdammt ruhig hier, muss ich sagen.
Ich komm gleich nach, sagte Raymond.
2
Um sieben Uhr dreißig morgens holte der Bus sie im Osten von Holt ab. Die Fahrerin wartete, halb zur Seite gedreht auf ihrem Sitz, und fixierte die Tür des Wohnmobils. Sie hupte. Sie hupte ein zweites Mal, dann ging die Tür auf. Ein junges Mädchen in einem blauen Kleid lief mit gesenktem Kopf über die ungepflegte Wiese aus Süßgras und Rotwurzel-Salbei auf den Bus zu, stieg die Metallstufen hinauf und ging zur Mitte, wo es noch freie Plätze gab. Die anderen Schüler beobachteten sie, während sie durch den schmalen Gang ging, bis sie sich setzte, dann redeten sie weiter. Nun kam die Mutter mit ihrem jüngeren Bruder an der Hand aus dem Wohnmobil. Er war ein kleiner Junge in Blue Jeans und einem bis zum Kinn zugeknöpften Hemd, das ihm zu groß war. Nachdem auch er im Bus war, sagte die Fahrerin: Ich müsste nicht so lange auf Ihre Kinder warten. Ich hab einen Zeitplan einzuhalten, wissen Sie.
Die Mutter wandte den Blick ab und spähte durch die Fensterreihe, bis sie sah, dass der Junge neben seiner Schwester saß.
Ich sag’s Ihnen nicht noch mal, schimpfte die Fahrerin. Ich bin’s leid. Ich muss achtzehn Kinder abholen. Sie schloss die Tür und löste die Handbremse. Der Bus machte einen Satz und holperte die Detroit Street hinab.
Die Frau sah ihr nach, bis der Bus an der Seventh um die Ecke bog, dann schaute sie sich um, als hielte sie Ausschau nach jemandem, der ihr zu Hilfe käme und ihr sagte, was sie antworten sollte. Doch zu dieser frühen Morgenstunde war noch niemand auf der Straße, deshalb ging sie zum Wohnmobil zurück.
Es war alt und heruntergekommen. Die grelle Sonne und der peitschende Wind hatten das einst leuchtende Türkis der Außenwände zu einem schmuddeligen Gelb ausgeblichen. Im Innern stapelten sich die Kleider in den Ecken, und ein Müllsack mit leeren Limonaden-Dosen lehnte am Kühlschrank. Ihr Mann saß am Küchentisch und trank Pepsi aus einem großen Glas voller Eiswürfel. Vor ihm auf einem Teller klebten die Reste von tiefgekühlten Waffeln und Spiegeleiern. Er war ein großer, schwerer Mann mit schwarzem Haar und einer übergroßen Trainingshose. Sein riesiger Bauch lugte unter dem rötlichbraunen T-Shirt hervor, die massigen Arme baumelten über die Rücklehne des Stuhls. Er lehnte sich zurück und ruhte sich vom Frühstück aus. Als seine Frau hereinkam, fragte er: Was war es diesmal? Ich seh’s dir doch am Gesicht an.
Sie macht mich noch verrückt. Das sollte sie lieber lassen.
Was hat sie gesagt?
Dass sie achtzehn Kinder abzuholen hat. Und dass sie nicht so lange auf Richie und Joy Rae warten muss.
Ich sag dir, was ich mache, ich ruf den Schuldirektor an. Sie hat kein Recht, uns irgendwas vorzuhalten.
Sie hat kein Recht, so mit mir zu reden, sagte die Frau. Ich werd mich bei Rose Tyler beschweren.
Am heißen Vormittag verließen sie das Wohnmobil und gingen zu Fuß in die Stadt. Sie überquerten die Boston Street, folgten dem Bürgersteig zum hinteren Teil des alten Gerichtsgebäudes aus rotem Backstein und traten durch die Tür mit dem schwarzen Schriftzug am Fenster: SOZIALAMT, BEZIRK HOLT.
Rechter Hand war der Empfang. Der Schalter hatte ein großes Fenster, und in die Holzverkleidung der Durchreiche eingelassen war eine Schiebemulde, in die man seine Unterlagen und Informationen legen konnte. Dahinter saßen zwei Frauen an Schreibtischen, auf denen Telefone und Unmengen von Aktenordnern standen, und unter ihren Stühlen stapelten sich weitere Unterlagen. An den Wänden hingen große Kalender und von der Landesbehörde herausgegebene Amtsmitteilungen.
Der Mann und die Frau warteten vor dem Schalter, während ein junges Mädchen im Teenageralter vor ihnen etwas auf ein Blatt Papier aus einem billigen gelben Notizblock kritzelte. Sie beugten sich vor, um zu sehen, was sie schrieb, bis das Mädchen innehielt und ihnen einen bösen Blick zuwarf, dann drehte sie sich weg, damit sie nicht sehen konnten, was sie tat. Als sie fertig war, beugte sie sich vor und sagte durch den Schlitz unter dem Fenster: Das können Sie jetzt Mrs Stulson geben.
Eine der Frauen sah auf. Meinen Sie mich?
Ich bin fertig.
Die Frau stand langsam auf und trat an den Schalter, während das Mädchen das Formular unter dem Fenster hindurchschob. Hier haben Sie Ihren Stift zurück, sagte sie und legte ihn in die Mulde.
Wollen Sie noch eine Nachricht dazuschreiben?
Steht alles schon drin, sagte das Mädchen.
Ich gebe es ihr, wenn sie zurückkommt. Danke.
Sobald das Mädchen weg war, entfaltete die Frau die Nachricht und las sie aufmerksam durch.
Das Paar trat vor. Wir sollen uns bei Rose Tyler melden, sagte der Mann. Sie hat einen Termin mit uns.
Die Frau am Schalter sah ihn an. Mrs Tyler spricht im Moment noch mit einem anderen Kunden.
Sie hat uns einen Termin für halb elf gegeben.
Wenn Sie sich schon mal setzen wollen, ich sage ihr Bescheid, dass Sie da sind.
Er warf einen Blick auf die Uhr an der Wand hinter der Scheibe. Der Termin war schon vor zehn Minuten, sagte er.
Verstehe. Ich sage ihr, dass Sie warten.
Sie sahen die Frau an, als gingen sie davon aus, dass sie noch etwas sagte, und sie erwiderte teilnahmslos ihren Blick.
Sagen Sie ihr, Luther Wallace und Betty June Wallace sind da, sagte er.
Ich weiß, wer Sie sind, erwiderte die Frau. Nehmen Sie bitte Platz.
Sie traten vom Schalter zurück und setzten sich wortlos auf die Stühle an der Wand. Neben ihnen standen Kisten mit Plastikspielzeug, ein kleiner Tisch mit Büchern und eine offene Schachtel mit Kreidestücken und abgebrochenen Bleistiften. Niemand sonst war im Raum. Nach einer Weile nahm Luther Wallace ein Klappmesser aus der Tasche und schabte an einer Warze auf seinem Handrücken. Er wischte die Klinge an seiner Schuhsohle ab und atmete schwer. Allmählich schwitzte er in dem überhitzten Raum. Betty saß neben ihm und starrte auf die Wand gegenüber. Offensichtlich dachte sie an etwas, das sie traurig stimmte, etwas, das sie in dieser Welt niemals vergessen könnte, als hielte sie der Gedanke gefangen, was immer er war. Auf ihrem Schoß hatte sie eine kleine glänzende Handtasche. Sie war eine große Frau, noch keine vierzig, mit einem pockennarbigen Gesicht und strähnigem braunen Haar; alle zwei Minuten zog sie den Saum ihres weiten Kleides sittsam über die Knie.
Ein alter Mann trat aus einer Tür hinter ihnen und humpelte mit seinem metallenen Gehstock durch den Raum. Er stieß die Tür auf und trat ins Foyer hinaus. Dann kam die Sachbearbeiterin Rose Tyler ins Wartezimmer. Sie war eine kleine, untersetzte Frau mit schwarzem Haar und einem bunten Kleid. Betty, sagte sie. Luther. Wollen Sie lieber ein anderes Mal kommen?
Wir haben nur hier gesessen und gewartet, sagte Luther. Sonst haben wir nichts gemacht.
Ich weiß. Ich kann Sie jetzt drannehmen.
Sie standen auf, folgten ihr durch den Gang in eines der fensterlosen Sprechzimmer und setzten sich an den rechteckigen Tisch. Betty strich ihr Kleid glatt, während Rose Tyler die Tür schloss und ihnen gegenüber Platz nahm. Sie legte eine Mappe auf den Tisch, schlug sie auf und blätterte darin, überflog jede Seite und sah schließlich auf. Also, sagte sie. Wie ist es Ihnen diesen Monat ergangen? Läuft alles nach Wunsch?
Och, es läuft ganz gut, sagte Luther. Ich glaub, wir können uns nicht beklagen. Oder, Schatz?
Ich hab noch immer diese Bauchschmerzen. Betty legte vorsichtig die Hand auf ihr Kleid, als wäre darunter etwas sehr Empfindliches. Nachts kann ich kaum schlafen, sagte sie.
Sind Sie beim Arzt gewesen, wie wir es besprochen hatten? Wir hatten einen Termin für Sie vereinbart.
Ich bin hingegangen. Der konnte mir aber nicht helfen.
Er hat ihr ein Fläschchen mit Pillen gegeben, sagte Luther. Sie nimmt sie.
Betty schaute ihn an. Aber sie helfen nicht. Hab immer noch ständig Schmerzen.
Was für Pillen?, fragte Rose.
Ich hab dem Mann am Schalter den Zettel des Arztes gegeben, und der hat ihn ausgefüllt. Die Pillen liegen zu Hause im Regal.
Und Sie können sich nicht erinnern, wie sie heißen?
Betty sah sich in dem kahlen Zimmer um. Im Moment nicht, sagte sie.
Es ist ein kleines braunes Fläschchen, sagte Luther. Ich sag ihr, dass sie jeden Tag eine nehmen muss.
Sie müssen sie regelmäßig nehmen. Sonst wirken sie nicht.
Hab ich ja, sagte sie.
Verstehe. Mal sehen, wie es Ihnen geht, wenn Sie nächsten Monat wiederkommen.
Hoffentlich wirken sie bald. Lange halt ich’s nicht mehr aus.
Das hoffe ich auch, sagte Rose. Manchmal dauert es eine Weile, wissen Sie? Sie warf einen kurzen Blick in die Akte. Wollen Sie heute noch irgendetwas anderes mit mir besprechen?
Nein, sagte Luther. Wie gesagt, ich glaub, wir kommen klar.
Was ist mit der Busfahrerin?, fragte Betty. Hast du die schon vergessen?
Oh?, sagte Rose. Was ist mit der Busfahrerin?
Na ja, die macht mich noch verrückt. Sie hat mir was gesagt, wo sie kein Recht zu hat.
Ja, sagte Luther. Er beugte sich vor und legte seine dicken Hände auf den Tisch. Sie hat Betty gesagt, sie muss nicht auf Richie und Joy Rae warten. Sie hat gesagt, sie hat insgesamt fünfzehn Kinder abzuholen.
Achtzehn, sagte Betty.
Sie hat kein Recht, so mit meiner Frau zu reden. Ich überlege, ob ich mich beim Schuldirektor beschweren soll.
Moment mal, sagte Rose. Immer mit der Ruhe. Erzählen Sie mir zuerst mal, was überhaupt passiert ist. Waren Richie und Joy Rae rechtzeitig an der Straße? Wir haben schon mal darüber gesprochen.
Sie waren da. Angezogen und fertig.
Dafür müssen Sie unbedingt sorgen, wissen Sie. Die Busfahrerin tut, was sie kann.
Sobald sie hupt, kommen sie raus.
Wie heißt die Busfahrerin? Wissen Sie das?
Luther sah seine Frau an. Wissen wir, wie die heißt, Schatz?
Betty schüttelte den Kopf.
Wir haben der ihr’n Namen nie gehört. Es ist die mit den blonden Haaren. Mehr wissen wir nicht.
Ja, na schön. Wollen Sie, dass ich anrufe und frage, was da los ist?
Rufen Sie auch den Schuldirektor an. Sagen Sie ihm, was sie uns angetan hat.
Ich rufe für Sie an, aber Sie müssen auch das Ihre tun.
Haben wir ja.
Ich weiß, aber Sie müssen auch versuchen, mit ihr zurechtzukommen, verstehen Sie? Was würden Sie denn machen, wenn Ihre Kinder nicht im Bus mitfahren könnten?
Sie schauten Rose an, dann das Plakat an der Wand gegenüber. NEHP – NIEDRIGENERGIE-HILFSPROGRAMM, alles in roten Buchstaben.
Und jetzt mal sehen, sagte Rose. Ich habe Ihre Lebensmittelmarken hier. Sie nahm die Marken aus der Mappe auf dem Tisch, Heftchen mit Marken im Wert von einem, fünf, zehn und zwanzig Dollar, alle in verschiedenen Farben. Sie schob den Packen über den Tisch, und Luther gab ihn Betty, damit sie ihn in die Handtasche steckte.
Haben Sie diesen Monat Ihr Arbeitsunfähigkeitsgeld rechtzeitig erhalten?, fragte Rose.
O ja. Die Schecks waren gestern in der Post.
Und Sie lösen sie so ein, wie wir besprochen haben, und stecken das Geld in verschiedene Umschläge für die unterschiedlichen Ausgaben?
Betty hat sie dabei. Zeig sie ihr, Schatz.
Betty zog vier Umschläge aus ihrer Handtasche. MIETE, LEBENSMITTEL, NEBENKOSTEN, EXTRAS. Jeder Umschlag war mit Großbuchstaben in Rose Tylers sauberer Handschrift beschriftet.
Sehr gut. Haben Sie sonst noch etwas auf dem Herzen?
Luther schaute Betty an, dann wandte er sich Rose zu. Tja, also meine Frau spricht die ganze Zeit von Donna. Sieht aus, als hätte sie nichts anderes im Kopf.
Hab gerade eben noch an sie gedacht, sagte Betty. Ich versteh nicht, warum ich sie nicht anrufen darf. Sie ist doch meine Tochter, oder?
Natürlich, sagte Rose. Aber das Gericht hat verfügt, dass Sie keinen Kontakt zu ihr aufnehmen dürfen. Das wissen Sie doch.
Ich will doch bloß mit ihr reden. Ich würd keinen Kontakt mit ihr haben. Ich will nichts weiter als wissen, wie’s ihr geht.
Ein Anruf würde aber als Kontaktaufnahme gewertet, sagte Rose.
Jetzt füllten sich Bettys Augen mit Tränen, sie saß zusammengesackt auf dem Stuhl, die offenen Hände auf dem Tisch, das Haar hing ihr ins Gesicht, einige Strähnen klebten an ihren nassen Wangen. Rose schob eine Packung Kleenex über den Tisch, Betty nahm ein Taschentuch und wischte sich das Gesicht ab. Ich würd sie nicht stören, sagte sie. Ich will nur mit ihr sprechen.
Es macht Sie traurig, nicht?
Würd Sie so was nicht traurig machen? Wenn Sie an meiner Stelle wären?
Doch, ganz bestimmt.
Du musst versuchen, das Beste draus zu machen, Schatz, sagte Luther. Mehr kannst du nicht tun. Er tätschelte ihre Schulter.
Sie ist nicht deine Tochter.
Das weiß ich, sagte er. Ich sag ja nur, dass du das Beste draus machen sollst. Was kann man sonst machen? Er sah Rose an.
Was ist mit Joy Rae und Richie?, fragte Rose. Wie geht es ihnen?
Na ja, Richie prügelt sich in der Schule, sagte Luther. Vor ein paar Tagen ist er mit einer blutigen Nase nach Haus gekommen.
Weil die anderen Jungs Streit mit ihm anfangen, sagte Betty.
Eines Tages bring ich ihm bei, sich zu wehren.
Was könnte der Grund dafür sein, was glauben Sie?, fragte Rose.
Weiß nicht, sagte Betty. Die hacken einfach ständig auf ihm rum.
Sagt er etwas zu ihnen?
Richie sagt gar nichts zu denen.
Weil ich’s ihm beigebracht hab: Halt die andere Wange hin, sagte Luther. Wenn sie dir eins auf die Backe geben, halt ihnen die andre hin. Steht in der Bibel.
Der hat aber nur zwei, sagte Betty. Wie viele soll er noch hinhalten?
Stimmt, sagte Rose, es gibt Grenzen, nicht wahr?
Wir sind an unsern Grenzen, sagte Betty. Ich weiß nicht mehr, was wir machen sollen.
Nein, sagte Luther, aber ansonsten können wir uns nicht beklagen. Er setzte sich im Stuhl auf, offensichtlich bereit zu gehen, sich dem zu stellen, was als Nächstes kommen würde. Ich meine, wir haben uns ganz gut geschlagen. Man nimmt, was man kriegt, und geht nicht in die Luft, sag ich immer. Hat mir auch mal wer gesagt.
3
Der Junge war klein, untergewichtig für sein Alter, mit dünnen Armen und dünnen Beinen und braunem Haar, das ihm in die Stirn fiel. Er war aufgeweckt, verantwortungsbewusst und zu ernst für seine elf Jahre. Vor seiner Geburt hatte seine Mutter beschlossen, den Mann, der sein Vater war, nicht zu heiraten, und als er fünf war, starb sie eines Samstagnachts bei einem Autounfall in Brush, Colorado, nachdem sie mit einem rothaarigen Mann in einer Kneipe am Highway tanzen gegangen war. Sie hatte nie verraten, wer sein Vater war. Seit ihrem Tod hatte er allein bei dem Vater seiner Mutter gelebt im Norden von Holt, in einem dunklen, kleinen Haus mit unbebauten Grundstücken rechts und links und einem von Maulbeerbäumen gesäumten Kiesweg dahinter. Er war im fünften Schuljahr und ein fleißiger Schüler, obgleich er den Mund nur aufmachte, wenn er aufgerufen wurde. Er meldete sich nie freiwillig, und nach dem Unterricht ging er allein nach Hause oder streifte durch die Stadt, und gelegentlich erledigte er Gartenarbeiten für die Frau, die am Ende der Straße wohnte.
Sein Großvater, Walter Kephart, war fünfundsiebzig und hatte weißes Haar. Dreißig Jahre lang hatte er im Süden von Wyoming und im Nordosten von Colorado als Gleisarbeiter gearbeitet. Mit fast siebzig hatte man ihn in Rente geschickt. Er war ein stiller alter Mann; nur wenn er getrunken hatte, redete er wie ein Wasserfall, doch er war kein Trinker und genehmigte sich normalerweise nur dann ein Gläschen, wenn er krank war. Allmonatlich, wenn er den Scheck mit seiner Rente bekam, löste er ihn ein und verbrachte einen Abend in der Kneipe von Holt, Ecke Third und Main Street, wo er mit anderen alten Männern aus der Stadt trank und Geschichten erzählte, die weniger übertrieben als weitschweifig waren, und dann erinnerte er sich ein oder zwei Stunden lang daran, was er vor langer Zeit, als er noch jung war, alles hatte machen können.
Der Junge hieß DJ Kephart. Er kümmerte sich um den alten Mann und geleitete ihn nachts durch die dunklen Straßen nach Hause, wenn er mit dem Erzählen in der Kneipe fertig war. Zu Hause erledigte er den Großteil des Kochens und der Hausarbeiten, und einmal in der Woche ging er mit ihrer schmutzigen Wäsche hinüber zum Waschsalon in der Ash Street.
Eines Tages im September kam er nachmittags aus der Schule. Der alte Mann erzählte ihm, dass die Nachbarin nach ihm gefragt hatte. Besser du gehst mal rüber und siehst nach, was sie will.
Wann war sie hier?
Heute Morgen.
Der Junge schenkte sich einen Becher kalten Kaffee aus der Kanne auf dem Herd ein, trank ihn und machte sich auf den Weg zu der Nachbarin. Draußen war es noch heiß, obwohl die Sonne bereits gen Westen wanderte und sich die ersten Anzeichen des Herbstes bemerkbar machten – der Geruch nach Erde und trockenem Laub, die alljährliche Einsamkeit am Ende des Sommers. Er ging an dem unbebauten Grundstück mit dem Fußpfad vorbei, der zu einer Reihe von Maulbeerbäumen am Kiesweg führte, und anschließend an den Häusern der Witwen, beide hinter verstaubten Fliederbüschen leicht zurückgesetzt von der ruhigen Straße, und gelangte zu ihrem Haus.
Mary Wells war knapp über dreißig und hatte zwei kleine Töchter. Ihr Mann arbeitete in Alaska und kam nur selten nach Hause. Sie war schlank und gesund, eine hübsche Frau mit weichem braunem Haar und blauen Augen, die die Gartenarbeit auch allein hätte verrichten können, aber sie wollte dem Jungen gern auf diese schlichte Art helfen, indem sie ihn für seine Arbeit bezahlte.
Er klopfte an die Haustür und wartete. Ein zweites Mal wollte er lieber nicht klopfen, das wäre unhöflich und respektlos. Nach einer Weile kam sie an die Tür und wischte sich die Hände mit einem Geschirrtuch ab. Hinter ihr standen die beiden Mädchen.
Grandpa hat gesagt, Sie wären heute Morgen da gewesen.
Ja, sagte sie. Willst du reinkommen?
Nein, ich fange am besten sofort an.
Willst du nicht vorher reinkommen und ein paar Plätzchen essen? Wir haben gebacken. Sie sind ganz frisch.
Ich habe gerade Kaffee getrunken, bevor ich gekommen bin, sagte er.
Dann vielleicht später, sagte Mary Wells. Jedenfalls dachte ich, vielleicht hättest du Zeit, ein wenig im Garten zu arbeiten. Wenn du nicht gerade etwas anderes zu tun hast.
Im Moment habe ich nichts anderes zu tun.
Dann kann ich dich gut brauchen. Sie lächelte ihm zu. Komm, ich zeige dir, was ich meine.
Sie stieg die Stufen hinab, gefolgt von den beiden Mädchen, dann gingen sie um die Ecke des Hauses zu dem von der Sonne versengten Garten vor dem Kiesweg. Sie zeigte auf das Unkraut, das gesprossen war, seit er das letzte Mal da gewesen war, und auf die Reihen von Bohnen und Gurken, die er ernten sollte. Würde es dir etwas ausmachen?, fragte sie.
Nein, Ma’am.
Aber nicht, dass es dir zu heiß hier draußen wird. Komm rauf und setz dich in den Schatten, wenn es zu anstrengend wird.
Mir ist nicht zu heiß, sagte er.
Ich schicke dir die Mädchen mit Wasser.
Sie gingen wieder ins Haus zurück, und er fing an, das Unkraut zwischen den grünen Pflanzen zu jäten, kniete sich auf die Erde und arbeitete kontinuierlich, wobei er schwitzte und immer wieder Fliegen und Mücken verscheuchte. Er war es gewohnt, allein zu arbeiten, auch unter beschwerlichen Bedingungen. Er häufte das Unkraut am Rand des Kieswegs auf, dann machte er sich daran, die Buschbohnen und Gurken zu ernten. Eine Stunde später kamen die Mädchen mit drei Plätzchen auf einem Teller und einem Glas Eiswasser aus dem Haus.
Mama hat gesagt, die sind für dich, sagte das ältere Mädchen, Dena.
Er wischte sich die Hände an der Hose ab, nahm das Glas Wasser und trank die Hälfte, danach verschlang er eins der großen Plätzchen mit zwei Bissen. Sie sahen ihm aufmerksam zu, während sie am Rand des Gartens im Gras standen.
Mama hat gesagt, du siehst hungrig aus, sagte Dena.
Die Plätzchen haben wir erst heute Nachmittag gebacken, sagte Emma.
Wir haben dabei geholfen, meinst du. Wir haben sie nicht selbst gebacken.
Wir haben Mama geholfen, sie zu backen.
Er trank den Rest des Wassers aus und reichte ihnen das Glas zurück. Jetzt waren schmutzige Fingerabdrücke und Schlieren darauf zu sehen.
Willst du die anderen Plätzchen nicht?
Esst ihr sie.
Mama hat gesagt, sie sind für dich.
Ihr könnt sie haben, ich bin satt.
Magst du sie nicht?
Doch.
Warum isst du sie dann nicht?
Er zuckte mit den Achseln und wandte den Blick ab.
Ich esse einen, sagte Emma.
Besser nicht. Mama meinte, sie sind für ihn.
Er will sie aber nicht.
Ist mir egal, es sind seine.
Ihr könnt sie haben, sagte er.
Nein, sagte Dena. Sie nahm die beiden Plätzchen vom Teller und legte sie ins Gras. Du kannst sie später essen. Mama hat gesagt, sie sind für dich.
Die Käfer werden sie fressen.
Dann solltest du sie lieber vorher essen.
Er sah sie an und machte sich wieder an die Arbeit, pflückte die grünen Bohnen und warf sie in eine weiße Emailleschüssel.
Die beiden Mädchen sahen ihm bei der Arbeit zu, jetzt robbte er auf den Knien an den Bohnenreihen entlang, mit dem Rücken zu ihnen, die aufgerichteten Sohlen seiner Schuhe ihnen zugewandt wie die schmalen Gesichter eines seltsamen Wesens, das Haar im Nacken dunkel vor Schweiß. Als er das Ende der Reihe erreichte, ließen die Mädchen die Plätzchen im Gras liegen und kehrten ins Haus zurück.
Nachdem er fertig war, brachte er die Bohnen und Gurken zur Hintertür, klopfte und wartete. Mary Wells kam mit den beiden Mädchen zur Tür.
Meine Güte, wie viel du gefunden hast, sagte sie. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel ist. Behalte einen Teil für dich. Warte, ich hole dir das Geld.
Sie ging wieder ins Haus, und er machte einen Schritt von der offenen Tür zurück und sah über den Garten auf das Nachbargrundstück. Unter den Bäumen gab es schattige Plätzchen. Da, wo er auf der Veranda stand, fiel die Sonne auf seinen braunen Kopf und sein verschwitztes Gesicht, auf den Rücken des schmutzigen T-Shirts und die Ecke des Hauses. Die Mädchen beobachteten ihn. Die Ältere hätte gern etwas gesagt, wusste aber nicht, was.
Mary Wells kehrte zurück und gab ihm vier zusammengefaltete Dollarscheine. Ohne sie eines Blickes zu würdigen, stopfte er sie in die Hosentasche. Vielen Dank, sagte er.
Gern geschehen, DJ. Und nimm etwas von dem Gemüse mit. Sie reichte ihm eine Plastiktüte.
Dann gehe ich jetzt. Grandpa hat bestimmt schon Hunger.
Aber pass auch auf dich selbst gut auf, hörst du?
Er drehte sich um, ging um das Haus herum zum Vorgarten und kam zur Straße, die jetzt, am späten Nachmittag, menschenleer war. Er hatte das Geld in der Tasche und die Plastiktüte mit den grünen Bohnen und zwei Gurken in der Hand.
Als er weg war, gingen die Mädchen zum Ende des Gartens, um zu sehen, ob er die Plätzchen gegessen hatte, aber sie lagen noch im Gras. Jetzt krabbelten rote Ameisen auf ihnen herum, und eine Reihe von Ameisen bewegte sich durch das Gras davon. Dena hob die Plätzchen auf und schüttelte sie heftig, dann warf sie sie hinaus auf den Kiesweg.
Zu Hause briet er Hamburger in einer Eisenpfanne, kochte ein paar rote Kartoffeln und die grünen Bohnen, die ihm Mary Wells mitgegeben hatte, und stellte Brot und Butter auf den Tisch, zusammen mit einer in Scheiben geschnittenen Gurke auf einem Teller. Er machte frischen Kaffee, und als die Kartoffeln und die Bohnen fertig waren, rief er seinen Großvater an den Tisch, und sie begannen zu essen.
Was solltest du da drüben erledigen?, fragte der alte Mann.
Unkraut jäten und Gemüse ernten.
Hat sie dich bezahlt?
Ja.
Wie viel?
Er zog die gefalteten Scheine aus der Tasche und zählte sie auf dem Tisch. Vier Dollar, sagte er.
Das ist eine Menge.
Wirklich?
Zu viel.
Das finde ich nicht.
Nun, am besten sparst du sie. Vielleicht willst du dir eines Tages etwas kaufen.
Nach dem Abendessen räumte er den Tisch ab, spülte das Geschirr und stellte es auf ein Küchentuch auf der Anrichte zum Trocknen, während sein Großvater ins Wohnzimmer ging, die Lampe neben dem Schaukelstuhl anknipste und den Holt Mercury las. Der Junge machte seine Hausaufgaben unter der Hängeleuchte am Küchentisch, und als er eine Stunde später nach ihm schaute, saß der alte Mann mit geschlossenen Augen da, die papierdünnen Lider von winzigen blauen Äderchen schraffiert, mit offenem dunklem Mund schwer atmend, die Zeitung auf dem Schoß der Latzhose ausgebreitet.
Grandpa. Er berührte ihn am Arm. Geh doch lieber ins Bett.
Sein Großvater wachte auf und schielte zu ihm hoch.
Zeit, schlafen zu gehen.
Der alte Mann musterte ihn einen Augenblick, als versuchte er herauszufinden, wer er war, dann faltete er die Zeitung zusammen und legte sie auf den Boden neben dem Stuhl. Er stand langsam auf, indem er sich von den Armlehnen des Schaukelstuhls hochstemmte, ging ins Badezimmer und anschließend in sein Zimmer.
Der Junge trank noch eine Tasse Kaffee an der Küchenspüle und kippte den Kaffeesatz in den Ausguss. Er spülte die Kanne aus, löschte das Licht und ging in das kleine Zimmer neben dem seines Großvaters, wo er noch zwei Stunden las. Durch die Wand hörte er, wie der alte Mann schnarchte, hustete und vor sich hin murmelte. Um halb elf knipste er die Lampe aus und schlief ein. Am nächsten Morgen stand er früh auf, machte Frühstück und ging an den Gleisen entlang zum neuen Schulgebäude im Süden von Holt. Während des Unterrichts tat er bereitwillig und routiniert alles, was man von ihm verlangte, sprach aber den ganzen Tag kaum ein Wort mit jemandem.
4
Sie brachten die einjährigen Blackbaldy-Rinder mit dem Gooseneck-Anhänger in die Stadt und verfrachteten sie hinter der Versteigerungshalle in eine Gasse neben der Verladerampe. Die Viehtreiber sortierten sie aus und trieben sie in den Pferch. Der Veterinär untersuchte sie und stellte keine der Atemwegserkrankungen fest, auf die er bei den Jährlingen achtete, auch keinen Augenkrebs, die Bang’sche Krankheit oder die missgebildeten Kiefer, mit denen man gelegentlich bei älteren Rindern rechnen konnte. Der Fleischbeschauer gab sie ohne Einschränkung zur Versteigerung frei. Anschließend erhielten sie einen Nachweis darüber, dass die Bullen ihnen gehörten und wie viele es waren. Sie fuhren wieder heim, aßen schweigend in der Küche zu Abend und legten sich schlafen. Am nächsten Morgen standen sie noch in der Dämmerung auf und begannen mit den üblichen Pflichten.
Jetzt saßen sie an einem rechteckigen Tisch der kleinen schmutzigen Kantine der Auktionshalle und bestellten ihr Mittagessen. Die Kellnerin kam mit dem Bestellblock und blieb vor ihnen stehen. Sie schwitzte und hatte ein erhitztes Gesicht. Was darf’s denn für euch beide sein?
Du siehst ganz schön erledigt aus, sagte Harold.
Ich bin seit sechs Uhr früh auf den Beinen. Wie soll ich da nicht erledigt sein?
Nun ja, du siehst aus, als könntest du jeden Augenblick zusammenklappen. Du solltest dich lieber ein bisschen schonen.
Wie denn?
Keine Ahnung, sagte Harold. Gute Frage. Hast du was Besonderes anzubieten?
Alles ist besonders. Was schwebt euch denn vor?
Tja, sagte er, ich hab an was Herzhaftes vom Schwein gedacht. In den letzten Tagen habe ich mich so viel mit diesen Blackbaldy-Bullen rumschlagen müssen, dass ich für mindestens eine Woche kein Rindfleisch mehr sehen kann.
Wir haben Schweinekoteletts, und es gibt auch Bacon, wenn dir danach ist. Wir könnten dir ein Schinkensandwich machen.
Dann bring mir ein Schweinekotelett. Mit Kartoffelpüree und brauner Sauce und was sonst noch dazugehört. Schwarzen Kaffee. Und auch ein Stück Kürbiskuchen, wenn’s geht.
Sie notierte alles rasch auf ihrem Block und blickte auf. Und was ist mit dir, Raymond?
Klingt gut, sagte er. Ich nehm das Gleiche wie Harold. Aber was habt ihr sonst noch für Kuchen da?
Apfel, Blaubeere, Karamell, Zitrone. Sie warf einen Blick nach hinten auf die Theke. Und ein Stück Schokoladenbaiser gibt es auch noch, glaube ich.
Blaubeere, sagte Raymond. Aber lass dir Zeit. Kein Grund zur Eile.
Ich wünschte, er würde noch eine zweite Kellnerin einstellen, sagte sie. Mehr bräuchte es ja gar nicht, oder? Aber glaubst du, Ward würde das je tun?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Im Leben nicht, sagte sie. Sie ging Richtung Küche und sagte im Vorbeigehen etwas zu zwei Männern an einem anderen Tisch.
Kurz darauf kehrte sie mit einem Tablett zurück, das sie auf einer Hand balancierte, darauf zwei Kaffeetassen, je eine Portion Salat für beide, ein Teller mit Weißbrot und zwei Portionen Butter, stellte alles auf ihren Tisch und ging wieder. Die McPheron-Brüder nahmen ihre Gabeln in die Hand und legten los. Während sie aßen, kam Bob Schramm zu ihnen an den Tisch. Sitzt hier schon wer?, fragte er.
Du, sagte Harold. Nimm Platz.
Schramm zog einen Stuhl heraus und setzte sich. Er nahm seinen schwarzen Hut ab und legte ihn kopfüber auf einen leeren Stuhl. Dann drehte er mit den beiden Zeigefingern die Plastikschalter seines Hörgerätes auf und strich sich das Haar auf dem Kopf glatt. Er sah sich in dem überfüllten Raum um. Tja, ich hab grad erfahren, dass der alte John Torres gestorben ist.
Wann denn?, fragte Harold.
Heute Nacht. Drüben im Krankenhaus. Krebs, nehm ich an. Ihr habt ihn doch gekannt, nicht?
Klar doch.
Das war schon einer, der alte John. Schramm sah ihnen beim Essen zu. Wie alt war er wohl, an die fünfundachtzig, sagte er, und das letzte Mal, wo ich ihn gesehen hab, ging er so krumm, dass er mit dem Kinn fast die Gürtelschnalle berührte. Ich sag, wie geht’s, John, und er, oh, nicht schlecht für einen alten Haudegen wie mich. Freut mich, sag ich, wenigstens schlägst du noch zu, und er sagt, ja schon, aber allmählich hab ich Mühe mit dem Pappelholz, in der Mitte ist es weich wie ein Schwamm, und man kriegt es einfach nicht sauber auseinander. Du stößt deine Axt rein, und es ist so, als würdest du eine Gabel in eine Pfanne mit Matsch stecken. Tja, ihr versteht schon, was ich meine, sagte Schramm. Da sitzt der alte John und versucht, Zunder zu geben, in seinem Alter.
Hört sich ganz typisch an für ihn. Harold nahm ein Stück Brot, strich Butter darauf, klappte es zusammen und biss ein großes, halbmondförmiges Stück ab.
Tja, er hat zwei Packungen Lucky Strike am Tag gequalmt, sagte Bob Schramm, aber keiner Seele jemals was zu Leide getan. Ich hab immer mit ihm zusammen gesessen, und wenn ich mir Kaffee eingeschenkt hab, ihm auch welchen eingegossen. Einmal kommt er rein und sagt, wie geht’s, und ich sag, gar nicht so gut, mir geht was nicht aus dem Kopf, hab mich über ein paar Leute geärgert. Und er sagt, über wen, soll ich mich drum kümmern, und ich sag, nein, schon gut, ich kümmer mich selbst drum, weil ich ja wusste, was er tun oder wen anders für sich tun lassen würde. Irgendwer würde mit aufgeschlitzter Kehle aufwachen, mein ich. Na ja, er war aus San Luis Valley. Mit dem hätte sich keiner gern angelegt. Selbst wenn er nie einer Menschenseele ein Haar gekrümmt hatte, hieß das nicht, dass er nicht diesmal dafür sorgen würde, auch wenn er sich nicht unbedingt selbst die Hände dabei schmutzig machte.
Die Kellnerin brachte zwei große Teller mit Koteletts, Kartoffelpüree, brauner Sauce, grünen Bohnen und Apfelmus. Sie stellte sie vor den McPheron-Brüdern auf den Tisch und wandte sich Schramm zu. Was ist mit dir, was darf’s sein?
Hab noch gar nicht drüber nachgedacht.
Dann komm ich später noch mal vorbei, sagte sie.
Schramm beobachtete, wie sie wegging, sah sich um und warf einen Blick auf den Nachbartisch. Kriegt man hier eigentlich keine Speisekarte mehr?
Steht alles oben über dem Tresen, sagte Raymond. An der Wand dahinter.
Früher gab’s auch noch Speisekarten.
Jetzt steht alles da oben.
Sind Speisekarten so teuer geworden?
Keine Ahnung, wie teuer Speisekarten sind, sagte Raymond. Hast du was dagegen, wenn wir schon mal anfangen?
Verdammt, nein. Wartet nicht auf mich. Schramm studierte die Speisekarte auf dem Pappkarton über dem Tresen, während die McPheron-Brüder sich über ihre Teller beugten und anfingen zu essen. Er zog ein blaues Taschentuch aus der hinteren Hosentasche und schneuzte sich mit geschlossenen Augen. Dann faltete er das Taschentuch zusammen und steckte es wieder ein.
Die Kellnerin kehrte zurück und schenkte ihnen Kaffee nach. Schramm sagte: Ach, bring mir einfach einen Hamburger mit Fritten und Kaffee, sei so nett.
Wenn du einen Nachtisch willst, sag’s lieber gleich.
Ich glaub nicht.
Sie ging zu einem anderen Tisch, schenkte Kaffee nach und ging weiter.
Wann ist die Beerdigung?, fragte Harold.
Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob sie schon irgendwelche Angehörigen ausfindig gemacht haben, sagte Schramm. Um ihnen mitzuteilen, dass er gestorben ist. Es werden wohl eine Menge Leute kommen wollen.
Er war beliebt, sagte Raymond.
Ja, das schon. Aber nicht bei allen. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Eine Zeitlang hat der alte John mit Lloyd Bailey’s Frau rumgemacht. Ich hab sie selbst mal gesehen, in ihrem brandneuen Buick drüben am Straßengraben neben den Gleisen an der Kreuzung von Diamond T. Sie hatten die Scheinwerfer ausgeschaltet, und der Buick wippte ein bisschen auf und ab. Im Radio lief leise irgendwas Mexikanisches aus Denver. Tja, Mister, die zwei beiden haben sich eine schöne Zeit gemacht. In diesem Herbst sind dann der alte John und Lloyd’s Missus über die Berge nach Kremmling durchgebrannt. Sie haben sich in einem Motelzimmer eingenistet und zusammengelebt wie Mann und Frau. Aber es gibt dort nichts zu tun, es sei denn, man ist Jäger und will einen Hirsch oder einen Elchbullen vor die Flinte kriegen. Ist ja ein kleiner Ort, wisst ihr, am Fluss, und wenn man nichts anderes zu tun hat, als die ganze Zeit auf einem riesigen Motelbett zu rammeln, kann es einem nach einer Weile ganz schön langweilig werden, auch wenn man das Zimmer mit der Kreditkarte von wem anders bezahlt. Deshalb kamen sie nach einer Weile wieder zurück, und sie geht zu Lloyd und sagt, willst du, dass ich zu dir zurückkomme, oder willst du die Scheidung? Lloyd hat ihr eine Ohrfeige verpasst, dass sie Sternchen sah, dann hat er gesagt, na gut, schätze, du kannst zurückkommen. Danach sind die beiden erst mal auf Sauftour gegangen. Bis Steamboat Springs sind sie gekommen, glaub ich, und dann wieder umgekehrt. Als sie wiederkamen, waren sie noch immer zusammen. Ich glaub, das sind sie heute noch. Lloyd sagte, er hätte sich zwei Wochen lang volllaufen lassen müssen, um sich den alten John Torres aus dem Kopf zu spülen.
Und wie lange hat er gebraucht, um ihn seiner Frau aus dem Kopf zu spülen?, fragte Harold.
Das weiß ich nicht. Hat er nie gesagt. Sicher ist nur, dass der alte John einem ganz schön an die Nieren gehen konnte.
Damit dürfte es jetzt vorbei sein, was?
Das kannst du laut sagen. Seine Zeit ist um.
Trotzdem, seinen Spaß hat er gehabt, sagte Raymond. Ist ganz schön auf seine Kosten gekommen.
Kann man wohl sagen, erwiderte Schramm. Mehr als jeder andere. Ich hab immer eine Menge auf den alten John Torres gegeben.
Hat jeder, sagte Raymond.
Ich weiß nicht, meinte Harold. Ich glaub kaum, dass Lloyd große Stücke auf ihn gehalten hat. Dann legte er seine Gabel weg und sah sich in der überfüllten Kantine um. Ich frag mich bloß, was aus dem Kuchen geworden ist, den sie bringen wollte.
Als sie mit dem Essen fertig waren, legten die McPheron-Brüder das Geld für die Kellnerin auf den Tisch und gingen in die Auktionshalle nebenan, wo um eins die Versteigerung beginnen sollte. Sie stiegen die Betonstufen zwischen den im Halbkreis angebrachten Sitzplätzen hinauf, setzten sich und sahen sich um. Unter ihnen lag der Verkaufsring mit seinem Zaun aus Eisenrohren, dem Sandboden und den großen Stahltoren auf beiden Seiten. Der Auktionator saß bereits auf seinem Platz hinter dem Mikrofon direkt neben der Verkäuferin im Auktionsstand über dem eigentlichen Ring, gegenüber den Sitzreihen der Bieter. Alle Tiere befanden sich in Pferchen im hinteren Teil.
Die Sitzreihen füllten sich mit Männern mit Cowboyhüten oder Mützen und ein paar Frauen in Jeans und Cowboyhemden, und um ein Uhr rief der Auktionator: Meine Damen und Herren, es ist so weit! Packen wir’s an!
Die Ringmänner ließen vier Schafe herein, alles junge Böcke, einer hatte sich ein Horn an der Brüstung des Geheges abgebrochen, und jetzt tropfte Blut von seinem Kopf. Die Schafe liefen ziellos herum. Niemand schien groß an ihnen interessiert zu sein, und am Ende wurden alle vier Böcke für fünfzehn Dollar das Stück an den Mann gebracht.
Als Nächstes führten sie drei Pferde herein, eins nach dem anderen. Zuerst einen großen siebenjährigen kastrierten Rotschimmel mit weißen Flecken am Bauch und vorn auf den Hinterbeinen. Jungs, brüllte der ältere Ringmann, das ist ein eins a zugerittenes Tier. Jeder kann es reiten, aber nicht jeder kann sich auf ihm halten. Er kommt aus dem Stall und legt los, Jungs. Außerdem kennt er sich mit Rindern aus. Siebenhundert Dollar!
Der Auktionator nahm das Angebot auf, schrie, klopfte mit dem Stiel seines Auktionshammers auf den Tisch, gab den Takt vor. Ein Mann in der vorderen Reihe bot dreihundert.
Der Ringmann sah ihn an. Fünfhundert müssten es schon sein.
Der Auktionator fing damit an, und der Rotschimmel ging schließlich für sechshundertfünfundzwanzig weg: Der alte Besitzer kaufte ihn zurück.