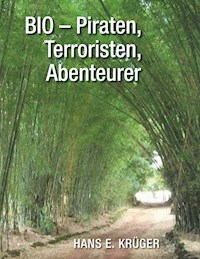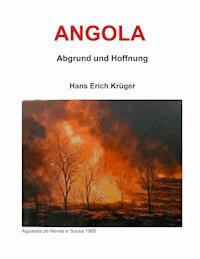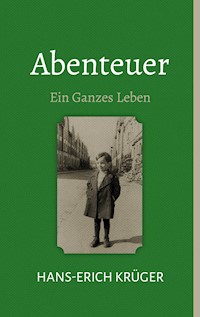
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Abenteuer auf drei Kontinentes erzählt diese Biografie von Hans E. Krüger, ein phantastisches Kaleidoskop über 80 prall gefüllte Jahre. Kindheit und Jugend in Bremen, die Befreiung vom Einfluss der Mutter, selbständiges Denken und Handeln, ohne irgendwelche persönlichen Bindungen und Hilfen. Vom erträumten Beruf des Außenhandels Kaufmanns, zum Journalisten, zum Projektmanager, Architekten, zum Farmer und schließlich zum Autor von mehreren Romanen, die Stationen aus seinem Leben wiedergeben. Das Leben war schwierig, oft sogar sehr gefährlich. Ohne Optimismus hätte er wohl manche Phase nicht durchgestanden. In seinem kleinen Garten zwischen seinen Pflanzen schaut Krüger jetzt auf ein erfülltes Leben zurück und ist mit sich zufrieden. "Es gibt nichts, was mich noch mal locken könnte. Alles ist rund und harmonisch," sagt er. "Ich bereue auch nichts, weil ich Realist bin. Meine Eskapaden in die Waffenbranche folgten einer technischen Neugier und einem Markt, der immer mehr wächst. Daran kann ich nichts ändern, absolut nichts. Man kann da mitspielen, wenn man kann, wenn man will, wenn man glaubt, dafür den Einfluss zu haben."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Kindheit
Grundschule
Schweden
Qualjahre
Umzug in die Gartenstadt
Erste Brasilienreise
Journalist
Zweite Brasilienreise
Hochzeit im Busch
Reise in ein Paradies
Wieder Brasilien – der Cerrado
Projekte
Unsere Tiere
Wer wagt, der verliert – öfter als man erwartet
Zu Kohle, zu Asche
Nigeria
Angola und die Bücher
Vanda
Die verfluchte Politik
Nachwort
Vorwort
Abenteuer auf drei Kontinentes erzählt diese Biografie von Hans E. Krüger, ein phantastisches Kaleidoskop über 80 prall gefüllte Jahre.
Kindheit und Jugend in Bremen, die Befreiung vom Einfluss der Mutter, selbständiges Denken und Handeln, ohne irgendwelche persönlichen Bindungen und Hilfen.
Vom erträumten Beruf des Außenhandels Kaufmanns, zum Journalisten, zum Projektmanager, Architekten, zum Farmer und schließlich zum Autor von mehreren Romanen, die Stationen aus seinem Leben wiedergeben.
Das Leben war schwierig, oft sogar sehr gefährlich. Ohne Optimismus hätte er wohl manche Phase nicht durchgestanden. In seinem kleinen Garten zwischen seinen Pflanzen schaut Krüger jetzt auf ein erfülltes Leben zurück und ist mit sich zufrieden. »Es gibt nichts, was mich noch mal locken könnte. Alles ist rund und harmonisch,« sagt er. »Ich bereue auch nichts, weil ich Realist bin. Meine Eskapaden in die Waffenbranche folgten einer technischen Neugier und einem Markt, der immer mehr wächst. Daran kann ich nichts ändern, absolut nichts. Man kann da mitspielen, wenn man kann, wenn man will, wenn man glaubt, dafür den Einfluss zu haben.
Kindheit
80 Jahre alt bin ich. Bevor das Gedächtnis nachlässt, will ich berichten, was sich in meinem Leben ereignet hat. Na, sagen wir: fast alles, denn es gibt immer Dinge, die man besser nicht sagt.
Ich sitze in meinem Gemüsegarten auf einem niedrigen Hocker mit einer Bespannung aus Antilopenleder, den ich aus Angola nach Brasilien gerettet habe. Um mich herum viele Beete, abgegrenzt durch dicke Bambusstangen oder mit Rank Hilfen. Da wachsen in der trockenen Augusthitze Karotten, Rote Beete, Porree, Paprika, Gurken, Bohnen, Kürbisse, Kohlrabi, Weißkohl, Tomaten, Petersilie, Zwiebeln, Salat und Dill. An den Wänden hängen Kästen mit Erdbeeren und Blumen. Nach den vielen teils sehr hektischen Jahren bin ich hier in dem kleinen brasilianischen Ort Indianopolis zur Ruhe gekommen, nicht weit entfernt vom Fluss Mandaguari, wo unsere ehemalige Farm Bela Taanda liegt.
Heute beobachte ich die vielen sehr kleinen Geschehnisse, die mich früher gar nicht interessiert haben, die ich heute aber für bemerkenswert halte, denn, mit etwas Phantasie, passiert hier im Kleinen, was überall auf der Welt immerzu im Großen stattfindet. Am besten lässt es sich mit dem Spruch »Fressen oder gefressen werden« sagen. Der Kampf ums Überleben also. Und jeder benutzt die Mittel, die zur Verfügung stehen. Der Mensch ist vielleicht das einzige Lebewesen, dass bei der Durchsetzung, manchmal, hoffentlich, Hemmungen hat.
Viele Tropenjahre haben dunkle Flecken auf meine Hände und Arme gebrannt. Wie soll man sich davor schützen, wenn man mit Erde arbeitet und Arbeitshandschuhe mir Allergien machen? Den Kopf? Ja, mit einem dunkelgrünen Hut. Aber der hat auch nicht verhindern können, dass mir Doktora Alice, meine Hautärztin, ein 10 cm großes Stück Schwarte vom Kopf entfernen musste wegen Krebsverdacht. Die fehlende Haut wurde vom Rücken und Oberschenkel transplantiert. Ich kam mir vor wie skalpiert.
Ich beobachte eine graue, haarige Spinne, die ich beim Jäten aus dem Schatten eines Salatblatts gescheucht habe und die jetzt über eine besonnte Stelle zum nächsten Schatten krabbelt. Ein kurzes Brummen neben mir und eine riesige schwarze Wespe setzt sich auf den Leib der Spinne. Der Leib krümmt sich und ihr Stachel fährt in den weichen Leib. Die Spinne macht nur noch kurze Fluchtbewegungen. Dann hat das Wespengift die Beute dauerhaft paralysiert, aber nicht getötet. Die Wespe schleift sie in ihr nahes Versteck, wo sie Eier in die Spinne ablegen wird, woraus Maden werden, die sich von der Spinne ernähren, bis sie zu neuen Wespen schlüpfen. Die Spinne hat verloren und anderes Leben ermöglicht.
Bei Menschen ist es natürlich ganz anders. Wir haben so viele Möglichkeiten. Aber es bleibt immer noch ein Kampf, um nach oben oder nach vorne zu kommen, besonders wenn man im 2. Weltkrieg geboren wurde. Aber die elementaren Bedürfnisse sind bei fast allen höheren Lebewesen dieselben: Essen, Trinken, Schlafen, Sex (Liebe ist mir zu abgegriffen) und Zuneigung.
Der Kampf meines Lebens begann früh, zunächst mehr passiv, später doch sehr energisch und zielgerichtet, obwohl ich die Ziele häufiger wechselte, wechseln musste oder sie von anderen geändert wurden.
Geboren wurde ich in Bremen im Jahre 1940. Im Jahr davor hatte meine Mutter den Eisenbahner Heinrich Knobloch aus Jülich im Rheinland kennengelernt. Er stammte aus einer traditionellen katholischen Familie und war irgendwie in oder bei Bremen als Marine-Soldat stationiert. Die näheren Umstände blieben verborgen und meine Mutter hat dabei tatkräftig mitgewirkt. Nur ein einziges Bild rettete meine Oma Grete vor der Schere meiner Mutter, die aus allen Fotos meinen Vater herausschnitt. »Das ist Knöppchen«, sagte Oma Grete mir irgendwann mal vertraulich, ihr Spitzname für Heinrich Knobloch. Die Wahl dieses Spitznamens zeigte mir, dass sie ihn eigentlich mochte und die »Rettung« einer einzigen Fotografie bewies das ebenfalls.
Der Krieg in Europa ging schon ins zweite Jahr, fand aber irgendwie nur fern statt, obwohl Bremen als Hafenstadt und Eisenbahn-Knotenpunkt wichtig waren. Wir wurden wenig »gepisackt«, wie man sagte. Die Engländer wussten sehr wohl um die strategische Wichtigkeit von Bremen. Die angeblich an den Grenzen »Des Reiches« und um die großen Städte installierten Abwehrsysteme, auch Flak genannt, sollten anfliegende Bomber sofort »neutralisieren«, sagte Hermann Göring. Denn nur aus der Luft konnte Unheil drohen. Auf dem Boden herrschte die Wehrmacht, das heißt die Infanterie und Artillerie samt Panzern. Und was die konnte, erlebte die Welt schon bald.
Also, im Jahr 1940 wurde ich geboren. 38 Luftangriffe wurden gezählt. Einige allerdings eher Nadelstiche als ernsthafte Angriffe oder die feindlichen Piloten luden Bomben ab, die sie aus welchen Gründen auch immer, nicht losgeworden waren. Ist auch egal. Jedenfalls bereiteten sich die Behörden vor und setzten ab November 1940 ein Sofortprogramm für Luftschutzbunker um, sowohl Hoch- als auch Tiefbunker. Die ersten Hochbunker entstanden mitten in Wohngebieten, hatten Wände von mehr als 1 Meter Beton, die Decken noch mehr und verstärkt durch Baustahl. Und einige sogar einen Dachstuhl wie auf Wohnhäusern, allerdings nicht aus Holzbalken, sondern aus Beton. Nachgebildet. Das Ganze wurde dann noch mit Schindeln belegt und wenn Bomben dort einschlugen, dann verpuffte deren Energie in der Dachkonstruktion und richtete im Hochbunker darunter keine größeren Schäden an. Aufklärer, die von den angerichteten Zerstörungen Bilder schossen, konnten dokumentieren, dass das Gebäude getroffen wurde und damit als Ziel für spätere Attacken ausfiel.
Aber zurück zu meinen ersten Erdenzeiten.
Eine stolze Stadt wie Bremen, immer der Sozialdemokratie verpflichtet, verdeckt soweit möglich, auch während des »Dritten Reiches«, hat niemals den obersten Befehlshaber in seinen Mauern empfangen. Eine nationale Feier? »Er« kam nie! Obwohl Hafen und Weser Richtung Nordsee mit den Werften für die Seekriegsführung absolute Priorität hatten. Auch ein Diktator kennt die politische Geographie.
Erst nach meiner Geburt heiratete Mutter meinen leiblichen Vater, um sich dann baldigst wieder scheiden zu lassen. Er war ihr nicht treu und verfiel wohl leicht der Weiblichkeit. Oma beschrieb ihn so: braune Augen, kastanienbraunes leicht gelocktes Haar. Ein Frauentyp eben. Geheiratet wurde nur, damit ich nicht als unehelich eingestuft wurde. Das war damals noch »eine Schande«.
Die Bombenangriffe wurden von Jahr zu Jahr heftiger. Es gab klare Regeln, an die man sich zu halten hatte: die ersten Meldungen kamen über das Radio, Radkasten oder Göbbels Empfänger genannt. Es wurden die Flugrichtungen der Bomberverbände gemeldet. Galt der Angriff Bremen, wurde Sirenenalarm gegeben und alle mussten ihren Luftschutzbunker aufsuchen; keine Gepäckstücke mitnehmen, nur Papiere. Meiner Mutter, die bei Focke Wulf arbeitete und später bei der Reichsbahn, als immer mehr Männer zum Kriegsdienst eingezogen wurden, war oft so müde, dass sie in der Etagenwohnung blieb. Sie hatte sicherlich einen Schutzengel. Oma und ich liefen jedenfalls zum ersten Hochbunker am Torfkanal.
1942 heiratete meine Mutter erneut, den Piloten der Luftwaffe Günther Troyke. Die Familie hatte in Ostpreußen ein Gut, das wir einmal besuchten. An die lange Bahnfahrt im Winter erinnere ich mich nicht mehr, wohl aber an die Ankunft mitten in der Nacht auf irgendeinem verlassenen und verschneiten Bahnhof. Vor dem stand ein riesiger Pferdeschlitten mit Kutscher, der uns erst mal warm in dicke Schafsfelle wickelte und mit einer riesigen Pferdedecke zudeckte.
Los ging es durch die eisige Winterlandschaft. Ich bin wohl eingeschlafen und wachte erst auf, als der Schlitten hielt. Schemenhaft erkannte ich Gebäude. Gesinde kam gerannt und half uns aus den Fellen und in einen Kuhstall, den man am Geruch sofort erkannte. Die Körperwärme der Tiere sorgte bei mir für Wohlfühlen.
Die Angestellten waren fast alle Polen, Frauen in der Überzahl. Der Krieg war damals durch die Luftangriffe in Bremen näher als hier. Die Polen gaben sich freundlich. Ich spielte mit den anderen Kindern, meistens in den Ställen, denn dort war es immer schön warm.
Danach ging es ins Erzgebirge, wo Verwandte von Günther Troyke lebten, denen eine Spinnerei in Chemnitz gehörte. Dort blieb ich längere Zeit und ging in den Kindergarten, wo ich mir Läuse holte, was meine Mutter furchtbar übelnahm. Ende 1943 wurden Kinder in großer Zahl aus den größeren Städten aufs Land verschickt, wo es sicherer war. Aber langsam verschlechterte sich die militärische Lage im Osten und wir kehrten nach Bremen zurück.
Die Zugfahrten waren immer voller Abenteuer, die Waggons quollen über von Menschen. Meine Mutter hatte mir eingeschärft, niemals etwas von Fremden anzunehmen, ohne sie vorher zu fragen. Es gab angeblich viele Verführer von Kindern! Einige Züge hatten Abteile, die für Kuriere und Offiziere reserviert waren. Meine Mutter war eine gutaussehende Frau, wurde angesprochen und ging gerne auf die Angebote dieser Privilegierten ein, sich ins Abteil zu setzen. So hatten wir beiden es eigentlich auf der langen Fahrt ganz gemütlich.
An die Propaganda-Maßnahmen wie »Räder müssen rollen für den Sieg« habe ich keine Erinnerungen. Wir, meine Mutter und ich, waren eigentlich immer unter einem Schutzschirm. Nur ganz am Ende, als wir wieder in unserer Heimat Bremen ankamen, bemerkte sogar ich als Kind, dass die Bedrohung grösser wurde, die sich in mein kleines Leben drängte!
Mein Onkel Wolfgang Meyer, der Bruder meiner Mutter, war als Flakhelfer in Quakenbrück eingeteilt. Er war selten zuhause, denn eigentlich war die Bedrohung aus der Luft in den letzten beiden Kriegsjahren permanent, wenn auch viele Bomberverbände über Norddeutschland hinwegflogen und ihre tödliche Last anderswo abluden, vor allem im Ruhrgebiet.
An eine Nacht erinnere ich mich noch sehr gut. Oma Grete Meyer zog mich hinter sich her über die Torfkanalbrücke zum ersten Hochbunker auf der anderen Seite. Ich sah oben in dem grauen Himmel die Umrisse der Bomber ganz ruhig ihre Bahnen ziehen. Viele, viele. – Dann waren wir im Bunker. Die Stahltore standen noch offen und der Luftschutzwart machte Tempo. Alle rein und mit einem Rumpeln wurde die Stahltür geschlossen. Durch den Vorraum oder Schleuse, dann eine weitere Stahltür, die ebenfalls geschlossen wurde. Wir suchten unseren Platz in einem der vielen Räume. Die einzige Luftverbindung nach außen waren kleine runde Löcher mit Stahlkappen, die jetzt ebenfalls geschlossen sein mussten. Kaum saßen wir, fielen die ersten Bomben, ganz in der Nähe. Der Bunker schwankte, das trübe Licht ging aus, wieder an. Wie lange der Angriff dauerte, weiß ich nicht. Meine Mutter hatte mal verlauten lassen, dass ich so schön singen könnte. Die anderen Leute forderten mich auf, doch mal was zu singen und ich gab »Mein Leben für die Liebe, jawohl« zum Besten. Das entspannte wohl die Stimmung etwas. Als Entwarnung kam, wurden die Luftlöcher geöffnet und das innere Stahltor auch. Die Menschen drängten nach draußen, in Sorge, was sie von ihrem Zuhause noch vorfinden würden. Dann kam der Schock in der Schleuse! Der Boden stand unter Blut, nicht unter Wasser. Nein, Blut. Auf den Pritschen lagen, saßen, hingen Verwundete, nur notdürftig behandelt und das Blut floss auf den Boden. Meine Oma zog mich durch die Schleuse hinaus in die brennende Nacht.
Bremen kapitulierte und die Engländer besetzten es. Im Bürgerpark lag eine Abteilung Artillerie der SS, die sich noch nicht ergab. Meine Mutter und ich waren da in einem Haus am Torfkanal einquartiert worden, weil das Reihenhaus in der Grünberg Straße einen Brandbombentreffer erhalten hatte. Die letzten Kampfhandlungen erlebte ich dort im Keller. Vor dem Haus die Straße, dann der Torfkanal und dann der Bürgerpark mit seinen schönen Eichen. Aus dem Kellerfenster des Nachbarhauses ratterte die ganze Nacht hindurch ein Maschinengewehr. Dann kamen bei Tagesbeginn die englischen Panzer, knickten die Eichen um und rasselten in den Bürgerpark. Ende des Dritten Reiches in Bremen.
Die Engländer blieben nicht. Eines Tages sahen wir nur noch Amerikaner. Inmitten der britischen Besatzungszone entstand eine amerikanische Enklave und die ersten Bremer Nummernschilder begannen daher auch mit AE (American Enclave). Der Grund: die USA meinten die Hafenkapazitäten von Bremerhaven für ihren Nachschub zu benötigen, der per Bahn und LKW durch Bremen Richtung Rhein-Main lief.
Meine erste Begegnung mit einem amerikanischen GI fand noch neben dem Haus am Torfkanal statt. Im Nebenhaus quartierten sich die »Amis« ein. Ich rief meine Mutter: «Guck mal Mutti, ein Neger!«. Der GI bleckte lächelnd sein Gebiss. »Nix Neger, schwarzer Mann.« Dann gab er mir Schokolade.
Mitte 1945 zogen wir wieder in die Grünberg Straße 19 zurück. Der durch Brandbomben getroffene Dachstuhl war ausgebessert. Der Schutt vor und hinter den hohen Reihenhäusern wurde von hunderten von Helfern aufgeräumt, meistens Frauen und Kinder, die Ziegel vom Mörtel gereinigt und fein säuberlich vor den Häusern aufgestapelt (siehe Foto auf dem Umschlag). Jetzt waren die vollgeschütteten Keller dran. Die Bewohner wachten mit Argusaugen über die Arbeiten, denn manch ein Gefäß, Besteck oder Geschirr tauchte auf und wurde wiederverwendet. Von meinem Opa August Meyer war darunter ein großer Porzellanbecher, jetzt allerdings ohne Henkel, der dann noch viele Jahre auf seinem Nachttisch stand. Opa hatte es an den Bronchien und den Schleim von seinem Husten spuckte er in den Becher.
Die Winter in den zugigen Wohnungen waren erbarmungslos. Wir hatten einen sogenannten gusseisernen Kanonenofen im Wohnzimmer, der mit Kohle oder Holz gefüttert werden musste. Und woher kam die Kohle? Ununterbrochen rollten die oben offenen Waggons mit amerikanischer Steinkohle durch Bremen. Damit genügend Kohle herunterfiel, während die Züge auf den wackeligen Gleisen langsam durch die Stadt fuhren, sprangen die stärkeren und mutigeren Männer auf und halfen nach. Aufsammeln durfte man, abwerfen aber gar nicht. Wer von den wenigen Zugbegleitern erwischt wurde, verschwand ohne Anklage in irgendwelchen Lagern, so auch mein Opa, nach dem meine Mutter lange suchen musste. Er war wohl einer der langsamen und eine leichte Beute. Die Oma Grete kümmerte sich nicht um ihren gefangenen Mann.
Langsam kamen die Dinge wieder an ihren richtigen Platz. Opa August ging wieder bei der Bahn arbeiten, was er den Krieg über schon getan hatte, als Nicht-Nazi ohne Chance auf eine Beförderung, denn er war ein aufrechter Sozi und blieb es bis an sein Lebensende.
Meine Mutter fand erst einen Posten bei der amerikanischen Verwaltung an der Contrescarpe, von dort brachte sie Erdnussbutter nach Hause, die ich bald nicht mehr ausstehen konnte. Ich glaube, sie klaute da etwas, was sie jedoch empört zurückwies. Später arbeitete sie als Serviererin bei Kaffee HAG im Schnoor und nahm nebenbei Schauspielunterricht. Angeblich hat sie auf eine Karriere verzichtet, weil der Theatermensch sie vor die Alternative stellte: entweder Karriere oder Mutter-Kind. Es gibt keine Zeugen für diese Version.
Grundschule
Ich wurde 1947 eingeschult an der Volksschule Nürnberger Straße. Zu Fuß von der Grünberg Straße war das ein ganz schön langes Stück zu laufen. Ich machte die Strecke meistens mit Heiko Emker, der etwas weiter unten wohnte. Er war kräftig und gedrungen und immer für eine Keilerei gut, genau das Gegenteil von mir. Und er hatte einen Sprechfehler. Mir und mich konnte er partout nicht auseinanderhalten. Seine Fäuste räumten manchen Raufbold, der es auf mich abgesehen hatte, aus dem Weg.
Noch gut kann ich mich an die Zeit der «kreativen« Essensherstellung erinnern. Von den Amerikanern gab es als Schulspeisung heiße Milch oder Kakao in Glasflaschen und irgendeinen Eintopf, während wir zuhause Gries Brei kochten, der als Brotaufstrich diente, und Brot selber buken, dem Baumrinde beigemischt war, denn Mehl war knapp. Das einzig Süße stammte aus der Zuckerrübenanlage am Güterbahnhof (Rüben gegen Sirup). Den Geschmack von dunklem leicht angebranntem Sirup kann ich noch heute nachempfinden. Unsere Verbindungen zu Bauern im Neuland zahlten sich aus. Die Rüben waren unsere Währung.
Und von unserem Balkon zum Hinterhof konnte ich die Kaninchen- und Hühnerställe sehen, die in einer Reihe am Zaun standen. Von dort kam für lange Zeit unser Eiweiß in Form von Eiern und Fleisch. Für die Fütterung war ich mit zuständig. In der Nachbarschaft gab es genügend Trümmergrundstücke mit Löwenzahn, den die Tiere besonders gerne mochten. Die Kaninchen schlachtete Opa selbst. Sie wurden mit einem Schlag ins Genick getötet. Ich bekam sie immer erst zu sehen, wenn Opa schon dabei war, ihnen das Fell sehr vorsichtig abzuziehen. Es wurde anschließend einem Gerber gebracht und kehrte dann wieder zu uns zurück, als Teil einer Jacke für die kalte Zeit.
Ansonsten schoss ich mit dem Luftgewehr Spatzen, die sich bei den Ställen ansiedelten und vom Balkon aus leicht zu erwischen waren. Etwa fünf reichten für eine dünne Suppe.
Ein Sonntagsessen ist mir gut in Erinnerung geblieben. Wir hatten den damals noch als »Verlobten« meiner Mutter bezeichneten Kunibert Krüger, einen Seemann, zu Gast. Damit wir etwas Fleisch im Erbsen-Eintopf anbieten konnten, hatte Oma Grete den Kopf eines Karnickels gut eingesalzen im Fliegenschrank konserviert. Einen Kühlschrank gab es damals noch nicht bei uns. Der Karnickelkopf wurde mitgekocht.
Zunächst bekam jeder eine Kelle voll Erbsensuppe. Sie schmeckte vorzüglich. Einige Fleischstücke schwammen darin, die sich wohl vom Kopf gelöst haben mochten. Dann wurde Kunibert Krüger, als Ehrengast aufgefordert, den Kopf aufzubrechen, denn natürlich sollte das Hirn mit verspeist werden. Also kam der Kopf auf ein Holzbrett und mit einem dicken Messer und einem Hammer wurde der Kopf gespalten. Der Inhalt bestand nicht aus Hirn, sondern aus lauter aufgequollenen Maden.
Ich weiß nicht mehr, ob sich jemand übergab, denn die vorher wahrgenommenen »Fleischstückchen« waren nichts anderes als zerkochte Maden gewesen. Den Appetit verdarb es uns jedenfalls. Noch vorhandene Bestandteile von Maden in dem Eintopf wurden entfernt, damit man den Rest noch essen konnte. Die Männer taten es. Ich nicht und meine Mutter auch nicht.
Der Tauschhandel blühte. Zu den begehrtesten Artikeln gehörten Nylonstrümpfe und Zigaretten. Deren Verkäufer waren die Kings und machten enorme Schnäppchen damit.
Mein erstes eigenes Geschäft machte ich mit Tabak, indem ich Kippen sammelte, den Rest des Tabaks von Asche und angebranntem säuberte, schön locker aufmischte und als Pfeifentabak verkaufte oder für selbstgedrehte Zigaretten. Man war nicht sehr wählerisch zu diesen Zeiten. Die noch teilverwendeten Kippen stammten fast alle von den qualmenden Amerikanern, denn die Deutschen rauchten Zigaretten so lange, bis sie sich die Lippen verbrannten. Für die letzten Paar Züge wurde die Kippe mit einer Haarklammer gehalten. Was dann noch übrig blieb, war für mich nicht mehr interessant. – Es gab auch »böse Raucher«. Das waren Amis, die sich einen Spaß daraus machten, die Kippe mit dem Schuh so zu zerquetschen, dass sie nutzlos war. Deren größte Genugtuung war es, die enttäuschten Minen der kleinen »Krauts« zu beobachten. Aber das waren eher Ausnahmen. Damals gab es noch keine Filterzigaretten.
Ein anderes Geschäft war Altmetall. Dazu schlossen wir uns zu kleinen Banden zusammen. Von den Innenwänden der Ruinen, die die Bomben übrigließen, hingen in den Stockwerken noch die Reste von Bleirohren von den Wänden sowie die Elektroleitungen. Um an die heranzukommen, wurde Kreativität gebraucht. Ungefährlich war es sowieso nicht. Leitern gab es nicht. Also warfen wir beschwerte Leinen mit einer Schlinge an der Wand hoch und irgendwann verhakte sich das Seil und wir zogen und zerrten gemeinsam, bis sich das Rohr löste, oft zusammen mit einem Teil der Wand. Das brachte uns Blei, Kupfer und auch Gusseisen, wenn wir einen Klokasten oder Waschbecken runterreißen konnten.
Käufer war ein Schrotthändler, der sein gut umzäuntes Areal auf der Bürgerweide vor der Grünberg Straße hatte. Der Mann selbst hauste in einem alten, vergammelten Wohnwagen und musste Tag und Nacht auf der Hut sein, damit man ihn nicht beklaute und das Zeug dann erneut an ihn verkaufte. Heute würde man das Recycling nennen.
Besonders schlimm war die Rattenplage nach dem Krieg. In den zum Teil noch intakten Kellern, die durch Schutt isoliert waren, vermehrten die sich rasant. Ich erinnere mich an ein Loch, das wir durch den Boden im Erdgeschoss gestemmt hatten und hineinleuchteten. Der Boden wimmelte nur so von den grauen Nagern, die schon mal 30cm ohne Schwanz erreichten. Bei der Vorstellung, da rein zu fallen, wurde mir richtig blümerant. – Die amerikanischen Besatzer setzten ihr Kampfprogramm gegen Seuchen rigoros um. Überall tauchte der per Schablone aufgemalte Totenkopf mit den gekreuzten Knochen an den Häuserwänden auf: GIFT.
In den ersten Nachkriegsjahren konzentrierte man sich auf die wichtigsten Arbeiten. Dazu gehörte, den Bürgerpark aufzuräumen. Überall auf den Spielwiesen, in dem schönen Park verteilt, waren Bombentrichter, vollgelaufen mit Wasser. Dazwischen sonnten sich die Bremer bereits wieder, vor allem Mütter mit ihren Kindern. Ich witterte dort eine Gelegenheit, Geld zu verdienen und bat meinen Onkel Wolfgang, mir Kasperle-Köpfe herzustellen, vor allem den Kasper, den Teufel und die Hexe. Dazu kochte er Zeitungspapier und formte aus der Masse zusammen mit Leim die innen hohlen Köpfe, die anschließend mit Ölfarbe bemalt wurden. Um den Kopf Hals herum wurden Stoffstreifen drapiert, mit angearbeiteten Armen und Händen. Der Zeigefinger schlüpfte in den Kopf, der Daumen und Mittelfinger jeweils in die Arme. Fertig war die Puppe. Ich konnte gleichzeitig mit zwei Puppen arbeiten, eine für jede Hand. Jetzt fehlte noch die Bühne. Sie bestand aus drei Teilen. In der Mitte die Bühne mit einem kleinen Vorhang und jeweils links und rechts die beiden Flügel, damit man das gut aufstellen konnte.
Damit begab ich mich auf eine Spielwiese und machte für die Kasperle-Vorstellung Werbung. Wer sich vor dem Theater einfand musste fünf Pfennig bezahlen. Je mehr der Kasper auf den Teufel oder die Hexe einprügelte, umso grösser war der Erfolg. Mich selbst sah man kaum, weil ich mich hinter der Bühne wegduckte. Irgendwann merkte meine Mutter, was ich da trieb und verbot weitere Vorstellung gegen Geld. Aber ohne machte es mir keinen Spaß und die Bühne wurde höchstens mal hervorgeholt, um Theater auf einem Geburtstag zu machen, ohne Bezahlung.
Unter der Bevölkerung der Eisenbahnersiedlung Findorff, zu der die Grünberg Straße gehörte, waren wir privilegiert, denn die in der Neustadt lebende Ur-Groß Oma, Omima Häfker genannt, hatte hinter ihrem Reihenhaus einen sehr, sehr großen Garten, mit allem, was das Herz begehrte: Hühner, Enten, Gänse, Truthähne, Karnickel und natürlich alles Obst, was in unserer Gegend wuchs: Birnen, Äpfel, Kirschen, Pflaumen, Stachelbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren und natürlich Gemüse: Alle Kohlsorten, Zwiebeln, Kartoffeln, Sellerie, Porree, Radieschen, Lauch, Petersilie und im Winter den berühmten Braunkohl oder Grünkohl, der erst nach den ersten Frösten so richtig gut schmeckte.
Wie oft habe ich im Sommer unter den Büschen gesessen und mir die Johannis- oder Stachelbeeren direkt in den Mund gesteckt.
Omima sprach nur Bremer Platt, Großmutter Grete auch meistens. Ihr Hochdeutsch war durchsetzt von Platt und man musste sehr aufpassen, um sie zu verstehen.
Diese entfernte Ecke der Neustadt war mit der Straßenbahn leicht zu erreichen, wenn auch die Fahrt eine Stunde und mehr dauerte. Ich machte sie noch viele Jahre, als Omima längst tot war, um den Onkel Heinrich Häfker, genannt Heini, zu besuchen. Er wohnte weiter als Junggeselle in dem alten Haus von Omima, in dem es nach Katzenpipi roch, weil nie richtig sauber gemacht und gelüftet wurde. Ich kam immer so gegen neun Uhr am Sonntagmorgen an. Da schlief der Onkel noch seinen Rausch aus. Über dem Bett hing ein riesiges Bild. Darauf ein gefallener Soldat (sein Bruder) und über ihm schwebend ein großer ernst und gleichzeitig sanft blickender Engel. »Gefallen für Kaiser und Vaterland« stand, glaube ich, darauf, wenn ich mich recht erinnere.
Heini Häfker war Vorführfahrer bei einer Traktorenfabrik und ein armes, einsames Schwein. Am Samstag ging es in die Kneipe und dann im Zickzack nach Hause. Irgendein Auto fuhr ihn nachts tot. Fahrerflucht. Die unter Personalmangel leidende Polizei fand den Täter nie.
Es war auch die Zeit, in der Verbindungen von GI mit deutschen »Fräuleins« immer mehr zunahmen und die amerikanischen Verwalter dem ziemlich machtlos zusehen mussten. Ich erinnere mich noch gut an einen Schlager, der damals die Runde machte: »Eins-zwei-drei-vier-fünf-sechs-sieben, wo ist meine Frau geblieben. Ist nicht hier und ist nicht da, ist wohl in Amerika.«
1948 kam ich in ein Verschickungsprogramm vom Rotes Kreuz, denn ich war mager und meine körperliche Entwicklung entsprach wohl nicht den Vorgaben der Herren Ärzte. Die Eisenbahn war als Rote-Kreuz-Transport gekennzeichnet und wurde von Krankenschwestern begleitet. Mütter durften keine mitfahren. Es ging in die Schweiz. Für mich eine aufregende Reise. Die erste überhaupt ins Ausland. Auf deutscher Seite war die Lok noch ein Kohlemodell aus Kriegszeiten mit großem Dampfkessel. Beim Zugwechsel an der Schweizer Grenze sah ich zum ersten Mal Elektroloks. Ja, die reiche, neutrale Schweiz hatte damals ihr Streckennetz schon größtenteils elektrifiziert.
Am Zielbahnhof, ich glaube es war Solothurn, wartete eine große Menschenmenge auf dem Bahnsteig und man begann sofort mit der »Verteilung« von uns Kindern. Ein Ehepaar Schenk-Grollimund »übernahm« mich und weiter ging es mit einem anderen Zug in das nahe gelegene Derendingen, wo die Schenks ein freistehendes Haus im Städtchen besaßen. Leibliche Kinder hatte das Ehepaar nicht. Und sie haben ihre ganze Liebe und Fürsorge auf mich projiziert, manchmal war es fast erdrückend, sodass ich kaum dazu kam, mich auch etwas freier zu bewegen.
Unbeschwerte Zeiten folgten. Ich blieb vier Monate bei ihnen und wurde mit allen Mitteln der Kunst aufgepäppelt. So viel gegessen hatte ich noch nie. Es gab vor allem Gemüse und, was ich gar nicht mochte, fast jeden Tag Maisbrei, mal salzig, mal süß mit Zimt.
In der Nachbarschaft arbeitete ein Hausschlachter. Um das Haus der Schenks sehr viele Gärten. Drei Dinge sind mir in guter Erinnerung geblieben. Mit einem Jungen von nebenan schleppten wir eine Leiter zur Wand des Schlachters. Wir krochen diese zu einem Fenster hoch, um unsere Neugier zu befriedigen. Er zerlegte die Körper von Rind und Schwein. Sowas hatte ich noch nie gesehen. Es war sehr spannend.
Die Schweiz litt damals unter einer Maikäferplage. Überall wurden Gruben ausgehoben, wo man die in Dosen gesammelten braunen Käfer gegen eine geringe Bezahlung abliefern konnte. Wir machten uns mit Konservenbüchsen ans Werk. Damit die Viecher aus der Grube nicht wieder wegflogen, wurden sie mit einer Flüssigkeit begossen und das Gekrabbel immer mal angesteckt.
Das Haus der Schenks hatte keinen Anschluss an Kanalisation, sondern aller Kot floss in einen ausgemauerten Erdtank neben dem Haus. Ich glaube, das ganze Städtchen kontrollierte so seine Abwässer. Sobald die Grube ¾ voll war, wurde sie geöffnet und die Gülle mittels eines langstieligen Schöpfeimers in Fässer gefüllt. Der Gärtner, der das Resultat seiner Arbeit auf Gärten und Felder verteilte, kommentierte den Geruch so: was stark stinkt, das gut klingt. Ohne Zweifel ist Naturdünger Geld wert.
Was sah ich da beim Hineingucken in die trübe Brühe? Etwas hatte sich noch nicht von selbst zerlegt und wurde nochmals gut geschüttelt. Durch die Beschau stellte ich fest, dass jemand aus dem Hause beim Kirschen essen die Kerne runtergeschluckt hatte, statt sie auszuspucken. Hans Schenk gab sich als »Täter« zu erkennen.
Am Tage des Abschieds gab es Tränen auf beiden Seiten. Das schöne andere Leben hatte mir sehr gut gefallen und als das Ehepaar Schenk-Grollimund fragte, ob ich wiederkommen wollte, versprach ich es sofort.
In Bremen begann wieder der lange Fußmarsch zur Schule. Überall wurde gebaut. Baugerüste an den Wänden. Wir Schüler gingen oft unter diesen Gerüsten hindurch. Eins stand vor einem Geschäft und im Vorbeigehen sah ich mir die Auslagen an. Ein Geräusch über mir veranlasste mich, nach oben zu blicken. Und schon hatte ich Kalkmörtel im Gesicht, einen dicken Haufen, der sich ins linke Auge drängte. Es brannte fürchterlich und ich schrie wie am Spieß. Sofort kam jemand mit Wasser, um den Mörtel abzuwaschen und vor allem aus den Augen zu entfernen.
Ab zum Augenarzt. Mittel gegen das Brennen. Der Augapfel hatte sich verfärbt und die Gefahr, das Augenlicht zu verlieren, war real. Aber alles ging noch mal gut. Zurück blieb ein kleines Stückchen »wildes Fleisch«, das man nach Jahrzehnten noch sehen konnte.
In Deutschland herrschte Mangel an allem. Große Spekulationsläger soll es gegeben haben, in denen alles Mögliche gehortet wurde. Das hatte ein abruptes Ende, als am 20. Juni 1948 die Währungsreform durchgezogen wurde. Opa August, Oma Grete, mein Onkel Wolfgang und ich gingen zur Ausgabestelle an der Admiralstraße, wo jeder Erwachsene 40 DM auf die Hand erhielt (später kamen noch mal DM 20,00 dazu). Das war die kapitalistische Starthilfe in eine neue Ära.
Als nächstes folgte 1949 die Gründung der Bundesrepublik Deutschland, bestehend aus den drei Westzonen von Amerikanern, Engländern und Franzosen.
Und 1950 war es wieder so weit: eine Reise in die Schweiz. Schenk-Grollimund luden mich ein. Meiner schulischen Entwicklung bekam das nicht so gut. Dieses Mal fuhr ich in meinen Ferien hin, die wir etwas verlängerten, damit es sich lohnte. Die Lehrer hatten dafür Verständnis. Aber wer zahlte die Reise? Meine Mutter, die von meinem leiblichen Vater nichts wissen wollte, wusste, dass er in Jülich wieder bei der Bahn arbeitete, wie schon vor dem Krieg, und Bahnangestellte hatten verschiedene Vorteile. Meine Mutter sorgte dafür, dass ich auf Kosten meines leiblichen Vaters reisen konnte oder auf Kosten der Bahn. Da war er plötzlich wieder: der Name Knobloch. Auf den Gedanken, ihn persönlich kennen lernen zu wollen, kam ich nicht. Aus heutiger Sicht wird klar: jeder Versuch in dieser Richtung wäre unterbunden worden.
Ab die Bahn! Ich erhielt einen durchsichtigen Umschlag umgehängt und los ging es. Die Schweizer Familie war inzwischen in ein eigenes ganz neues Haus umgezogen, das außerhalb von Derendingen mitten in den Feldern ganz alleinstand. Als Transportmittel gab es nur eine Lambretta, die der Hausherr Hans Schenk fuhr.
Vor der Tür sozusagen begannen die Äcker. Die Kartoffelernte stand an. Der Bauer fuhr mit einer Art Flug seitwärts in die gehäufelten Kartoffelreihen, sodass die Erde umgedreht wurde und die Kartoffeln bloß lagen und aufgesammelt werden konnten. Nicht nur Kartoffeln wurden so ausgeworfen, auch manche Feldmaus verlor ihr Heim. Ich fing eine bei der Nachlese und steckte sie in die Hosentasche. Später wollte ich mich mit ihr befassen. Da sie sich jedoch gar nicht bewegte, fühlte ich mal nach und da biss sie mich in den Finger. Ich riss die Hand aus der Tasche und die Maus gleich mit, die mit einem Satz im Kartoffelkraut verschwand.
Im Haus meiner Ersatzfamilie bahnte sich eine Tragödie an, deren Ausgang ich nicht mehr erlebte. Frau Grollimund war extrem, fast krankhaft religiös. Kaum ein Satz, in dem »der Herrgott« nicht vorkam. Hans Schenk erzählte später meiner Mutter, als er uns in Bremen mit seiner Lambretta besuchte, seine Frau sei schon in einer Anstalt gewesen. Es hätte aber nichts genutzt. Die beiden lebten ihr Leben fast wie Fremde nebeneinander.
Ich erinnere mit an zwei Sommergewitter in diesem freistehenden Haus. Die Frau kroch unter den Dachfirst, wo er am höchsten war und verharrte dort während der Gewitter im lauten Gebet: der Herr möge ihr Haus verschonen. Was sie »ihm« dafür alles versprach, habe ich nicht gehört.
Immer mal tauchte eine Verwandte auf, die Emelie genannt wurde. Ein dürres Weiblein, mit dunkler Haut, intensiven braunen Augen und einer gewaltigen Hakennase. Man könnte sagen, sie sah wie eine Hexe oder Zigeunerin aus. Mich belegte sie sofort mit Beschlag. Ihre Spezialität war das Sammeln von Blechabfall. Sie hatte immer einen Magneten dabei, um Eisenblech und Aluminium zu unterscheiden. Wo sie das sammelte? Auf der Müllkippe von Derendingen. Ich begleitete Emelie dorthin. Es gab damals noch keine Plastikflut oder Reste von Nahrungsmitteln, die weggeworfen wurden. Der Abfall war überschaubar und entsprechend lange dauerte unsere Sammelaktion. Wir hatten viel Spaß und keinerlei Ekelgefühle.
Es war auch in der Schweiz, dass ich zum ersten Mal Hundefleisch ass. Es stammte von einem großen Hund, der den Postboten immer wieder angegriffen hatte und von seinem Herrn geschlachtet wurde. Wir bekamen von dem Fleisch ab und aßen es gekocht, ganz bewusst und ohne Vorbehalte. Ja, diese Schweizer waren sparsame Menschen. Nichts Essbares wurde verschmäht.
Auch von dieser »Mastreise« kam ich kaum dicker zurück, sprach die ersten Wochen mehr Schwyzerdütsch als Hochdeutsch, wie beim ersten Mal auch.
In der Etagenwohnung Grünberg Straße wohnten wir zu fünft: Oma und Opa, mein Onkel Wolfgang, meine Mutter und ich. Unter dem schrägen Satteldach des Reihenhauses waren zur Straßenseite hin kleine Zimmer eingebaut worden, die meine Mutter und ich sowie Onkel Wolfgang zum Schlafen aufsuchten. Der einsame abendliche Gang zwei Stockwerke hinauf gehört zu meinen Traumata. Die Flurbeleuchtung hielt nicht mal durch, bis man oben war und auf dem Dachboden selbst gab es kein Licht. Trotz Bitte an meine Mutter musste ich jeden Abend allein hinauf, ohne Taschenlampe. Sowas hatten wir gar nicht. Der Treppenflur war noch überschaubar, aber der Boden..... Die Reihenhäuser waren oben nicht voneinander getrennt, sondern der Boden ging direkt über zum Nachbarhaus. Das heißt, jemand konnte von weiter herkommen und dort lauern. Die Geschichte von Harmann ging immer noch um und ich habe bis heute noch das Liedchen im Kopf: »Warte, warte nur ein Weilchen, dann kommt Harmann auch zu dir, mit dem kleinen Hackebeilchen und macht Hackefleisch aus dir.« Den Harmann hatten sie zwar erwischt und geköpft, aber der Schrecken hielt sich noch lange. Hinzu kam, dass ich unser Zimmer nicht abschließen durfte, weil meine Mutter ja noch später kam. Dass man einen Zweitschlüssel anfertigen lassen konnte, darauf kam sie nicht.
Die Häuser waren unterkellert. Jede Familie hat einen Keller für sich, den man abschließen konnte. Dort herrschte Halbdunkel und Temperaturen ohne große Schwankungen. Das einzige Licht kam durch zwei schmale Kellerfenster herein, durch die im Herbst Kohlen geschüttet wurden und eventuell auch Winterkartoffeln. Die Kohlen musste man dann zur Wohnung als Heizmaterial für die Küche und das Wohnzimmer hinaufschleppen. Alle anderen Zimmer blieben kalt. In der Küche war es nur warm, wenn gekocht wurde, in einem großen Herd aus Gusseisen, mit einer Klappe für den Back Teil und eine darunter, um die Asche zu entnehmen.
Aber zurück zum Keller. An einer Querwand stand ein riesiges Regal in drei Ebenen und darauf große Weckgläser voller Obst und Gemüse, die in einem doppelstöckigen verzinkten Kocher eingemacht wurden. Die Gläser waren mit einem Glasdeckel und Gummiring verschlossen und mussten regelmäßig kontrolliert werden. Bildete sich darin Schimmel, war das Vakuum nicht mehr vorhanden und der Inhalt musste schnellstens verbraucht werden. Handelte es sich um Bohnen, musste man sie erneut kochen, weil die Gefahr von Vergiftung bestand.
Wenn man aus der Grünberg Straße herauskommt, liegt vor einem das riesige Ausstellungsgelände, Bürgerweide genannt, auf dem im Frühjahr die Osterwiese und im Herbst der Freimarkt abgehalten wurden, mit seinen Karussells, Los- und Schießbuden, Achterbahn, Wilde Maus, Geisterbahnen, Elektroscooter und Riesenrad. Für uns Kinder besonders aufregend war eine komplette Liliputaner Stadt, in der man die ulkigen Stimmen dieser kleinen Menschen hören und ihrem Leben in den seitwärts offenen Wohnwagen zusehen konnte.
Mich zog es schon früh immer zuerst zu den Schießbuden. Sofern die Aussteller ihre Luftgewehre nicht verstellt hatten, brachte ich es dort zu vielen Trophäen, meistens Kunstblumen, Teddybären und später auch schon mal zu einer Flasche billigem Vermute, für den Eigenkonsum. Es verging kein Tag, an dem ich nicht dort war.
Links vorn am Beginn der Grünberg Straße hatte ein Einzelhändler Meyer aufgemacht, bei dem man fast alles kaufen konnte, damals vor allem konserviertes aus Dose und Glas. Am anderen Ende der Straße war ein Fischgeschäft, in das ich oft geschickt wurde. Wir kauften dort meistens den preiswertesten Fisch und das waren damals Heringe aus dem Fass, in Salz eingelegt, riesige Burschen von 40 cm Länge. Man merkte richtig, dass die Nordsee noch nicht wieder stärker befischt wurde. Problematisch war Verpackungsmaterial. Entweder man brachte alte Zeitungen mit oder musste hoffen, dass es welche gab. Plastik war noch in weiter Ferne hinter dem Horizont. Die Heringe wurden mit einer großen hölzernen Zange aus dem Fass geholt, begutachtet und diagonal auf das Papier gelegt. Zwei- dreimal gerollt und an den Enden umgeknickt, fertig war die Verpackung, mit der ich eilig nach Hause strebte, bevor der Inhalt das Papier aufweichen konnte.
Meine Mutter lernte nach dem Krieg den schon erwähnten Seemann Kunibert Krüger kennen. Ihr zweiter Mann Günther Troyke war Nachtjäger bei der Luftwaffe gewesen und kam von einem Einsatz nicht zurück. Also war sie Kriegerwitwe, wie das hieß. Kunibert war Kommandant auf einem Minenräumer gewesen, in der Ostsee stationiert. Die Engländer beließen ihm sein Kommando, aber er musste in der Nordsee zwei Jahre lang Minen räumen und nach jeder Fahrt einen englischen Hafen zur Berichterstattung anlaufen, wo ein Commander der britischen Marine sein Führungsoffizier war (Commander Harries).
Als er abmusterte, arbeitete er im Bremer Hafen kurzfristig als Wachmann. Sein Patent wurde von Siegern und deutschen Politikern nicht anerkannt und er musste noch einmal die Schulbank drücken, um seinen Nautiker »nachzumachen«. Aber wo war die Flotte? Im Krieg versenkt, von den Siegern beschlagnahmt, zusammengeschossen und rostend in irgendwelchen Hafenbecken.
Schweden
Da bot sich die Chance, auf einem schwedischen Dampfschiff der Ahlmark-Reederei anzuheuern, die in Karlstad am Vänersee beheimatet war. Das heißt, die Schiffe mussten das Salzwasser verlassen, um über ein Schleusensystem bei Trollhättan in den Vänersee hinaufgeliftet zu werden. Kunibert begann dort als Matrose und wurde schnell zum 3. Offizier befördert, vor allem dank Kapitän Eskil Johansson, der ihn förderte und dessen Familie sich für den Deutschen öffnete. Wie ich später erfuhr, war Kapitän Johansson Kommunist. Anmerken tat man es ihm nicht. Oder merkt man sowas gar nicht? Er war ein stiller, bescheidener Mann, im Gegensatz zu seiner quirligen Frau, Mullan genannt. Richtig hieß sie, glaube ich, Hillevi Johansson.
Sein Schiff kam nicht sehr häufig nach Bremen und sehr bald hieß es umziehen, nach Kristinehamn am Vänersee, wo meine Mutter als Hausdame von einer Zahnarztfamilie Lagerblad unter Vertrag genommen wurde. Ich selbst reiste auf einem Dampfer der Ahlmark-Reederei in die »neue Heimat«.
Kaum eine Woche im Lande, wurde ich eingeschult, ohne schwedische Sprachkenntnisse. Man meinte, die Praxis würde das schnell ändern. Und tatsächlich, so war es auch. Außer meiner Mutter sprach niemand deutsch und da meine Mutter arbeitete, war ich eigentlich immer in der Obhut der Familie Johansson, deren beide Kinder schon etwas älter waren: Sigurd und Ruth.
Der Beginn der Schulzeit stand für mich noch unter dem Einfluss der englischen Kriegspropaganda. Das soll heißen, ich wurde von einigen meiner Mitschüler verprügelt, weil ich Deutscher war. Gegen die gut genährten und sportlichen Jungs hatte ich Mägerling sowieso keine Chance. Mit am schlimmsten war, dass der Lehrer der Prügelei während der Pause im Hof zusah, ohne einzuschreiten. Dabei war Schweden neutral gewesen und hatte keine negativen Erfahrungen, was Deutschland anbetraf. Im Gegenteil: es machte mehr oder weniger geheim gute Geschäfte mit dem »Dritten Reich«.