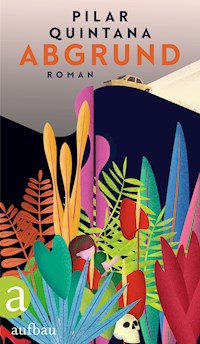
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Eine der kraftvollsten neuen Stimmen aus Lateinamerika.« DEUTSCHLANDFUNK KULTUR
Das heranwachsende Mädchen Claudia ist viel allein. Ihre unglücklich verliebte Mutter verfällt dem Alkohol, der resignierte Vater schweigt sich davon. Was bleibt, ist die Sehnsucht nach einem anderen Leben. Und ein junges Mädchen auf der Suche nach Antworten. Ein herzzerreißender Familienroman vor einer atemberaubenden kolumbianischen Kulisse, in der die Abgründe allgegenwärtig sind.
»Die kolumbianische Autorin Pilar Quintana legt hinter dem Klischee tiefe menschliche Sehnsüchte und Abgründe frei.« SÜDDEUTSCHE ZEITUNG.
»Pilar Quintana ist eine hellwache Autorin.« TAZ.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Claudia lebt mit ihren Eltern in einer Wohnung, in der überall wilde Pflanzen wuchern und allmählich nach ihr zu greifen scheinen. Die Achtjährige verbringt die meiste Zeit allein. Ihre Mutter ist mit der fehlenden großen Liebe in ihrem Leben beschäftigt, blättert unentwegt in Zeitschriften und weder der Tochter noch dem älteren Ehemann gilt ihr Interesse. Sie träumt von einem anderen, einem glamourösen Leben. Als sie Gonzalo, die neue Eroberung ihrer Schwägerin, kennenlernt, ist es um Claudias Mutter geschehen. Vor den Augen des heranwachsenden Mädchens beginnt sie eine heimliche Affäre und geht daran kaputt. Claudia beobachtet den Verfall ihrer Mutter, das Schweigen des Vaters und findet Trost in ihrer Lieblingspuppe Paulina. Das Mädchen zieht aus dem Verhalten der Eltern ihre ganz eigenen Schlüsse.
Über Pilar Quintana
Pilar Quintana, Jahrgang 1972, ist eine der bekanntesten und meistgelesenen Autorinnen Lateinamerikas. Ihr Roman „Abgrund“ („La perra“, 2017) markiert einen großen Meilenstein: Er ist der erfolgreichste und meistverkaufte literarische Roman der letzten Jahre in Kolumbien und wurde 2018 mit dem begehrten Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana ausgezeichnet.
Im Aufbau Verlag ist ebenfalls ihr Roman „Hündin“ lieferbar.
Mayela Gerhardt wurde in Mexiko geboren, studierte in Düsseldorf Literaturübersetzen und bildete sich in Spanien in journalistischem und audiovisuellem Übersetzen weiter. Als Übersetzerin aus dem Englischen, Spanischen und Französischen lebt und arbeitet sie in Barcelona.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Pilar Quintana
Abgrund
Roman
Aus dem Spanischen von Mayela Gerhardt
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Motto
Erster Teil
Zweiter Teil
Dritter Teil
Vierter Teil
Impressum
Für meine Schwestern
»Meine Seele stürzt sich von einem schwarzen, scheußlichen Abgrund, der durch Mund, Ohren und Nase zähflüssig in mich eindringt.«
FERNANDO IWASAKIDer Fremde
Erster Teil
In unserer Wohnung gab es so viele Pflanzen, dass wir sie den Urwald nannten.
Das Gebäude schien einem alten futuristischen Film zu entstammen. Flache Formen, schwebende Elemente, viel Grau, große offene Räume, Panoramafenster. Das Wohnzimmerfenster unserer Maisonette-Wohnung erstreckte sich vom Boden bis zur Zimmerdecke, die an dieser Stelle zwei Stockwerke hoch aufragte. Unten bestand der Boden aus schwarzem Granit mit weißer Maserung. Oben aus weißem Granit mit schwarzer Maserung. Die Treppe hatte ein Geländer aus schwarzen Stahlrohren und glatt geschliffene Stufen. Eine kahle Treppe voller Lücken. In der oberen Etage war der Flur zum Wohnzimmer hin offen, wie ein Balkon, das Geländer bestand aus den gleichen Rohren wie das der Treppe. Von dort betrachtete man den Urwald darunter, der sich ringsum ausbreitete.
Die Pflanzen befanden sich auf dem Boden, auf den Tischen, auf der Stereoanlage und der Anrichte, zwischen den Möbeln, auf schmiedeeisernen Podesten, in Tontöpfen, baumelten von den Wänden und der Decke, standen auf den unteren Treppenstufen und an den Orten, die man vom Obergeschoss nicht sah: in der Küche, im Waschraum und im Gästebad. Es gab alle möglichen Arten von Pflanzen. Solche, die Sonnenlicht brauchten, Schattengewächse und Wasserpflanzen. Einige wenige, die Flamingoblumen und die weißen Vogelorchideen, hatten Blüten. Alle anderen waren Grünpflanzen. Glatte und krause Farne, Pflanzen mit gestreiften, gefleckten oder farbigen Blättern, Palmen, Sträucher, gewaltige Bäume, die in Blumenkübeln gut gediehen, und zarte Kräuter, die in meine Mädchenhand passten.
Wenn ich durch die Wohnung lief, kam es mir manchmal so vor, als reckten sich die Pflanzen, um mich mit ihren Blättern zu berühren, als wären es Finger, und als machten sich die größten, in einem Wald hinter dem Dreiersofa, einen Spaß daraus, die Menschen, die dort saßen, zu umschlingen oder mit einer leichten Berührung zu erschrecken.
Auf der Straße standen zwei Trompetenbäume, auf die man vom Balkon und vom Wohnzimmer blickte. Während der Regenzeit verloren sie ihre Blätter und bedeckten sich mit rosaroten Blüten. Die Vögel hüpften von den Trompetenbäumen auf den Balkon. Die mutigsten unter ihnen, die Kolibris und Trauertyrannen, wagten sich bis ins Esszimmer vor, um es zu erkunden. Die Schmetterlinge flatterten furchtlos vom Esszimmer ins Wohnzimmer. Manchmal stahl sich abends eine Fledermaus herein, in tiefem Flug und scheinbar orientierungslos. Meine Mama und ich kreischten. Mein Papa griff nach einem Besen und blieb reglos in der Mitte des Urwalds stehen, bis die Fledermaus wieder dort hinausflog, wo sie hereingekommen war.
Nachmittags blies ein kühler Wind von den Bergen herunter und durchquerte Cali. Er rüttelte die Trompetenbäume wach, wehte durch die offenen Fenster herein und schüttelte die Pflanzen drinnen. Ein lärmendes Durcheinander erhob sich, wie unter den Besuchern eines Konzerts. In der Abenddämmerung goss meine Mama die Pflanzen. Das Wasser füllte die Blumentöpfe, sickerte durch die Erde, rann durch die Löcher und plätscherte wie ein Bach in die tönernen Untertöpfe.
Ich liebte es, durch den Urwald zu laufen und zu spüren, wie mich die Pflanzen sanft berührten, mittendrin stehen zu bleiben, die Augen zu schließen und zu lauschen. Dem herabrinnenden Wasser, dem Raunen des Windes, den aufgeregten, durchgeschüttelten Zweigen. Und ich liebte es, die Treppe hinaufzustürmen und ihn von der oberen Etage zu betrachten, wie vom Rande eines Abgrunds, als wären die Stufen eine zerklüftete Felsschlucht. Unseren üppigen wilden Urwald dort unten.
Meine Mama war immer zu Hause. Sie wollte nicht wie ihre eigene Mutter sein. Das sagte sie mir immer und immer wieder.
Meine Großmutter schlief immer bis zum späten Vormittag, und meine Mama ging zur Schule, ohne sie vorher gesehen zu haben. Nachmittags spielte meine Großmutter mit ihren Freundinnen lulo und war an vier von fünf Tagen nicht zu Hause, wenn meine Mama von der Schule zurückkam. Und an dem einen Tag war sie nur deshalb da, weil sie an der Reihe war, das Kartenspiel bei sich auszurichten. Acht Frauen umringten den Esstisch, rauchten, lachten, legten Karten ab und aßen pandebonos, kleine Brötchen mit Käsefüllung. Meine Großmutter sah meine Mama nicht einmal an.
Als sie einmal im Club waren, hörte meine Mama, wie eine Frau meine Großmutter fragte, warum sie keine weiteren Kinder bekommen habe.
»Ach, meine Liebe«, antwortete meine Großmutter, »wenn ich es hätte verhindern können, hätte ich die hier auch nicht bekommen.«
Die beiden Frauen brachen in schallendes Gelächter aus. Meine Mama war gerade aus dem Schwimmbecken gekommen und triefte vor Wasser. Es fühlte sich an, erzählte sie mir, als ob sich eine Hand in ihren Brustkorb bohrte und ihr das Herz herausriss.
Mein Großvater kehrte immer am späten Nachmittag von der Arbeit heim. Er umarmte meine Mama, kitzelte sie und fragte, wie ihr Tag gewesen sei. Ansonsten wuchs sie unter der Aufsicht der Hausangestellten auf, die rasch aufeinanderfolgten, weil meine Großmutter mit keiner zufrieden war.
Auch bei uns blieben die Hausangestellten nie lange.
Yesenia kam aus dem Amazonas-Regenwald. Sie war neunzehn Jahre alt, hatte glattes Haar, das ihr bis zur Taille reichte, und die gleichen groben Gesichtszüge wie die Steinstatuen im archäologischen Park von San Agustín. Wir verstanden uns auf Anhieb.
Meine Schule lag nur wenige Straßenzüge von unserem Haus entfernt. Yesenia brachte mich morgens zu Fuß hin und wartete nachmittags am Ausgang auf mich. Unterwegs erzählte sie mir von ihrer Heimat. Von den Früchten, den Tieren, den Flüssen, die breiter waren als jede Allee.
»Das«, sagte sie und deutete auf den Río Cali, »ist kein Fluss, sondern ein Bach.«
An einem Nachmittag gingen wir direkt in ihr Zimmer. Eine Kammer neben der Küche, mit einer Toilette und einem winzigen Fenster. Wir setzten uns aufs Bett, einander gegenüber. Yesenia hatte mir erzählt, dass sie kein einziges Klatsch- und Singspiel kannte. Ich brachte ihr mein Lieblingslied bei, das von den Puppen aus Paris. Sie vertat sich ständig, und wir krümmten uns vor Lachen. Da erschien meine Mama in der Tür.
»Claudia, komm bitte nach oben.«
Sie war furchtbar ernst.
»Was ist los?«
»Du sollst nach oben kommen, habe ich gesagt.«
»Wir spielen gerade.«
»Bring mich nicht dazu, es noch einmal zu sagen.«
Ich sah Yesenia an. Ihr Blick gab mir zu verstehen, dass ich gehorchen sollte. Ich unterbrach unser Spiel und verließ das Zimmer. Meine Mama griff sich meinen Schulranzen. Wir gingen nach oben, betraten mein Zimmer, und sie schloss die Tür.
»Ich will dich nie wieder so vertraulich mit ihr sehen.«
»Mit Yesenia?«
»Mit keiner Hausangestellten.«
»Warum denn nicht?«
»Weil sie eine Hausangestellte ist.«
»Und was macht das?«
»Sie wachsen einem ans Herz, und dann gehen sie wieder.«
»Yesenia hat niemanden in Cali. Sie kann für immer bei uns bleiben.«
»Ach, Claudia, sei nicht so naiv.«
Wenige Tage später verschwand Yesenia, ohne sich zu verabschieden, während ich in der Schule war.
Meine Mama sagte, Yesenia habe einen Anruf aus Leticia erhalten und sei zu ihrer Familie zurückgekehrt. Ich hatte den Verdacht, dass das nicht stimmte, aber sie beharrte auf ihrer Version.
Als Nächste kam Lucila zu uns, eine ältere Frau aus der Provinz Cauca, die sich gar nicht mit mir abgab und länger als alle anderen Hausangestellten bei uns blieb.
Vormittags, während ich in der Schule war, kümmerte sich meine Mama um ihre Hausfrauenpflichten. Die Einkäufe, die Erledigungen, die Rechnungen. Mittags holte sie meinen Papa vom Supermarkt ab, und sie aßen gemeinsam. Nachmittags nahm er das Auto mit zur Arbeit, und sie blieb zu Hause und wartete auf mich.
Wenn ich von der Schule zurückkam, traf ich sie meist im Bett an, mit einer Zeitschrift. Sie las gern die ¡Hola!, die Vanidades und die Cosmopolitan. Darin erfuhr sie alles über das Leben berühmter Frauen. Die Artikel wurden von großen Farbfotos begleitet, auf denen Häuser, Yachten und Partys zu sehen waren. Ich aß zu Mittag, und sie blätterte die Seiten durch. Ich machte meine Hausaufgaben, und sie blätterte die Seiten durch. Um vier Uhr nachmittags begann in dem einzigen Fernsehsender das Programm, und während ich die Sesamstraße guckte, blätterte sie die Seiten durch.
Einmal erzählte mir meine Mama, wie sie kurz vor dem Abitur darauf gewartet hatte, dass ihr Vater von der Arbeit nach Hause kam, um ihm zu sagen, dass sie an der Universität studieren wolle. Sie waren im Zimmer meiner Großeltern. Er zog sich die guayabera aus, warf das Hemd auf den Boden und blieb so, wie er war, in seinem Unterhemd. Groß, behaart, mit rundem, weichem Bauch. Ein Bär. Dann sah er sie an, mit einem seltsamen Ausdruck in den Augen, den sie nicht von ihm kannte.
»Jura«, wagte meine Mama noch hinzuzufügen.
Meinem Großvater schwollen die Venen am Hals an, und mit seiner gebieterischsten Stimme sagte er zu ihr, eine anständige Señorita habe zu heiraten, und er wolle nichts von der Universität oder Jura oder ähnlichem Blödsinn hören. Seine unheilvolle Stimme dröhnte wie durch ein Megafon – fast konnte ich sie hören –, während meine Mama zaghaft vor ihm zurückwich.
Einen knappen Monat später starb er an einem Herzinfarkt.
An einer Wand des Arbeitszimmers hingen Familienporträts.
Das Bild meiner Großeltern mütterlicherseits war ein Schwarz-Weiß-Foto mit einem Silberrahmen. Es war im Club aufgenommen worden, auf ihrer letzten gemeinsamen Silvesterparty. Um sie herum fielen Luftschlangen herab, die Leute trugen Papierhüte und bliesen in Tröten. Meine Großeltern lösten sich gerade aus ihrer Umarmung. Sie lachten. Er ein Hüne im Smoking, mit Bifokalbrille und einem Drink in der Hand. Sein Haar war nicht zu sehen, aber von anderen Fotos und aus Mamas Erzählungen wusste ich, dass es überall an ihm hervorspross. Aus den Hemdsärmeln, am Rücken, aus der Nase und sogar aus den Ohren. Meine Großmutter trug ein elegantes Kleid mit tiefem Rückenausschnitt, hielt ein Zigarettenetui in der Hand und hatte ihr kurzes Haar toupiert. Sie war groß und dünn, ein aufrechter Regenwurm. An der Seite ihres Mannes wirkte sie winzig.
Die Schöne und das Biest, dachte ich immer, auch wenn meine Mama ihren Vater in Schutz nahm und sagte, er sei keine Bestie, sondern ein Teddybär, der nur dieses einzige Mal wütend geworden sei.
Mein Großvater hatte sein ganzes Leben lang im Vertrieb eines Haushaltsgeräteherstellers gearbeitet. Er hatte wichtige Kunden, ein gutes Gehalt und erhielt für jeden Verkauf eine Provision. Nach seinem Tod entfielen die Provisionszahlungen, und die Witwenrente, die meiner Großmutter blieb, war nur ein Bruchteil seines Gehalts.
Sie und meine Mama mussten das Auto und ihr Haus im Stadtteil San Fernando verkaufen und die Mitgliedschaft im Club aufgeben. Sie zogen in eine Mietwohnung im Zentrum von Cali, entließen alle Bediensteten und heuerten tageweise eine Haushaltshilfe an. Sie stellten ihre Friseurbesuche ein und lernten, sich selbst die Fingernägel und die Frisuren zu machen. Meine Großmutter trug ein verschlungenes Gebilde auf dem Kopf, für das sie ihr Haar mithilfe eines Kamms und einer halben Dose Lack bearbeitete, bis es zu einem Turm aufragte. Sie gab das ludo auf, weil es zu teuer war, acht Frauen zu bewirten, wenn das Spiel bei ihr zu Hause stattfand, und schwenkte auf Canasta um, das zu viert gespielt wurde.
Meine Mama hatte gerade ihr Abitur in der Tasche und begann ehrenamtlich im Hospital San Juan de Dios zu arbeiten – eine Tätigkeit, die mein Großvater gutgeheißen hätte.
Das San Juan de Dios war ein gemeinnütziges Krankenhaus. Ich hatte es nie von innen gesehen und stellte es mir als einen dreckigen und düsteren Ort vor, mit blutverschmierten Wänden und Patienten, die auf den Fluren wehklagend dahinsiechten. Als ich meine Vorstellung eines Tages laut aussprach, lachte meine Mama. In Wahrheit, erzählte sie, sei das Krankenhaus geräumig und hell, mit weißen Wänden und begrünten Innenhöfen. Das Hospital befinde sich in einem Gebäude aus dem Jahr siebzehnhundert und werde von den Nonnen, die es leiteten, bestens instandgehalten.
Dort lernte sie meinen Papa kennen.
Das Bild meiner Großeltern väterlicherseits war oval und hatte einen Bronzerahmen mit gestanzten Verzierungen. Sie hatten in einer Zeit gelebt, die der meiner Großeltern mütterlicherseits voranging, und in meiner kindlichen Vorstellung war ihre Epoche ebenso düster wie die Farben des Porträts.
Es war ein Ölgemälde von ihrem Hochzeitstag, dem eine Studiofotografie als Vorlage gedient hatte, mit braunem Hintergrund und trüben Details. Das Einzige, was strahlte, war die Braut. Ein sechzehnjähriges Mädchen. Meine junge Großmutter saß auf einem Holzstuhl. Ihr Kleid bedeckte sie vom Hals bis zu den Schuhen. Sie trug einen spanischen Spitzenschleier, lächelte sittsam und hielt einen Rosenkranz in den Händen. Es sah aus, als empfinge sie ihre Konfirmation und als sei der Bräutigam ihr Vater. Er stand neben ihr, wie ein alter Holzpfosten, eine Hand auf ihre Schulter gelegt. Ein spröder Mann mit schütterem Haar, grauem Anzug und dicken Brillengläsern.
Meine Großmutter, dieses Mädchen, war noch nicht einmal zwanzig, als sie bei Papas Geburt starb. Sie lebten damals auf der Kaffeefinca meines Großvaters. Er zog daraufhin allein nach Cali. Von dem Verlust am Boden zerstört, dachte ich. Ein trauriger Mann, der nicht in der Lage war, sich um jemanden zu kümmern. Der neugeborene Junge und seine zweijährige Schwester, meine Tante Amelia, blieben in der Obhut einer Schwester der Verstorbenen dort wohnen.
Die Geschwister wuchsen auf der Kaffeefinca auf. Als die Zeit reif war, meldete ihre Tante sie in der Dorfschule an, die von den Kindern der Bauern und Arbeiter besucht wurde. Als sie in der zweiten Klasse aus ihren Schuhen herauswuchsen, schnitt ihre Tante die Schuhspitzen mit einem Messer ab, so dass ihre Zehen vorn rausguckten, und so gingen sie zum Unterricht.
»Wart ihr arm?«, fragte ich meine Tante, als sie mir die Geschichte erzählte.
»Aber nein! Die Kaffeefarm warf viel Geld ab.«
»Und warum haben sie euch dann keine neuen Schuhe gekauft?«
»Wer weiß«, sagte sie, hielt inne und setzte schließlich nach: »Mein Vater hat uns nie besucht.«
»Bestimmt war er traurig, weil eure Mama gestorben war?«
»Bestimmt.«
Dann wurde ihre Tante krank. Die Ärzte konnten nichts mehr für sie tun, und nach ihrem Tod wurden die Kinder zu ihrem Vater nach Cali geschickt. Er verkaufte die Kaffeefinca und eröffnete den Supermarkt.
Mein Papa und Tante Amelia blieben bei meinem Großvater wohnen, bis sie volljährig waren. Er rauchte jeden Tag zwei Schachteln Zigaretten, erlitt ein Lungenemphysem und starb lange vor meiner Geburt. Damals erbten die beiden den Supermarkt.
Tante Amelia war mit den Abläufen im Supermarkt vertraut, ging aber nicht dort arbeiten. Sie verbrachte die Tage in ihrer Wohnung, trug eine Tunika, rauchte und trank nachmittags ein Glas Wein. Sie besaß Tuniken in allen Stilrichtungen und Farben. Aus Mexiko, aus La Guajira, aus Indien mit Batik-Muster und handbestickte aus Cartago.
Immer wenn es auf Tante Amelias Geburtstag oder auf Weihnachten zuging, beschwerte sich meine Mama, sie wisse nicht, was sie ihr schenken solle. Letztlich kaufte sie ihr eine Tunika. Meine Tante nahm sie mit einer Begeisterung entgegen, die nicht aufgesetzt wirkte, beteuerte, wie gut sie ihr gefalle, und sagte, diese Art habe sie noch nicht oder das sei genau die Farbe, die ihr noch fehle.
Mein Papa war Geschäftsführer des Supermarkts. Er nahm nie Urlaub. Er ruhte sich aus, wenn der Supermarkt geschlossen blieb, sonntags und an Feiertagen. Er kam morgens als Erster, ging als Letzter, und manchmal musste er mitten in der Nacht eine verspätete Lieferung entgegennehmen. Samstags fuhr er nach Ladenschluss zum Hospital San Juan de Dios, um für die Kranken Lebensmittel zu spenden.
Als mein Papa dort eintraf, war meine Mama gerade in der Vorratskammer damit beschäftigt, Platz für die neuen Nahrungsmittel zu machen. Sie schenkte ihm keine Beachtung. Er wiederum war von ihr so angetan, dass er die diensthabende Nonne fragte, wer die junge Frau sei. Die Nonne war klein und stämmig, erzählte mir meine Mama. Ich stellte sie mir vor wie den Stumpf eines gefällten Baums, in einem braunen Habit, das nach unten hin weiter wurde.
»Unsere neue ehrenamtliche Mitarbeiterin«, sagte sie zu meinem Papa. »Ihr Name ist Claudia.«
Mein Papa und die Nonne sahen zu meiner Mama hinüber.
»Und sie ist ledig«, fügte sie hinzu.
Vielleicht war es das, was ihn ermutigte. Mein Papa wartete, bis meine Mama ihre Schicht beendet hatte, dann ging er zu ihr, stellte sich vor und bot ihr an, sie nach Hause zu fahren. Sie, gerade einmal neunzehn Jahre alt, musterte ihn von oben bis unten und sah einen Mann in den Vierzigern.
»Nein, danke«, sagte sie.
Mein Papa gab sich nicht geschlagen. Er brachte ihr Schokoladenpralinen, Pistazien oder andere Köstlichkeiten mit, die er in La Cristalina gekauft hatte, einem Geschäft, das importierte Waren anbot. Meine Mama wies seine Geschenke zurück.
»Jorge«, sagte sie eines Tages zu ihm, »Sie geben wohl nie auf?«
»Nein.«
Sie lachte.
»Ich habe Ihnen dänische Butterkekse mitgebracht.«
Es war eine große Dose voller Kekse, und meine Mama konnte nicht widerstehen. Sie griff danach.
»Heute darf ich Sie aber nach Hause bringen?«
Dieses Mal brachte sie es nicht über sich, ihn zurückzuweisen.
Meine Großmutter war entzückt von diesem vornehmen Mann, der ein ansehnliches Vermögen besaß und christliche Nächstenliebe praktizierte, indem er das Krankenhaus mit Lebensmittelspenden versorgte.
»Er ist alt«, führte meine Mama ihr vor Augen.
»Ich dachte, du magst ältere Männer?«
Damit hatte sie recht. Meine Mama konnte mit den Jungen ihres Alters nichts anfangen, die für sie Kindsköpfe waren und nichts Besseres zu tun hatten, als im Schwimmbecken des Clubs Kopfsprünge zu machen.
»So alt nun auch wieder nicht«, stellte sie klar.
Meine Großmutter verdrehte die Augen.
»Dich soll einer verstehen, Claudia.«
Als meine Mama am Montag vom Krankenhaus nach Hause kam, traf sie dort die Canasta-Damen an. Sie waren in eine Wolke aus Zigarettenrauch gehüllt und aßen die dänischen Butterkekse. Vier Hausfrauen mit üppigen Haartrachten, groß wie Partyluftballons, und langen lackierten Fingernägeln, mit denen sie die Spielkarten mischten und auf dem Tisch auslegten.
Es war höllisch heiß, erzählte meine Mama. Calis typische Hitze, die einen zu erdrücken scheint, dachte ich. Die Damen deuteten auf einen Stuhl, und sie setzte sich. Aída de Solanilla nahm sich einen Keks und aß ihn genüsslich.
»Mit vierzig«, sagte sie, nachdem sie geschluckt hatte, »ist ein Mann nicht alt, sondern in der Blüte seines Lebens.«
»Er ist einundzwanzig Jahre älter als ich«, sagte meine Mama.
Solita de Vélez, mit violetten Fingernägeln und aufgemaltem Schönheitsfleck über dem Mund, drückte ihre Zigarette im Aschenbecher aus, der vor Stummeln mit Lippenstifträndern überquoll.
»Der Altersunterschied ist ein Vorteil«, sagte sie.
Ihr eigener Mann, erzählte sie, sei achtzehn Jahre älter, der von Lola de Aparicio zwanzig, der von Miti de Villalobos, die heute nicht anwesend, aber eine Freundin aus alten luto-Zeiten war, fünfundzwanzig, und alle drei konnten sie bestätigen, dass ihre Ehe so gut war, wie eine Ehe eben sein konnte, sogar besser als zwischen gleichaltrigen Partnern, die beide jung und deshalb aufbrausend waren.
Die Damen drehten sich zu meiner Mama um. Sie hielt dagegen, er sei kahl, klein, hager und trage eine Brille mit Gläsern so dick wie Flaschenböden.
»Jorge macht etwas her«, widersprach Aída de Solanilla. »Ich sehe ihn immer im Supermarkt. Er trägt Markenkleidung – und stets ordentlich gebügelt.«
Das konnte meine Mama nicht leugnen.
»Er kriegt kaum ein Wort heraus«, sagte sie.
»Ach, Liebes«, antwortete Lola de Aparicio und entfaltete ihren spanischen Fächer, »ein Mädchen, das an jedem Mann etwas auszusetzen hat, bleibt für immer allein.«
Meine Großmutter und die anderen Damen nickten zustimmend, während ihre Blicke auf meiner Mama ruhten. Die höllische Hitze, ich konnte sie spüren, lag wie eine Schlinge um ihren Hals.
Zur damaligen Zeit war es üblich, dass die Eltern der Braut für die Kosten der Hochzeit aufkamen. Doch zur großen Erleichterung und Freude meiner Großmutter ließ mein Papa nicht zu, dass sie auch nur einen Peso beisteuerte, und meine Mama durfte die Hochzeit nach ihren Vorstellungen planen.
Sie wollte keine große Feier, nur die kirchliche Trauung. Ihr Kleid war weiß, wenn auch kein klassisches Brautkleid – knielang, ohne Schleier und Verzierungen –, und sie hatte das Haar zu einem schlichten Dutt gedreht, in dem ein Kamm mit kleinen Blumen steckte. Mein Papa trug einen Frack, war das Ebenbild meines Großvaters, nur kahler und älter.
Das Foto von meinen Eltern an der Wand des Arbeitszimmers war schwarz-weiß und hatte einen Holzrahmen. Darauf standen sie vor dem Altar. Im Hintergrund der Pfarrer, der Altartisch und der gekreuzigte Christus. Vorn das Brautpaar, von Angesicht zu Angesicht, beim Austausch der Eheringe. Mein Papa strahlte über das ganze Gesicht. Meine Mama hielt den Blick gesenkt und wirkte deshalb traurig, aber bestimmt war sie nur darauf konzentriert, ihm den Ehering anzustecken.
Zwei Wochen nach der Hochzeit starb meine Großmutter an einem Hirnschlag.
Das frisch vermählte Paar zog zunächst in eine Mietwohnung. Das Haus meines Großvaters war zu groß für Tante Amelia, und sie verkauften es. Von dem Geld kauften sie zwei Wohnungen. Eine kleine für meine Tante, wenige Straßenzüge vom Supermarkt entfernt, in der Portada al Mar zu Füßen der Berge, am Eingang zu einem traditionellen Stadtviertel mit alten Villen und Neubauten. Die andere für meine Eltern, ganz in der Nähe, im Nachbarviertel auf der anderen Seite des Flusses.
Die Vorbesitzer der Wohnung meiner Eltern hatten auf dem Balkon eine Pflanze zurückgelassen. Eine Grünlilie mit langen, weiß geränderten Blättern. Ihre Spitzen waren versengt, die Farben verblasst. Meine Großmutter hatte in ihrem Haus in San Fernando eine solche Pflanze gehabt, bevor ihr Mann gestorben war und sie und meine Mama ihr Leben ändern mussten. Meine Mama, die immer noch um ihre Eltern trauerte, nahm die Grünlilie auf.
Eine gläserne Falttür mit Holzrahmen trennte das Esszimmer vom Balkon. Meine Mama stellte die Pflanze nach drinnen. Sie goss sie, topfte sie in einen großen Blumenkübel um, setzte sie in neue Erde. Noch nie hatte sie sich um ein lebendiges Wesen gekümmert, und es beglückte sie, als die Pflanze wieder ergrünte.
Doña Imelda, die Kassiererin aus dem Supermarkt, sah, wie sehr sie sich freute, und schenkte ihr den Ableger eines Löchrigen Fensterblatts. Meine Mama pflanzte ihn in einen Tontopf, den sie auf den Wohnzimmertisch stellte. Die Blätter des Fensterblatts wucherten bis auf den Boden. Als Nächstes brachte mein Papa ihr einen Dreieckigen Frauenhaarfarn mit, und Tante Amelia schenkte ihr zum Geburtstag eine Strahlenaralie.
Nach und nach füllte sich die Wohnung mit Pflanzen, bis sie sich in den Urwald verwandelte. Für mich waren die Pflanzen im Urwald immer die Toten meiner Mama. Ihre auferstandenen Toten.
Die Treppe ist das Erste, woran ich mich erinnere. Ich vor dem kindersicheren Gitter und dahinter die lange, zerklüftete Treppe, eine unüberwindbare Felswand, die zur wunderbaren grünen Welt im Erdgeschoss führt.
Das Bett meiner Eltern bildet meine zweite Erinnerung. Meine Mama und ich, sie mit ihrer Zeitschrift, ich hüpfe herum.
»Mamamamamamamama.«
Plötzlich ein Ausbruch: »Zum Teufel, Mädchen! Kannst du nicht still sein?!«
Oder vielleicht ist diese Erinnerung auch älter als die mit der Treppe, und sie kommt mir nur neuer vor, weil ich sie viele Male erlebt habe.
Meine Mama im Bett, mit ihrer Zeitschrift, ich ziehe ihr das Hemd hoch und puste ihr auf den Bauch.
»Musst du ständig auf mir rumkrabbeln?«
Ich übersäe ihren Arm mit Küsschen.
»Lass mich in Frieden, Claudia, wenigstens für eine Minute, Herrgott noch mal!«
Ich beobachte meine Mamma, während sie am Frisiertisch sitzt und sich die Haare kämmt. Ihre langen, glatten, schokoladenbraunen Haare, Haare, die man streicheln möchte.
»Warum gehst du nicht auf dein Zimmer?«
Ich, inzwischen ein großes Mädchen, setze mich neben sie aufs Bett, nachdem ich meine Hausaufgaben gemacht habe.
»Hallo Mama.«
Sie steht sichtlich verärgert auf und lässt mich mit der geöffneten Zeitschrift auf dem Bett zurück.
»Warum hast du nicht weiter im Krankenhaus gearbeitet?«, fragte ich sie.
»Weil ich geheiratet habe.«
»Und warum hast du nicht studiert, nachdem du geheiratet hast?«
Sie überlegte, etwas zu antworten, schwieg aber.
»Hat Papa es dir nicht erlaubt?«
»Das war es nicht.«
»Was dann?«
»Ich habe ihn nicht einmal gefragt.«
»Hattest du keine Lust mehr?«
»Doch, ich hätte gern studiert.«
»Warum hast du es dann nicht getan?«
Sie schlug die Zeitschrift zu. Es war eine ¡Hola!. Auf der Titelseite Carolin von Monaco mit einem trägerlosen Abendkleid und Kronjuwelen – Rubine und Diamanten.
»Weil du geboren wurdest.«
Sie stand auf und ging in den Flur. Ich folgte ihr.
»Warum hast du nicht noch mehr Kinder bekommen?«
»Noch eine Schwangerschaft? Noch eine Geburt? Ein schreiendes Baby? Nein, danke. Damit soll man mich bloß in Ruhe lassen. Außerdem habe ich mir meinen Körper mit dir mehr als genug ruiniert.«
»Hättest du mich nicht bekommen, wenn du es hättest verhindern können?«
Sie blieb stehen und sah mich an.
»Ach, Claudia, ich bin nicht wie meine Mutter.«
Mein Geburtstag fiel in die langen Ferien, auf den Unabhängigkeitstag, an dem Festzüge stattfanden und die Leute einen Abstecher ins Umland machten, in ihre Landhäuser oder ans Meer. Wir feierten also im Familienkreis und gingen in ein Restaurant.
Wie jedes Jahr erzählte meine Mama von ihrer Schwangerschaft. Von ihrem dicken Bauch, den geschwollenen Füßen, dass sie alle fünf Minuten zur Toilette musste, nicht schlafen konnte und kaum aus dem Bett hochkam. Die Schmerzen setzten beim Mittagessen ein. Es war das Grauenvollste, was sie je erlebt hatte. Mein Papa fuhr sie ins Krankenhaus, und dort litt sie den ganzen Nachmittag, die ganze Nacht, den ganzen Vormittag des nächsten Tages, einen weiteren Nachmittag, glaubte, sterben zu müssen, und noch eine ganze Nacht bis zum Morgengrauen.
»Als sie endlich rauskam, war sie lila. Fürchterlich. Sie legten sie mir auf die Brust, und ich dachte: Dafür die ganze Qual?«
Meiner Mama entfuhr ein gewaltiges Lachen, das den Blick auf ihren Gaumen freigab – tief und gerippt wie der Oberkörper eines unterernährten Menschen.
»Das hässlichste Baby im ganzen Krankenhaus«, sagte mein Papa.
Er und Tante Amelia lachten ebenfalls, zeigten die Zunge, die Zähne, das halb zerkaute Essen.
»Das andere kleine Mädchen, das an diesem Tag geboren wurde, war wirklich niedlich«, sagte meine Tante.
Das letzte Bild an der Wand des Arbeitszimmers stammte vom Tag meiner Geburt. Wie das Foto meiner Großeltern mütterlicherseits war es rechteckig, schwarz-weiß und steckte in einem Silberrahmen.





























