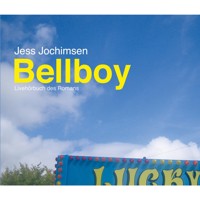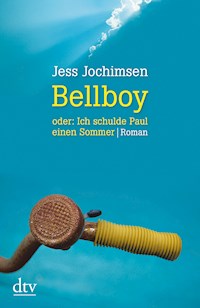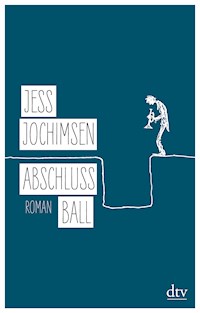
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Menschen erzählen sich Geschichten, um zu leben. Und für den Tod brauchen sie die Musik.« Für Marten ist der Friedhof der richtige Ort: Friedhöfe sind ruhig, gut ausgeschildert und bieten ausreichend Schatten. Schon als Kind hat er die Befürchtung, nicht in diese Welt zu passen – und als sich die Möglichkeit auf ein Dasein frei von Unwägbarkeiten bietet, greift er zu: Er wird Beerdigungstrompeter auf dem Nordfriedhof in München und spielt den Toten das letzte Lied. Als Marten die Bankkarte seines soeben zu Grabe getragenen Klassenkameraden Wilhelm findet, beginnt eine groteske Irrfahrt. Ohne eigenes Zutun wird er in einen Strudel merkwürdiger Ereignisse gezogen und lernt all das kennen, wovon er sich Zeit seines Lebens so mühsam ferngehalten hat: andere Menschen, Geld, Abenteuer, die Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über das Buch
Für Marten ist der Friedhof der richtige Ort: Friedhöfe sind ruhig, gut ausgeschildert und bieten ausreichend Schatten. Schon als Kind hat er die Befürchtung, nicht in diese Welt zu passen – und als sich die Möglichkeit auf ein Dasein frei von Unwägbarkeiten bietet, greift er zu: Er wird Beerdigungstrompeter auf dem Nordfriedhof in München und spielt den Toten das letzte Lied. Als Marten die Bankkarte seines soeben zu Grabe getragenen Klassenkameraden Wilhelm findet, beginnt eine groteske Irrfahrt. Er wird in einen Strudel merkwürdiger Ereignisse gezogen und lernt all das kennen, wovon er sich bislang so mühsam ferngehalten hat: andere Menschen, Geld, Abenteuer, die Liebe. ›Abschlussball‹ erzählt anrührend und komisch von einem wundersamen Lebensverweigerer, der binnen eines Sommers das Abenteuer seines Lebens bestehen muss.
Jess Jochimsen
Abschlussball
Roman
I
Wie es sich anfühlt, willst du wissen?
Nun … Eines Tages beginnst du zu schrumpfen
und alles wird langsamer.
Du beginnst, Leute, die einen Stock benutzen,
nicht mehr zu belächeln.
Du schläfst weniger. Brauchst eine Brille.
Alles nicht schlimm.
Es wird leichter, wenn du zwei Dinge verstehst:
Menschen erzählen sich Geschichten, um zu leben.
Und für den Tod brauchen sie die Musik.
1
Von den großen Friedhöfen der Stadt ist mir der Nordfriedhof der liebste. Er ist ruhig, schlicht und vor allem gut ausgeschildert. Außerdem gibt es ausreichend Schatten.
Wenn es das Wetter zulässt, warte ich draußen. Ich sitze auf einer der alten, runden Bänke vor der Aussegnungshalle und sehe den Friedhofsgärtnern beim Rauchen zu. Ab und an bedeute ich den zu spät kommenden Trauergästen mit einem Kopfnicken, dass sie ruhig in die Halle gehen dürfen, und wärme währenddessen das Mundstück in der Hosentasche an. Irgendwann öffnet sich das Portal und die Trauergesellschaft erscheint. Dann reihe ich mich unauffällig ein und gehe zu meinem Arbeitsplatz.
In einem meiner ersten Gespräche mit Berger erklärte er mir, dass der Gang zum Grab der entscheidende Punkt sei, weil es ab hier kein Zurück mehr gebe. In der Kapelle werde nur rumgesessen und zugehört, das tue niemandem wirklich weh. Beim Loslaufen ändere sich das. An den ersten Schritten der Prozession erkenne man, was Sache sei. Ob es eine gute Beerdigung werde oder ob jemand zusammenbreche, das sehe man in dem Moment, in dem sich der Zug in Bewegung setze, überhaupt sei das eine Offenlegung der Verhältnisse. »Wer geht wo hinterm Sarg und mit wem?«, das sage mehr aus als jede Familienaufstellung.
Ich muss ihm recht geben. Ich habe es oft genug selbst erlebt. Ich habe Menschen gesehen, die gefasst aus der Halle traten und ein paar Minuten später am offenen Grab Kränze auf den Boden warfen und darauf herumtrampelten. Ich habe Heulkrämpfen und Panikattacken beigewohnt, habe wüste Beschimpfungen mitangehört und Erbstreitigkeiten, die ausgetragen wurden, noch bevor die erste Schaufel Erde auf den Sarg fiel. Was es auch war, immer hatte es sich während der ersten Meter, die der Trauerzug zurücklegte, angedeutet. Ein kurzes Aus-dem-Tritt-Geraten. Ein Stampfen. Ein wütendes Husten.
Es ist so: Die Bewegung löst, was sich während der Reden oder der Predigt aufgestaut hat, das ungewohnt langsame Schreiten lockert es weiter auf und am Grab entlädt es sich.
Berger ist ein Meister darin, die Zeichen zu deuten. Und oft genug greift er ein. Dann weist er die Sargträger an, einen kleinen Umweg zu laufen, oder er stoppt die Prozession, um eine winzige Veränderung an der Sargdekoration vorzunehmen und sich anschließend die Schuhe zu binden. Diese kurzen Einbrüche von Normalität reichen meist aus, um Schlimmeres zu verhindern. Liegt eine Katastrophe in der Luft, bittet Berger die Musiker, schon während des Laufens ein Lied zu spielen, damit der Tränenfluss der Gäste die unterschwelligen Aggressionen wegspült oder zumindest aufweicht.
Manchmal hilft alles nichts. Und manchmal hat Berger auch einfach keine Lust. Wenn er einen Kater hat oder ihm seine Auftraggeber unsympathisch sind, wenn er schon ahnt, dass er Monate auf sein Geld warten wird, dann lässt er den Dingen ihren Lauf.
Ich glaube, insgeheim freut sich Berger darüber, wenn seine Prophezeiungen eintreffen, wenn er später beispielsweise erzählen kann, er habe es gewusst, in dem Augenblick, als sich jene ältere Dame im teuren Kleid noch auf den Stufen der Kapelle lautstark geschnäuzt habe, weswegen der Zug kurz ins Stocken geraten sei und man sie mit vorwurfsvollen Blicken bedacht habe, da habe er, Berger, es bereits gewusst, dass just diese Dame eine Viertelstunde später die Fassung verlieren und der Verstorbenen ein für alle hörbares »Endlich ist die Hure verreckt« ins Grab nachrufen würde.
Solche Vorfälle sind allerdings die Ausnahme. Meist verlaufen die Abschiednahmen, die Berger betreut, ruhig und in großer Würde. Glaubt man der hervorragenden Auftragslage, sterben in den letzten Jahren entweder mehr Menschen als früher oder Berger hat sich den Ruf erworben, ein guter und gewissenhafter Bestatter zu sein. Der Grund dafür ist Bergers einfaches und banales Geschäftsmotto, dem letztendlich auch ich beipflichte: Es geht nie um die Toten, sondern um die Lebenden.
2
An dem Tag, an dem alles begann, blieben mir noch über zwei Stunden und ich war unschlüssig. Es war ein heißer Tag und wenn ich zu Fuß ginge, würde ich in meinem Anzug schon verschwitzt am Friedhof ankommen. Nähme ich den Bus oder die U-Bahn, wäre ich in weniger als zwanzig Minuten da. Allerdings war es Samstag und die Verkehrsmittel würden voller Kaufwütiger sein.
Ich blickte in meiner winzigen Wohnung umher und überlegte, was es noch zu erledigen gab. Viel war es nicht: das Geschirr vom gestrigen Abend abspülen, Trötenöl nachfüllen, die neuen Schnürsenkel einfädeln und dann noch die seit Tagen nicht abgehörte Nachricht von Sonia auf dem Band. Vom Abwasch abgesehen war nichts dringend oder auch nur von Belang. Ein Teller, ein Messer, ein Glas und die leere Butterdose. Ich ließ diese vier Dinge fast aus Trotz in der Spüle stehen und machte mich auf den Weg.
An der Ecke zur Baumstraße hatten Kinder einen kleinen Flohmarkt aufgebaut. Ich stellte mich neben eine Frau und musterte wie sie das auf dem Boden ausgelegte Sammelsurium an ausrangiertem Spielzeug. Es wirkte wahllos.
»Das ist ja reizend, was ihr hier macht«, sagte die Frau, »aber meine Enkel sind leider schon zu alt.« Sie ging schnell davon und ich bezog ihre Flucht auf mich.
Auf einem Pappkarton stand »Bunt bemalte Steine«.
»Wollen Sie einen Stein kaufen?«, fragte ein vielleicht zehnjähriges Mädchen.
»Warum sollte ich?«, fragte ich zurück.
»Weil er schön ist«, sagte das Mädchen, »außerdem kostet er nur vierzig Cent.«
»Das sind zwei Gründe, einer davon ist gut.«
Das Mädchen sah mich verwirrt an. Ein Junge, der möglicherweise ihr Bruder war, zog hörbar seinen Rotz hoch und ließ dann langsam und konzentriert einen Spuckefaden in ein Gullyloch fallen.
»Hör auf, das ist eklig«, sagte das Mädchen.
»Warum sollte ich also einen Stein kaufen?«, nahm ich, mehr aus Verlegenheit, das Gespräch wieder auf.
»Man kann Kätzchen ertränken damit«, sagte der Junge.
Das Mädchen begann zu weinen. »Du bist so blöd!«
»Ich nehme einen«, sagte ich hastig und sah in die Kiste, »einen blauen.«
»Was ist denn in deinem Koffer?«, fragte der Junge. »Eine Maschinenpistole?«
»Nein.« Ich gab dem Mädchen das Geld.
»Was dann? Kann ich mal sehen?«
»Lieber nicht«, sagte ich und ging, das Köfferchen in der einen, den Stein in der anderen Hand, davon.
In meinem Rücken hörte ich, wie das Mädchen leise sagte: »Einen brauchen wir noch, dann reicht es für ein Eis.«
Obwohl der blaue Stein weniger wog als mein Köfferchen, merkte ich, dass mir das Gehen leichterfiel, seitdem ich in beiden Händen etwas trug. Ich versuchte, meine hängenden Arme ein wenig schwungvoller am Körper vorbeischlenkern zu lassen, ohne mit dem Koffer an den Oberschenkel zu stoßen. Es gelang und ich genoss es, wie mein Gang rhythmischer und beschwingter wurde. Entspräche das Gewicht des Steines dem des Koffers, wäre es vermutlich noch besser, dachte ich, ich hätte beim Kauf darauf achten sollen. Vielleicht wäre das ja eine zündende Geschäftsidee für die Kinder, Steine verschiedenen Gewichts anzubieten und sie an Taschen oder Tüten tragende Passanten zu verkaufen? »Damit Sie leichter gehen können: bunt bemalte Steine.« Und Leuten, die bereits mit beiden Händen etwas trugen, könnte man den Kauf eines Steines zum Gewichtsausgleich vorschlagen. »Beschweren Sie sich, um es leichter zu haben.«
Ich stellte mir vor, wie ich das Geschäft betreiben würde, angenommen, es wäre meines. Wahrscheinlich würde ich einen Schritt weiter gehen und die Einkaufstaschen der Leute komplett aus- und umpacken, die Einkäufe vielleicht sogar auf eine mitgebrachte Waage legen, um das Gewicht perfekt auszutarieren. Vermutlich würde ich, während ich die abgewogenen Waren akribisch zu zwei gleich großen Haufen aufschichtete, die Leute darüber hinaus fragen, ob sie den einen oder anderen eingekauften Artikel tatsächlich brauchten, ob es für den Fortgang ihres Lebens nicht viel besser wäre, einen Teil des erworbenen Krams auf der Stelle zu entsorgen. Sie brauchen das nicht! Schauen Sie, dort drüben steht ein Mülleimer, geben Sie sich einen Ruck! Oder geben Sie das Zeug mir. Behalten Sie nur das absolut Notwendige, den Rest nehme ich. Hier, ich gebe Ihnen einen Stein dafür. Sie kennen doch die Geschichte von Hans im Glück, nehmen Sie einen blauen, von deutschen Kinderhänden liebevoll bemalt.
Nichts würden die Leute von mir nehmen, dachte ich, nicht mal einen Stein. Und wenn doch, würden sie diesen nicht wegschmeißen, wie im Märchen, sondern nach Hause schleppen und auf den Fenstersims oder in den Vorgarten legen – zu den anderen, die sie irgendwann einmal in einem Andenken-Shop gekauft hatten und in die vom Hersteller »Love« oder »Happiness« eingraviert worden war, um die Käufer in Stein gemeißelt daran zu erinnern, was im Leben wirklich zählte.
In der Innentasche meines Sakkos vibrierte mein Handy. Weil ich keine Hand frei hatte, ließ ich es einfach klingeln. Ein weiterer Vorteil des Steins, er verhinderte die ständige Erreichbarkeit.
Ich warf den Stein einmal kurz in die Luft und fing ihn wieder auf. Was mache ich jetzt mit dir? Jemanden erschlagen? Es fiel mir niemand ein. Oder eine Scheibe einschmeißen? Ob es einen Unterschied machte, dies mit einem farblich ansprechenden Souvenir zu tun statt mit einem grauen, auf einer Baustelle entwendeten Pflasterstein? Ich könnte den blauen Stein in das Schaufenster eines der Andenkenläden werfen, dachte ich, natürlich nicht, ohne ihn vorher beschriftet oder graviert zu haben: mit »Hate«. Oder mit »Ich wollte nach Hause« oder »Jetzt brauchen Sie die Scheibe auch nicht mehr putzen«. Aber für Randale war ich zu alt. Ich hatte mich schon immer zu alt dafür gefühlt. Und nicht nur dafür.
Vielleicht singe ich dem Stein auch einfach etwas vor? Mal sehen, ob er weint. Aber ich war nicht Orpheus und geheult würde später noch genug, wenn ich spielte.
Ich rief mir die Titelliste, die Berger mir für diesen Tag durchgegeben hatte, ins Gedächtnis. Es war nichts darauf, das ich hätte üben müssen. Ich beschloss, die Fußgängerzone in einem Bogen zu umlaufen, und ging zur Isar hinunter. Am Ufer angekommen, warf ich den Stein ohne nachzudenken ins Wasser und hoffte auf irgendein Zeichen von Erleichterung. Ich spürte nichts.
3
Mein Handy meldete den Eingang einer SMS. Berger. Außer Berger schrieb mir selten jemand.
Ich schaute auf den Fluss und erinnerte mich an eine Szene in einem Buch von Gerbrand Bakker, das ich vor kurzem gelesen hatte. Darin geht ein Mann in einen Teich, um sich das Leben zu nehmen. Obwohl er nicht schwimmen kann, hat er sich zur Sicherheit die Manteltaschen mit schweren Haushaltsgegenständen vollgestopft. Aber das Wasser ist nicht tief genug. Noch in der Mitte des Teiches reicht es ihm kaum bis zur Hüfte, er hat es viel tiefer eingeschätzt und nun ist er nicht imstande, sich fallen zu lassen. Also bleibt er einfach stehen, bis seine Kollegen ihn irgendwann entdecken und ins Trockene bringen.
»Vielleicht war er verblüfft gewesen.«
Dieser Satz war alles, was der Erzähler dazu sagte. Der Vorfall wurde das ganze Buch über mit keinem Wort mehr erwähnt. An etwas anderes erinnerte ich mich nicht. Ich hatte mich nicht mehr auf die Geschichte konzentrieren können, das Bild des verloren im Wasser stehenden Mannes hatte mich nicht mehr losgelassen und alles andere überdeckt. Diese Sinnlosigkeit. Der Hausrat in den Taschen … Immer wieder hatte der Mann in meiner Vorstellung eine andere Gestalt angenommen, mal eine willkürliche, die von Passanten etwa oder von Gästen, dann zunehmend eine mir bekannte, die meines Vaters, die von Berger und sogar die meiner Schwester. Aber egal, wen ich gerade vor Augen hatte, immer war der Gesichtsausdruck von spöttischem Erstaunen gekennzeichnet, von irrwitziger Verblüffung. Was zum Teufel habe ich hier zu suchen?
In der Kurzmitteilung schrieb Berger: »Änderung in der 18:30er. Hinterbliebene wünschen ›Wooden Heart‹ von Elvis. Kriegst du das hin?«
Als ich »ja« in mein Handy tippte, bemerkte ich, dass meine Finger blau gefärbt waren.
Ich schrieb »Muss i denn, muss i denn zum Städtele hinaus« und schickte die SMS ab.
Sekunden später rief Berger an. »Ist irgendwas?«
»Nein«, sagte ich.
»Weil du so geschwollen schreibst«, sagte Berger und schnaufte. Die Hitze machte ihm hörbar zu schaffen.
»Ich wollte dich nur wissen lassen, dass ›Wooden Heart‹ dieselbe Melodie wie ›Muss i denn‹ hat, das ist alles.«
»Das ist mir doch egal.«
»Ich wollte es nur gesagt haben, du bist doch derjenige, der auf halbwegs angemessene Trauermusik achtet.« Ich sang leise in den Hörer. »Und du, mein Schatz bleibst hier. Wenn i komm, wenn i komm, wenn i wieder wieder komm …«
»Zum Glück spielst du nur und singst nicht«, sagte Berger, »schon klar, das Lied ist saublöd. Aber heute ist mir das auch egal.«
»Hauptsache, die Angehörigen wissen Bescheid«, sagte ich.
»Ich weiß noch nicht mal, wer die Angehörigen sind«, sagte Berger und schnaufte wieder, »lief alles schriftlich. Ich weiß gar nichts. Geld ja, in Hülle und Fülle. Aber sonst nichts. Grabmal des unbekannten Soldaten. Komm jetzt.«
»Bin unterwegs.«
Berger hatte schon aufgelegt.
4
Die ersten beiden Beerdigungen an diesem Samstag waren gut über die Bühne gegangen. Der ausgewählten Kleidung und dem großen Andrang der Trauergäste nach zu urteilen, stammten die Verstorbenen aus besseren Verhältnissen. Auch hatten beide ein hohes Alter erreicht, was den Tod gemeinhin rechtfertigte und den Abschied leichter machte.
Ich hatte ausschließlich aus den Trauer-Charts gespielt. ›Time to Say Goodbye‹ und das ›Ave Maria‹. Die einzige Besonderheit war gewesen, dass die Hinterbliebenen in der zweiten Abschiednahme neben dem Schubert ein weiteres Lied gewünscht (und, wie Berger betonte, auch extra dafür bezahlt) hatten, ›Ein Stern, der deinen Namen trägt‹.
Ich hatte längst aufgehört, mir über die musikalischen Vorlieben der Trauergäste Gedanken zu machen. Seit Jahren spielte ich auf Beerdigungen und während ich in meiner Anfangszeit fast ausschließlich um Klassik, Kirchenlieder und Volksweisen gebeten wurde, war es in den letzten Jahren mehr und mehr in Mode gekommen, auch bekannte Popsongs und Schlager am Grab vortragen zu lassen. Weder die Kirche noch die Bestattungsinstitute hatten sich dieser Entwicklung entgegengestellt, warum auch, schien sie doch zu vollen Häusern und Kassen zu führen.
Berger war einer der Ersten gewesen, der offensiv mit diesem Wandel der Bestattungskultur umgegangen war. In seinen Prospekten und auf seiner Homepage formulierte er es würdevoll, aber deutlich: »Die Gestaltung des letzten Abschiednehmens wird immer persönlicher und entscheidend von der musikalischen Begleitung mitbestimmt. Traditionell mit christlicher Musik gestaltet, sind die Möglichkeiten heutzutage vielfältiger und müssen nicht mehr religiös geprägt sein. Ganz im Sinne des Verstorbenen kann jede Art von Musik gewählt werden. Ob Livemusik in der Trauerhalle, am Grab oder auf der anschließenden Trauerfeier, unsere Musiker können grundsätzlich jeden gewünschten Titel aufführen.«
Und so war es auch. Wir spielten, was beliebte. Zwar versuchte Berger, die Musikwünsche durch eine zweihundert Stücke umfassende »Liste gängiger Titel« ein wenig zu steuern, aber letztlich siegten die persönlichen Vorlieben der Leute. Whitney Houstons ›I Will Always Love You‹ verdrängte das ›Largo‹ von Georg Friedrich Händel, Chopins ›Tristesse‹ hatte das Nachsehen gegenüber ›Somewhere Over the Rainbow‹. Mittlerweile gab der Bund Deutscher Bestatter eine offizielle »Top Ten der Trauerhits« heraus und zementierte den Massengeschmack. Sarah Brightmans und Andrea Bocellis ›Time to Say Goodbye‹ rangierte seit Jahren unangefochten auf dem ersten Platz, seit einiger Zeit dicht gefolgt von ›Geboren um zu leben‹ der Band Unheilig; ein klassisches Stück fehlte unter den erfolgreichsten zehn.
Ich war nicht böse darüber, dass ich Mozarts ›Abendruhe‹ oder Haydns Andante aus dem Trompetenkonzert in Es-Dur nur noch selten spielte, dafür umso häufiger ›Tears in Heaven‹ von Eric Clapton oder ›Abschied ist ein scharfes Schwert‹ von Roger Whittaker. Es war der Lauf der Dinge und ich nahm ihn hin.
Die Begräbnisgeiger dagegen – Berger beschäftigte ausschließlich Violinisten und Trompeter – wurden nicht müde, den Verfall der Trauermusik zu beklagen. Auf den monatlichen Treffen, die Berger mit seinen Musikern abhielt, machten sie ihrem Unmut regelmäßig Luft.
»Was wir aufführen, ist ein derartiger Unfug, ich halte das nicht mehr aus«, murrten sie, oder: »Es ist einfach nur beschämend. ›Geboren um zu leben‹ spiele ich nicht mehr, da rotieren die Toten doch im Sarg. Unheilig – der Name sagt doch alles. Was soll man über so einen Mist denn improvisieren? Ich möchte einmal wieder aus Beethovens Dritter spielen oder zumindest das ›Ave Verum‹. Früher war das gang und gäbe … und heute? ›Ich hatt’ einen Kameraden‹ und Helene Fischer!«
Ich hielt mich zurück. Berger berief die Treffen ohnehin nur ein, um den Musikern ein Ventil zu verschaffen. Denn letztlich beklagten sie vor allem ihr eigenes Schicksal: Bei keinem von ihnen hatte es für eine Karriere als Solist oder Orchestermusiker gereicht. Sie fanden weder Anschluss an die lokale Jazzszene noch einen Job in einer Tanzkapelle. Noch nicht einmal durch Musikunterricht konnten sie ihren Lebensunterhalt vollends bestreiten. Sie brauchten das Geld und waren auf der vermeintlich untersten Stufe des Musikerdaseins angelangt: Sie gaben die Jukebox auf Beerdigungen.
Nur Sebastian, ein weit über siebzigjähriger Geiger, der schon für Berger gearbeitet hatte, als ich anfing, beteiligte sich nie an den Schimpftiraden. Sebastian war groß, hager und hatte eine markante Hakennase. Wenn sich die Musiker trafen, saß er schweigend am Tisch, aß das von Berger spendierte Mahl und schien von den Klagen über die seichten Lieder völlig unberührt zu sein.
Ein einziges Mal sagte er: »Vielleicht muss das so sein. Vielleicht verdient ein entseeltes Zeitalter nur einen entseelten Tod.«
5
Ich hatte Pause. Die Abschiednahmen am Nachmittag sollte allesamt wieder ich begleiten, für die um 13:00 Uhr aber hatte Berger Sebastian eingeteilt. Ein willkommener Anlass, im Schatten zu sitzen, mich auszuruhen und Sebastians Kunst zu genießen.
Ich mochte den alten Geiger, nicht nur weil dieser ähnlich in sich gekehrt war wie ich, sondern vor allem, weil er nicht haderte. Sebastian sah sich nicht als gescheiterte Musikerexistenz, sondern – im Gegenteil – nachgerade dazu berufen, den Menschen zum letzten Geleit zu spielen. Fragte man ihn, was er sonst noch so machte, schüttelte er den Kopf, nichts, er sei Totengeiger. Als sei dies ein Beruf, den er vor vielen Jahrzehnten einmal gelernt hatte und in dem er voll und ganz aufging.
Statt einer Schnecke hatte Sebastian einen geschnitzten Totenkopf an seiner Violine und er trug sommers wie winters einen schwarzen Gehrock und einen Zylinder. Sein exzentrisches Äußeres rechtfertigte er durch sein Spiel. Er war der mit Abstand versierteste Musiker von uns allen und schwang sich nicht selten zu langen und waghalsigen Improvisationen auf. Sein Vorgehen folgte dabei einem immer ähnlichen Muster. Zunächst spielte er die Melodie oder den Kehrvers des gewünschten Titels schnörkellos und ohne jede Emphase. Sobald er sich sicher war, dass die anwesende Trauergesellschaft das Lied erkannt hatte (hierauf legte Berger Wert), wechselte er die Tonart. Er tat dies nicht durch eine sanfte Modulation, sondern völlig abrupt. Er riss die Töne förmlich aus ihrem bisherigen harmonischen Gefüge und trieb sie, meist mit einem sehr schnellen Lauf über zwei oder drei Oktaven, dorthin, wo er sie haben wollte; in Gefilde, in denen die wohlige Gewissheit des Wiedererkennens schwand, in denen das ohnehin schon schale Pathos vollends brüchig wurde. Meinte man im einen Moment noch, Sebastian variiere nun im Stile eines Feierabend-Jazzers die Ausgangsmelodie und eine Rückkehr zum ursprünglichen Lied sei jederzeit möglich, zerstörte er diesen Eindruck im nächsten Moment nachhaltig. Er forcierte oder verlangsamte das Tempo, änderte den Takt, brach ab, setzte an einem neuen, abwegigen Ort wieder an, streute Fetzen anderer Stücke ein, nur um auch diese sogleich wieder unkenntlich zu machen. Bisweilen verließ er die Felder gängiger Tonalität ganz und entlockte seinem Instrument nurmehr merkwürdige Klänge. Er klopfte und kratzte auf Saiten und Korpus herum, imitierte Umweltgeräusche, einen Windhauch etwa, eine Vogelstimme oder das Aufjaulen eines zufällig vorbeifahrenden, beschleunigenden Autos, er ließ seine Geige wimmern, flüstern oder schreien.
Hatten die Zuhörer zu Beginn gemeint, einem andächtigen Stück Trauermusik beizuwohnen, wurden sie mehr und mehr Zeuge eines wirren, der Situation scheinbar unangemessenen Tanzes. In ihr anfängliches Staunen mischte sich zusehends Verwirrung und stets auch spürbare Entrüstung.
Die ersten Male, bei denen ich Sebastians Vorträgen beigewohnt hatte, war ich mir sicher gewesen, seine Improvisationen seien seine Art der Kritik an den einfältigen, ja lächerlichen Musiktiteln, die gewünscht wurden. Bald aber begriff ich, dass es ihm darum am allerwenigsten ging. Das Stück Musik war ihm einerlei. Und auch an einer Provokation der Gäste war ihm nicht gelegen. Im Gegenteil, niemals brach sich die Entrüstung der Anwesenden Bahn, denn noch bevor sie sich wirklich hätte breitmachen können, hatte Sebastian sein Spiel schon wieder verändert. Er versöhnte das Publikum mit einer einfachen, melodiösen Phrase, verblüffte es mit einem fast heiteren Pizzicato, schmeichelte ihm … nur um es dann aufs Neue mit einem wütenden Crescendo zu verwirren.
Sein Können stellte Sebastian dabei nie zur Schau. Er stand stocksteif da und verbot sich noch die winzigste Andeutung eines irgendwie gearteten musikalischen Selbstbewusstseins. Das war das Geheimnis. Egal, wie schwindelerregend Sebastians Volten waren, immer blieb sein Spiel seltsam schlicht, immer wurde es getragen von einer unerklärlichen Aura von Einfachheit und Demut. Gegen Ende seiner Vorträge ließ Sebastian seine Klänge und Töne mehr abtropfen denn erklingen, es war, als führten sie einen letzten, stiller werdenden Kampf gegen das Unabänderliche und für das Gehen-Lassen. Und wenn sie sich schließlich vermeintlich müde und erleichtert zur Ursprungsmelodie zurückschleppten, hatten alle Anwesenden Tränen in den Augen oder weinten lauthals.
Kaum einer, der Sebastian nur ein oder zwei Mal am Grab hatte spielen hören, konnte erklären, was da gerade genau passiert war, woher die tiefe Aufgewühltheit rührte, die Bereitschaft, so hemmungslos und bisweilen auch grundlos zu heulen. Dabei war es einfach: Da hatte einer nicht die ohnehin erhöhte Empfänglichkeit der Trauergäste erfasst und durch sein Spiel um Tränenfluss gebuhlt (wie ich es mir manchmal unterstellte), sondern da hatte einer aufrichtig versucht, den Tod zu illustrieren. Bei jedem einzelnen Begräbnis, auf dem Sebastian musizierte, beschrieb er immer wieder neu all jene Gefühle, die das Sterben auslösen konnte: Panik, Verwirrung, Staunen, Entsetzen, Entrüstung, Wut, Verführung, Dankbarkeit. Nur um die Traurigkeit musste sich jeder selbst kümmern, aber Sebastians Spiel machte allen ein ernst gemeintes Angebot.
Sebastian war der einzige von Bergers Musikern, dem es von Zeit zu Zeit gelang, über die geladenen Trauergäste hinaus Publikum anzuziehen. Und er war auch der einzige, den Berger nicht ab und zu kritisierte oder ins Gebet nahm. Wobei sich dessen Ermahnungen, die er uns anderen in schöner Regelmäßigkeit zuteilwerden ließ, auf die immer gleichen drei Dinge beschränkten:
»Ich will erstens, dass ihr halbwegs anständig gekleidet seid, zweitens, dass die Gäste das gewünschte Lied erkennen, und drittens, dass sie flennen. Wenn sie Rotz und Wasser heulen, ist alles gut, dann sind auch die ersten beiden Punkte nicht so wichtig.«
Diesbezüglich gab es bei mir keinerlei Anlass zur Klage. Ich trug einen Anzug, improvisierte selten (und wenn, waren meine Variationen kaum hörbar) und die Leute weinten sich die Augen aus.
Ich spielte so, wie ich lebte: ordentlich, leise und langsam.
6
Es steht ein Soldat am Wolgastrand/hält Wache für sein Vaterland.
Hatte es, als Sebastian zu seiner Interpretation des gewünschten Stücks von Franz Lehár ansetzte, unter den Trauergästen noch etliche gegeben, die wohlig schauernd vor allem diese beiden Zeilen assoziierten, so war, nachdem Sebastians letzter Ton verklungen war, noch dem Letzten jedwede völkische oder gar militaristische Lesart des Liedes ein für alle Mal ausgetrieben worden. Nicht einer der Anwesenden würde sich je wieder eine Aufnahme dieses Titels anhören können, ohne an den seltsamen Geiger mit Zylinder denken zu müssen, der ihn einst am Grab eines Weggefährten so nachhaltig erschüttert und zum Weinen gebracht hatte. Sie würden es nie erfahren, aber Sebastian hatte sie – allein durch sein Spiel – mit den vergessenen Anfangsversen des Wolga-Liedes vertraut gemacht, mit jenem Text, den sie nicht kannten, weil er in den Versionen von Heino, Ivan Rebroff oder Freddy Quinn ganz bewusst ausgespart wurde: Allein! Wieder Allein!/Einsam wie immer./Vorüber rauscht die Jugendzeit./In langer, banger Einsamkeit.
Als sich der Friedhof geleert hatte, standen wir vor dem Portal der Aussegnungshalle in der Sonne und genossen es, während der Mittagspause nicht gedämpft, sondern in normaler Lautstärke sprechen zu können. Neben mir waren drei weitere von Bergers Musikern gekommen, um Sebastians Vortrag zu hören, und Berger nutzte die Gelegenheit, ein wenig Kritik an ihnen zu üben. Ulrich und Gregersen, zwei Geiger, die es beide aus Norddeutschland nach München verschlagen hatte, wies er auf deren stets ungeputzte Schuhe hin und Dittmar, einen beinahe kahlen Trompeter aus Fürth, der ähnlich viel Zeit auf dem Friedhof zubrachte wie ich, ermahnte er, seine Spucke gefälligst nicht in Anwesenheit einer Trauergesellschaft aus seinem Instrument laufen zu lassen.
Zu Sebastian sagte Berger nichts, an den anderen in Anwesenheit des alten Geigers herumzumäkeln, war seine Art, ihn zu loben. Weil Berger auch mich und meine Vorträge unerwähnt ließ, ergriff Dittmar das Wort: »Ich habe dir heute Morgen zugehört, darf ich mir eine Anmerkung erlauben?«
Weil keiner etwas sagte, fuhr er fort: »Dein ständiges C-Dur lass ich mal außen vor, aber fällt dir eigentlich auf, dass du in deinem betont langsamen Spiel immer in den Dreivierteltakt rutschst? Sowohl bei ›Ein Stern‹ als auch beim ›Ave Maria‹ warst du gegen Ende im Dreier. Willst du, dass die Leute anfangen, langsamen Walzer zu tanzen? Oder ist das eine Volksmusik-Reminiszenz?«
»Das wird jetzt aber kein Fachgespräch, oder«, sagte Ulrich und zündete sich eine Zigarette an.
Wir anderen schwiegen – Sebastian, weil er immer schwieg, Berger und Gregersen, weil ihnen Dittmars Gestichele von jeher egal war, und ich, weil ich mich ertappt fühlte. Es war mir noch nie aufgefallen, aber Dittmar hatte recht. Je länger ich darüber nachdachte, je genauer ich mir die Stücke, die ich in letzter Zeit gespielt hatte, ins Gedächtnis rief, desto deutlicher trat der schleppende Walzer zutage, in den ich beim Spiel stets – und ohne es zu merken – verfallen war.
»Es ist der Takt des Todes«, sagte Sebastian in die Stille, »und der des Volkes.«
Nun war unser Schweigen komplett. Keiner hatte es bislang erlebt, dass sich der hagere Geiger je in ein Gespräch eingemischt, geschweige denn sich zu musikalischen Fragen geäußert hätte. Sebastian sah in unsere erstaunten Gesichter, nahm seinen Zylinder ab und sagte dann im ruhigen Duktus eines Volksschullehrers, der einer Gruppe unwissender Buben zum x-ten Male einfachste Grundlagen vorbetete: »Trauermärsche waren ursprünglich immer im Dreivierteltakt komponiert. Das Ungerade symbolisierte den abgeschnittenen Lebenslauf des Toten, und die Leute haben das auch verstanden. Zu Hochzeiten und Begräbnissen gehörten Walzer, weil das Volk wusste, dass das Leben eine ewige Tippelei ist. Nur die Obrigkeit der Kirche mit ihren salbungsvollen Versen und ewigen Viervierteln hat immer versucht, Geradlinigkeit herzustellen, wo da doch keine ist, wo niemals eine sein kann.« Er wendete sich zum Gehen. »Wir sehen uns später.«
Dittmar war der Erste, der seine Sprache wiederfand. »Ich habe Sebastian noch nie so viel an einem Stück sagen hören.«
»Was meinte er mit Tippelei?«, fragte Ulrich.
»Auf der Walz sein«, sagte Gregersen.
Dittmar schüttelte den Kopf. »Das ist doch alles dummes Gerede.«
»Vielleicht«, sagte Berger und setzte sich in Bewegung, »aber auf mich wartet jetzt die Arbeit. Und auf dich, Marten, wartet deine Freundin.«
Er nickte Sonia zu, die nur ein paar Meter entfernt auf einer Bank saß. Ich war so in Gedanken gewesen, dass ich ihre Anwesenheit nicht mitbekommen hatte. Sie ist nicht meine Freundin, dachte ich, und sie warf mir, als wolle sie meine Gedanken Lügen strafen, eine Kusshand zu.
Als ich neben ihr Platz genommen hatte, drehte sich Berger noch einmal um und rief: »Ich hatte es dir noch gar nicht gesagt, die Halbsiebener wird ein Abschlussball.«
Sonias Gegenwart ließ mich augenblicklich zur Ruhe kommen. Sie war, wenn man von meiner Schwester Ricarda absah, die einzige Verbindung zu meiner Vergangenheit. Wir waren auf dem Gymnasium in dieselbe Klasse gegangen und sie kannte meine Geschichte. Nach der Schule hatten wir uns etliche Jahre aus den Augen verloren, dann trafen wir uns zufällig und kurz nacheinander auf drei verschiedenen Beerdigungen wieder. Seitdem sahen wir uns regelmäßig. Immer auf dem Friedhof. Ich, weil ich dort arbeitete, sie, weil sie gern dort hinging.
Ich fand schnell heraus, dass Sonia Bestattungen nicht etwa wegen der Verstorbenen besuchte, sondern einfach so. Ich störte mich nicht daran. Sonia gehörte zu den Menschen, die sich auf die Begräbnisse fremder Leute mogelten, um dort ungestört und in aller Öffentlichkeit das eigene Leben beweinen zu können. Es gab in München nicht wenige davon.
Nachdem wir eine Weile schweigend dagesessen hatten, siegte Sonias Neugier: »Was meinte Berger eben damit, Marten? Was ist ein Abschlussball?«
»Das ist etwas, das Leute wie du und ich aufgrund unserer mangelnden Teilnahme am richtigen Leben nicht kennen.«
Sie sah mich missbilligend an. »Du hast ja keine Ahnung. Im Gegensatz zu dir habe ich in meiner Jugend sehr wohl einen Tanzkurs besucht.«
»Dann weißt du ja Bescheid.«
»Auf den Abschlussball bin ich nicht gegangen. Mein Tanzpartner …« Sonia sprach nicht weiter.
»Wer war denn dein Tanzpartner?«, fragte ich.
»Das sage ich dir erst, wenn du mir erzählst, was Berger gemeint hat.«
Ich nickte. Warum sollte ich Sonia auch nicht von den raren Höhenpunkten, die mein Dasein als Beerdigungsmusiker bot, erzählen? Da sie zweifellos den ganzen Tag hier, zwischen den Grabsteinen, verbringen würde, würde sie es ohnehin mitbekommen.
Ob sie sich vorstellen könne, wie die Beerdigung eines Hartz-IV-Empfängers ohne Angehörige oder eines einsamen Obdachlosen ablaufe, fragte ich. Sie konnte es nicht. Also erklärte ich ihr, wie teuer eine Beisetzung durchschnittlich war und wie viele Menschen diese Kosten unmöglich aufbringen konnten, erzählte ihr von den Tausenden Armenbegräbnissen, die Jahr für Jahr in der Stadt stattfanden, erläuterte ihr den Unterschied zwischen einer ordnungsbehördlichen und einer Sozialbestattung, berichtete ihr von der Willkür der Behörden, von anonymen Gräbern und von Beerdigungen ohne jede Würde und Publikum. »Der Tod ist für diese Menschen die Fortsetzung dessen, was zu Lebzeiten mit ihnen geschehen ist.«
Dann erzählte ich ihr, dass es sich Berger schon seit langem zur Aufgabe gemacht hatte, diesbezüglich Abhilfe zu schaffen, erzählte, wie er immer wieder die Ämter abklapperte, wie er auf Veranstaltungen und in Foren um die Wiedereinführung des Sterbegeldes und für eine bessere Bestattungsvorsorge stritt, wie er sich darum kümmerte, dass es auch auf den Armenbegräbnissen Redner und Musik gab, und wie er Essen und Trinken organisierte, weil allein das oft genügte, um Publikum anzuziehen.
»Ich habe nicht die leiseste Ahnung, woher er die Energie nimmt, Sonia, und vor allem das Geld. Da gibt es irgendwelche Stiftungen und auch reiche Privatpersonen. Manchmal glaube ich, Berger verdient nicht schlecht daran, auf jeden Fall spielen wir ziemlich oft auf solchen Abschiednahmen und es sind nicht die schlechtesten.«
»Und ein Abschlussball?«, insistierte Sonia.
»Ein paar Mal im Jahr lädt Berger groß ein. Wenn er ausreichend Geld zusammengetrommelt hat, engagiert er ein Catering-Unternehmen, das hinter der Halle einen Stand aufbaut. Es gibt gutes Essen, Bier und Wein. Wir machen vor und nach der Grablegung Musik, im Sommer wird getanzt, es ist das reinste Spektakel.«
»Das ihr Abschlussball nennt.«
»Richtig.«
»Schöner Name.« Sonia legte ihre Hand auf meinen Arm. »Und so ein Abschlussball findet also heute Abend statt?«
Ich bejahte und erzählte weiter, dass Berger ein solches Fest gar nicht publik machen müsse, dass die Zukurzgekommenen und Erdabgewandten das allesamt mitbekämen, die Bettler und Grattler, die Nutten, die Diebe, die ungebetenen Gäste. Das komplette Lumpenproletariat putze sich heraus und gebe sich die Ehre. Sich einmal wieder richtig satt essen, sich betrinken und feiern, darum gehe es.
»Und weißt du, um wen es nicht geht? Um den, der begraben wird. Bei einem Abschlussball geht es ausschließlich um die – um die es sonst nie geht.«
Ich richtete mich auf, aber Sonia hielt mich zurück. »Heute nicht«, sagte sie leise, »heute geht es auch um den, der begraben wird.«
Ich sah sie verständnislos an.
»Ich habe versucht, dich anzurufen«, sagte Sonia, »ich habe dir sogar auf den Anrufbeantworter gesprochen …« Sie hielt inne, dann sagte sie stockend: »Um halb sieben … ist die Beerdigung von Wilhelm Schocht.«
Mehr als ein ungläubiges Kopfschütteln brachte ich nicht zustande. Ich hatte mein Leben in den letzten Jahren derart darauf ausgerichtet, Überraschungen zu vermeiden, dass ich jetzt nicht wusste, wohin mit meinen wirren Gedanken und aufsteigenden Gefühlen. Ich hatte fast alles aus der Schulzeit vergessen oder verdrängt, die meisten meiner Klassenkameraden eingeschlossen, die Erinnerung an Wilhelm jedoch traf mich mit voller Wucht. Wilhelm Schocht, der Wortführer unserer Klasse, der Musterschüler, der Alleskönner, der Mädchenschwarm …
Auch wenn ich es in diesem Moment niemals hätte benennen können, wusste ich doch sofort, warum mich die Erinnerung so bedrängte: nicht weil Wilhelm in so ziemlich allem das exakte Gegenteil von mir gewesen war, sondern weil er (im Gegensatz zu mir) so plötzlich aufgegeben hatte. Kurz vor dem Ende der zwölften Klasse hatte Wilhelm Schocht aus heiterem Himmel die Schule verlassen und war nie wieder aufgetaucht.
»Alles in Ordnung?«, fragte Sonia.
Ich konnte nicht antworten und sah nur auf die Uhr. Die Mittagspause war fast zu Ende und ich war froh, mich zu meiner Trompete flüchten zu können.
7
Ich hatte mich auf einem fast eingewachsenen Bänkchen im blickdichten, der Niebuhrstraße zugewandten Teil des Friedhofs zurückgezogen und dachte nach.
In knapp zwei Stunden würde Wilhelm Schocht zu Grabe getragen werden. Und ich würde spielen. Zum ersten Mal ein letztes Lied für jemanden, den ich kannte. Gekannt hatte. Ob es einen Unterschied machte?
Meine Erinnerung an Wilhelm war mittlerweile klar und deutlich. Ich hatte seinen federnden Gang vor Augen, seine Unbeschwertheit, sein strahlendes Gesicht. Es war das Gesicht eines Jungen, dem alles wie von selbst zufiel, dem alles gelang. Und von einem Tag auf den anderen war dieses Strahlen verschwunden gewesen. Nach der Studienreise (an der ich nicht teilgenommen hatte) war Wilhelm noch eine Woche in die Schule gekommen und dann nie mehr erschienen. Es hatte wilde Gerüchte gegeben: Wilhelm sei auf der Reise ausgeraubt worden. Er habe sich in eine verheiratete Frau verliebt und sei mit ihr durchgebrannt. Sein Vater sei im Gefängnis und er müsse sich um seine Mutter kümmern. Aber das waren Hirngespinste gewesen, Schülergerede, das mit der Zeit verstummte. Ein neuer Klassensprecher wurde gewählt. Die Mädchen suchten sich ein neues Objekt ihrer Begierde. Das Leben ging weiter. Den wahren Grund für Wilhelms Verschwinden hatte niemand herausgefunden und es hatte mich auch nicht sonderlich interessiert.
Trotzdem saß ich nun auf einer Friedhofsbank und zerbrach mir den Kopf. Es ging mir nur mittelbar um Wilhelm, das stand außer Frage, ich hatte ihn gar nicht wirklich gekannt. Außerhalb des Klassenzimmers hatten wir keinerlei Kontakt gehabt und auch in der Schule kaum ein Wort miteinander gewechselt. Es war seine damalige Verweigerung, die mich so beschäftigte, seine irre Konsequenz. Weniger der Mensch interessierte mich als vielmehr seine, wie mir jetzt schien, unerhörte Tat. Einzig Wilhelm hatte seinerzeit einen rigorosen Schritt getan und einfach nicht mehr mitgemacht. Im Gegensatz zu allen anderen. Auch zu mir.
Was mich in diesem Moment plagte, war nicht, dass ich einem ehemaligen Mitschüler zum letzten Geleit spielen sollte, und auch nicht, dass ich dabei aus dem Takt geraten könnte. Was mich plagte, war der Einbruch einer vergangenen Möglichkeit in meine sorgsam gepflegte, beschauliche Gegenwart.
Eine junge, hochschwangere Frau kam den schmalen Weg auf das Bänkchen zu und riss mich aus meinen Gedanken. Sofort sondierte ich meine Fluchtmöglichkeiten. Außer der, sich wie ein auf frischer Tat Ertappter in die Büsche zu schlagen, gab es keine. Die Bank befand sich am Ende einer Sackgasse und dort war es so eng, dass ich nicht an der Schwangeren vorbeikommen würde. Ich würde warten müssen, bis sie mich erreicht hätte, um aufzustehen, ihr dadurch meinen Platz anzubieten und erst dann auf dem Weg wieder ins Innere des Friedhofs gelangen zu können. Ohne einen Blickkontakt oder einen kurzen Wortwechsel würde sich das kaum bewerkstelligen lassen. Vielleicht würde die Frau aber auch rechtzeitig bemerken, dass die Bank besetzt war, und kehrtmachen, aber sehr wahrscheinlich war das nicht. Schwangere beanspruchten allein durch ihr Auftreten jeden sich bietenden Sitzplatz und erhielten ihn widerspruchslos. Zumindest bildete ich mir das ein.
Aber auf der Suche nach einer Sitzgelegenheit konnte sie eigentlich nicht sein, es gab bessere und schönere auf dem Nordfriedhof, vor allem welche, die weniger abseits lagen. Die Frau konnte diesen Weg nur zufällig eingeschlagen haben, das Bänkchen lag so versteckt, dass nur wenige davon wussten. Im Sommer übernachtete hier oft ein Obdachloser. An heißen Tagen wie heute hielt sich hartnäckig sein Geruch über dem Bänkchen, der Geruch nach altem, ungewaschenem Mann. Er rührte von den Tüten mit seinem Schlafsack und seinen Habseligkeiten her, die er in unmittelbarer Nähe im Gestrüpp verborgen hielt. Mich störte der Geruch nicht, aber es war klar, dass die schwangere Frau gar nicht anders konnte, als ihn mit mir in Verbindung zu bringen. Mein ordentlicher schwarzer Anzug würde wenig helfen, für die Frau würde unweigerlich ich es sein, der sie mit dem Gestank von Alter und Verfall belästigte.
Schon legte die Frau ihre Hände schützend auf ihren Bauch, eine Geste, die ich bereits oft bei Schwangeren beobachtet hatte und bei der ich mir jedes Mal vorstellte, die werdenden Mütter hielten so den in ihnen wachsenden Kindern die Augen zu. Oder die Ohren. Hör weg, Kind! Sieh nicht hin! So wie der sollst du nie werden! Ich bewahre dich davor!
Ich schämte mich meines Unbehagens, kam aber nicht umhin: Schwangere schüchterten mich ein, sie waren so raumgreifend, so proper und rein. Ich fürchtete mich vor ihrer Zukunftsversessenheit. Sie waren prall gefüllt mit Lebenslust und hatten stets diesen Ausdruck von durch nichts zu erschütternder Rechthaberei. Ich bin das Leben und du dem Tod geweiht, schienen sie in einem fort zu sagen, und jetzt mach Platz!
Die junge Frau hielt inne und suchte meinen Blick.
Sie hob kurz ihre Hand, drehte sich um und ging.
Nur wenige Minuten später erschien Sonia. Als sie sich setzte, rümpfte sie die Nase. Ich deutete auf die beiden Plastiktüten des Stadtstreichers im Gebüsch.
Nach einer Weile sagte sie: »Ich glaube, außer uns beiden wird niemand zu Wilhelms Beerdigung kommen. Niemand von früher, meine ich.«
Ich fragte, wie sie darauf komme, und sie erzählte mir, dass ihr Wilhelms Tod keine Ruhe gelassen habe und sie deswegen recherchiert, aber nicht das Geringste herausgefunden habe. Es gebe keinen Eintrag für »Schocht« im Telefonbuch, keine Meldeadresse, einfach nichts. Noch nicht mal im Internet habe sie etwas über Wilhelm finden können, es existiere kein Profil in irgendeinem der sozialen Netzwerke und selbst die Namenssuche bei Google habe keinen einzigen Treffer ergeben, so etwas müsse man erst mal schaffen. Als ob es ihn nicht gäbe, nie gegeben habe.
Wie sie denn überhaupt von seinem Tod erfahren habe?
Durch Zufall, aus der Zeitung. Sonia kramte in ihrer Handtasche, zog einen Ausriss aus der ›Süddeutschen‹ hervor und zeigte ihn mir.
Es war die kleinste und kürzeste Todesanzeige, die ich je gelesen hatte.
»Wilhelm Schocht ist tot.«
Darunter waren in kleineren Lettern Ort und Zeitpunkt der Beisetzung genannt. Ich las die Anzeige mehrmals durch, als läge irgendein tieferer Sinn darin verborgen.
»Mehr steht da nicht, Marten.«
Ich gab ihr das Stück Zeitung zurück.