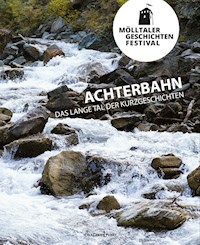
Achterbahn E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Anton Pustet
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mölltaler Geschichten Festival
- Sprache: Deutsch
Ein Auf und Ab ist das Leben … Als das Mölltaler Geschichten Festival im letzten November "Achterbahn" als Thema für seinen jährlichen Kurzgeschichtenwettbewerb auswählte, war niemandem klar, wie sehr die Hochschaubahn symbolisieren würde, was wir momentan gerade erleben. Für Autorinnen und Autoren aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Italien war die "neue Normalität" jedoch Anreiz, die verschiedensten Stadien der Achterbahn des Lebens zu ergründen. Und so sammeln sich nun in diesem Buch Kurzgeschichten von falschen und richtigen Dilemmas, mörderischen Chancen, unglaublichen Eventualitäten, ungestümen Beziehungen und nicht zuletzt von der Überwindung der Angst vor der Achterbahn. Das Mölltaler Geschichten Festival, ein kleines, feines Oberkärntner Literaturfestival, widmet sich seit mittlerweile fünf Jahren deutschsprachigen Kurzgeschichten – und zwar solchen, die sich durch Erfindungsreichtum und Wortgewandtheit auszeichnen und den Mut haben, Grenzen zu sprengen. Die besten Geschichten werden jedes Jahr im Rahmen von Lesungen präsentiert und in einer Anthologie zusammengefasst. Weitere Informationen: www.moelltaler-geschichten-festival.at
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2021 Verlag Anton Pustet
5020 Salzburg, Bergstraße 12
Sämtliche Rechte vorbehalten.
Herausgeber: ProMÖLLTAL
Lektorat: Martina Schneider
Grafik und Produktion: Nadine Kaschnig-Löbel
Coverfoto: „Astenbach“ mit freundlicher Genehmigung von Tobias Wandtke (www.fotografie-wandtke.de)
„Das lange Tal der Kurzgeschichten“ mit freundlicher Genehmigung von Sabine Seidler
auch als gedrucktes Buch erhältlich: ISBN 978-3-7025-1013-8
eISBN 978-3-7025-8082-7
www.pustet.at
ACHTERBAHN
DAS LANGE TAL DER KURZGESCHICHTEN
INHALT
VORWORT
SENDERWECHSEL MICHAELA HASSLACHER
350 KILOMETER KURT FRISCHENGRUBER
DIE BLAUEN ROSEN MARCEL ZISCHG
2069 HELMUT LOINGER
HABEN SIE ANGST VOR WOLLMÄUSEN? BETTINA SCHNEIDER
MONSTERPRÜFUNGEN UND MÜLLPAPIER MARKUS GRUNDTNER
FLÜCHTIG VERONIKA BUCHER-ZIRKNITZER
HANNAH UND DIE ELEFANTEN EVA WOSKA-NIMMERVOLL
SAFE CROWD© DAVID JACOBS
FRITZ MUSS WEG! EDITH ANNA POLKEHN
NACHWEHEN NICOLE MAKAREWICZ
NAHE DER STADT MANUEL HÖRBIGER
DER WÄCHTER BENEDICT FRIEDERICH
UNTER DER ACHTERBAHN MONIKA LOERCHNER
SPÜRST DU DAS AUCH? ANKE ELSNER
DIE ENTSCHEIDUNG ELFRIEDE ROJACHER
DAS PRINZIP HOFFNUNG CORINA LERCHBAUMER
WIR HATTEN ES SO GENAU SUSANNE AXMANN
FÜR SIE MARIELIES SCHMID
ROLLING STONES RAINER GUZEK
IM NAMEN DER ELSTER ANNA FERCHER
FALSCH SEBASTIAN WOTSCHKE
EINER SABINE IBING
GHOSTWRITER FLIEG! WOLFGANG MACHREICH
SCHMERZHAFTES INTERVALL DORINA MARLEN HELLER
EINSTICHSTELLEN OLIVER BRUSKOLINI
EIN MOMENT. JULIA MAGDALENA NAGY
(K)EIN LIEBESROMAN OHNE HAPPY END STEFANIE IVAN
IM RAUSCH ANNA-MARIA BAUER
ALLE SIEBEN SEKUNDEN RAOUL EISELE
ACHTERBAHNFAHRT IN DIE VERGANGENHEIT KATHARINA WEISS
HERR LEHRER MAIER ALEXANDER ZWISCHENBERGER
LETZTE FAHRT KARIN LEROCH
NACHWORT
VORWORT
Was für ein Jahr, dieses Jahr der „Achterbahn“. Ein Jahr, in dem mikroskopisch kleine Reisende eine tiefgreifende, folgenreiche Wirkung auf die gesamte Welt ausübten. Die sich wiederum mit einer vehementen Verteidigung wehrte, die viele Leben in ungeplante und unplanbare Richtungen trieb, links, rechts, rauf, runter, wie auf einer schienenlosen Achterbahn ohne Auffangnetz und ohne Zielbahnhof.
Ein Jahr aber auch, das viele Menschen bewog, das aufgezwungene Exil zu nutzen, um innezuhalten und ihr Leben zu betrachten. Und vielen Autorinnen und Autoren die Zeit gab, sich der grenzenlosen Welt der Kreativität zu öffnen und ihre Einfälle niederzuschreiben.
Hier sind einige der besten davon …
Viel Vergnügen auf der Achterbahn!
SENDERWECHSEL
MICHAELA HASSLACHER
Seit Kottingbrunn schon brummt dein Schädel. Tock … Tock … Tock … Trotzdem spielen deine Finger Duracellhase, tacktacktacktacktack klackern die Tasten deines Notebooks. Harry neben dir auf dem Fahrersitz, nur eine Hand am Lenkrad. Ein Fahrstil wie ein Windhund auf Speed. Harry, ich bitte dich.
Das Problem ist, du brauchst diese Story. Du brauchst sie so dringend wie der Blinde seinen Hund. Eigentlich alles völliger Blödsinn, aber ob das völliger Blödsinn ist, das entscheidest nicht du, sondern Mark Bauer. Mark Bauer ist nämlich Gott. Mark Bauer – nicht der, der die Welt versteht, sondern der, der sie macht. Mark Bauer, der Unterhaltungschef. Mark Bauer, dein verdammter Redaktionsleiter. „Wie lange noch?“, fragst du Harry, ohne von deinem Notebook aufzuschauen. „Noch fast drei Stunden“, nuschelt er. Harry steigt aufs Gas und du wirfst dir ein Schmerzmittel ein.
Mark Bauer hat früher Avantgarde gemacht. Filme, die von Menschen handeln, die ihren Kopf zum Frühstück verspeisen. Gedreht in Schwarzweiß oder Neonfarben. Dann aber hat Spy TV zugeschlagen und ihn gekauft. Seitdem vergiftet Mark Bauer dein Leben. „Ideen, Leute. I-DE-EN“, schreit er quer durch die Redaktion und schiebt seine schwarze Panto-Brille zurecht. Manchmal aber will Mark Bauer einfach nur spielen.
Er nennt sie Magic Box. Eine Schachtel, bis obenhin mit Zetteln gefüllt. Auf den einen stehen Begriffe wie Burnout, Katzenzunge, Schraubenzieher oder Pankreaskarzinom, auf den anderen Orte. Paris, Costa Rica, Sichuan, Sankt Hintertupfing. Und dann musst du ziehen. Wenn du Glück hast, darfst du über den Wohnpark Alt-Erlaa in Liesing drehen. 11 000 Einwohner, 250 000 Quadratmeter, über 3 000 Wohnungen – Satellitenstadt. Oder du gehst auf das Bezirksgericht Eggenburg, Nachbarschaftsstreit. Das ist das Kleine Sozialreportagenredakteurseinmaleins.
Er also in Spiellaune und du hast ziehen müssen. ACH-TER-BAHN. Das Wort heißt Achterbahn! Puls sinkt auf Normallevel. Wahnsinn, denkst du dir. Das ist ein Hammerthema. Adrenalinjunkie, Weltrekord, Gefühle und so weiter und so fort. Action in voller Fahrt. Das schreit schon fast nach Grimmepreis. Fehlt dir also nur noch der Ort. Du greifst in die Box und … hältst das Mölltal in den Händen. Puls rast nach oben. Mark Bauer zwirbelt seinen Salvador-Dalí-Gedächtnisbart und lächelt dir ins Gesicht. Ja, mein Herz, Achterbahnen stehen im Disneyland, im Prater oder im Six-Flags-Great-Adventure-Park in den Vereinigten Staaten.
Doch es hilft alles nichts. Mark Bauer ist Gott. Deshalb schließlich sitzt du neben Harry im Dienstwagen. Noch immer klopfst du in das Notebook, denn Mark Bauer hat dich ja von der Leine gelassen. Tacktacktacktack-tack. „Wie lange noch?“, fragst du Harry und massierst deine pochenden Schläfen. Er grunzt und drückt aufs Gas. Harry, verflixt. Noch eine Stunde bis zum Mölltal. In 60 Minuten musst du wissen, wovon deine Achterbahnstory handelt. Bald, ganz bald, muss der Kettenhund knurren. Tack-tacktacktacktack.
Natürlich hast du auch schon von Wien aus recherchiert. Du hast telefoniert. Mit dem Bürgermeister und dem Dorfwirt. Du hast Social Media strapaziert. Du hast im Senderarchiv geschwitzt. Du hast mit Kollegen debattiert. Aber das Mölltal ist nicht Favoriten. Auch nicht Neukölln oder Detroit, wo es vielleicht manchmal bergauf, aber vor allem steil bergab geht. Dort ist das Leben ein Möbiusband, eine stählerne Unendlichkeitsschleife, die zu Orientierungslosigkeit führt wie die Quarterlife Crisis oder der Rückwärtsgang bei Mario Kart. Nein, das Mölltal ist nicht Tijuana.
Dieses Mal schaust du selbst aufs Navi. Noch 15 Minuten auf der Drautalstraße, dann die Gabelung nach Möllbrücke. Schon fast vier Stunden im Auto. Harry gähnt. Da knallst du dein Notebook auf die Rückbank, hinten im Kofferraum scheppert die Kamera, das allwissende Panoptikum. Kapitulation.
Nun. Links Berge, rechts Berge, dazwischen die Möll. „Wohin, Boss?“, fragt Harry. „Geradeaus“, sagst du aufs Geratewohl. Harry gibt Gas. Du schaust nach draußen. Landluft, nichts als Landluft, denkst du und knetest deinen Nacken. Und da geschieht es: Harry biegt ab. Neunzig Grad von der Bundesstraße, ein geschotterter Weg ins Nichts. „Harry?“, fragst du überrascht. Harry gibt Gas und sagt nichts.
Der Weg verwandelt sich in Schlangenlinien. Du schaust auf das Navi. Kein Satellitenempfang. Kein Satellitenempfang. Kein Satellitenempfang. „Was zum ..?“, willst du fragen. Doch Harry brettert die Kurven entlang. Schlagloch um Schlagloch um Schlagloch. Die Kamera scheppert im Kofferraum. Kopfschmerzen heiraten Übelkeit. „Harry!“, brüllst du, dann drückst du deine Hand gegen deinen Mund. Schlagloch um Schlagloch um Schlagloch. „Achterbahn“, sagt Harry und grinst. Gar nicht dein Humor. „Bleib stehen“, schimpfst du. Harry knallt auf die Bremse, Schotter fliegt in alle Himmelsrichtungen, Reifen graben sich in den Boden.
Du reißt die Beifahrertüre auf und steigst aus. Landluft, nichts als Landluft. Meine Güte. Du knetest deinen Nacken und atmest ein. Landluft, nichts als Landluft, sonst nichts, einfach nichts. Du schaust über das Tal, dein Magen tanzt und hier kommst du nicht weiter. Also stapfst du los, den Schotterweg entlang. „Boss?“, fragt Harry und schaut aus dem Autofenster heraus.
Harry fährt im Schritttempo hinter dir her. Rumpeln in jedem Schlagloch, du aber steigst um jedes Einzelne herum. Die Landluft vertreibt langsam die Übelkeit, doch dein Sozialreportagenredakteursproblem nicht. Du gehst weiter, atmest ein und aus und das geht lange so.
Dann plötzlich. Hinter einer Schlaglochkurve eine eingezäunte Wiese. Du kneifst die Augen zusammen. Wattebäusche. Viele Wattebäusche. Du bleibst stehen, Harry hinter dir auch, beugt sich aus dem Fenster. „Das sind Brillenschafe. Kärntner Brillenschafe“, sagt Harry. Du kneifst deine Augen noch ein wenig mehr zusammen. Auch die Wolltiere beobachten dich durch ihre schwarzen Gläser. Nun geschieht lange nichts.
Doch dann flüstert du plötzlich: „Avantgarde, wir machen jetzt Avantgarde.“ Vor dir fahren Wattebäusche Achterbahn.
Harry packt seine Kamera aus. Sein Lächeln hinter der Kofferraumklappe siehst du nicht.
Michaela Hasslacher
Die waschechte Salzburgerin, mit starkem Hang zum Bezirk Spittal an der Drau, hat einen brotlosen Abschluss in Germanistik, verdient aber dennoch ihre Brötchen damit: Sie schreibt Presseaussendungen, Werbetexte oder Einkaufszettel, und treibt ihre Mitmenschen mit der korrekten Verwendung von Bindestrichen in den Wahnsinn. Hin und wieder gibt es aber auch verzweifelte literarische Versuche, die im hintersten Festplatteneck versauern. Diesmal aber nicht.
350 KILOMETER
KURT FRISCHENGRUBER
„Scheiß Wiena!“, schrie er erregt, mit hochrotem Kopf und tropfender Nase mitten hinein in die gemächlich dahinflanierende Menschenmenge auf der sanft von der Nachmittagssonne verwöhnten Wiener Kärntner Straße. Eine gefühlte Ewigkeit lang hatte er sein Bestes gegeben, hatte alles aus seiner alten Gitarre und seinen Stimmbändern herausgequetscht. Ohne Erfolg. Kein Schwein hatte sich für seine Darbietungen interessiert. Aber jetzt stockte die Menge sofort. Im Nu formierte sich ein gaffendes Menschenknäuel um den unscheinbaren Straßenmusikanten mit dem markanten Flinserl im Ohr. Ebenso schnell förderte die anschließende, lautstarke Diskussion die Herkunft des Schreiers zutage, denn der machte keine Anstalten seinen markanten Südstaaten-Dialekt vor der wachsenden Schar an Neugierigen zu verbergen. „Scheiß Wiena, oba echt! Olls lei Plattla!“
„Heast, gusch Oida!“ und „Wos is Gscheada, wuist a Uhrfeign?“, drang es alsbald ziemlich aggressiv aus besagter Menge zurück. Zwei leere Plastikbecher kamen geflogen, verfehlten ihr Ziel nur um Haaresbreite. Grund genug für den Schreier, den geordneten Rückzug anzutreten, weil man wusste ja nie. Hastig verstaute er sein Instrument und trabte leicht schwitzend in Richtung Graben davon. Keine Verfolger in Sicht. „Scheiß Wiena, oba die Oma hot mi eh imma gwarnt davor“, grummelte er und dachte an früher.
Vor wenigen Wochen erst hatte er eine völlig andere Richtung eingeschlagen auf seiner Achterbahn des Lebens. Vor wenigen Wochen erst hatte der überzeugte Südländer alles zurückgelassen, was ihm bisher so wichtig erschienen war, so selbstverständlich, so gesund und munter, so tagtäglich.
Die heimatliche Scholle, seine noch taufrische Freundin, Vater, Mutter, Geschwister, Freunde, Saufkumpane, seine geliebte Oma und ihre von Hand gegrendelten Kasnudeln, seinen akut abstiegsgefährdeten Fußballverein, den gemischten Chor, die Volkstanzgruppe, die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr und sein Stammlokal. All das war jetzt plötzlich 350 Kilometer weit weg. All das hatte er zurückgelassen, um bei den „Großkopfatn draußn in Wien“ mittels Publizistikstudium für das weitere Leben gewappnet zu sein, aber auch um diesen arroganten Hauptstädtern zu zeigen „wo a echta Kärntna Bartl den Most holt!“
Ein Kulturschock. Eigentlich ein regelrechtes Kulturerdbeben, ja ein Kulturtsunami. Alles war in weite Ferne gerückt, trotzt moderater Bahnverbindung und Südautobahn. Die weit aufragenden Gipfel, das kleine Haus der Eltern am Waldrand, die schon fast kitschig schönen Seen und Teiche in der Umgebung, die Sonnenölflecken der Sommerfrischler im örtlichen Schwimmbad und die alte Scheune am Wiesengrund, in welcher er damals zum Manne gereift war. War doch irgendwie schön gewesen das alles, aber seine Hochschaubahn-Fahrt durch das Leben ließ sich nicht aufhalten, wie es schien. Jetzt ging es ganz einfach darum, nicht aus der Bahn geworfen zu werden. Schon wegen der Oma.
Gut, weibliche Wesen gab es in dieser Stadt wie Sand am Meer. Viel mehr, als er sich erträumt hatte. Viel mehr als zu Hause.
Aber sein bisher so unverwechselbarer Charme, sein urig-folkloristisches Gebirgsjäger-Charisma, sein ländlich-rustikaler Überschmäh? Alles schien plötzlich wie weggeblasen. Fast hatte es den Anschein, als müsste er sein schwer erkämpftes Landmacho-Image völlig neu konzipieren. Einsame Scheune am Wiesengrund gab es erst recht keine weit und breit, schließlich gab es ja auch keinen Wiesengrund und seine karge Studentenbude am Reumannplatz teilte er sich mit zwei Leidensgenossen. Eine sturmfreie Bude sah anders aus.
Autos und Häuser, Häuser und Autos. Völlig überfüllte Straßenbahnen, U-Bahnen und Busse inklusive ihrer ewig grantigen Insassen, ein Gewirr aus unverständlichen Sprachen und Dialekten, ein Sammelsurium aus Individuen, Hautfarben und Gerüchen. Sogar echte Burgenländer hatte er schon ausgemacht. „Olta!“
Der infernalische Lärm der städtischen Mistkübelausleerer in aller Herrgottsfrühe, dieser penetrante Großstadtgeruch aus zu viel Verkehr, zu vielen Menschen und zu viel Bruttosozialprodukt. Ach ja, und enorme Mengen an Hundekot. Hundekot auf Schritt und Tritt, Hundekot in den Parks und auf den Gehsteigen, Hundekot einfach überall.
Diese abgefuckten No-Future-Typen auf den Parkbänken und diese dickbäuchigen Kontrolleure, die er trotz gültiger Jahresnetzkarte (finanziert von der Oma) jedes Mal für russische KGB-Agenten hielt.
Zucker im Salat, ach du meine Güte, Cäsium in den Sandkästen und dieses animalische Geruchs-Potpourri aus Wiener Schnitzeln, Käsekrainern, Bier, Kotze und Kanal.
Die dreckig-graue, blaue Donau, die bröckelnde Fassade des Steffl und die zu dick aufgetragene Schminke der Gürteldamen, zu denen er auch kein Naheverhältnis aufbauen wollte. Für die Liebe bezahlen? „So a Schaß!“
Lauter bauchspeckschwabbelnde Nackerte in der Lobau und auch das Ausweichbad Gänsehäufl war nichts anderes, als ein überdimensionaler Lagerplatz für Hausmeister-Verschnitte mit Kühltasche in der Hand und Heißluft im Hirn.
Wie auf einer Achterbahn eben, denn vor Kurzem hatte er mit seinen Freunden noch in den glasklaren Fluten der Möll gebadet.
Ja und dieser Straßenverkehr. Absolut lebensgefährlich für einen, der bisher auf die beschaulichen Verkehrsverhältnisse eines 1 000-Seelen-Ortes eingeschworen war, ohne eine einzige Ampel und ohne einen einzigen Kreisverkehr.
Die Tage kamen und gingen. Manche Kurven seiner Hochschaubahn erschienen ihm durchaus befahrbar, bei manchen musste er sich ganz schön festhalten, um nicht aus der Bahn geschleudert zu werden. Manchmal ließ es sich auch nicht vermeiden, kräftig auf die Bremse zu steigen.
Und dann trat sie auf den Plan. Wie aus dem Nichts. Eigentlich wollte sie sich ja lediglich eine Zigarette schnorren, doch der etwas verstört wirkende junge Kerl, der da einsam und verlassen in der U-Bahn-Station Arbeitergasse herumlümmelte, war ihr irgendwie sympathisch, verbreitete er neben einem mittelschweren Schweißgeruch irgendwie auch das Flair eines echten Exoten. Ja, und auf ihr hübsches, kess geschminktes Schnäbelchen war sie auch nicht gefallen. Echtes Wiener Kind aus Simmering eben.
Aber „gut Ding“ braucht ja bekanntlich „Weile“ und so entwickelte sich das weiblicherseits durchaus charmant angezettelte Gespräch über das anhaltende Schlechtwetter der letzten Tage nur langsam und bis auf ein paar spärliche Bemerkungen, dass es im Süden Österreichs jetzt wesentlich sonniger sei, war dem Jeansjackenträger nicht viel zu entlocken. Immerhin war er aber ohne lange zu überlegen bereit, drei weitere Smart-Export unters Volk zu werfen, obwohl ihn seine Großmutter damals ausdrücklich vor diesen arroganten, oberflächlichen „Großstadtschicksn“ gewarnt hatte. „Tua nur nit hudln Bua, schon gor nit bei die Weiba!“
Das Gesprächsklima lockerte sich, als die beiden am Abend durch das berühmt-berüchtigte Bermuda-Dreieck bummelten. Perplex musste er feststellen, dass man sich mit diesen arroganten Wienerinnen durchaus angenehm unterhalten konnte. „Heast Oma!“
Das Ottakringer mundete vorzüglich und lies sogar sein für unschlagbar gehaltenes Hirter gedanklich in der Versenkung verschwinden. Die Distanz zwischen den beiden nahm ab, kein Wunder also, dass er diese Nacht endlich einmal ohne seine WG-Kollegen verbringen durfte. Ein echter Meilenstein, ein historischer Richtungswechsel auf seiner persönlichen Achterbahn.
Und es kam, wie es kommen musste. Seine ohnehin seltenen Unibesuche wurden noch seltener, die Zahl der Beisel-Besuche kletterte nach oben und seine Bekanntschaften mehrten sich.
Die neue Wohnung im Fünften war zwar kleiner, dafür teurer, aber endlich eine sturmfreie Bude in Hinblick auf die Zwischenmenschlichkeit. Das Bild seiner Oma an der Wand hat er bei solchen Gelegenheiten eben einfach umgedreht.
Sein Interesse an den Sorgen und Nöten einer Großstadt im Herzen Mitteleuropas wuchs. Überrascht stellte er fest, dass sich schon einige Wiener Brocken in seinen ansonsten noch immer unnachahmlichen Dialekt gedrängt hatten und dass sich auch seine allgemeinpolitische Denkweise ein wenig ins Liberale änderte, was immer das auch sein mochte. „Tschuldige Oma!“
Nach einiger Zeit verlegte er seinen ordentlichen Wohnsitz vom sonnigen Süden in die Bundeshauptstadt, schließlich wollte er an den wichtigen politischen Entscheidungen in dieser Stadt zumindest passiv mitmischen. Logisch, dass sein erster beinahe selbstständig finanzierter Flitzer (Anteil der Oma eher gering) zwar alt und durchgerostet war, dafür aber ein schlichtes W an beiden erheblich verbeulten Stoßstangen trug, was ihn durchaus mit Stolz erfüllte. Auch wenn er als Gegenpart einen leicht vergilbten Aufkleber mit der Aufschrift Kärntner schnackseln besser! auf die Kühlerhaube geklebt hatte.
Keine zwei Wochen später nahm er seinen ersten Kredit auf und als untrügliches Zeichen seines mittlerweile erlangten Wohlstandes zierte eine nagelneue Waschmaschine seine Zwei-Zimmer-Wohnung, mit der er manchmal sogar die Schmutzwäsche seiner häufig wechselnden Gesprächspartnerinnen wieder auf blütenweiß trimmte.
Bei seinen seltener werdenden Besuchen im Süden beschränkte sich seine Kommunikation mit den Eingeborenen mit der Zeit auf banale Aussagen zum aktuellen Wetter oder noch häufiger auf „a Runde geht noch, oba ex!“, während er sich an der Theke seines neuen Stammbeisels in der Gumpendorferstraße schon eifrig in die Diskussionen des Tages einbrachte.
Immer häufiger ertappte er sich dabei, ein forsches „echt leiwand“ in die Runde zu schleudern, ohne gröberes Aufsehen zu erregen. Die sensationelle Erkenntnis, dass zwischen einem Zeltfest der Freiwilligen Feuerwehr und einer Darbietung im Raimundtheater ein gewisser kreativer Freiraum existierte, verdankte er einer Beziehung zu einer Studienkollegin von der theaterwissenschaftlichen Fraktion.
Der überraschende Besuch von Oma, Mama und Papa bescherte ihm neben einer blitzblank geputzten Wohnung auch eine eindringliche Ermahnung, seine universitätsmäßigen Ambitionen nicht so schleifen zu lassen. In Verbindung mit der hinter vorgehaltener Hand ausgesprochenen Drohung, widrigenfalls die väterlichen beziehungsweise großmütterlichen Zuwendungen überhaupt einzustellen. Zumal speziell seine Oma nicht im Entferntesten daran dachte, wertvolles Familienkapital für das Waschen von fremden Büstenhaltern zu vergeuden.
Seine kulturelle Beziehung platzte aufgrund eines übervollen Terminkalenders seitens der Beziehung, eine blondgelockte Strandschönheit aus der Donaustadt sorgte allerdings schnell für Ersatz.
Ein gehöriger Schock und ein darauffolgender Jahrhundert-Rausch folgten wenige Monate später in Verbindung mit einem Schwangerschaftstest. Der Aufkleber Kärntner schnackseln besser! wurde entfernt. Weitere acht Monate und zahlreiche Beiselbesuche später erhöhte sich die Geburtenanzahl in der Metropole aller Österreicherinnen und Österreicher um ein weiteres Menschenkind. Achterbahn eben. Der euphorisierte Ex-Provinzler war live dabei, als sein erster Sohn im AKH das Licht der Wienerstadt erblickte, welcher seine südländischen Wurzeln durch kräftiges Schreien eindrucksvoll demonstrierte und vom überglücklichen Erzeuger dennoch voll Stolz als echter Wiener bezeichnet wurde.
Das hochoffizielle Wien gratulierte mittels Bürgermeister-Brief und beigelegter Infobroschüre über die Gesundheits- und Sozialeinrichtungen der Stadt.
Wieder wechselte die Wohnung und wurde größer. Die Uni sah er nur noch von außen, ein zukunftssicherer Job bei den Wiener Städtischen Verkehrsbetrieben sorgte längst für die nötige finanzielle Absicherung inklusive Freifahrt für den Rest der Familie.
Seine so mit der Zeit auf die Zahl drei angewachsene Kinderschar verbrachte die großen Ferien zumeist bei den Großeltern im Süden. Gemeinsam besuchte man dann und wann auch das Grab der Uroma.
Das Bäuchlein des Familienvaters mutierte zu einem gestandenen Bauch. Der letzte noch vorhandene Trachtenanzug wurde zu eng und nicht mehr ersetzt. Immer häufiger ertappte er sich dabei, einen südländischen Brocken in diverse diskutierende Runden zu schleudern, ansonsten erschien seine Mischung aus versuchter Hochsprache und Wiener Slang akustisch durchaus akzeptabel.
Und als eines Tages auf der Kärntner Straße wieder einmal einer dieser frisch dahergelaufenen Karawankenindianer (Dunkelziffer 50 000 bis 70 000) in einem Anfall von geistiger Umnachtung ein deftiges „Scheiß Wiena!“ in die gemächlich dahinflanierende Menge schleuderte und sich nach kurzer Diskussion in Richtung Graben davonmachte?
„Sicher ein Frischling!“, dachte sich der mitflanierende Familienvater, ohne sich groß aufzuregen. „Ur-Cool, echt leiwand, lei lossn!“
Kurt Frischengruber
Der ausheimische Mölltaler war im Lauf seiner beruflichen Karriere u.a. Geschäftsführer und Creativ Director renommierter Werbeagenturen, Journalist, Texter, Songwriter und Autor, aber auch mehrere Jahre als Seemann auf allen Weltmeeren unterwegs. Jetzt ist er wenigstens nach Klagenfurt heimgekehrt. Seine Veröffentlichungen inkludieren Kinderbücher und Kriminalromane („Das Waschbrettbauchmassaker“, „Blutige Kampagne“, und „Tödlicher Chatroom“ – alle Echomedia-Buchverlag). Publikum und Fachjury, nachfühlend, wählten seine Kurzgeschichte auf den 2. Platz des Mölltalpreises.
DIE BLAUEN ROSEN
MARCEL ZISCHG
Biologiestudent Vittorio ist im Zug von Vicenza nach Padua unterwegs, um ihr, wie in jedem November, eine Geburtstagskarte zu überbringen. Jedes Mal ist ihm dabei, als würde sein Herz in eine Achterbahn steigen, und er fühlt vor Aufregung eine leichte Übelkeit.
Er will nicht, dass Karte und Blumen per Post zugestellt werden. Er hat einen Strauß blauer Rosen mitgebracht, denn er erinnert sich: Damals hat sie blaue Rosen geliebt. Vittorio weiß auch noch, wo sie in Padua wohnt und dass sie inzwischen Medizin studiert.
Am Bahnhof angekommen, nimmt er sich ein Taxi zum Prato della Valle. Es ist schon dreiviertel sechs und dunkel. Während der Fahrt durch die abendlichen Straßen erinnert er sich: Er hat sich als Teenager in der Oberschule in sie verliebt. Sie hatte langes, schwarzes Haar, und sie trug es immer glatt und offen. Wenn sie lächelte, sah ihr Gesicht aus, als gäbe es nichts Aufrichtigeres als dieses Lächeln; es spiegelte Güte und Bescheidenheit wider. Doch wirklich gekannt hatte er sie eigentlich nicht, denn sie war in eine Parallelklasse gegangen und er hatte ihr nie seine Gefühle gestanden. Tatsächlich hatte er auch nie ein Wort mit ihr gesprochen, obwohl er sie oft auf Partys gesehen hatte. Aber wenn er sie erblickt hatte, war er niemals mutig genug gewesen, sie anzusprechen.
Die anonyme Glückwunschkarte jedoch muss er ihr nun alljährlich bringen. Inzwischen ist sie schon Ende zwanzig, ebenso wie er selbst, und ihr Lächeln auf den Bildern, die er manchmal im Internet sieht, ist nicht mehr so wie früher: Es wirkt weniger aufrichtig. Ihr Blick scheint härter und nachdenklicher.
Jahr für Jahr wundert sie sich über die blauen Rosen, die vor ihrer Tür liegen. Nie ist ein Name dabei, aber immer eine Karte mit einem Gedicht. Jedes Jahr überkommt sie das Gefühl: Ich darf meinem Mann nichts verraten von diesem Geschenk. Außerdem sagt sie sich, dass dieses Geschenk ihr gar nichts bedeutet, denn sie weiß ja nicht einmal, von wem es kommt. Dann geht sie jedes Mal zur Ponte Molino, wo sie einst, im ersten Semester, ihren Mann kennengelernt hat. Dort beugt sie sich über das träge und grün fließende Wasser, holt aus und wirft die blauen Rosen und die Karte hinunter in den Bacchiglione.
Er entspringt in der Nähe von Vicenza, und in Padua teilt er sich auf in mehrere Kanäle. Es beruhigt sie, nicht zu wissen, über welchen Kanal und in welche Richtung die Blumen davongetragen werden – blaue Rosen mag sie nämlich gar nicht. Vor langer Zeit hat sie in einem Interview, das sie aufgrund ihrer hervorragenden Matura einer Regionalzeitung geben durfte, behauptet, ihre Lieblingsblumen seien blaue Rosen. Aber es war eine Lüge gewesen, weil sie nicht alles über sich preisgeben hatte wollen. Ihre Lieblingsblumen sind rote Rosen. Ohnehin gilt all ihre Liebe ihrem Mann – und den roten Rosen, die er ihr zu jedem Geburtstag schenkt: einen ganzen Arm voll.
Am Prato della Valle steigt Vittorio aus dem Taxi. Zuerst setzt er sich mit den blauen Rosen an den Springbrunnen in der Mitte des Parks. Junge Leute flanieren an diesem lauen Novemberabend auf dem Platz am Kanal.
Das Brunnenbecken ist rund, der Park von prächtigen Laternen beleuchtet. Im Hintergrund des Parks thront ein Palast mit Spitzbögen: die Loggia Amulea. Mit ihren tiefroten Mauern verursacht sie in Vittorio eine fürchterliche Aufregung – er muss aufstehen und sich von ihr abwenden. Er atmet tief durch und blickt eine Weile in das dunkle Gras. Die rote Farbe der Loggia erinnert ihn daran, wie sich ein Pärchen in Vicenza einmal unter einem ebenso tiefroten Schirm geküsst hat. Der junge Mann hat dabei immer wieder die Frau mit Küssen überhäuft. Vittorio, der seine Geliebte niemals geküsst hat, ist der Gedanke unerträglich, dass er sich ihr so aufdrängen könnte wie dieser Mann. Er konnte damals unmöglich einfach zu ihr gehen und sie mit Küssen überhäufen – obwohl er dies insgeheim am liebsten getan hätte. Sicher hätte sie seine Liebe nicht erwidert und das hätte er kaum ertragen. Er liebt sie aber, das beweisen die blauen Rosen, die er ihr jedes Jahr schenkt.
Jetzt geht er mit dem blauen Blumenstrauß durch den Park, überquert eine Brücke und bleibt schließlich vor der Statue des Trojaners Antenor stehen. Im hellen Licht der Laternen blickt er zu der Statue auf, die ihm zu lächeln scheint und in einen prächtigen steinernen Mantel gehüllt ist. Die Gastfreundlichkeit und Friedensliebe des Antenor hat Vittorio immer bewundert, deshalb will er die Statue auf diesem Platz meistens ansehen, wenn er hier ist. Der Legende nach floh Antenor nach dem Untergang Trojas und irrte auf den Meeren umher; schließlich soll er die Stadt Padua gegründet haben.
Langsam geht Vittorio in Richtung der Basilica di Sant’ Antonio. Kurz davor biegt er in eine enge Seitengasse ein, in der kein Mensch zu sehen ist. Diese Abkürzung zu dem Haus, in dem sich ihre Wohnung befindet, nimmt er immer.
Bald steht er auf dem kleinen Parkplatz, und direkt neben ihm erhebt sich das vertraute Haus mit der großen gläsernen Eingangstür. Er wartet hinter einem hohen Strauch in der Nähe des Eingangs, dass jemand aus dem Gebäude kommt und er sich so Zutritt verschaffen kann. Bislang hat er jedes Jahr Glück gehabt.
Da verlässt ein hübscher junger Mann mit einer schwarzen Lederjacke das Haus, der offenbar beschlossen hat, noch etwas spazieren zu gehen. Vittorio erinnert sich an die Fotos aus dem Internet und erkennt, dass dies ihr Mann sein muss – tatsächlich ist er ihm noch niemals begegnet. Sein dunkles Haar und der gepflegte Vollbart wirken modern und gesund, aber es scheint Vittorio, als habe der Mann einen traurigen Ausdruck im Gesicht. Er blickt weder nach links noch nach rechts, sondern marschiert zügig davon in Richtung Prato della Valle.
Bevor sich die Tür schließt, schlüpft Vittorio ins Haus. Im Treppenhaus ist es still und dunkel. Die Angst davor, ihr zu begegnen, ist heute stärker als früher. Wenn sie die blauen Rosen in seinen Armen sehen würde, wüsste sie sofort, dass er sie ihr jedes Jahr bringt. Der Halbmond strahlt durch ein Fenster ins Treppenhaus und beleuchtet seinen Weg nur schwach.
Während des Aufstiegs denkt er an eine Begegnung mit einer jungen Frau vor einem Jahr: einer Literaturstudentin. Bei ihrem Abschied nach einer Party trat sie näher an ihn heran und wollte ihn küssen. Aber instinktiv wich er zurück und lief davon. Sie schrieb ihm später auf sein Handy: „Willst du mich nicht wiedersehen?“ Er antwortete nur: „Nein, tut mir leid.“ Nachdem er diese Antwort abgesendet hatte, betrachtete er ein Bild von seiner Liebsten – er umarmte das Bild und wollte es am liebsten nie wieder loslassen. Es war nur ein Bild, welches er aus dem Netz kopiert hatte, aber ihm bedeutete es so unglaublich viel. Er hatte es golden eingerahmt und an die Wand seines Schlafzimmers gehängt. Auf dem Bild war sie mit offenem glattem Haar zu sehen und einem Lächeln, das ungeheuer liebevoll aussah. Vittorio musste dieses Bild einfach immer wieder umarmen.
Im zweiten Stock hält er inne, legt die blauen Rosen schnell auf dem schwarzen Fußabstreifer vor ihrer Tür ab, dreht sich um und eilt die Treppe wieder hinunter. Hastig flüchtet er zur Tür hinaus und hat dabei das beängstigende Gefühl, von ihr verfolgt zu werden. Durch die menschenerfüllte Stadt läuft er zum Bahnhof, nimmt den erstbesten Zug und wird um Viertel nach acht wieder in Vicenza sein. Im Zug aber fällt ihm ein: Hat er in seiner Aufregung nicht vergessen, das Kärtchen mit dem Gedicht beizulegen?
Der Mann in der schwarzen Lederjacke erblickt die blauen Rosen vor seiner Tür. Schon zuvor hat er auf seinem Spaziergang an der Statue des Antenor eine blaue Rose entdeckt, die er noch immer in der Hand hält. Er bewundert Antenor für seine Friedensliebe, und wahrscheinlich hat er darum die blaue Rose mitnehmen müssen. Die Karte mit dem Gedicht hat er nicht gesehen.
Als er jetzt den Strauß blauer Rosen aufhebt, ist er verwundert. Gedankenverloren nimmt er die Blumen mit in die Wohnung und fragt sich, von wem sie wohl kommen mögen. Er zieht die Jacke aus, nimmt eine Blumenvase, füllt sie mit Wasser, steckt die Rosen hinein und stellt sie auf den Küchentisch. Dann geht er noch einmal in den Flur zurück und blickt auf den Garderobenständer, wie so oft: Nur noch seine Jacke hängt darauf. Er wischt sich mit beiden Händen übers Gesicht und geht in die Küche zurück. Ihm wird plötzlich leicht übel, als hätte er gerade in einer Achterbahn gesessen. In der Küche setzt er sich an den Tisch und überlegt, ihr zu schreiben, aber stattdessen betrachtet er nur stumm die Blumen, bis er auf einmal laut die Frage stellt: „Ob du wohl blaue Rosen ebenso liebst wie rote?“
Marcel Zischg
Nach seinem Studium der Germanistik und der Komparatistik in Innsbruck schreibt der Autor aus Meran, Südtirol, nun Märchen und Sagen für Kinder und Kurzprosa für Erwachsene. Nach Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften und Anthologien gewann er 2017 den 3. Preis in der Kategorie „Kinder- und Jugendliteratur“ der elften Bonner Buchmesse Migration mit seiner Geschichte „Kakapo – Ein Kindermärchen aus Neuseeland“.
2069
HELMUT LOINGER
Die Augustsonne steht hoch über dem Mölltal. Übliche fünfundvierzig Grad Sommerhitze brutzeln den Talkessel wie ein Steak, das zu Tode gegrillt wird. Lois Tschabuschnig hockt auf einer morschen Holzbank auf der Terrasse seines Weingutes. Er beobachtet, wie der glühend heiße Südwind staubtrockenes Stroh über die menschenleere Straße scheucht. Sein müder Blick schweift von den zumeist verlassenen Häusern in Flattach bis rauf zum Grafenberg, zu seinen Weinbergen. Tschabuschnig ist sich nicht sicher, ob das staubvernebelte Flimmern der Landschaft von der unerträglichen Hitze stammt, oder ob ihm sein amphetamin-geschwängertes Hirn einen fatamorganischen Streich spielt.
Die verdorrten Rebstöcke am Grafenberg muten wie Skelette an, die kopfüber im ausgemergelten Boden zu stecken scheinen. Wie ein Denkmal erinnern sie an eine Zeit, in der die Welt trotz aller Kriege, Terroranschläge und Epidemien noch halbwegs in Ordnung schien und in der das Wort „Klimakatastrophe“ jedem nur ein müdes Lächeln entlockte. Heute, hundert Jahre nach Woodstock und der ersten Mondlandung, lacht keiner mehr darüber. Schon gar nicht im Mölltal.
Lois Tschabuschnig fühlt sich müde und krank, obwohl ihn seine implantierte Medikamentenpumpe permanent mit einem Cocktail aus Amphetaminen und Opiaten versorgt. Immer dann, wenn die smarte Hightech-Linse in seinem Auge analysiert, dass er medikamentös unterversorgt oder einfach unterglücklich ist. Und immer dann, wenn ihm der zwetschkengroße Tumor in seinem Mölltaler Dickschädel eine hämmernde Schmerzattacke liefert. Tschabuschnigs Pumpe wird nicht langweilig.
Das Weingut hat lange keinen Wein mehr hervorgebracht. Seit Jahren haben die dunklen Glasfronten des Verkostungsraumes kein Wasser mehr, geschweige denn Reinigungsmittel gesehen. Matt spiegelt die verdreckte Oberfläche die





























