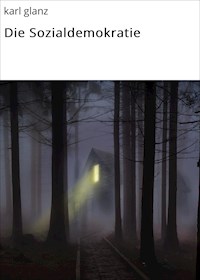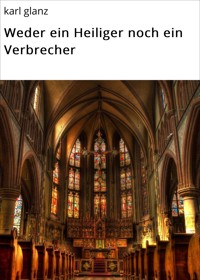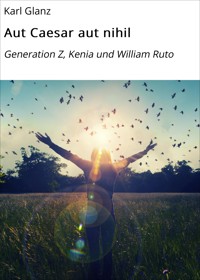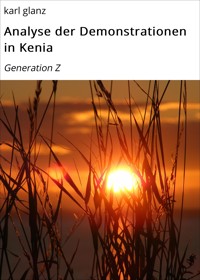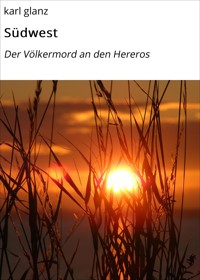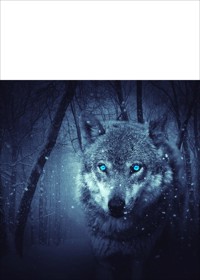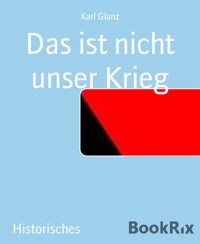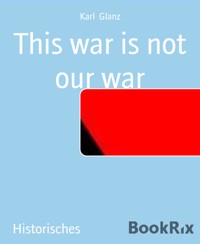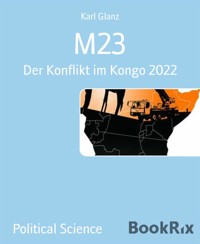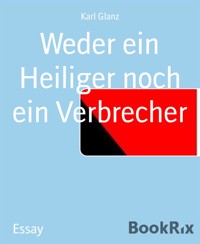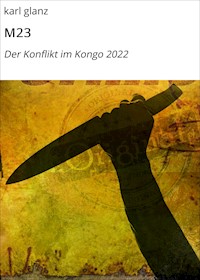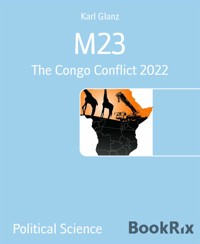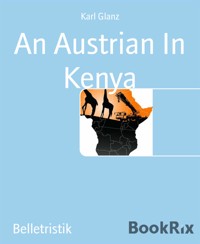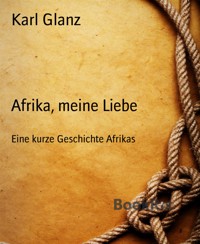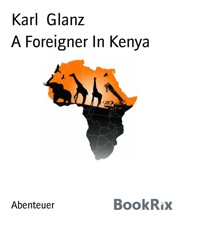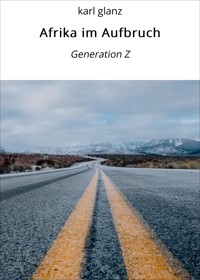
4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das ist ein Buch, das sich mit der sozialen Entwicklung in Afrika beschäftigt. "Der Kampf, den wir führen, ist nicht nur ein Kampf für Burkina Faso, es ist ein Kampf für ganz Afrika", sagt der Präsident Ibrahim Traore von Burkina Faso. Afrika ist im Wandel. Afrika macht sich endlich von den Kolonialmächten frei.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
karl glanz
Afrika im Aufbruch
Generation Z
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Afrika im Aufbruch
Impressum neobooks
Afrika im Aufbruch
0
Von Karl Glanz
Leute, wir haben nur eine Nation, Kenia. Es ist unsere Heimat. Bei allem, was wir tun, müssen wir sehr vorsichtig sein. Lasst uns nicht unser Haus niederbrennen und der Instabilität keine Chance geben. Wir sind Kenianer und lasst uns Kenia friedlich, wohlhabend und großartig machen, das ist unsere Verantwortung. Gute Nacht, Kameraden. Generation Z.
Die Eroberer schreiben Geschichte. Sie kamen, sie siegten, sie schreiben.
Man erwartet nicht, dass die Leute, die gekommen sind, um uns zu erobern, die Wahrheit über uns schreiben. Sie werden immer negative Dinge über uns schreiben und sie müssen das tun, weil sie ihre Invasion in all unseren Ländern rechtfertigen müssen.
(Miriam Mskeba)
„Der Kampf, den wir führen, ist nicht nur ein Kampf für Burkina Faso, es ist ein Kampf für ganz Afrika.“
(Präsident Ibrahim Traore von Burkina Faso)
1
In Afrika ist ein tiefgreifender politischer Wandel zu beobachten. Es ist ein Umbruch der bestehenden Ordnung,
Afrika befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel und mehrere Schlüsselfaktoren deuten darauf hin, dass die gegenwärtigen Veränderungen eine neue Dimension erreichen könnten.
Die Urmenschen, aber auch der Homo sapiens, waren in Afrika zu finden, weshalb Afrika als Wiege der Menschheit gilt.
Die Geschichte Afrikas beginnt mit dem Aufkommen der Hominiden, der archaischen Menschen und – vor mindestens 200.000 Jahren – des anatomisch modernen Menschen (Homo sapiens) in Ostafrika. Sie setzt sich ungebrochen an den verschiedensten Orten in unterschiedlichen und sich politisch entwickelnden Nationalstaaten fort.
Wissenschaftler haben zwei Haupttheorien darüber formuliert, wie und wo sich die Menschheit entwickelt hat. Einige glaubten an die sogenannte multiregionale Ursprungshypothese, die besagt, dass sich die Vorfahren des Menschen über den ganzen Globus verbreiteten - der moderne Mensch könnte sich also an einer Handvoll verschiedener Orte auf der Welt entwickelt haben.
Dann gibt es noch ein Konzept, das als Out-of-Africa-Theorie bekannt ist. Wie der Name schon sagt, geht es dabei darum, dass der moderne Mensch vor Tausenden von Jahren auf dem Kontinent entstand und sich dort entwickelte, bevor er in andere Teile der Welt migrierte. In den 1980er Jahren schienen Wissenschaftler eine klare Bestätigung der Out-of-Africa-Theorie gefunden zu haben.
Um die Wurzeln der Menschheit zu ermitteln, können Wissenschaftler die genetischen Informationen moderner Populationen analysieren. Von dort aus verfolgten sie die Abstammungslinien mehrerer Subjekte weit in die Vergangenheit, und diese Spuren schienen die Forscher immer wieder zu einem Ursprungsort zurückzuführen: Afrika.
Die früheste bekannte Geschichte begann in Ägypten und später in Nubien, der Sahelzone, dem Maghreb und am Horn von Afrika.
Niemand betet eine Gottheit oder einen Gott nach dem Bild einer anderen Rasse an, außer Sklaven! Wenn ein Schwarzer immer noch weiße europäische Götter, Engel und Jesus anbetet, sind diese Menschen nichts weiter als Sklaven! Schwarze Menschen haben dominantere Gene als andere Rassen. 1974 wurde in Tansania das älteste menschliche Skelett namens „Lucy“ entdeckt, dessen Alter auf 3,2 Millionen Jahre geschätzt wird. Dies sollte ein Hinweis darauf sein, dass Schwarze die ursprünglichen Wesen dieses Planeten sind. Wenn der höchste Geist hinter der Schöpfung eine Farbe hat, muss sie schwarz gewesen sein, denn die ersten Menschen auf diesem Planeten waren schwarz. Warum sollte der kreative Geist wie ein Kaukasier aussehen, der erst vor weniger als 8000 Jahren entstand? Sicherlich eine gute Frage. Hat Gott eine Hautfarbe? Wer kann das beantworten?
In Afrika gibt es 54 Länder, eines davon ist ein „nicht selbstregiertes Gebiet“, die Westsahara.
Im Zuge des „Wettlaufs um Afrika“ wurde ganz Afrika von Weißen kolonisiert, mit Ausnahme Äthiopiens und Liberias.
Bevor die Weißen nach Afrika kamen, gab es bis zu 10.000 verschiedene Staaten und autonome Gruppen mit unterschiedlichen Sprachen und Bräuchen.
Der Prozess der deutschen Kolonisierung Ostafrikas begann im 19. Jahrhundert. Vor 1882 gab es „keine oder keine umfassenden Kolonisierungsprogramme und keine organisierten Interessengruppen, die diese gestalteten und kanalisierten“. Die ersten Territorien begannen 1882, als in Deutschland der Deutsche Kolonialverein gegründet wurde, um für den Erwerb von Kolonien durch das Kaiserreich zu werben. Befürworter der kolonialen Expansion argumentierten, dass Deutschland in die Fußstapfen Großbritanniens treten und seiner Industrie Überseemärkte sichern sollte. Die größte Herausforderung bei der Erreichung dieses Ziels bestand darin, Bundeskanzler Otto von Bismarck (war einer der bedeutendsten Politiker Deutschlands und wird auch „der Eiserne Kanzler“ genannt) davon zu überzeugen, die Idee der Überseeexpansion zu akzeptieren. 1874 hatte Bismarck den Antrag des Sultans von Sansibar abgelehnt, Sansibar unter „deutschen Schutz“ zu stellen. Erst am 22. Februar 1885 fasste Bismarck seine endgültige Entscheidung und genehmigte den Erwerb der Überseekolonien offiziell – aus Gründen, die unter Historikern bis heute umstritten sind.
Sansibar war keine deutsche Kolonie, sondern ein freies Sultanat. Es gehörte lediglich zur deutschen Interessensphäre, was jedoch keine verfassungsrechtliche Bedeutung hatte.
Der Vertrag zwischen dem Deutschen Reich und dem Vereinigten Königreich über die Kolonien und Helgoland vom 1. Juli 1890 regelte das Verhältnis zwischen den territorialen und souveränen Ansprüchen des Deutschen Reichs und des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland im kolonisierten Afrika. Dabei ging es vor allem um Klarstellungen hinsichtlich der afrikanischen Kolonien, wobei das Vereinigte Königreich dem Deutschen Reich neben einem Landstreifen nordöstlich von Südwestafrika auch die Nordseeinsel Helgoland überließ.
Nach der deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1871 und dem Aufblühen des deutschen Industriesektors wurde eine Expansion nach Übersee möglich und unvermeidlich. Der Erwerb von Kolonien wurde von den Befürwortern der Kolonialpolitik in Deutschland nicht nur als eine Frage des nationalen Prestiges angesehen, sondern auch als Allheilmittel für Deutschlands Industrie- und Überbevölkerungsprobleme. Deutschland brauchte neue Märkte und Rohstoffquellen für seine Industrie und wollte sich darüber hinaus als Supermacht beweisen, die in der Lage war, die kolonisierten Gesellschaften in ihrer gegenwärtigen Form zu kolonisieren und zu zivilisieren - im Deutschen als Kulturmission bekannt. Bereits 1884 hatte Karl Peters seine Gesellschaft für deutsche Kolonisation gegründet und reiste über Sansibar ins Innere Ostafrikas, wo er Verträge mit afrikanischen Häuptlingen abschloss. Noch vor Ende 1884 hatte Peters, der von den Menschen Ostafrikas als Mann des Blutes (Mkono wa damu) bezeichnet wurde, sogenannte Scheinverträge mit den heutigen Häuptlingen von Uzigua, Uluguru und Usagara abgeschlossen. Als er am 7. Februar 1885 mit den zwölf Scheinverträgen, die er mit ostafrikanischen Häuptlingen geschlossen hatte, nach Deutschland zurückkehrte, erhielt er einen Schutzbrief von Bismarck, der sich zuvor geweigert hatte, die Kolonialpolitik zu akzeptieren. Peters' Reichsurkunde und die Tatsache, dass er seinen Verein 1887 mit dem Deutschen Kolonialverein zur Deutschen Kolonialgesellschaft zusammengelegt hatte, beschleunigten den Kolonisierungsprozess Ostafrikas. Die Reichsurkunde billigte die Kolonisierung der oben genannten und in den Scheinverträgen zu deutschen Einflusssphären erklärten Gebiete. Dieser Zustimmung folgte die effektive Kontrolle der in Peters' Verträgen genannten Gebiete, was die Einrichtung von Militärstationen zur Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung und zur Unterdrückung afrikanischen Widerstands einschloss. Gleichzeitig drangen Vertragsexpeditionen weiterhin in die Gebiete vor, die noch nicht von den Scheinverträgen abgedeckt waren. Nach einer Reihe bilateraler Abkommen zwischen Deutschland und Großbritannien wurde Deutsch-Ostafrika gegründet. Es sei eine riesige Kolonie gewesen, „ein Gebiet von etwa einer Million Quadratkilometern“, das das heutige Festland von Tansania, Ruanda und Burundi umfasste.
Die Tatsache, dass die koloniale Vergangenheit die afrikanischen Gesellschaften bis heute beeinflusst, unterstreicht die Bedeutung der Erinnerungsgeschichte in der afrikanischen Geschichtsschreibung. Tim Woods hat geschrieben:
Der Kolonialismus ist für die Afrikaner kein in der Vergangenheit verankertes Ereignis, sondern eine Geschichte, die im Wesentlichen noch nicht zu Ende ist, eine Geschichte, deren Auswirkungen nicht nur in allen kulturellen Aktivitäten allgegenwärtig sind, sondern deren traumatische Folgen sich auch heute noch aktiv in der politischen, historischen, kulturellen und politischen Welt entfalten.
Die Erinnerungen an den Imperialismus sind in den Köpfen der Afrikaner noch frisch und werden noch dadurch verstärkt, dass das koloniale Erbe in Afrika weit verbreitet ist.
Die pharaonische Zivilisation des alten Ägypten ist eine der ältesten Zivilisationen der Welt.
Afrika ist der zweitgrößte Kontinent und hat etwa 16 Prozent der Weltbevölkerung. Über 50 Prozent der Afrikaner sind jünger als 25 Jahre.
Bis 2050 wird sich die Bevölkerung des Kontinents auf 2,3 Milliarden Menschen mehr als verdoppeln.
Afrika ist der ärmste und am wenigsten entwickelte Kontinent der Welt; sein BIP beträgt lediglich 2,4 Prozent des globalen BIP.
Fast 40 Prozent der Erwachsenen in Afrika sind Analphabeten, zwei Drittel davon sind Frauen. In vielen afrikanischen Ländern, insbesondere in den Ländern südlich der Sahara, liegt die Alphabetisierungsrate der Erwachsenen unter 50 Prozent.
Mehr als 25 Millionen Menschen auf dem Kontinent sind HIV-positiv. Mehr als 17 Millionen Menschen sind an der Krankheit gestorben.
Der verheerendste Krieg in Afrika war der Zweite Kongo-Krieg, der über 5,4 Millionen Menschenleben forderte und ihn zum verheerendsten globalen Konflikt seit dem Zweiten Weltkrieg machte.
In Afrika haben weniger Menschen Zugang zum Internet als in New York City.
Etwa 90 Prozent aller Malariafälle weltweit treten in Afrika auf; 24 Prozent aller Todesfälle bei Kindern in Afrika südlich der Sahara sind auf die Malariaerkrankung zurückzuführen.
In Ländern wie Somalia, Sudan und Äthiopien eskalieren grundlegende Konflikte um staatliche Einheit und Verfassung. Lokale staatliche Strukturen sind vielerorts zusammengebrochen, vor allem in den Regionen Amhara und Oromia in Äthiopien. Eine mögliche Anerkennung Somalilands würde einen Tabubruch in der äthiopischen Außenpolitik bedeuten.
Bereits im 7. Jahrhundert erlebte Afrika einen historischen Wendepunkt, als Nordafrika sich dem Islam zuwandte und sich damit von Europa abgrenzte. Durch den Transsahara-Handel kam es zu einem kulturellen Austausch.
Der Mangel an schriftlichen Zeugnissen Afrikas führte lange Zeit zu Verzerrungen in der Geschichtsschreibung und Geringschätzung des Kontinents. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begann ein Umdenken.
Heute steht Afrika erneut vor tiefgreifenden Umwälzungen, die die Stabilität und die humanitäre Lage in der Region belasten. Die aktuellen Entwicklungen stellen besondere Herausforderungen dar.
Auslöser war Mali.
Der letzte bedeutende Regierungswechsel in Mali fand am 19. August 2020 statt, als Präsident Ibrahim Boubacar Keïta nach einem Militärputsch zurücktrat. Die Militärjunta, die die Macht übernahm, versprach, einen zivilen Übergang einzuleiten und Neuwahlen abzuhalten. Zuvor waren massive Proteste gegen die Regierung ausgebrochen, die als ineffektiv angesehen wurde.
Ibrahim Boubacar Keïta, oft als IBK bekannt, war ein malischer Politiker, der von September 2013 bis August 2020 Präsident Malis war, als er durch den Staatsstreich 2020 zum Rücktritt gezwungen wurde. Zuvor war er von Februar 1994 bis Februar 2000 Premierminister Malis und von September 2002 bis September 2007 Präsident der Nationalversammlung Malis. Keïta wurde 1945 in Koutiala, Mali, geboren und studierte Geschichte, Politikwissenschaft und internationale Beziehungen in Paris. Er gründete 2001 die Mitte-Links-Partei Rallye für Mali (RPM). Als Präsident sah sich Keïta mit Herausforderungen konfrontiert, die sich durch einen wirtschaftlichen Abschwung, umstrittene Wahlen und anhaltende dschihadistische Gewalt in Mali ergaben. Obwohl er 2013 mit dem Versprechen gewählt wurde, Frieden und Sicherheit wiederherzustellen, tat sich seine Regierung schwer damit, Malis drängende Sicherheitsprobleme zu lösen, was schließlich im August 2020 zu seinem Sturz durch das Militär führte. Keïta starb am 16. Januar 2022 im Alter von 76 Jahren in seiner Residenz in Bamako. Die genaue Todesursache ist unbekannt.
Ein großes Problem in Mali ist die Korruption. Korruption ist eine große Herausforderung und durchdringt die malischen Institutionen auf allen Regierungsebenen. Mali erreicht auf dem Korruptionswahrnehmungsindex einen Wert von 28, was auf ein hohes Maß an Korruption im öffentlichen Sektor hinweist.
Korruption gilt allgemein als grundlegender Konflikttreiber in Mali, insbesondere in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit.
Trotz des politischen Willens, Reformen zur Korruptionsbekämpfung durchzuführen, kämpft Mali weiterhin mit Korruption.
Im Umgang mit den Zollbehörden Malis besteht ein sehr hohes Korruptionsrisiko, da im Import- und Exportprozess unregelmäßige Zahlungen häufig vorkommen.
2012 kam es in Mali zu einem Militärputsch, der ein Machtvakuum hinterließ. Islamistische Gruppen nutzten dies aus, um im Norden des Landes die Kontrolle zu übernehmen.
Auch mit islamistischen Gruppierungen hat Mali zu kämpfen. Zu den bekanntesten Gruppierungen zählen Ansar Dine, Al-Kaida im Islamischen Maghreb (AQIM) und der Islamische Staat in der Großen Sahara (ISGS). Diese Gruppierungen verfolgen zwar unterschiedliche Ziele, haben aber oft ähnliche radikale Ideologien.
Islamistische Gruppen kontrollierten zeitweise weite Teile Nordmalis, vor allem in Regionen wie Gao, Kidal und Timbuktu. Sie führten strenge islamische Gesetze ein und zerstörten Kulturstätten.
2013 intervenierte Frankreich militärisch in Mali, um die islamistischen Gruppen zurückzudrängen. Der Einsatz führte zu einer vorübergehenden Stabilisierung, die Sicherheitslage blieb jedoch fragil.
Trotz internationaler Bemühungen ist Mali nach wie vor von Gewalt und Instabilität geprägt. Konflikte zwischen verschiedenen Volksgruppen und die Rückkehr islamistischer Kämpfer sind ständige Herausforderungen.
Wiederkehrende Konflikte haben zu einer schweren humanitären Krise geführt, die Millionen von Vertriebenen zur Folge hatte und zu einem Mangel an grundlegenden Dienstleistungen führte.
Mali ist eines der ärmsten Länder der Welt. Die Armutsrate ist hoch und der Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen wie Bildung und Gesundheitsversorgung ist begrenzt.
Die Sicherheitslage ist angespannt, insbesondere im Norden des Landes, wo islamistische Gruppen aktiv sind. Dies hat zu Vertreibung und Unsicherheit geführt.
Der Zugang zu Bildung ist eingeschränkt, vor allem für Mädchen. Die Einschulungsraten sind niedrig und die Qualität der Ausbildung schwankt stark.
Die Landwirtschaft stellt eine zentrale Lebensgrundlage dar, leidet jedoch unter klimatischen Bedingungen wie Dürre und Überschwemmungen.
Nach Mali kam es in Burkina Faso zu einem Putsch. Der jüngste Regierungswechsel ereignete sich am 30. September 2022, als eine Militärjunta unter dem Kommando von Hauptmann Ibrahim Traoré Oberst Paul-Henri Damiba stürzte, der selbst erst im Januar 2022 an die Macht gekommen war. Traoré übernahm die Führung und installierte eine Übergangsregierung, die eine Rückkehr zur Zivilherrschaft versprach, aber wiederholt Wahltermine verschob und die Übergangszeit auf fünf Jahre verlängerte.
Ibrahim Traoré, geboren am 14. März 1988 in Burkina Faso, ist Militäroffizier und derzeitiger Interimspräsident. Er trat sein Amt am 6. Oktober 2022 an, nachdem Paul-Henri Sandaogo Damiba durch einen Staatsstreich gestürzt wurde. Traoré, der jüngste amtierende Staatschef der Welt, diente zuvor in der Friedensmission der Vereinten Nationen in Mali und war an verschiedenen Aufstandsbekämpfungsoperationen gegen dschihadistische Gruppen in Burkina Faso beteiligt. Seine Führung ist angesichts bedeutender politischer und militärischer Veränderungen im Land unter die Lupe genommen worden, insbesondere aufgrund seiner Verbindungen zu Russland und der Wagner-Gruppe.
Paul-Henri Sandaogo Damiba, geboren am 2. Januar 1981, ist ein burkinischer Militäroffizier, der vom 31. Januar bis 30. September 2022 Interimspräsident von Burkina Faso war. Er kam durch einen Putsch an die Macht, der Präsident Roch Marc Christian Kaboré stürzte. Damiba wurde durch einen anschließenden Putsch unter der Führung von Ibrahim Traoré gestürzt. Er ist Absolvent der École Militaire in Paris, hat einen Master-Abschluss in Kriminologie und hatte verschiedene militärische Positionen inne, darunter den des Kommandanten der Dritten Militärregion von Burkina Faso.
Roch Marc Christian Kaboré, geboren am 25. April 1957 in Ouagadougou, Burkina Faso, ist ein bekannter burkinischer Bankier und Politiker. Er war von 2015 bis zu seinem Sturz durch einen Putsch im Januar 2022 Präsident. Zuvor war er Premierminister (1994-1996) und Präsident der Nationalversammlung (2002-2012). Kaboré gründete 2014 die Partei Volksbewegung für den Fortschritt, nachdem er den Kongress für Demokratie und Fortschritt verlassen hatte. Seine Präsidentschaft markierte einen bedeutenden Wandel in der politischen Landschaft Burkina Fasos, da er der erste nichtmilitärische Präsident seit fast fünf Jahrzehnten war.
Burkina Faso weist einen Korruptionswahrnehmungsindex von 35 auf und gehört damit zu den Ländern mit einem hohen Maß an Korruption.
Korruption gibt es in vielen Bereichen, unter anderem in Regierungsinstitutionen, bei Sicherheitskräften und in der Wirtschaft.
Bestechung, Misswirtschaft und Vetternwirtschaft zählen zu den häufigsten Formen der Korruption in Burkina Faso.
Trotz der Bemühungen der Regierung, die Korruptionsbekämpfung zu verstärken, bleiben Herausforderungen bestehen.
Die Zivilgesellschaft und internationale Organisationen spielen bei der Überwachung und Bekämpfung der Korruption in Burkina Faso eine wichtige Rolle.
In den letzten Jahren kam es in Burkina Faso zu einer Zunahme von Gewalt und Terrorismus, was zu einer humanitären Krise mit zahlreichen Vertriebenen führte.
Auch hier ist die Armutsrate hoch und viele Menschen leben von Subsistenzwirtschaft.
Der Zugang zu Gesundheitsdiensten ist eingeschränkt und Krankheiten wie Malaria sind weit verbreitet.
Bildungseinrichtungen sind oft unterfinanziert und vielen Kindern, insbesondere Mädchen, ist der Zugang zu Bildung erschwert.
Dann kam Niger. Der Regierungswechsel fand am 26. Juli 2023 statt, als das Militär unter General Abdourahamane Tiani den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum absetzte und verhaftete. Tiani erklärte sich am 28. Juli zum neuen Staatsoberhaupt und bildete eine provisorische Militärregierung, den „Nationalen Rat zur Rettung des Vaterlandes“.
Abdourahamane Tchiani, geboren 1960 oder 1961, ist ein nigrischer Militäroffizier und Vorsitzender des Nationalen Rates zum Schutz des Heimatlandes nach dem Sturz von Präsident Mohamed Bazoum durch einen Putsch am 26. Juli 2023. Zuvor war er von 2011 bis 2023 Chef der Präsidentengarde Nigers. Tchiani hat einen militärischen Hintergrund, der UN-Friedensmissionen und die Vereitelung von Putschversuchen umfasst. Er ist bekannt für seine engen Verbindungen zum ehemaligen Präsidenten Mahamadou Issoufou und gilt als umstrittene, aber einflussreiche Figur in der politischen Landschaft Nigers.
Mohamed Bazoum, geboren am 1. Januar 1960, ist ein nigrischer Politiker, der von April 2021 bis zu seiner Absetzung im Juli 2023 während eines Militärputsches als 10. Präsident Nigers amtierte. Vor seiner Präsidentschaft hatte er verschiedene Regierungsämter inne, darunter Außenminister und Innenminister. Bazoum war Nigers erster arabischer Präsident und ist bekannt für seinen demokratischen Ansatz und seine Bemühungen zur Bekämpfung des Terrorismus in der Sahelzone. Nach seiner Absetzung wurde er unter Hausarrest gestellt und ihm droht eine Anklage wegen Hochverrats. Sein Anwaltsteam behauptet, seine Rechte seien während des Verfahrens schwer verletzt worden.