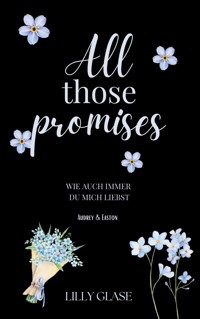
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Audrey Andersens Fassade verbirgt ihre wahren Gefühle, doch was steckt wirklich dahinter? Nach einem tragischen Unfall, durch den sie ihre beste Freundin verliert, fällt sie in ein tiefes Loch der Verzweiflung. Die Person, die ihr am wichtigsten war, ist von ihr gegangen. Nun hat sie niemanden mehr und muss Trost in sich selbst finden. Doch dann tritt Easton Miller in ihr Leben - der Junge mit den grünen Augen, dem breiten Lächeln, den süßen Grübchen und einem gebrochenen Herz. Können diese beiden verlorenen Seelen zueinander finden und sich gegenseitig Trost spenden? Beide sind von ihrer Vergangenheit geprägt - so verschieden und doch so gleich. Audrey beginnt endlich wieder, nach langer Zeit, etwas zu fühlen, aber wird dieses Gefühl von Dauer sein? Was sie nicht weiß, ist, dass Easton ein Geheimnis birgt, das die Beziehung der beiden zerstören könnte. Wie viel Schmerz und wie viel Leid kann Audreys Herz noch ertragen, bis es endgültig zerbricht? Beide sind zu jung, um so viel ertragen zu müssen, und doch macht es sie umso stärker.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Liebe Leserschaft, in diesem Buch gibt es potentielle Inhalte, die bei einigen Lesern unangenehme Gefühle hervorrufen können. Aus diesem Grund findet sich auf der letzten Seite eine Inhaltswarnung. Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Für Larissa <3
Und für alle, die jede Nacht nach dem hellsten
Stern am Himmelszelt sehen.
The heart wants what it wants.
Scann mich um zur Playlist zu gelangen:
Playlist
APOCALYPSE – CIGARETTES AFTER SEX
IN MY ROOM – CHANCE PEÑA
THOSE EYES – NEW WEST
CRY – CIGARETTES AFTER SEX
SPARKS – COLDPLAY
SOMEONE TO STAY – VANCOUVER SLEEP CLINIC
PATIENCE – TAKE THAT
WHERE'S MY LOVE – SYML
ONLY – RY X
ANCHOR – NOVO AMOR
BLACK FRIDAY – TOM ODELL
IT'S OK – TOM ROSENTHAL
BURY ME ALIVE – CLOCKCLOCK
HEAL – TOM ODELL
OCEAN EYES – BILLIE EILISH
REFLECTIONS – THE NEIGHBOURHOOD
ROMANTIC HOMICIDE – D4VD
I WANNA BE YOURS – ARCTIC MONKEYS
NERVOUS – THE NEIGHBOURHOOD
Vergissmeinnicht Sie sind ein Zeichen wahrer Liebe und symbolisieren Treue und Zusammengehörigkeit. Jemandem diese Blume zu geben bedeutet, dass du die Person ewig lieben wirst und respektierst. Diese Geste ist ein Beweis eurer Beziehung und ein Versprechen, die Person nie zu vergessen.
Inhaltsverzeichnis
1. Audrey
2. Audrey
3. Audrey
4. Audrey
5. Audrey
6. Easton
7. Audrey
8. Easton
9. Audrey
10. Easton
11. Easton
12. Easton
13. Audrey
14. Easton
15. Easton
16. Audrey
17. Audrey
Easton
18. Audrey
19. Easton
20. Audrey
21. Easton
22. Audrey
23. Easton
24. Easton
25. Audrey
26. Easton
27. Audrey
28. Easton
29. Audrey
30. Audrey
Easton
31. Easton
32. Audrey
33. Easton
34. Audrey
Easton
35. Audrey
36. Easton
37. Easton
38. Audrey
39. Easton
40. Audrey
41. Easton
42. Audrey
43. Easton
44. Audrey
45. Easton
46. Audrey
47. Audrey
48. Audrey
49. Easton
50. Audrey
51. Audrey
52. Easton
53. Audrey
54
55. Audrey
56. Easton
57. Easton
58. Audrey
59. Easton
60. Audrey
Epilog
Prolog
Audrey
8 April.
Leere.
Das Gefühl purer Leere durchdringt meine Seele, breitet sich wie ein Schatten aus und hüllt mich in Dunkelheit. Langsam, aber unaufhaltsam nähert sie sich, unsichtbar und doch so spürbar.
So schnell wie sie gekommen ist, so schnell verschwindet sie auch wieder. Doch das Gefühl, das bleibt. Es wächst unaufhörlich und erfüllt meinen gesamten Körper.
Ich sitze regungslos da, unfähig mich zu bewegen. Mein Blick verliert sich in der Ferne, während ich in meiner Starre gefangen bin. Kein Funken Kraft bleibt mir, um mich zu regen. Alles scheint sinnlos zu sein.
Bilder spielen sich wie ein Film immer wieder in Dauerschleife vor meinem inneren Auge ab, aber ich kann sie nicht ausblenden.
Wieso nur? Wieso wurde mir genau diese eine Person, genommen, die mir am wichtigsten ist?
Sie ist gestorben, und ich konnte sie nicht retten. Ich spüre überhaupt nichts mehr – starre vor mich hin. Mein Körper bebt – ich habe keine Kontrolle mehr über ihn.
Der gestrige Abend hat mich verändert. Ich schätze, in diesem Moment ist auch ein Teil von mir gestorben. Jetzt bin ich ganz auf mich alleine gestellt, denn sie ist die Einzige gewesen, die für mich da war, mir geholfen und mich immer verstanden hat. Nun habe ich niemanden mehr und ich muss Trost in mir selbst finden.
Langsam öffnet sich meine Zimmertür und meine Mutter streckt sachte den Kopf hinein. »Audrey«, haucht sie leise und setzt sich neben mich.
Mir fließt ungewollt eine Träne über die Wange, woraufhin sie mich in den Arm nimmt. »Ich weiß, dass das schwer ist, aber Schatz, du musst es akzeptieren. Sie ist tot, daran wird sich nichts mehr ändern. Du musst lernen, normal weiterzuleben«, höre ich meine Mutter sagen.
Ich schlucke schwer.
Normal.
Ich soll also einfach normal weitermachen, so als wäre nichts geschehen? Normal in die Schule gehen, normal Freunde treffen, normal Spaß haben. Was ist überhaupt noch normal, ganz ohne sie?
Sachte nimmt Mam mein Kinn in ihre Hand, so sanft, als würde ich gleich auseinanderfallen, wenn sie zu fest zudrückt. »Versuche, etwas zu schlafen, das brauchst du«, fährt sie fort und streicht mir eine Strähne hinters Ohr. Ihre warmen Berührungen an meinem kalten Körper fühlen sich tröstend an. Ich brauche nun meine Mutter nun mehr als je zuvor.
»Ich kann nicht«, schluchze ich leise, doch meine Stimme versagt. Ich werde kein Auge zukriegen, so sehr ich das auch möchte – es geht nicht. Wird das für immer so sein? Schlaflose Nächte, mit diesem Gefühl?
»Doch, du kannst. Das weiß ich«, sagt sie bestimmt.
Ich blicke erst verzweifelt zu ihr und daraufhin zu Boden. »Rede mit mir, bitte« fleht meine Mutter, jedoch bekomme ich keinen Ton hinaus.
Ich sehe zu ihr – so viel Schmerz erkenne ich in ihrem Blick. Als ich das sehe, verziehe ich traurig das Gesicht und fange wieder an zu zittern. »Bleib. Bitte«, bringe ich gerade so hervor und versuche, mich auf meine Atmung zu konzentrieren. Tief ein und wieder aus.
Ich kann jetzt nicht reden, es ist zu schmerzhaft. Ich will lediglich abwarten, bis es mir besser geht. Einen Schritt nach dem anderen, oder?
Meine Mutter nickt leicht und legt sich zu mir.
Große Angst breitet sich in mir aus – Angst wie es weitergehen soll – Angst mich selbst zu verlieren.
1
Audrey
Eleanor. Blut. Tod.
Ich schrecke schweißgebadet auf – die Uhr zeigt kurz vor drei. Seufzend lasse ich mich auf meine Matratze zurückfallen.
Ich denke nach – ich denke viel nach in letzter Zeit. Manchmal gebe ich mir selbst die Schuld für das, was passiert ist. Ach Quatsch, ich glaube zu hundert Prozent, dass es meine Schuld gewesen ist.
Es tut so weh.
Es tut so unglaublich weh.
Hätte ich früher etwas unternommen, dann hätte ich es vielleicht verhindern können. Ich habe keine Ahnung, wie ich mit diesem Schmerz umgehen soll – er bohrt sich tief in meine Seele hinein und hinterlässt ein dunkles Loch. Ich kann nichts dagegen tun, ich muss es einfach überstehen.
Mein ganzes Leben fühlt sich wie ein einziger Albtraum an, und ich hoffe, dass ich daraus bald erwache. Aber das tue ich nicht, denn ich bin bereits wach. Ich lebe.
Mein Blick verliert sich starr in der Luft, aber ich richte mich langsam auf. Es darf nicht so weitergehen – Eleanor hätte das nicht gewollt.
Ich atme noch einmal kurz durch, bis ich aus meinem Zimmer gehe. Geschwind laufe ich in den Gang hinaus, will gerade ins Bad verschwinden, da kommt mein Vater zur Tür hinein.
Er stellt seine Arbeitstasche ab und als er mich entdeckt, beginnen seine Augen zu leuchten und er lächelt mich breit an. In ein paar Schritten ist er bereits bei mir und hat seine Arme fest um mich geschlungen.
»Hallo, Schätzchen«, begrüßt er mich.
Ich zwinge mir ein kleines Lächeln auf die Lippen und begrüße ihn ebenfalls.
»Wie geht es meiner Großen?«, fragt er munter und wuschelt mir durch die Haare. Ich glaube, mein Vater denkt, dass bei mir längst wieder alles in Ordnung ist. Aber Entschuldigung, wie sollte es das bitte sein? Es sind nicht einmal zwei Wochen vergangen.
Aus irgendeinem Grund fühlt sich diese Situation hier allerdings schön an. Es fühlt sich gut an, normal behandelt zu werden, als wäre nichts passiert.
Meine Mutter ist da das komplette Gegenteil gewesen – nun ja, die Betonung liegt auf gewesen. Sie leidet unter einer bipolaren Störung und immer, wenn ich denke, es wird besser, beweist die Krankheit auf ein Neues das Gegenteil. Meine Mutter sieht mein deprimiertes Verhalten als Faulheit an und hat keinerlei Mitgefühl.
Für einen kurzen Augenblick, in der Nacht nach dem Unfall, da hat sie mir ihre Liebe und Zuneigung gezeigt. Sie hat mir das Gefühl gegeben, welches ich brauche, doch dies ist nun Vergangenheit. Ich kann mich lediglich an der Erinnerung festklammern und warten, bis meine Mutter wieder so wird.
»Okay«, antworte ich knapp und blicke zu Boden.
Dad setzt sich auf einen Stuhl und deutet mit einem auffordernden, Setz-dich-hin-Blick auf den Hocker neben sich. Ich lasse mich fallen und schaue meinen erwartungsvollen Vater an.
»Und wie war die Schule heute? Gut gelernt?«
Ich schlucke schwer.
Er ist viel am Arbeiten – sehr viel. Und ich schätze, er bekommt einige Dinge, die hier zuhause ablaufen, nicht mit. Manchmal ist das auch ganz gut so, weil er nicht weiß, wie schlecht es mir eigentlich geht. In anderen Momenten würde ich ihm aber auch gerne meine wahren Gefühle zeigen, da er immer die Person war, die mich Verstand. Aber das ist nicht so leicht. Leichter ist es, so zu tun, als wäre nichts.
»Ich war heute nicht in der Schule«, gebe ich leise von mir.
Verwirrt blickt mein Vater zu mir auf.
Ich atme einmal tief durch. Es kostet mich enorm viel Kraft, das jetzt zu sagen. Ich will selbst nicht einmal wahrhaben, dass dieser Tag bald kommt und immer, immer näher rückt.
»Ich bin bis zu der Beerdigung von der Schule befreit«, würge ich heraus.
Es fühlt sich schlimm an, schlimmer als alles andere. Denn in dem Moment, in dem ich die Worte ausspreche, werden sie zur Realität. Ich habe es versucht, zu unterdrücken. Aber ich glaube, ab einem bestimmten Zeitpunkt geht es nicht mehr. Mir wird übel, denn morgen ist es so weit, meine größte Angst wird Wirklichkeit.
Mam hat mir vor ein paar Tagen ein schwarzes Kleid und Makeup in die Hand gedrückt. Damit die Menschen auf der Trauerfeier nicht denken, dass du auch tot bist. So bleich, wie du aussiehst – wie ein Geist, hatte sie gesagt.
Und eigentlich hätte ich schon seit Tagen damit beginnen sollen, eine Rede vorzubereiten, ich habe es aber nicht übers Herz gebracht. Nicht weil ich keine Lust hatte, nein. Weil mir die Kraft dazu gefehlt hat. Und jedes Mal, wenn ich versuchen will, damit zu starten, fühlt es sich so an, als würde ich gleich zusammenbrechen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie wirklich tot ist. Sie war noch so jung – zu jung, um zu sterben.
Früher habe ich mir immer vorgestellt, was ich machen würde, wenn sie plötzlich stirbt. Da ich diesen Gedanken aber so grausam fand, habe ich gedacht, wenn das passiert, bin ich alt und dann wird es nicht so schlimm sein.
Tja, so ist es definitiv nicht. Jetzt bin ich älter und es ist einen Scheiß leichter. Ich dachte immer, wenn ich erwachsen werde, habe ich keine Probleme mehr. Dass diese alle auf magische Art und Weise verschwinden. Allerdings fangen nun erst die Probleme an. Wie gerne ich wieder ein Kind wäre.
»Dir geht es ja schon wieder gut – eine Unverschämtheit, dass du nicht zur Schule darfst«, antwortet mein Dad aufgebracht und sieht sich im Raum um.
Ich beiße mir auf die Unterlippe und bringe ein wehleidiges: Mhm, heraus. Schnell drehe ich mich von ihm weg, damit er nicht sieht, wie ich mein Gesicht verziehe. In ein paar tiefen Atemzügen atme ich ein und aus, bis ich anschließend ein falsches Lächeln aufsetze und meinen Kopf wieder zu ihm drehe.
Um nicht länger dasitzen zu müssen, stehe ich auf und beende das Gespräch. »Ich muss jetzt wirklich aufs Klo«, sage ich, bevor ich mich im Bad einschließe.
Sobald die Tür hinter mir ins Schloss fällt, breche ich zusammen.
Ich weine nicht.
Ich habe schon viel zu viel geweint. Es fühlt sich so an, als hätte ich alle Tränen aufgebraucht und es sind keine mehr übrig.
Denk an was Schönes, Audrey.
Komm schon.
Ich schließe meine Augen und erinnere mich an ein Ereignis, das ich schon fast vergessen hatte.
»Audrey?«, flüstert Eleanor leise und blickt mich mit ihren wunderschönen, blauen Augen an. Der Wind streicht sanft durch unsere Haare und die Sonne prickelt auf unsere Gesichter. Wir sitzen gemeinsam auf einem Steg und es ist einer dieser Sommertage, die einem für immer in Erinnerung bleiben.
»Ja?«, antworte ich.
Ellie schmiegt sich an mich und legt ihren Kopf auf meine Schulter. »Versprich mir, dass wir für immer beste Freundinnen bleiben.«
Ich schaue sie durchdringend an. Natürlich wird sie für immer meine beste Freundin bleiben. Keiner könnte sie je im Leben ersetzen.
»Ich verspreche es«, murmle ich ihr ins Ohr.
Versprechen werden nicht nur gegeben, um sie zu brechen – nein. An ein Versprechen hält man sich, und zwar für immer. In jenem Moment habe ich keinerlei Zweifel, für mich steht es sowieso fest.
Eleanors Lippen verziehen sich ruckartig zu einem breiten Grinsen. Ich weiß, dass sie sich nun irgendetwas in den Kopf gesetzt hat – das erkenne ich ganz genau an ihrem Blick.
Ich liebe es, wie gut wir uns kennen. Ich denke, ich bin eine der Wenigen, die Eleanors Gedanken lesen kann. Das ist sehr vorteilhaft, da sie sich oft, selbst mir gegenüber, verschließt und ihre wahren Gefühle verbirgt. Obwohl es besser ist, nicht alles mit sich selbst auszumachen.
Grinsend blickt sie mich an. »Beweis es.«
Verwundert schaue ich zu ihr hinüber.
»Beweis mir, dass du es ernst meinst. Springe in den See.«
Nun schaue ich sie noch viel erstaunter als zuvor an und räuspere mich. »Wie? Jetzt?«
Sie nickt lächelnd und zuckt mit den Schultern. »Na, meinst du es jetzt ernst oder nicht?«, gibt sie neckend von sich.
Ich überlege noch einen kurzen Moment, aber was habe ich für eine Alternative? Schließlich tue ich das einzig Richtige, nehme Anlauf und springe samt meiner Klamotten in den See.
Als ich auftauche, lächelt sie breit und ich kann ein Grinsen nicht mehr unterdrücken. Das Wasser ist zwar ein bisschen kühl, aber das war es wert.
Ich schwimme an den Rand des Steges und strecke meine Hand nach ihr aus. »Kannst du mir wenigstens hochhelfen?«
Sie hält mich fest und will mir raushelfen, da ziehe ich sie zu mir ins Wasser. Als sie wieder auftaucht, sieht sie wie das glücklichste Mädchen auf Erden aus. Ab diesem Moment bin ich mir sicher, dass sie für immer meine beste Freundin bleiben wird.
Ich hole tief Luft und halte daran fest – an dieser Erinnerung.
Mit wackligen Beinen stehe ich wieder auf und bewege mich in die Richtung zur Toilette. Ich hätte nie gedacht, dass es mich einmal so viel Kraft kosten würde, alltägliche Dinge, wie den Toilettengang zu bewältigen. Aber nach jedem Schritt, den ich mache, werden meine Beine stetig schwerer. Es ist, als bestünden sie aus Blei und jedes Mal, wenn ich auftreten möchte, fühlt es sich noch gewichtiger an als zuvor.
Ich muss am Montag wieder in die Schule und habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Meine angeblichen Freunde haben sich kein einziges Mal bei mir gemeldet, obwohl sie haargenau wissen, was passiert ist.
Ich meine bei Asher kann ich es noch verstehen, wir sind nicht so eng und kennen und noch nicht lange, aber was ist mit den Anderen? Was ist mit meinen Freunden, welche ich schon so lange an meiner Seite habe?
Generell hat mein Handy schon seit Tagen keinen Ton mehr von sich gegeben, was auch gut ist – ich will kein Mitleid. Aber mitzubekommen, wie wenig ich meinen Freuden wirklich wert bin, tut schon etwas weh. Also um der harten Wahrheit ins Gesicht zu sehen – ich habe keine Freunde. Nicht mehr.
Wenn ich nur daran denke, alle wiedersehen zu müssen oder auf der Straße ständig von Menschen die mich nicht einmal richtig kennen angesprochen zu werden, kommt mir die Kotze hoch.
Viele denken, wenn sie etwas wie: Herzliches Beileid, oder: Du schaffst das schon, sagen, würde mir das helfen, weil ich ja nicht alleine sei. Aber jedes Mal, wenn das jemand zu mir sagt, ist es, als würden sie mir ein Messer tiefer und tiefer ins Herz stoßen.
Ich war seit dem Unfall nur einmal draußen und das war, als ich zur Polizei musste, um zu schildern, was geschehen ist. Schon als ich aus der Haustür hinausgegangen bin, hat meine Nachbarin wehleidig zu mir herübergeschaut und mich mit: Herzliches Beileid, belagert.
Es war die Hölle. Wie wird es dann erst sein, wenn ich wieder in die Schule gehe?
2
Audrey
Der schlimmste Tag in meinem Leben.
Das wird definitiv der allerschlimmste Tag in meinem Leben.
Ich lag die ganze Nacht wach, konnte mich nicht regen und fühlte mich, als wäre ich festgefroren. Die ganze Zeit habe ich mir Gedanken gemacht, was ich sagen soll. Ich möchte mich nicht verabschieden, denn dieses Mal bedeutet es für immer. Eleanor verdient eine schöne Beerdigung. Aber so gerne ich auch eine Rede geschrieben hätte, schaffe ich es psychisch nicht und dafür hasse ich mich so sehr.
Schlaf habe ich auch wieder einmal keinen bekommen, wie eigentlich fast jede Nacht. Wenn ich dann doch kurz die Augen geschlossen habe, wurde ich von Albträumen verfolgt. Immer wieder derselbe Traum – immer wieder dieser grauenhafte Abend – und nie habe ich sie gerettet.
»Audrey, aufstehen«, ruft meine Mutter laut. Sie zieht den Rollladen hoch, öffnet das Fenster und schnappt mir die Decke weg.
Die Sonnenstrahlen treffen mich und brennen, aufgrund der Helligkeit, in meinen Augen. Ich fühle mich so schlapp und mir wird ganz übel, wenn ich daran denke, was mir heute bevorsteht. Am liebsten würde ich den ganzen Tag in meinem Bett bleiben – mein ganzes Leben.
»Um halb zehn essen wir, bis dahin hast du geduscht und dein Bett gemacht – jetzt ist fertig mit Faulenzen«, gibt sie harsch von sich und seufzt laut.
Meine Mutter ist von mir enttäuscht – das weiß ich selbst. Ich bin nicht so, wie sie sich ihr Kind vorgestellt hat, und ich bin auch selbst frustriert, dass ich nicht so sein kann, wie sie es sich wünscht. Aber das ist nicht nur seit dem Unfall so, es war schon davor immer so gewesen.
»Ich weiß echt nicht, was ich tun soll«, höre ich meine Mutter reden.
Leise schließe ich die Tür hinter mir, sodass meine Eltern nicht merken, dass ich wieder zuhause bin.
»Mach dir keine Sorgen, das ist sicherlich nur die Pubertät.«
Ich verdrehe meine Augen, als ich die Worte meines Vaters höre.
Die Pubertät, bla, bla, bla.
»Ich denke nur, manchmal wäre es einfacher ohne diesen ganzen Stress«, sagt meine Mutter.
Dieser ganze Stress – also ich.
Sie legt die Stirn in Falten und sieht erschöpft zu meinem Vater. »Nun sag doch auch etwas. Ich muss immer die Böse sein, nur weil ich das ausspreche, was wir beide denken.«
Mein Vater setzt sich auf den Hocker in der Küche und sieht gestresst aus. Er öffnet den Mund und möchte etwas sagen, doch da spricht meine Mutter aufgebracht weiter. »Sie sollte mehr Respekt haben. Ich denke, Audrey vergisst, wer hier die Eltern sind. Ich meine, wirklich. Es geht nicht, dass wenn ihr beisammen seid, du dich wie ihr Freund benimmst. Erziehung ist hart und muss streng sein. Wenn ihr keine Grenzen gesetzt werden, wo soll das denn dann noch hinführen? Du solltest einmal deine Erziehungsmaßnahmen überdenken und vielleicht ein bisschen strenger sein.« Verurteilend blickt sie meinen Vater an. Ich kann dabei die Enttäuschung in ihren Augen erkennen.
Das möchte ich nicht sehen und ich möchte auch nichts weiter hören – nein. Ich bemühe mich so sehr, meiner Mutter gerecht zu werden, aber nie entspricht es ihren Vorstellungen. Ich tue das, was sie verlangt, jedoch findet sie immer irgendwas, das ich falsch gemacht habe.
»Ich denke nicht, dass das alles stimmt. Wir sind schon sehr streng mit Audrey, aber ein bisschen Liebe darf sie ja wohl noch spüren«, entgegnet mein Vater.
Ein bisschen Liebe darf sie ja wohl noch spüren.
Papas Worte brechen mir mein Herz.
Nochmal und nochmal – immer wieder aufs Neue.
Noch einmal sieht mich meine Mutter mit einem Blick voller Enttäuschung an, dann verschwindet sie.
Nachdem ich es endlich geschafft habe zu duschen, gehe ich ins Wohnzimmer und setze mich an den Tisch.
»Du isst den ganzen Teller leer, sonst magerst du mir noch ab«, ermahnt mich meine Mutter mit warnendem Blick. Schweigsam setze ich mich und fange an, das Essen runter zu würgen.
»Dein Vater ist heute bei der Arbeit, er kann nicht mitkommen. Wenn du aufgegessen hast, ziehst du dein Kleid an, schminkst dich und dann gehen wir zur Beerdigung.«
Ich nicke schwer.
Die Worte aus ihrem Mund kommen mir so surreal vor.
Beerdigung. Es hört sich unrealistisch an, als wäre das nur ein böser Albtraum.
»Vergiss nicht, deine Rede mitzunehmen«, erinnert mich meine Mutter.
Ich spiele mit dem Essen in meinem Mund und beiße verlegen auf meine Lippe. Nach kurzer Zeit antworte ich zögernd. »Ich habe Keine.«
Ihre Augen werden groß und ihr Gesicht rot. Meine Mutter ballt ihre Hände und ich sehe genau, wie sie sich zurückhalten muss, nicht handgreiflich zu werden.
»Wie du hast Keine? Du hattest die ganzen zwei Wochen Zeit, Eine zu schreiben. Willst du mich jetzt auch noch vor allen anderen blamieren?«, fragt sie außer sich.
Ich habe Angst ihr die Wahrheit zu sagen. Denn wenn ich ihr erzähle, dass ich keine Kraft dazu habe, wird sie sagen, ich sei faul. Es zählt nicht, was ich denke, wie es mir geht oder was ich sagen will. Ich muss das tun, was sie möchte.
»Es tut mir leid, ich habe es vergessen«, flüstere ich.
Das ist zwar nicht ganz die Antwort, welche meine Mutter hören will, aber immerhin ist diese Ausrede besser, als der eigentliche Grund.
»Du blamierst mich nicht vor den Gästen. Schreibe noch Eine«, gibt sie schroff von sich.
Ich sehe sie mit einem gezwungenen Lächeln an und nicke. Damit stellt sie sich zufrieden und ich sehe, wie sich ihre Faust lockert.
Nachdem ich aufgegessen habe, verschwinde ich in meinem Zimmer. Ich will nicht. Kurz denke ich darüber nach, mich einzuschließen und abzuwarten, bis dieser Tag ein Ende nimmt. Doch dann denke ich an Eleanor – was mehr schmerzt als alles andere auf dieser Welt. Ich bin mir sicher, sie hätte gewollt, dass ich auf ihrer Beerdigung bin und ich bin mir sicher, dass sie sich freuen würde, wenn ich eine Rede halten werde.
Ich atme tief durch, hocke mich an meinen Schreibtisch und setze zum Schreiben an. Alles nur für dich, Eleanor. Anfangs fällt es mir schwer, die richtigen Worte zu finden, aber nach kurzer Zeit fallen mir immer mehr Sachen ein, welche noch ungesagt sind.
Hin und wieder läuft mir doch eine Träne über die Wange, obwohl ich eigentlich nicht dachte, dass ich im Stande bin, je nochmal in meinem Leben zu weinen.
Zitternd lasse ich den Stift fallen.
3
Audrey
»Das ist ein Desaster. Das Kleid ist dir viel zu groß. Sieht aus wie ein Kartoffelsack«, ertönt die Stimme meiner Mutter. Sie zupft an mir herum und rümpft angestrengt ihre Nase.
Ja, ich habe innerhalb den letzten Wochen ein bisschen abgenommen. Aber nicht, weil ich das wollte, sondern da ich es nicht mehr schaffe, zu essen. Der Hunger ist wie weggeblasen und ich muss mich regelrecht zwingen, etwas zu mir zu nehmen, um überhaupt zu Kräften zu kommen.
Meine Mutter schüttelt enttäuscht den Kopf. »Vielleicht kann ich es hinten schnell zusammennähen, dann passt es bestimmt besser.«
Ich nicke nur leicht mit dem Kopf, ohne ihre Worte zu registrieren. Sie zehrt an meinen Haaren herum, um mir eine Frisur zu machen, näht das Kleid um, sodass ich hineinpasse, und wir sind fertig.
Jetzt geht es gleich los, verinnerliche ich. Ich werde mit meiner Mutter zusammen aus dem Haus gehen – zum Friedhof – zu Ellies Beerdigung.
»Beeil dich, wir wollen ja nicht zu spät kommen«, schimpft sie gestresst und blickt mich warnend an.
»Ich komm ja schon«, erwidere ich geschlagen und steige schnell ins Auto. Mit meinem Kopf angelehnt an der Fensterscheibe, schließe ich meine Augen.
Ich muss stark sein.
Für sie.
Für Eleanor.
Als wir ankommen, haben sich schon ein paar Menschen versammelt. Es sind nicht viele. Ihre Eltern und ihre große Schwester, ein paar Verwandte und Bekannte, aber keiner von unseren Freunden ist in Sicht.
Ein Kloß bildet sich in meinem Hals. Zum Glück konzentrieren sich die Menschen hier eher auf Eleonores Familie, sodass ich gar nicht groß auffalle.
Wir betreten die kleine Kapelle vor dem Friedhof und ich erstarre. Mein Blick liegt auf ihrem toten Körper. Sofort erscheinen die Bilder von dem Abend vor meinem inneren Auge.
Überall Blut – ihr Blut. Ich presse ihre Hand an meine Brust. Eiskalt. Ihr lebloser Körper in meinen Armen. Sie ist gestorben – in meinen Armen.
»Beweg dich.« Die dringliche Stimme meiner Mutter bringt mich wieder in die Wirklichkeit zurück. Ich spüre ihre Hand in meinem Rücken und fühle, wie sie mich voran schiebt.
Wir setzen uns auf eine Bank und warten auf den Pfarrer.
Ich kann nicht aufhören sie anzustarren.
Ich starre. Wieder.
Mein Blick fällt auf Ellies Eltern, welche weinend vor dem Sarg stehen. Es muss sehr schlimm sein, ein Kind zu verlieren – ein Kind, welches gerade einmal sechzehn Jahre alt war.
Ich erkenne Eleanors Schwester. Sie sitzt ein paar Reihen vor mir.
Sie weint nicht – nein, sie sitzt nur da.
Sie starrt – so wie ich.
Der Pfarrer betritt den Raum, es wird ruhig in der kleinen Kapelle und alle Angehörigen nehmen Platz. Ich bemerke, wie er Worte von sich gibt, aber ich höre nicht zu – ich kann nicht. Ständig muss ich zu Ellie schauen.
Noch ein letztes Mal blicke ich sie an, aber nun ist es so weit, der Sarg wird geschlossen und hochgehoben. Alle stehen auf und zusammen laufen wir den Sargträgern hinterher.
Eleanor wird in die Erde eingelassen und es fühlt sich an, als würde man mir das Herz herausreißen. Wir werfen Blumen auf den Sarg und Eleanors Eltern halten eine Rede.
Es fühlt sich nicht real an – nichts davon.
Alles ist nur ein schrecklicher Traum.
»Audrey, möchtest du auch noch ein paar Worte sagen?«, fragt mich Miss Wheeler.
Ich zucke bei ihren Worten schreckhaft zusammen.
»Ja, will sie«, antwortet meine Mutter für mich und gibt mir einen kleinen Klaps, sodass ich aufstehe. Mit wackligen Beinen laufe ich nach vorne.
Jetzt ist es an der Zeit mich bei ihr zu verabschieden – für immer. Aber es ist nicht nur das, sondern mich beunruhigen auch, die ganzen Menschen, die mir dabei zuhören werden. Die ganzen Menschen, die sehen, wie schwach ich werde. Sie sehen mir zu und dabei habe ich noch nicht einmal geübt.
Miss Wheeler drückt mich kurz, bevor sie sich wieder hinsetzt. Jetzt stehe ich da vorne, vor all den Leuten und werde mich von ihr verabschieden.
»Wir haben uns heute hier versammelt, weil wir eine geliebte Person verloren haben. Sie war eine Tochter, eine Schwester, eine Bekannte, eine Verwandte, aber vor allem meine beste Freundin. Sie war ein wundervoller Mensch. Immer wollte sie das Beste für die Anderen und hat sich erst als Letztes um sich selber gekümmert. Sie war hübsch – wunderschön. Ihre Grübchen in den Wangen, wenn sie lachte, erhellten mir meinen Tag. Ihre Augen, so blau wie der Ozean und ihre Haare, so blond wie eine Weide. Ich sehe sie vor mir am Strand, wie ihre Haare im Wind wehen und sie–«, meine Stimme bricht ab.
»–sie glücklich ist. Eleanor liebte es, zu backen. Ich weiß noch, einmal, da haben wir zusammen versucht, Schoko Muffins zu backen.« Ich lächle.
»Sie sind uns voll verbrannt. Aber nachdem wir die verkohlten, schwarzen Stellen abgeschnitten hatten, waren sie echt lecker und wir hatten eine Menge gelacht. Selbst in meinen schlechten Zeiten ist sie bei mir geblieben und hat mir Trost gespendet. Sie war immer für mich da und hatte alles für mich getan. Auch wenn ich nicht in der Stimmung war, zu lachen, brachte sie mich jedoch immer wieder dazu. Bei ihr konnte ich sein, wie ich wollte und konnte, ihr alles sagen.«
Weinend fahre ich fort. »Sie hat ihr Versprechen gehalten, Eleanor hat meine Geheimnisse mit ins Grab genommen. Vor fast neun Jahren haben wir uns kennengelernt. Ich bin gerade neu in die Stadt gezogen, weg von all meinen Freunden und meinem Zuhause. Ich kannte niemanden und an meinem ersten Schultag sah ich dann Eleanor. Sie saß in der zweiten Reihe und las in einem ihrer Bücher, als ich reinkam. Sie hob neugierig den Kopf und als die Lehrerin mich vorstellte, meldete sie sich freiwillig, um mir die Schule zu zeigen. Ich setzte mich neben sie und Eleanor lächelte mich verschmitzt an. Hier begann unsere Freundschaft. Seit diesem Tag sammelten wir viele, schöne Erlebnisse miteinander. Wir haben zusammen gelacht, aber auch geweint. Wie an guten als auch an schlechten Tagen. Sie hat mein Leben zu einem Besseren gemacht und dafür werde ich ihr für immer dankbar sein. Ich vermisse sie mehr als alles andere und ich denke, ich spreche hier für alle, wenn ich sage, dass sie etwas ganz Besonderes war. Sie liebte es, zu lesen, und ein Zitat fand sie besonders schön. Zu Ehren Eleanor lese ich es euch vor. Es stammt aus ihrem Lieblingsroman: »Wie die Ruhe vor dem Sturm«, von Brittainy C. Cherry. Ich bin mir sicher, sie hätte das gewollt:
»Man muss nicht erst über die Liebe sprechen, um zu wissen, dass sie existiert. Liebe wurde nicht erst real, wenn jemand es laut aussprach. Nein, Liebe saß vielmehr ganz still da, in den Schatten der Nacht, und heilte die Risse in unseren Herzen.«
Ich bin fertig – ich habe es geschafft.
Die Menschen applaudieren und selbst meine Mutter ist von meiner Rede gerührt. Ich erkenne, wie sie sich bemüht, nicht gleich mit dem Weinen anzufangen. Erst jetzt bemerke ich, wie sehr ich selbst weine. Wie angewurzelt bleibe ich stehen.
Meine Mutter kommt zu mir gelaufen und nimmt mich fest in den Arm. Ich bebe und ihr T-Shirt saugt sich mit meine Tränen voll.
»Du hast das sehr gut gemacht Schatz.« Sie dreht meinen Kopf nach oben. »Ich bin stolz auf dich.«
Und da waren sie – da waren die Worte, welche ich die ganze Zeit hören wollte. Es gibt mir ein gutes Gefühl.
Ich lächle leicht.
Meine Mutter lächelt zurück und zum ersten Mal seit langer Zeit fühle ich Geborgenheit.
4
Audrey
Heute beginnt wieder die Schule.
Ich habe Angst – Angst davor, was passiert und was das alles in mir auslösen wird.
Geschlafen habe ich natürlich – wie eigentlich jede Nacht – nicht viel und meine großen Augenringe sind nicht weniger geworden. Ich habe zwar wieder ein bisschen mehr Farbe im Gesicht, aber trotz allem sieht man mir noch genau an, dass ich viel durchmache.
Seufzend schaue ich auf mein Regal, auf dem noch das Make-up von Freitag liegt. Ich setzte mich an meinen Schreibtisch und beginne mit Concealer die dunklen Stellen unter meinen Augen zu überdecken.
Meinen Schulranzen habe ich, nach langem Diskutieren mit meiner Mutter, gestern schon gerichtet. Ich schmeiße den Ranzen über meinen Rücken und stelle ihn schon einmal in den Gang.
Als ich ins Wohnzimmer laufe, steht bereits ein Müsli auf dem Tisch. Neben der Schale liegt ein Zettel und ich erkenne die schöne Handschrift meiner Mutter.
Schönen Schultag, Audrey.
Musste leider kurzfristig bei der Arbeit für eine Kollegin einspringen. Wir sehen uns nach der Schule. Ich hole dich ab! Liebe Grüße, Kuss.
Das fängt ja schon mal gut an, jetzt muss ich mit dem Bus in die Schule fahren.
Bloß nicht in Panik geraten.
Ich bin am Überlegen, einfach nicht in die Schule zu gehen. Allerdings muss ich schließlich irgendwann wieder den Unterricht besuchen und wenn nicht jetzt, dann muss ich wann anders diesen grauenvollen, ersten Tag überstehen.
Da ich immer noch keinen Appetit habe, stehe ich nach dem zweiten Bissen auf und schütte den Rest meines Müslis weg. Ich ziehe mir eine Jeans und einen grünen Pullover an, bei dem Eleanor immer gesagt hatte, dass meine Augen dadurch viel besser zur Geltung kommen.
Als ich mich zum Gehen wende, atme ich noch einmal tief durch, setze meine Kopfhörer auf und übertrete die Türschwelle. An der Bushaltestelle angekommen, sehen mich manche mit mitleidendem Blick an. Ich stelle meine Musik auf ganz laut, sodass sie ja nicht denken, mich ansprechen zu müssen.
Im Bus lehne ich mit dem Kopf an der Fensterscheibe und sehe den Wassertropfen zu, wie sie langsam hinunterlaufen. Als Eleanor und ich noch ganz klein waren und zusammen lange Autofahrten an einem regnerischen Tag hatten, wetteten wir immer gegenseitig, welcher der Regentropfen als erstes unten im Ziel ankommt.
Sie hatte fast immer recht. In allem, was sie gesagt hatte, hatte sie fast immer recht. Wenn ich also etwas wissen wollte, ging ich nicht wie jedes normale Kind zu meinen Eltern, sondern fragte sie. Wenn sie es mir erklären konnte, war ich froh darüber. Wenn nicht, empfand ich es nicht mehr als wichtig, da sie es auch nicht wusste.
Der Bus stoppt an meiner Haltestelle, woraufhin ich aussteige. Langsam laufe ich der Schule entgegen und bei jedem Schritt, den ich gehe, wird mir ein bisschen mehr übel.
Ich betrete das Schulhaus und einige Augen starren mich an. Diesmal bin es nicht ich die starrt – nein. Es sind sie – sie alle. Ich habe das Gefühl, als würde jeder in diesem Raum auf mich schauen und sich denken, wie froh sie ja seien, dass ihnen so etwas nicht passiert ist. Oder sie sind einfach mit ihren eigenen Problemen beschäftigt.
Mir schwirren bestimmt viel zu viele Gedanken im Kopf herum und ich steigere mich dort hinein. Denn ich glaube, dass dies nicht einmal so viele mitbekommen haben, höchstens die aus meiner Stufe.
Ich höre wie ein Mädchen aus meinem Physikkurs an mir vorbeilaufen und leise: Mein Beileid, nuscheln. Gekonnt ignoriere ich es und laufe die Treppen hoch. Schwer schluckend stoße ich die Tür zu meinem Kursraum auf.
Kaum komme ich hinein, erblicke ich meine Freunde – Eleanors und meine Freunde. Ich sehe wie sie lachend beieinandersitzen. Es ist ja nicht so, als wäre Eleanor vor rund zwei Wochen gestorben. Und sie? Was machen sie? Sie haben den Spaß ihres Lebens. Und das sollen meine Freunde sein?
Als mich Adam erblickt, stößt er seine Freunde an, um ihnen zu signalisieren, dass ich wieder da bin. Alle verstummen daraufhin, nun lacht keiner mehr.
Fünf Augenpaare landen auf mir.
Ich stehe immer noch wie angewurzelt in der Tür, als sie zu mir laufen.
»Hey«, begrüßt mich Celine zögernd.
Ich antworte mit einem kurzen Nicken – in dem Moment bin ich viel zu aufgebracht, um sie freundlich zu begrüßen.
»Wir wollten eigentlich zu Eleanors Beerdigung kommen, aber Jayden hat dort seinen Geburtstag gefeiert und nun ja, wir fanden es bisschen unhöflich, seine Einladung abzulehnen«, meldet sich jetzt Adam zu Wort.
Unhöflich? UNHÖFLICH? Es ist unhöflich, nicht bei der Beerdigung seiner Freundin aufzutauchen und dann dies als Entschuldigung anzusehen – nein, es ist unverschämt.
Ich bin kurz davor, sie alle zu erwürgen – ganz ehrlich. In diesem Moment bin ich nicht mehr traurig, ich bin wütend und enttäuscht. Wir haben keinerlei Bedeutung für sie. Ellie und ich sind ihnen kein Stück wichtig. Wie konnten wir früher nur mit ihnen befreundet sein?
Wären sie echte Freunde, würden sie alles stehen und liegen lassen, um zu ihrer Beerdigung zu kommen. Es ist ja nicht mal so, dass sie zu traurig waren, um dort zu erscheinen, nein. Es war ihnen schlichtweg egal. Sie haben Eleanor schon längst vergessen.
Ich antworte ihnen nicht und laufe mit gesengtem Kopf an meinen Platz. Das ist wirklich noch schlimmer als die Hölle.
Joey sieht mich entschuldigend an – ein Blick voller Mitleid. Ich denke, im Herzen ist er kein schlechter Freund, er wird nur von den anderen beeinflusst. Was aber noch lange keine Entschuldigung ist.
»Wie willst du das denn schaffen?«, frage Joey mit großen Augen und öffnet seinen Mund, um ein Stück seines Schokoriegels abzubeißen.
Ich zucke mit den Schultern und blicke zu Eleanor. »Ich kann das, nicht wahr Ellie?«
Sie nickt eifrig mit dem Kopf und blickt schlussendlich ebenfalls zu Joey. »Einmal haben wir das auch gemacht. Ich habe aufgepasst, dass niemand kommt, und Audrey hat schnell den Brief in den Schulranzen gesteckt.«
Joey sieht uns immer noch ein bisschen unschlüssig an.
»Zeig mal her, was du bis jetzt hast«, sage ich und nehme ihm den Brief aus der Hand. Ich überfliege seinen Text und sehe ihn daraufhin zufrieden an. »Das ist gut. Sie wird es lieben«, sage ich und stecke den Liebesbrief in einen Umschlag.
»Wenn Carla den Brief nachher sieht, wird sie bestimmt antworten«, gibt Ellie kichernd von sich, wodurch ihre Grübchen zum Vorschein kommen.
»Ich weiß nicht. Was ist, wenn sie nicht will? Ich habe gesehen, wie sie mit Ilyes Händchen gehalten hat.« Oh, Joey.
»Die findet dich bestimmt auch süß. Wir machen das jetzt. Du wirst uns danken«, kommt es von mir uns kaum, dass Joey reagieren kann, rennen Eleanor und ich lachend weg.
Nervös spiele ich mit einem Stift zwischen meinen Fingern. Eine Mischung der Gefühle kommt in mir hoch und ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
Die Tür öffnet sich, jeder setzt sich schnell an seinen Platz und unsere Geographielehrerin – Frau Rodriguez – betritt den Raum.
Schnell senke ich meinen Kopf, um möglichst keinen Blickkontakt mit ihr aufzubauen, aber das hindert sie nicht. Im Augenwinkel erkenne ich ihre Schuhe, welche sich immer näher in meine Richtung bewegen. Ich spüre, wie sie nur darauf wartet, bis ich zu ihr hochsehe.
Mist.
»Miss Andersen, würden sie bitte ihre Kopfhörer abziehen?«
Hektisch ziehe ich sie mir vom Kopf. »Ja, tut mir leid«, murmle ich.
»Lassen sie das nicht noch einmal vorkommen«, gibt sie mit einer leicht hörbaren Arroganz von sich. Wieso muss sie mich gleich an meinem ersten Tag so demütigen. Hat sie denn keinerlei Mitgefühl?
»Ich habe von Eleanor gehört und es tut mir außerordentlich leid, dass man so etwas, in so jungen Jahren, durchstehen muss. Das geht an euch alle.« Bei ihren letzten Worten dreht sie ihren Kopf zu den anderen aus unserem Kurs und sieht jeden mit mitleidigem Blick an.
Das ist definitiv zu viel.
Ich stürme aus der Tür und schließe mich in der Mädchentoilette ein. Heulend sitze ich auf dem dreckigen Boden der Kabine. Ich bin nicht die Einzige, welche ihre Freundin verloren hat, alle anderen doch auch. Also wieso muss sie sich genau an mich wenden? Weil ich bei ihrem Tod dabei war? Ich wage nicht einmal, weiter darüber nach zu denken.
Es. Ist. Zu. Viel.
5
Audrey
Samstagabend.
Eleanor und ich sind auf einer Party auf einer Hütte im Wald. Ein paar Jungs machen uns mit kitschigen Sprüchen an und wir trinken vielleicht ein, zwei Shots zu viel.
Wir tanzen miteinander und haben den Spaß unseres Lebens. Als dann aber plötzlich die Polizei kommt, gerät jeder in Panik. Alle fahren so schnell sie können weg. Auch unser Fahrer verschwindet – ohne uns. Wir haben kein Auto – nichts. Also rennen wir – wir rennen in den Wald hinein.
Ich werde aus meinen Gedanken gerissen, denn es klopft sachte an der Toilettenkabine.
»Hey, ich wollte nur sagen, dass wir jetzt kein Geographie mehr haben, also keine Frau Rodriguez mehr.«
Schnell wische ich mir die Tränen von meinem Gesicht und stehe auf. Daraufhin streiche ich meinen Pulli glatt, bevor ich zögernd die Tür aufschließe.
Vor mir steht Celine und kaum, dass ich etwas sagen kann, nimmt sie mich auch schon in den Arm. Vielleicht ist sie doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Das habe ich so sehr vermisst und ich bin es leid, immer stark zu sein. Ich lasse mich fallen und meine Tränen fließen nun in ihr T-Shirt.
Was wäre, wenn …?
Was wäre, wenn …?
Was wäre, wenn …?
Diese Fragen quälen mich ununterbrochen. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn wir nicht weggerannt wären. Ich frage mich, was geschehen wäre, wenn wir an diesem Abend zuhause geblieben wären. Ich frage mich, ob sie noch leben würde, wenn ich etwas unternommen hätte.
So sehr ich auch versuche, mich auf den Unterricht zu konzentrieren, es gelingt mir nicht. Ich schweife dauernd in Gedanken ab.
Was hat ihr Tod nur mit mir gemacht? Ich erkenne mich kaum wieder. Ständig ist mir zum Heulen zumute und auch, wenn ich ein sehr optimistischer Mensch bin, fällt es mir in diesem Augenblick schwer, positiv zu denken.
Im Grunde weiß ich, dass ich das schaffen werde – ich bin stark. Irgendwann werde ich lernen, wie ich mit diesem Schmerz umgehen kann, doch jetzt ist die Zeit noch nicht gekommen.
Audrey, bleib stark.
Für Eleanor.
Und für dich selbst.
»Haben wir die Bestandteile des Blutes nicht schon früher durchgenommen?« Die Stimme meines Mitschülers reißt mich aus meinen Gedanken.
Blut.
Blut.
Blut.
Ich blicke starr auf meine Hand hinunter. Blut fließt meinen Arm entlang und tropft auf den Boden.
Ihr Blut – Eleanors Blut.
Ich ringe nach Luft, aber mein Hals ist geschnürt.
Ich bekomme keine Luft.
Ich bekomme keine Luft.
Ich bekomme keine Luft.
Hilft mir denn niemand?
»E-El…Eleanor.« Zitternd lege ich meinen Zeige- und Mittelfinger auf ihre Halsschlagader – kein Puls.
Kein Puls.
Kein Puls.
Kein Puls.
Der Schultag naht sich zwar dem Ende, jedoch starre ich ununterbrochen auf die Uhr, in der Hoffnung, dass die Zeiger sich noch schneller bewegen. Fünf Minuten, welche sich allerdings wie eine halbe Ewigkeit anfühlen – länger dauert es nicht mehr, bis dieser Schultag endlich zu Ende geht.
Wenn ich den heutigen Tag Revue passieren lasse, war es eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe, es war noch schlimmer. Aber nun bin ich hier und habe den Tag durchgestanden. Das wird nun also mein neues Leben? Jeden Tag aufs Neue durchstehen und hoffen, dass es irgendwann besser wird?
Manchmal denke ich nach, wie es später sein wird – ob der Schmerz jemals nachlässt. Aber selbst der Gedanke, fühlt sich wie ein Verrat an – als würde ich Eleanor vergessen.
Ich hatte zuvor noch nie so starke, negative Gefühle. Also woher soll ich wissen, wie ich damit umgehen soll? Niemand hilft mir damit – ich bin ganz auf mich alleine gestellt.
Schlagartig werde ich aus meinen Gedanken gerissen – die Klingel läutet. Das bedeutet, dieser Horror ist nun endlich zu Ende. So schnell ich kann, packe ich meine Schulsachen zusammen und stürme aus dem Raum. Eilig drängle ich mich an der Menschenmasse vorbei, um schnellstmöglich aus der Schule herauszukommen.
Ich spüre regelrecht, wie sich langsam eine Last von meinen Schultern löst und auch, wenn das hier nur der Anfang ist, bin ich dennoch froh, den ersten Schultag überstanden zu haben.
»Audrey«, höre ich jemanden meinen Namen rufen. Diese Stimme kommt mir bekannt vor.
Sehr bekannt.
Zu bekannt.
Ein Schauer läuft mir über den Rücken, ich halte die Luft an und innerhalb von Sekunden drehe ich mich um.
Ich erstarre wie Eis.
Vor meinem Auge erblicke ich Eleanor, wie sie blutbeschmiert auf dem Boden liegt.
Ihre Augen – geschlossen.
Ihre Hände auf dem Boden – regungslos.
Ich erkenne eine fremde Person, welche nervös von einem auf den anderen Fuß steigt.
In Panik. Diese Person ist in Panik.
Schon von weitem höre ich die Sirenen des Krankenwagens und gleich dahinter die Polizei.
Und dann erkenne ich auf einmal mich, wie ich blutbeschmiert vor Eleanor niederknie. Ich schreie furchtsam und blicke sie mit tränenüberströmtem Gesicht an. »Du darfst jetzt nicht sterben«, höre ich mich immer wiederholen.
Einen Schritt mache ich auf uns zu. Ich nähere mich Eleanor, um ihr zu helfen – sie noch einmal zu berühren, aber auf einmal ist alles weg. Keine Eleanor mehr, kein fremder Mann, niemand.
Ich bin wieder im Hier und Jetzt.
Immer noch regungslos, stehe ich auf dem Pausenhof. Habe ich mir das eben nur eingebildet? Es kam mir doch so echt vor.
Erst jetzt bemerke ich, wie sehr ich an meinem ganzen Körper zittere. Langsam realisiere ich, wie sich ein Kreis aus Menschen um mich gebildet hat. Menschen, die ich nicht kenne.
Panik kommt in mir hoch.
Ich kann nicht mehr klar denken. Werde ich nun etwa verrückt? Ich bezweifle, dass ich es je schaffen werde, wieder Freude im Leben zu finden, und dieses Ereignis zieht mich gerade enorm zurück – ganz tief in ein schwarzes Loch hinein.
Es kommt mir so vor, dass jedes Mal, wenn ich einen kleinen Fortschritt mache, wieder irgendetwas passiert und ich nochmal ganz von vorne anfangen muss. Das heute war alles zu viel für mich. Erst die Sache in Geographie und jetzt noch diese Erscheinung.
Es dauert nicht lange, bis mein zitternder gesamter Körper zusammenbricht, und ich zu weinen beginne. Ich möchte stark sein, möchte alle Gefühle zurückhalten, aber meine Beine tragen mich nicht mehr und die Tränen strömen nur so aus mir heraus.
Auf einmal spüre ich eine Berührung.
Eine echte Berührung!
Ich weiß nicht wer und ich weiß auch nicht warum, aber jemand nimmt mich von hinten in den Arm und stützt mich. Auch wenn das absurd kling, gibt es mir Kraft, da ich mich nun nicht mehr ganz so einsam fühle.
Langsam werden die Abstände meiner Schluchzer immer länger und ich zittere nun nur noch ein bisschen. Behutsam hebe ich den Kopf und sehe in die Menschenmenge. Bedächtig drehe ich mich um und die Person, welche ich dort sehe, ist niemand, den ich kenne.
Nein.
Ein fremder Junge hält mich in seinen Armen.
Ich weiche ein bisschen zurück, aber er scheint sofort zu verstehen, und löst seine Hände von mir.
Schweigend betrachte ich ihn.
Er hat dunkles Haar, grüne Augen, genauso wie ich, nur der Unterschied ist, dass seine viel dunkler sind, und trägt einen schwarzen Pullover mit einer blauen Jeans.
In meinem Jahrgang ist er bestimmt nicht, ich würde ihn zumindest vom Sehen her kennen und junger sieht er auch nicht aus. Ich schätze, er ist eine Stufe über mir.
Der Junge blickt mich besorgt an und gerade, als er seinen Mund öffnet, werde ich weggezogen.
»Audrey was ist hier los? Komm, wir gehen«, höre ich die ernste Stimme meiner Mutter. Ich erkenne in ihren Worten keinerlei Mitleid – sie sind nur eiskalt und voller Scham.
6
Easton
Ein paar Minuten zuvor.
»Matt, hier«, rufe ich. Eilig umgehe ich meine Gegner und stehe nun frei. Geschickt passt Matt mir den Ball zu, ich renne vor ins Feld der anderen Mannschaft und bin nun keine zwanzig Meter mehr vom Tor entfernt.
Hastig schweift mein Blick zu der Anzeigetafel, welche noch acht Sekunden indiziert. Es ist momentan Gleichstand und wenn ich das Spiel noch gewinnen will, muss ich jetzt treffen. Ich weiß, was ich kann und ich kenne meine Grenzen. Allerdings bin ich mir unsicher, ob die Zeit noch reicht, näher nach vorne zu rennen.
Als mein Blick zum Tor schweift, sehe ich, wie sich davor langsam eine Mauer aus Menschen bildet und es gibt keinen meiner Mitspieler, welchem ich passen könnte.
Ich höre, wie mein Name immer wieder gerufen wird, um mich anzufeuern. Trotz, dass die Chance sehr gering ist, gehe ich einen Schritt zurück, um Anlauf zu nehme und schmettere den Ball direkt nach vorne.
Alle sehen ihm gespannt nach.
Den Ball habe ich in einem perfekten Winkel geschossen, sodass er geradeaus durch die Menschenmauer fliegt und mitten im Tor landet.
Es ertönt ein lauter Pfiff und das Spiel ist beendet.
Wir haben drei zu zwei gewonnen.
Ein paar meiner Mitspieler kommen auf mich zu, klopfen mir auf die Schulter und klatschen mich freudig ab. Ich grinse schief, doch nach kurzer Zeit mache ich mich auch schon auf den Weg zur Umkleide. Hastig ziehe ich mich um und laufe schleunigst nach draußen um den Bus rechtzeitig zu schaffe. Jeden Montag ist es immer das Gleiche und jedes Mal bin ich so in Eile.
Als ich den Schulhof überquere, erblicke ich, wie sich vor dem Schuleingang eine Menschenmasse bildet. Es schadet sicher nicht, kurz nachzusehen, was dort vor sich geht.
Mit großen Schritten laufe ich nach vorne, um mir das Spektakel von nahem anzusehen.
Und dort sehe ich sie.
Mir läuft ein Schauer über den Rücken, als ich sie erblicke. Panik steigt in mir auf. Ich hatte gehofft, sie nie wieder zu sehen und nun geht sie auf dieselbe Schule wie ich? Wie konnte ich sie nie bemerken? Ich meine, innerhalb dieser acht Jahre hätte ich sie doch mindestens einmal sehen müssen. Wobei ich sie damals ja noch nicht einmal kannte. Allerdings würde ich mich erinnern, hätte ich sie früher schon einmal gesehen.
Nun steht sie dort, wie erstarrt, und ich kann nichts dagegen unternehmen. In meinem Körper fängt sich alles an zu drehen und ich stütze mich an der Wand hinter mir ab.
Das kann nicht sein – das darf nicht sein.
Ich gehe noch ein paar Schritte in ihre Richtung, um ihr näher zu sein.
Still sehe ich sie an. Sie sieht anders aus, seit ich sie das letzte Mal gesehen habe, aber immer noch sehr hübsch. Scheiße, wieso denke ich hierbei daran, ob sie gut aussieht? Ich sollte ihr helfen und nicht wie alle anderen ratlos dastehen.
Selbst wenn sich alles in meinem Körper sträubt, in ihre Nähe zu gehen, laufe ich zu ihr. Es ist fast so, als würde sie mich wie ein Magnet anziehen. Ein so festes Verlangen, das all meine Bedenken weitaus übertrumpft.
Ich dränge mich an den Personen vorbei, bis ich schließlich vor ihr stehe. Mein Herz erschüttert. Sie so zu sehen ist grauenvoll. Ich erkenne ganz genau, wie sie am ganzen Körper zittert und ich wünschte, ich könnte ihr diesen Schmerz nehmen.
Ich weiß, wie sie sich gerade fühlen muss. Jahre vor ihr habe ich diesen Schmerz schon erlitten. Tag für Tag – immer wieder aufs Neue. Mein Körper zieht sich jedes Mal ein bisschen mehr zusammen, wenn ich daran denke.
Es tut weh – verdammt weh.
Ich denke, das ist auch der Grund, weshalb ich mich nun entschieden habe, zu ihr zu gehen. Als ich klein war, habe ich selbst jemanden gebraucht, der mich versteht und bei mir ist. Ich möchte nicht, dass sie das alleine durchstehen muss. Zumindest nicht den Anfang.
Behutsam lege ich meine Hand an sie. Es fühlt sich gut an, sie zu berühren, auch wenn es das nicht sollte. Ich weiß nicht einmal, ob das für sie in Ordnung ist, immerhin kennt sie mich nicht, aber nun ist kein guter Zeitpunkt um nachzufragen.
Sie sackt in sich zusammen und fällt schluchzend auf den Boden. Gemeinsam mit ihr gehe ich zu Grunde und nehme sie schließe in meine Arme.
Ich halte sie.
Sie reagiert nicht auf meine Berührungen, also lasse ich sie auch nicht los. Ich bin bei ihr, um ihr das Gefühl zu geben, nicht alleine zu sein. Da ich ihr so nah bin, kann ihren Herzschlag spüren und ich fühle ihren Schmerz.
Es ist so seltsam, dass sie mir jetzt so nah ist. Ich weiß, es darf nicht so sein. Mein Verstand sagt mir, ich sollte alles andere als das machen, aber mein Bauchgefühl vermittelt mir, dass ich das Richtige tue.
Die Abstände ihrer Schluchzer werden länger und das Zittern nimmt immer mehr ab. Alle sehen uns an – wie ich diese Personen im Moment hasse. Sie sollen entweder etwas unternehmen oder sich um ihre eigenen Probleme kümmern. Am liebsten würde ich aufstehen und ihnen sagen, sie sollen verschwinden, aber das würde nur noch demütigender für sie werden, also lasse ich es lieber.
Voller Konzentration lausche ich ihrem Atem – er ist ungleichmäßig und sagt doch so viel aus. Ich erinnere mich noch genau an früher. Tagelang hatte ich mich in meinem Zimmer eingeschlossen und wollte weder essen, noch trinken. Ich hatte sehr viel nachgedacht und wusste nicht, wie ich je aus diesem Teufelskreis herauskommen sollte.
Niemand war für mich da – niemand half mir, wieder normal weiterzuleben. Wie sollten sie denn auch helfen? Meine Geschwister hatten ebenfalls den gleichen Schmerz wie ich durchlitten. Ich hatte keinen, der mir verriet, wie ich damit umgehen kann.
Das war ich ganz alleine – ich hatte ohne jene Hilfe mein Leben wieder in den Griff bekommen und das ist definitiv nicht fair. Es hat mich meine Kindheit gekostet. Dieser Lebensabschnitt wurde mir einfach weggenommen, ohne dass mich jemand danach gefragt hatte.
Eine Träne fließt mir von der Wange.
Schnell wische ich sie mit meiner freien Hand weg.
Niemand soll sehen, dass ich verletzlich bin und schon gar nicht sie. Wenn ich sie an mich heranlasse, zerstört das meine Mauer, welche ich um mich herum aufgebaut habe. Sie dient zu meinem eigenen Schutz. Wenn ich niemanden an mich heranlasse, kann mich auch niemand verletzen.
Das Mädchen dreht sich zu mir um und blickt mir direkt in die Augen. Wir sind uns nun so nahe, dass ich spüren kann, wie ihr Atem sanft an mir vorbei haucht.
Ich merke, dass sie sich unwohl fühlt, also lasse ich sie augenblicklich los. So etwas spüre ich sofort. Meine Schwester hat früher immer zu mir gesagt, es sei eine Gabe. Der Männerschwarm aller Frauen, der genau weiß, was sie wollen.
Aber ich sehe dies als normal an. Man muss sich in die Personen hineinversetzten und erst dann kann man ihre Gefühle nachvollziehen.
Es ist wie, als würdest du in einem Tagebuch lesen wollen, ohne den Schlüssel dafür zu besitzen. Du siehst zwar die Hülle und kannst dir ausmalen, was dort drin geschrieben steht, aber du wirst es nie genau wissen. Erst nachdem du es geöffnet hast, erfährst du all die Geheimnisse und Gedanken.
Genau das Gleiche ist es bei einem Menschen. Sie können dir etwas vorspielen, dich glauben lassen, sie seien okay, aber in Wirklichkeit sind sie ganz und gar nicht in Ordnung.
Unsere Gefühle überwältigen uns und somit lügen wir – aber im Grunde belügen wir uns damit nur selbst, in der Hoffnung, dass wir es irgendwann einmal glauben.
Aber um tief in einem Menschen hineinzuschauen und seine wahren Gefühle zu entblößen, braucht man mehr, als nur ein paar warme Worte. Es benötigt lange Zeit, jemanden richtig kennen zu lernen und es beansprucht noch umso mehr Zeit ein Fingerspitzengefühl für diesen bestimmten Menschen zu entwickeln, um zu wissen, wie die Person tickt. Erst dann kann man anfangen, sie zu lesen und ihr Innerstes zu entfalten.
Das Mädchen sieht mich innig an, mit ihren wunderschönen, grünen Augen. Es ist, als würden sie mir all ihre Gefühle offenbaren und das weckt das Bedürfnis in mir, mehr über sie erfahren zu wollen. Ich möchte sie kennen lernen, um sie lesen zu können, aber es geht nicht. Diesen Fehlern darf ich auf keinen Fall begehen.
Sie blickt nervös an mir auf und ab. Verwirrung erkenne ich in ihrem Gesichtsausdruck und auch ein bisschen Verlegenheit. Ich kann mir vorstellen, wie schlimm das gerade für sie sein muss, immerhin hatte sie vor ein paar Sekunden noch eine Panikattacke.





























