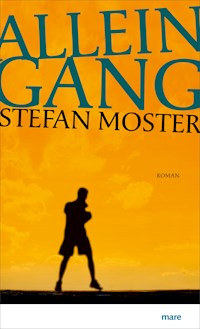
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mareverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Kinder sind sie Freunde: Freddy und Tom. Sie wohnen in derselben Straße, besuchen dieselbe Klasse, nachmittags spielen sie Baader-Meinhof-Bande. Während Tom als behütetes Einzelkind aufwächst, lebt Freddy mit Oma und Geschwistern in einem verwahrlosten Haushalt. Anfang der Achtziger zieht Tom in eine alternative Studenten-WG; man positioniert sich gegen Kernkraft, Startbahn West und Pershing-Raketen – und gefällt sich darin, "einen wie Freddy" in seinen Reihen zu haben. Doch die Rolle des Außenseiters ist kompliziert. Erzählt aus der Perspektive des Erwachsenen, der frisch aus der Haft entlassen ist, spielt der Roman an einem einzigen Tag: Von dort blickt Freddy zurück in jene Zeit, in der Freundschaften, Konflikte, freie Liebe und der Hunger nach Anerkennung sein Leben bestimmten – und zu einer Tragödie führten, die ihn viele Jahre seines Lebens kosten sollte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Moster
ALLEINGANG
Roman
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.ddb.de abrufbar.
TEXTNACHWEIS S. 143–144: Anaïs Nin: Das Delta der Venus, übersetzt von Eva Bornemann, Frankfurt am Main: Büchergilde Gutenberg 1979.
© 2019 by mareverlag, Hamburg
Umschlagadaption Nadja Zobel / Petra Koßmann, mareverlag nach Grace Han / Penguin Random HouseAbbildungen basierend auf Originalvorlagen von José Escofet
Typografie (Hardcover) mareverlagDatenkonvertierung E-Book Bookwire
ISBN E-Book: 978-3-86648-350-7
ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-297-5
www.mare.de
Inhalt
TEIL I
ANKOMMEN
BOXEN
STARTEN
SPIELEN UND KÄMPFEN
KLAUEN
PROBLEMATISIEREN
RÄDER WECHSELN
AUFS HERZ SCHLAGEN
SCHUHE VERBRENNEN
RICHTUNGEN WÄHLEN
OFFEN LIEBEN
MITGEHEN
HEIMKEHREN
BEZIEHUNGEN AUFNEHMEN
VERWEIGERN
AKTIV WERDEN
ALLEINGÄNGE MACHEN
EINEN FREUNDSCHAFTSDIENST ERWEISEN
TEIL II
AUFS MEER BLICKEN
TAXI FAHREN
ZUR WELT KOMMEN
BEHERRSCHUNG VERLIEREN
ORIENTIERUNG FINDEN
ZUM HIMMEL SCHAUEN
TEIL III
FEUER ENTZÜNDEN
ZAUBERN
ÜBERSETZEN
I
ANKOMMEN
In der Vorstellung ist das Meer immer blau. Bitte ein Kind, den Ozean zu malen, und es weiß sofort, nach welcher Wachsmalkreide es zu greifen hat.
Die Wirklichkeit sieht häufig anders aus: weiß, grün, golden, sogar orange, rosa, türkisfarben, je nach Lichtverhältnissen, und oft eben auch schwarz, grau oder braun.
Wer gleich bei der ersten Ankunft an einer Küste auf die ultramarine Erfüllung seines Traumbilds schaut, fühlt sich bestätigt und belohnt. Wer beim ersten Blick aufs Meer nur schiefergraues Wasser sieht, kommt sich betrogen vor.
Freddy Wohn sah das Meer zum ersten Mal im Sommer 1982. Es war wachsmalkreideblau.
Begeistert sprang er aus dem Wagen, rannte dem Anblick entgegen, machte einen Satz auf die niedrige Mauer, die den Parkplatz von dem steil abfallenden Hang trennte, breitete die Arme aus und schrie, hörte gar nicht mehr auf damit, er johlte und jauchzte, in der Erwartung, die anderen würden gleich einstimmen, aber als er sich umdrehte, stiegen Tom und Marianne gerade erst mit müden Gliedern aus dem Wagen.
Der rote Lack des 1200er-Kombis leuchtete prachtvoll im frischen Vormittagslicht. Zweitausend Kilometer hatten sie mit dem Lada zurückgelegt, um an diese Stelle hoch oben neben der Burg von Thessaloniki zu gelangen, wo sich eine so umfassende Sicht auf den Thermaischen Golf bot, dass man glaubte, die gesamte Ägäis zu überblicken. Freddy schickte eine weitere Salve Indianergeheul in den Himmel über dem Meer, dann waren die Reisestrapazen vergessen. Er schlug Tom, der nun endlich neben ihm stand, vor Freude auf die Schulter, aber dieser verriet keinerlei Anzeichen von Begeisterung. Außerdem musste er sich seiner Freundin Marianne zuwenden, die mit fest um den Leib geschlungenen Armen zu ihm trat, als sei ihr trotz der Sommerwärme kalt.
Freddy wunderte sich über seinen Freund Tom, den er kannte, seit er denken konnte, und dem er es letztlich zu verdanken hatte, dass er bei dieser Tour dabei sein durfte, denn Tom hatte ihn mit den anderen zusammengebracht und dafür gesorgt, dass man ihn, den Berufsschüler, in die Kreise der Gymnasiasten und Studenten aufnahm. Auch von Marianne hätte Freddy eine lebhaftere Reaktion auf die Begegnung mit dem Meer erwartet, war sie es doch gewesen, die bei der Planung der Reise das Licht, die Wärme und die befreiende Atmosphäre des Südens so verführerisch beschrieben hatte.
Freddy blickte zum Parkplatz und sah, wie die beiden Pärchen aus dem anderen Auto, dem weißen R4-Kastenwagen, näher kamen: Finger und Lurch mit ihren Freundinnen Mechthild und Lioba. Sie trotteten auf ihn zu, stiegen wortlos auf das Mäuerchen und beschirmten die Augen. Freddy musterte seine Freunde, wie sie aufgereiht neben ihm standen, von der Morgensonne angestrahlt. Sechs junge Menschen, die schweigend auf Saloniki blickten, auf die Ägäis mit ihren Inseln, auf die thessalischen Berge im Hintergrund. Diese Aussicht hatten sie sich immer wieder ausgemalt, den ganzen Frühling über, seit der Beschluss gefasst war, nach Griechenland zu fahren, und nun verrieten sie keine Spur von Freude, geschweige denn Überschwang.
Es muss mit den Geschehnissen der Vortage zu tun haben, sagte sich Freddy, mit seiner ruppigen Methode, die Autoreifen zurückzuerobern, die man ihnen in Jugoslawien gestohlen hatte. Und mit seiner energischen Art, seine Freunde daran zu hindern, Melonen vom Feld zu klauen. Beide Male hatte er die anderen erschreckt. Beide Male hatte ein Zerwürfnis in der Luft gelegen. Fast wie Feinde hatten sie sich gegenübergestanden, er und die anderen, und das, obwohl sie Freunde waren und sich auf einer gemeinsamen Reise befanden.
Aber musste man solche Reibereien bei dieser Aussicht nicht einfach vergessen?
»Ich sehe gerade zum ersten Mal das Meer«, stellte Lioba fest.
»Ich auch«, sagte Mechthild.
»Die Stadt müsste weg sein, dann wäre die Aussicht besser«, meinte Lurch, der schon immer fand, die Schönheit der Erde sei dort am reinsten, wo Menschen sie nicht störten.
»Ich war bis jetzt nur an der Ostsee«, murmelte Marianne, »als Kind, mit meinen Eltern, in Timmendorfer Strand.«
Tom war als Einziger von ihnen schon einmal im Süden gewesen, im Sommer 1978, im Alter von vierzehn Jahren.
»Damals war ich maßlos enttäuscht vom Mittelmeer«, erklärte er, »weil es bloß eine trübe Brühe war mit laschen Wellen. Ich hatte mir was Sensationelles in Azurblau vorgestellt, aber was ich dann vor mir hatte, sah aus wie eine Desillusionierung, die jemand böswillig inszeniert hatte.«
Der Schauplatz seiner Enttäuschung sei ein italienischer Badeort namens Eraclea Mare gewesen, da habe er den Sommerurlaub mit seinen Eltern verbringen müssen.
Freddy hätte am liebsten erwidert, dass er als Vierzehnjähriger von einem Familienurlaub in Eraclea Mare gewiss nicht enttäuscht gewesen wäre, unabhängig von der Farbe des Meeres. Damals hatte er praktisch keine Eltern mehr gehabt, schon lange nicht mehr. Seine Mutter hatte im Herbst seiner Einschulung jemanden kennengelernt und war ausgezogen, sein Vater hatte sich bereits Jahre früher aus dem Staub gemacht. Aber Freddy sagte nichts, sondern versuchte, sich auf die Aussicht zu konzentrieren. Das Meer, das vor ihm lag, war ganz und gar so, wie er es sich ausgemalt hatte. Als gigantisches Geschenk zur Volljährigkeit empfand er es, dass ihm die Welt an dieser Stelle so ozeanweit offenstand.
Ende Februar war er achtzehn geworden – gewissermaßen, denn er hatte am neunundzwanzigsten Geburtstag, einem Datum, das im Kalender des Jahres 1982 nicht vorgesehen war.
Verstohlen schielte er zur Seite. Toms Gesichtsausdruck ließ eher Genugtuung als Begeisterung vermuten. Auf ihn schien der Anblick der Ägäis lediglich wie die überfällige Korrektur der Enttäuschung von Eraclea Mare zu wirken.
Finger nahm das Panorama zum Anlass, sich eine Zigarette zu drehen. Er genoss es ganz offensichtlich, wie ein Feldherr von oben über die Landschaft zu schauen und sich den Wind um die Nase wehen zu lassen. Den Mund machte er nicht auf, aber immerhin lächelte er sein typisches Lächeln, das die Bereitschaft zur Versöhnung mit allem und jedem ausdrückte.
Die Frauen wirkten erschöpft von der langen Fahrt, die sie auf den Rückbänken von Lada und R4 verbracht hatten, weil die Jungs sie – abgesehen von einer Ausnahme, für die Freddy verantwortlich gewesen war – weder auf den Beifahrersitz noch gar ans Steuer gelassen hatten. Abwesend schauten sie auf das Panorama. Sie schienen das Meer wie durch ein Fenster wahrzunehmen, das seit Jahren niemand mehr geputzt hatte.
Wie gern hätte Freddy jemanden gehabt, mit dem er seine Euphorie teilen konnte. Aber die Freunde merkten nicht, wie er sie ansah.
Er zuckte mit den Schultern, schüttelte leicht den Kopf und richtete den Blick wieder nach vorn, sog die Aussicht geradezu in sich auf, als ahnte er, dass er das Meer nach diesem Sommer nie mehr zu Gesicht bekommen würde.
BOXEN
Das bisschen Kleidung, Wasch- und Rasierzeug, die Taschenbücher, die er nur mitnimmt, weil Mesut behauptet, nichts auf Deutsch lesen zu wollen, und natürlich die Briefe, dann ist die alte Sporttasche mit dem kaputten Reißverschluss gepackt.
Fehlen nur noch die Bilder.
Er streckt den Arm aus, schiebt behutsam den Magneten zur Seite, nimmt das Foto der neugeborenen Rosa vom Bettpfosten und steckt es in die Brusttasche seines Hemdes.
Mesut rührt sich nicht auf seiner Matratze, aber als Freddy an den Klebestreifen pickt, mit denen das zweite Bild an der Wand befestigt ist, protestiert er.
»Nee, Alter, das kannst du mir nicht antun. Komm, lass hängen.«
Es ist nichts weiter als die Doppelseite aus dem Mittelteil einer Illustrierten, ein Foto mit verschossenen Farben, stellenweise eingerissen, ursprünglich jedoch behutsam herausgelöst, nachdem die Heftklammern mit einem Messer aufgebogen worden waren.
So haben sie es früher immer gemacht, Tom und er, wenn sie Zeitschriften aus dem Müll zogen und nach interessanten Bildern durchforsteten. Für dieses Foto waren sie allerdings nicht in die Tonne getaucht, sondern zum Laden gegangen und hatten Münzen auf die Theke gelegt, denn sie mussten es unbedingt haben, auf der Stelle. Wann war das gewesen? Im November 1974. Freddy muss sich nicht lange besinnen, denn der Kampf, den das Foto dokumentierte, fand am 30. Oktober statt.
»Echt jetzt. Bitte.«
Freddy dreht sich übertrieben unwirsch um. »Hast du gerade bitte gesagt?«
»Quatsch!«
»Also gut.«
Er lässt das Bild hängen, tritt einen Schritt zurück und betrachtet es ein letztes Mal. Das Scheinwerferlicht macht Schweißtropfen in der schwarzen Nachtluft sichtbar. Sie sprühen vom Kopf des getroffenen Boxers auf, es ist der Moment, der die Wende einleitet, von jetzt an lässt sich Ali nicht mehr in die Seile drängen, sondern baut seinen Konter zum Angriff aus, weil er sieht, dass dem Gegner Beine und Arme müde werden, und Freddy weiß noch, wie er zusammenzuckte, als er diesen Schlag auf der Mattscheibe sah, zusammenzuckte, weil er die Wucht begriff, aber auch, weil er nun wieder Hoffnung schöpfte, nachdem er mehrere Runden lang den Tränen nahe gewesen war, angesichts der Niederlage, die er für Ali unausweichlich hatte kommen sehen. Auch wenn er nie zuvor einen Kampf von Schwergewichtsboxern verfolgt hatte, erkannte er doch Foremans Überlegenheit. Es mussten Hunderte Schläge gewesen sein, die Alis Körper zu verkraften hatte, und Freddy hatte sich in die Faust gebissen.
Nun ist wieder November, einundvierzig Jahre später.
Freddy stutzt, als machte er erstmals Bekanntschaft mit dem Phänomen Zeit. Seit einundvierzig Jahren begleitet ihn dieses Bild. Mit einundfünfzig hütet er noch immer den Schatz des Zehnjährigen, wie um sich zu beweisen, dass beide ein und derselbe Mensch sind. Plötzlich wird ihm flau. Vier Jahrzehnte, was hätte man aufbauen können in der Zeit, wie viele Häuser bauen, Bäume pflanzen, Kinder zeugen! Bloß nicht so etwas denken, nicht jetzt, unmittelbar vor der sogenannten Freiheit. Freddy tritt nervös von einem Bein aufs andere, und da sagt Mesut:
»Ja, komm, mach noch mal!«
Freddy sieht seinen Zellengenossen fragend an.
»Tanz noch mal wie Ali!«
Freddy schüttelt den Kopf und greift nach seiner Tasche.
»Nun komm schon, zum Abschied.«
Er hat es fast täglich getan, schattenboxend getänzelt, das war sein Training gewesen, zweimal eine halbe Stunde am Tag, er hatte dabei Laute von sich gegeben und manchmal sogar große Töne gespuckt wie Ali, um Mesut zu unterhalten. Aber jetzt geniert er sich, als er die Fäuste zur offenen Deckung hebt und anfängt, auf den Fußballen zu hüpfen, vom rechten auf den linken, und sich hüpfend von der Stelle bewegt, im Kreis, im Ring, im eckigen Kreis. Sobald es nach Tanz aussieht, kommen Mesuts Anfeuerungen, und der Spaß verscheucht die Scham.
»Mach den Anchor Punch!«, verlangt Mesut. Freddy tut ihm den Gefallen, versucht, ihn besonders schnell kommen zu lassen, ansatzlos, sodass man es kaum sieht, dann bricht er das Spiel plötzlich ab, schlägt in Mesuts Hand ein, zieht ihn vom Bett hoch und umarmt ihn kurz und hart, als wären sie gemeinsam in einem ausgeglichenen Fight über die volle Distanz gegangen und sich nun nicht sicher, bei wem die Punktrichter mehr Treffer gezählt hatten.
»Das Bild bleibt hängen«, sagt Freddy. »Lass dich nicht unterkriegen«, muntert er Mesut auf, der halb so alt ist wie er und ihn nun eine Sekunde lang ansieht wie ein Sohn seinen Vater. »Mach’s wie Ali. Zeig allen, dass ein Comeback möglich ist. Aber schlag in Zukunft nur zu, wenn du Boxhandschuhe anhast.«
Mesut setzt sich wieder aufs Bett. Gemeinsam blicken sie auf die Wand mit dem Foto aus Afrika, Ali gegen Foreman, The Rumble in the Jungle, 30. Oktober 1974, morgens um vier Uhr Ortszeit in Kinshasa, hunderttausend Schwarze, nur vorne am Ring, knapp oberhalb des federnden Bodens, die Gesichter der weißen Berichterstatter, aufgerissene Augen selbst bei den professionellen Beobachtern, hier geschieht etwas Außergewöhnliches, Faszination und Entsetzen, wie immer, wenn Männer sich schlagen, der sportliche Rahmen gibt Regeln vor, verlangt Geschick und antrainiertes Können, aber das Ziel ist das gleiche wie bei einer ungebändigten Schlägerei: die Kampfunfähigkeit des Gegners durch Gewalt.
»Und du hast das live gesehen?«, fragt Mesut wie schon so viele Male zuvor.
Freddy presst die Lippen zusammen, nickt und schickt einen kleinen Laut des Lachens durch die Nase.
Der Kampf war ein Geschenk von Tom gewesen. Normalerweise bekam Freddy nichts geschenkt, nicht einmal zum Geburtstag, weil der nur alle vier Jahre stattfand und dann niemand daran dachte, aber auch weil in seiner zerzausten Sippschaft der Sinn für Zeremonien nur schwach ausgeprägt war. Tom hingegen stammte aus einer Familie, in der nicht nur alle Festtage begangen wurden, sondern in der man auch lernte, an seine Mitmenschen zu denken und den Benachteiligten etwas von seinem Wohlstand abzugeben.
»Seid ihr eigentlich arm?«, hatte er Freddy gefragt, als sie noch Abc-Schützen mit orangen Schildmützen waren und den Schulweg gemeinsam zurücklegten, weil sie nun einmal vis-à-vis wohnten und morgens zur gleichen Zeit das Haus verließen.
»Wieso arm?«
»Weil ihr kein Auto habt und das Waschwasser in den Hof schüttet und weil ihr so viele seid, aber ohne Mama und Papa.«
»Wir sind normal«, hatte Freddy gesagt, und als er sich daran erinnert, muss er über die Entschiedenheit des Erstklässlers schmunzeln, der bis dahin noch nie mit Außenstehenden über seine Familie gesprochen hatte und sich seiner Sache sicher war, weil er nichts anderes kannte als das Leben mit zwölf Geschwistern in dem kleinen, von den vielen Menschen überforderten Haus, in dem wegen der ständigen Abwesenheit seiner Eltern die ebenfalls kleine und überforderte Großmutter allein das Regiment führte.
Erst nach und nach, und durch seine gelegentlichen Besuche bei Tom, wurde ihm klar, wie anders das Leben in einem Haus sein konnte, das im Prinzip mit dem, in dem er wohnte, identisch war: zur gleichen Zeit errichtet, nur durch einen Anbau erweitert. Aber es war irgendwie sauberer, überschaubarer, ruhiger, mit Dingen, die ihren festen Platz hatten, sodass man sie nicht ständig suchen musste, mit Schranktüren, die nicht sperrangelweit offen standen, mit Betten, die gemacht waren und von denen man genau sagen konnte, welches wem gehörte, und zwar in allen Nächten des Jahres – erst da hatte er verstanden, dass sein Leben mit Oma und Geschwistern nur für ihn normal war, für alle anderen jedoch einen Schandfleck in dieser Siedlung der ordentlichen Nutzgärten und betonierten Garageneinfahrten darstellte. Sie ließen ihr Haus herunterkommen, während die Nachbarn ihre Eigenheime mit Doppelglasfenstern und Veranden veredelten: Zeugnisse ihres Aufschließens zum Mittelstand. Freddys Familie hinkte hoffnungslos hinterher, und am deutlichsten wurde das, wenn das Puddelauto kam und mit einem dicken, geriffelten Schlauch die Fäkalien aus der Klärgrube saugte, weil sie sich den Anschluss ans Kanalnetz nicht leisten konnten. Dann stank die ganze Straße, und Freddy schämte sich.
Außerdem war es in ihrem Haus, das in all der Zeit keinen neuen Anstrich erfahren hatte, laut und unruhig. Wenn geschrien wurde, drang es durch die Sprossenfenster, die noch aus den frühen Dreißigerjahren stammten, und es schrie eigentlich dauernd jemand: eine gereizte Schwester, ein wütender Bruder oder eben Oma, die eines der Enkelkinder zusammenstauchte, weil es an ihr Portemonnaie gegangen war oder einen halben Ring Fleischwurst ohne Brot vertilgt hatte, oder einfach, weil es auf der Couch lag, ohne die Schuhe ausgezogen zu haben. Oma hatte nicht einmal auf offener Straße Hemmungen, ihrem Herzen Luft zu machen, Ich hau dich windelweich, schrie die kleine, magere, nahezu zahnlose Person in der Kittelschürze jedes Mal, wenn sie Freddy am Abend ins Haus rief, dieser aber keine Anstalten machte, sich von seinen Spielgefährten zu trennen.
Laut und schmutzig hätte das Prädikat für Freddys Elternhaus ohne Eltern lauten können, aber der Nachbarschaft genügte als Charakterisierung asozial. Niemand betrat das Grundstück freiwillig; nicht einmal bei den Nachbarskindern wog die Neugier schwerer als die diffuse, argwöhnische Furcht vor dem, was sie bei Freddy erwarten könnte. Wenn sie auf der Straße Fußball spielten, war er, solange der Ball rollte, einer von ihnen, aber sobald derjenige, dem der Ball gehörte, abzog, weil ihn seine Mutter zum Essen rief, und die anderen, ihres Spielgeräts beraubten Kinder desorientiert herumstanden, hatte Freddy schon nach kurzer Zeit das Gefühl, nicht mehr dazuzugehören. Es war, als rieche er schlecht. Selbst diejenigen, die gerade noch auf seiner Seite gekickt hatten, rückten nun in kleinen Schritten von ihm ab, womöglich ohne dass sie es merkten. Bloß einer hielt seine Position: Tom von gegenüber. Gemeinsam machten sie sich auf den Heimweg, sagten, wenn sie bei ihren Häusern angekommen waren, »Mach’s gut« oder »Bis morgen«, und dann bog Tom nach links ab, wo das Gartentor aus gekreuzten, dunkel gebeizten Holzstreben stets geschlossen war, und Freddy nach rechts, wo das rostige Eisentor schief in den Angeln hing und grundsätzlich offen stand.
Tom besuchte Freddy nie, und wenn Freddy zu Tom kam, dauerte es nicht lange, bis sie von Toms Mutter ins Freie geschickt wurden, darum hatte Freddy seinen Ohren nicht getraut, als Tom ihn eines Tages einlud, mit ihm zusammen den Kampf Foreman gegen Ali anzuschauen, und zwar im Wohnzimmer der Großeltern, die mit im Haus lebten. Toms Eltern hätten ihm nie erlaubt, wegen eines Boxkampfs den Nachtschlaf zu unterbrechen, aber in seinem Großvater hatte er einen Komplizen gefunden, der ihn heimlich zu wecken versprach und auch damit einverstanden war, dass der Nachbarsjunge hinzukam.
Seit Wochen hatten sie über das bevorstehende Duell in Afrika gesprochen, hatten das Warten kaum ertragen und schier verrückt werden wollen, als der Kampf um sechs Wochen verschoben wurde, weil Foreman vom Ellenbogen seines Sparringspartners verletzt worden war. Sechs quälend lange Wochen.
Freddy hatte sich nicht auf Anhieb von Toms Begeisterung anstecken lassen, sondern erst nach und nach, er hatte zunächst sein Misstrauen gegenüber dem Boxsport überwinden müssen. Im Gegensatz zu Tom war er nämlich schon mehr als einmal Zeuge geworden, wie zwei Männer, die gerade noch rauchend und trinkend einträchtig an einem Tisch gesessen hatten, plötzlich aufsprangen und die Fäuste fliegen ließen. Er hatte in diesen Fällen nicht zugeschaut, sondern war geflüchtet, weil er befürchtete, die jäh ausgebrochene Gewalt könnte auf ihn übergreifen. Sah man Schläge aus nächster Nähe, erkannte man, dass sie sich nicht leicht beherrschen ließen. Nur mit noch größerer Stärke kam man gegen sie an. War man nicht stark und bereit, der Gewalt mit Gewalt zu begegnen, tat man gut daran, sich zu verkrümeln.
Am schlimmsten hatte Freddy einen Schlagabtausch zwischen seinem Vater und seinem Bruder Werner in Erinnerung. Nach langer Abwesenheit war der Vater wieder einmal zu Hause aufgetaucht, hatte sich am Esstisch niedergelassen, Freddy, seinen Jüngsten, wie eine Trophäe auf den Schoß genommen und großspurige Reden geführt. Bis Werner hereinkam und nach einem einzigen Blick auf seinen Erzeuger kurz und knapp sagte: »Sieh zu, dass du Land gewinnst.«
Der Vater setzte Freddy vom Schoß ab, stand auf, trat vor seinen Ältesten hin und scheuerte ihm ansatzlos eine. Zurück kam keine flache Hand, sondern eine Rechte mit geballter Faust, die dem Vater die Lippe aufriss und ihn in einer Schraubbewegung auf den Küchentisch stürzen ließ, wo daraufhin die Flaschen umkippten wie beim Kegeln und der Aschenbecher seinen Inhalt erbrach.
Tom kannte solche Szenen nicht, Tom plapperte nach, was sein Großvater über die Kunst der Verteidigung beim Boxen sagte, über Taktik und Plan. Boxer sind keine Feinde, beteuerte er, Boxer sind Gegner, aber auch Kameraden. Vor dem Kampf plustern sie sich auf und fauchen sich an, im Ring tun sie alles, was erlaubt ist, um den Gegner zu bezwingen, aber danach geben sie sich die Hand.
Der Umstand, dass beim Boxen nicht alles erlaubt war, vor allem Schläge unter die Gürtellinie nicht, überzeugte Freddy schließlich. Ringrichter und Regeln hielten die Kämpfer im Zaum. Seile verhinderten, dass die Gewalt aus dem viereckigen Ring sprang.
Ein wenig bange war ihm trotzdem bei der Vorstellung, in Echtzeit dabei zu sein, weil das bedeuten konnte, dass unversehens einer der Kontrahenten bewusstlos zu Boden ging. Je näher der Kampf rückte, desto mehr wich die Bangigkeit jedoch der Aufregung über das nächtliche Geheimnis. Allein das Wort Kinshasa auszusprechen, war bereits ein Abenteuer, als würde man im selben Atemzug eine verbotene Welt betreten. Noch abenteuerlicher war es freilich, mitten in der Nacht unbemerkt über die Straße zu gelangen. Den Wecker zu stellen kam nicht infrage, der würde die Brüder aus dem Schlaf reißen. Freddy blieb nichts anderes übrig, als sich wach zu halten, bis es Zeit war, das Haus zu verlassen. Dadurch beobachtete er dank Muhammad Ali zum ersten Mal ausführlich die Nacht.
Wie üblich herrschte im Brüderzimmer Unruhe bis nach Mitternacht, so lange stellte sich Freddy schlafend. Als Stille einkehrte und die Brüder gleichmäßig schnauften und schnarchten, schlich er sich ins Zimmer der Schwestern im ersten Stock, wo man vom Gaubenfenster aufs Haus gegenüber blickte. Tom hatte versprochen, mit der Taschenlampe Lichtzeichen zu geben. Freddy bezog seinen Posten, lautlos, um die Schwestern nicht aufzuwecken, und sah in die Dunkelheit hinaus. Auf der Straße regte sich nichts, die Bewohner der Vorortsiedlung schliefen, und diejenigen, die Nachtschicht hatten, würden erst im Morgengrauen zurückkehren. Freddy betrachtete das von den Gaslaternen matt aufgehellte Standbild. Einmal zuckte er zusammen, weil ein Blatt zu Boden segelte. Von da an richtete er den Blick fest auf die Birke vor dem Haus, um den Moment zu erwischen, in dem sich ein weiteres Blatt löste. Es gelang ihm nicht, und bald verlor er die Lust. Nun wurde ihm langweilig. Eine Uhr besaß er nicht, so konnte er nicht verfolgen, wie die Zeit verstrich, und als ihm lange genug langweilig war, kroch Müdigkeit die Beine herauf. Er musste sich wach halten, wagte es aber nicht, sich zu strecken und zu schütteln, weil er befürchtete, die Bodendielen könnten knarren. Immer schwerer fiel es ihm, der Schläfrigkeit standzuhalten, wie eine Boa constrictor umschlang sie ihn und presste die letzten Reste von Wachheit aus ihm heraus. Doch bevor er im Stehen einschlief, bellte irgendwo ein Hund, es musste der Schäferhund vier Häuser weiter sein, laut und wütend bellte er, und sofort war Freddy wieder hellwach, die Boa ließ von ihm ab, stattdessen packte ihn die Angst, ertappt zu werden, denn in seinem Rücken drehten sich gleich mehrere Körper in ihren Betten um. Sei still, flehte er innerlich, aber der Hund wurde immer wütender, womöglich stellte er gerade einen Einbrecher. Freddy drückte das Gesicht an die Scheibe in dem Versuch, aus spitzem Winkel etwas zu erkennen, da regte sich auf der Straße etwas. Ein Tier kam von links angerannt, ein Vierbeiner, doch das war kein Schäferhund, nein, so rannte kein Hund, so huschend und rasch, das musste ein Fuchs sein, und kaum hatte Freddy das erkannt, war das Tier schon verschwunden, und das Bellen brach ab.
Dass in den Gärten der Siedlung ein Fuchs lebte, hatte er nicht geahnt. Er hauchte auf die Scheibe und zeichnete mit dem Finger die Umrisse eines Fuchses auf die beschlagene Stelle, wischte sie aus, hauchte erneut, zeichnete einen Hund, dann einen Boxer, das war schwer, er benötigte viele Versuche, bis es gelang, und jedes Mal, wenn er ein Bild ausgewischt hatte, fuhr er sich mit der flachen Hand durchs Gesicht und hielt sich mit der kalten Feuchtigkeit wach, bis gegenüber unversehens ein Licht aufleuchtete. Das Zeichen! Tom blinkte mit der Taschenlampe. Aufgeregt winkte Freddy mit beiden Armen, als könnte Tom ihn sehen, dann schlich er barfuß die Treppe hinunter, schlüpfte in die Turnschuhe, die er neben der Tür bereitgestellt hatte, öffnete die Haustür gerade so weit, dass sie nicht zu quietschen anfing und er durch den Spalt passte, und rannte zum offenen Gartentor. Dort duckte er sich neben den Zaunpfosten, spähte in beide Richtungen, bevor er in gebückter Haltung auf Toms Gartentor zulief. Es war angelehnt. Weiterhin geduckt huschte er in den Hof hinein zur Haustür. Dort wartete Tom auf ihn und bedeutete ihm mit einer Geste, die Schuhe auszuziehen. Barfuß und auf Zehenspitzen huschten sie in das kleine Wohnzimmer, wo in gedämpfter Lautstärke der Fernseher lief. Toms Großvater saß in einer Strickjacke über dem gestreiften Pyjama und mit Pantoffeln an den Füßen im Sessel und begrüßte den Gast mit einem Nicken.
Tom schloss die Wohnzimmertür, stellte den Ton am Fernseher lauter und legte für sich und Freddy jeweils ein Kissen auf den Boden. Kaum hatten sie im Schneidersitz Platz genommen, fing die Menschenmenge im nächtlichen Stadion an zu schreien, Blitze flammten auf, die Kamerabilder wechselten unruhig, als könnte sich der Regisseur nicht entscheiden, aus welchem Blickwinkel er das Geschehen zeigen sollte, als hätte er Angst, die Übertragung dieses einmaligen Ereignisses zu verderben.
»Jetzt geht’s los«, meinte Toms Großvater trocken.
»Warum haben die eigentlich mitten in der Nacht gekämpft?«
Freddy braucht einen Moment, bis er begreift, aus welcher Welt die Frage kommt.
»Ich meine, Deutschland und Kongo liegen doch praktisch untereinander, die müssten doch dieselbe Zeit haben, wenigstens ungefähr«, hört er Mesut sagen, der offenbar nachgedacht hat.
Freddy stutzt. Das ist ihm noch nie in den Sinn gekommen. Mesut hat recht, zwischen Europa und Afrika gibt es keine so großen Zeitunterschiede wie zwischen Europa und Amerika. Aber der Kampf hatte tatsächlich nachts um drei stattgefunden, mitteleuropäischer Zeit, also waren damals hunderttausend Afrikaner mitten in der Nacht aufgebrochen, um zum Stadion zu pilgern und um vier Uhr morgens – weil Zaire, wie der Kongo damals hieß, eine Zeitzone weiter östlich lag – den größten Fight aller Zeiten zu verfolgen.
»Gute Frage«, gibt Freddy zu.
»Fehlt bloß eine gute Antwort«, sagt Mesut grinsend.
Freddy muss gestehen, dass er keine hat, dass er es nicht weiß, aber während er ganz mechanisch seine Unwissenheit beteuert, begreift er, dass die amerikanisch-afrikanische Zeitdifferenz doch Einfluss auf den Übertragungszeitpunkt genommen haben muss. Es konnte nur einen Grund dafür gegeben haben, zwei Männer in den frühen Morgenstunden zur sportlichen Höchstleistung zu bitten: Der Kampf sollte im amerikanischen Fernsehen zur besten Sendezeit übertragen werden.
Nachdem Freddy den Zusammenhang erkannt hat, zögert er kurz, ihn Mesut zu erklären. Als er es schließlich tut, meint dieser nur: »Die Afrikaner sind und bleiben arme Schweine.«
Auf dem Gang nähern sich Schritte, sie stoppen vor der Zellentür, es folgt ein metallisches Rasseln.
Mesut steht auf und sieht Freddy in die Augen, jetzt allerding nicht mehr so wie ein Sohn seinem Vater. Sie hören, wie von draußen der Schlüssel ins Schloss gesteckt wird.
»Pass auf dich auf, Alter«, sagt Mesut. »Und such dir draußen einen neuen Namen!«
Weil Freddy ihn fragend anschaut, fügt er hinzu: »Wer weiße Hemden trägt, der kann nicht Freddy heißen.«
Vom Gang zieht kühle Luft herein, als die Zellentür aufgeht. Freddy wirft sich die Lederjacke über die Schulter, nimmt seine Tasche, nickt Mesut noch einmal zu und tritt über die Schwelle, ohne den Schließer eines Blickes zu würdigen.
Such dir einen neuen Namen. Was soll das bedeuten? Damit ist Mesut ihm noch nie gekommen, aber Freddy hat ihm angesehen, dass er es ernst meint.
Namenswechsel haben etwas Unheimliches. Sie irritieren, so wie damals, als Freddy zum ersten Mal hörte, dass Muhammad Ali ursprünglich Cassius Clay geheißen habe. Niemand konnte ihm erklären, warum der Boxer den Namen gewechselt hatte, schon gar nicht Toms Großvater, der einzige Erwachsene, von dem Freddy wusste, dass er sich fürs Boxen begeisterte, denn der machte den Namenswechsel einfach nicht mit, sondern blieb bei Clay. Cassius Clay klang auch in Freddys Ohren gut, es erinnerte an die amerikanischen Soldaten, die wenige Straßen weiter in der Kaserne der US-Panzerbrigade lebten, morgens ihren Frühsport mit rhythmischem Gesang begleiteten und abends mit riesigen Pizzaschachteln durch die Gegend schlurften, groß und schlank und lässig, mit weißen Turnschuhen, um die ein dünner roter Streifen lief. Die hätten alle Cassius Clay heißen können, aber nicht Muhammad Ali.
Trotzdem war Ali größer als jeder Einzelne von ihnen, denkt Freddy auf dem Weg über den Gang, in dem die Schritte übermäßig hallen, weil in diesem Gebäude so viel Metall verbaut ist, dass es auch scheppert und knallt, wenn eigentlich Ruhe herrscht.
Kurz versucht sich Freddy ein Gefängnis mit Teppichboden, Türgummis und Holzbetten vorzustellen, aber dann rappelt auch schon die nächste Tür. In seinem Inneren spürt er etwas, das sich lauter bemerkbar macht als die Knastgeräusche und schon bald alles andere in den Hintergrund drängt: Lampenfieber.
STARTEN
Ist einem der genaue Zeitpunkt der Haftentlassung erst einmal mitgeteilt worden, kann man gar nicht anders als die Tage zählen, und es lässt sich auch nicht verhindern, dass die Ungeduld wächst, je näher der Tag rückt; trotzdem verliert Freddy nicht die Fassung, als ihn der Pförtner unnötig lange vor der automatischen Tür warten lässt. Dies ist die dritte Haftentlassung seines Lebens, er kennt das. Eine letzte, kleine Schikane. Beim Unterschreiben des Formulars hört er den Uniformierten den Abschiedsspruch sagen, der klingt, als stammte er aus einem Fernsehfilm. Freddy wüsste etwas darauf zu antworten, aber er verkneift es sich, schiebt stumm das Blatt durch die Öffnung im Panzerglas und nickt nur leicht. Dann richtet er den Blick auf die blaue Metalltür. Nach wenigen Sekunden geht sie auf, und Freddy ist draußen.
Weil er weiß, dass sie ihn über die Kamera beobachten, bleibt er nicht stehen wie ein Unschlüssiger, sondern geht, wenn auch langsam, weiter, als wüsste er genau, wohin. Unauffällig sieht er sich nach einem kleinen roten Auto um. Er weiß gar nicht, was für ein Modell Rosa fährt, doch aus irgendeinem Grund stellt er es sich klein und rot vor. Quirlig, flink, dienstbereit und freundlich.
Er lächelt. Und wundert sich darüber.
Ein rotes Auto kann er nicht entdecken; in den silbernen, weißen, schwarzen Wagen am Straßenrand sitzen keine Wartenden. Eine kleine, ungerechtfertigte Enttäuschung macht sich in ihm breit. Es war nicht abgemacht, dass Rosa kommt, doch sie ist die einzige nicht amtliche Person, die weiß, dass dieser Tag sein neuer Start ist. Er hat es ihr geschrieben, und dem Punkt, den er ans Ende der Mitteilung setzte, ist unweigerlich Hoffnung entwachsen.
Als Nächstes merkt er, dass er friert. Hemd und Lederjacke können gegen die neblige Novemberkälte nichts ausrichten. Er kommt sich vor wie einer von den Alkoholikern, die früher schon morgens vor der Trinkhalle standen und gegen das Schlottern in ihren zu dünnen Jacken antranken. Normalerweise war mindestens einer seiner Brüder darunter. Sieht so aus, als wäre er doch wie sie geworden, jedenfalls was die Unfähigkeit betrifft, sich vor Kälte zu schützen.
An der Haltestelle steht ein rauchender Fahrer neben seinem Bus und tut so, als nehme er den Mann, der mit der altmodischen Sporttasche in der Hand auf ihn zukommt, nicht wahr.
»Hab ich noch Zeit, eine zu rauchen?«, fragt Freddy.
»Kommt drauf an, wie schnell du ziehst«, gibt der Fahrer zurück und setzt sich ans Steuer. Freddy verzichtet auf die Zigarette. Den Fahrschein will er mit einem Fünfziger vom Überbrückungsgeld bezahlen.
»Sehe ich aus wie ’ne Bank?«, blafft der Busfahrer ihn an. »Wer große Scheine in der Tasche hat, kann Taxi fahren.«
Freddy beherrscht sich. »Wo geht’s zum Bahnhof?«, fragt er. Der Fahrer schickt mit dem Zeigefinger einen unsichtbaren Pfeil durch die Windschutzscheibe, schließt die Tür und fährt ab. Freddy folgt zu Fuß. Ich würde jeden Abgänger mitnehmen, denkt er sich, egal, ob er Kleingeld hat oder nicht, und das ist die Wahrheit, denn wenn man etwas über ihn sagen kann, dann, dass er in seinem Leben eine Menge Leute mitgenommen hat, oft ohne etwas dafür zu verlangen, zwar nicht im Bus, aber in diversen anderen Fahrzeugen. Schon sieht er sie vor sich, die Autos seines Lebens, und er hätte nicht übel Lust, sich in eines davon ans Steuer zu setzen und ein bisschen in der Gegend herumzufahren, als Gegengift zum vergitterten Dasein, das er gerade hinter sich lässt.
Als er zum ersten Mal im Straßenverkehr Auto fuhr, besaß er nicht einmal den Führerschein. Er fühlte sich dennoch verpflichtet zu fahren, weil es wichtig schien. Und was wichtig war, war oft auch richtig, selbst wenn es offiziell für falsch erklärt wurde.
Seine Freunde, mit denen er dank seines Kindheitskameraden Tom nach und nach vertraut geworden war, hatten sich, wie sie selbst sagten, der links-alternativen Szene zugehörig gefühlt und beschlossen, sich nicht mehr damit zu begnügen, über Themen wie Umwelt, Rüstung, Gleichberechtigung ausführlich zu diskutieren, sondern aktiv zu werden.
Sie wollten ihre Werte in einer Lebensform verwirklichen, die allem Rechnung trug, was ihnen wichtig war. Darum gründeten sie eine Wohngemeinschaft. Und sie wollten draußen in der Welt alles bekämpfen, was ihren Werten widersprach. Darum beteiligten sie sich an Aktionen.
Damals, als sie zusammenzogen, spitzte sich gerade die Auseinandersetzung um die Erweiterung des nahe gelegenen Rhein-Main-Flughafens zu. Also bot es sich an, am Widerstand gegen die geplante Startbahn West teilzunehmen. Ihr Bau musste verhindert werden, forderte besonders lautstark Lurch, der genau informiert war, wie viele Bäume dem Beton zum Opfer fallen würden und welche chronischen Krankheiten der Fluglärm bei den Bewohnern der umliegenden Ortschaften aller Wahrscheinlichkeit nach auslöste. Am WG-Tisch hatte man einvernehmlich dafür gestimmt, sich an den Protestaktionen zu beteiligen: Finger, Lurch und Tom sowie die Frauen. Aber als die nächste Großdemonstration anstand, erlitt ihr Eifer aus ganz profanen Gründen einen Dämpfer, denn sie stellten fest, dass sie gar nicht wussten, wie sie in den Wald neben dem Großflughafen kommen sollten.
Finger, der damals seinen R4 noch nicht besaß, ließ resigniert den Kopf hängen, weil ihm niemand einfiel, der bereit sein könnte, ihnen sein Auto zu leihen. Wie es aussah, würden sie zu Hause bleiben müssen, während an der Baustelle im Wald Zigtausende den Kopf hinhielten.
»Ich hab irgendwie das Gefühl, die anderen im Stich zu lassen«, meinte er, als würde er sämtliche Startbahngegner persönlich kennen, drehte sich eine Zigarette und blickte mit melancholischem Gesichtsausdruck in die Runde. Schon damals hatte er die übertrieben langen Nägel an der rechten Hand, die Freddy immer abstoßend fand, selbst als er den Anblick längst kannte, die aber in dem Moment, in dem Finger die Gitarre in die Hand nahm, vollkommen angemessen aussahen. Sie mussten so lang sein, damit das Picking klang. Und sie mussten für die Musik geschont werden. Finger machte nie einen Job, bei dem Gefahr bestand, dass die Nägel litten; er spülte grundsätzlich kein Geschirr, weil es die Nägel weich machte, sondern trocknete immer nur ab, und er reparierte auch sein Fahrrad nicht selbst, weil dabei leicht ein Nagel reißen oder brechen konnte. Stattdessen machte er eine ganz beiläufige Bemerkung, wenn Freddy in der Nähe war, worauf dieser meistens schon kurze Zeit später nach draußen ging, um es sich mal anzusehen.
Lurch, der eigentlich sowieso gegen Autos war, schlug vor, die Bahn nach Mörfelden zu nehmen und von dort mit dem Rad weiterzufahren, aber darauf hatte niemand Lust. Trotzdem schien es die einzige Möglichkeit zu sein, bis Freddy plötzlich meinte: »Ich kann fahren.«
»Seit wann hast du einen Führerschein?«, fragte Tom, der Freddy am längsten und besten kannte, und Freddy entgegnete lässig: »Zum Fahren braucht man keinen Lappen. Meine Brüder fahren alle ohne.«
Erst nachdem er das gesagt hatte, fing er an, sich zu überlegen, wie er es am besten anstellte, sich in der Werkstatt, in der er seine Lehre machte, unbemerkt ein Auto auszuleihen, mit dem er seine Freunde zum Demonstrieren in den Wald chauffieren konnte.
Sonderbar eigentlich, dass sie ihn damals nicht fragten, wo er das Fahrzeug hernehmen wollte. Vermutlich nahmen sie seinen Vorschlag gar nicht ernst.
Gerade als Freddy versucht, sich den Moment ins Gedächtnis zu rufen, in dem er heimlich den Wagenschlüssel vom Haken nimmt, reißt ihn ein Lied aus den Gedanken. Zwei Kinder singen es so laut sie können in den Morgen hinein, sie singen um die Wette und doch gemeinsam, und es ist ihnen nicht etwa gleichgültig, was die Leute denken, im Gegenteil, sie wollen, dass alle es hören, das liest Freddy ihren Gesichtern ab, als sie an ihm vorbeirollen, dicht nebeneinander in einem breiten, zeltartigen Wagen sitzend, der wie ein Fahrradanhänger aussieht und von einem lachenden Vater geschoben wird. In dem Moment weiß Freddy auf einmal, dass er das Lied der Kinder kennt, und zwar nicht, weil er es schon einmal gehört, sondern weil er es selbst gesungen hat. Eine in Nebel gehüllte Straße, feuchte Dunkelheit, ein Mann mit rotem Umhang auf einem weißen Pferd, ringsum Kinder, alle halten einen dünnen Stock in der Hand, an dessen Spitze mit Draht ein Lampion aus Papier befestigt ist, alle haben ein solches Licht, ausnahmslos alle, auch er, Freddy, und er trägt seine Laterne mit banger Vorsicht, damit sie nicht Feuer fängt, denn es brennt eine Kerze darin. Er hält seine Hand so, wie er sie damals hielt, und in dem Moment könnte er auch wieder das Lied mitsingen, brenne auf mein Licht, brenne auf mein Licht.
Freddy lächelt zum zweiten Mal, seit er das Gefängnis verlassen hat.
Wie erschrocken bleibt er stehen. Es ist ihm unheimlich. Im Knast wird nicht gelächelt. Es ist gefährlich, man gewöhnt es sich ab. Jetzt hat er es wieder getan. Wäre ich mit dem Bus gefahren, wäre mir das nicht passiert, denkt er und geht weiter. Die Tasche wiegt fast nichts.
Seltsam leicht trug sich auch die Laterne. Freddy konnte kaum fassen, dass er mit der Faust den hellen, dünnen Holzstock umschloss, an dessen Ende der Lampion hing. Er hatte ihn zum Martinstag selbst gebastelt, und er war heil geblieben. Schon die Geschichte dieses Mannes hatte ihm gefallen, der Sohn des römischen Offiziers, der mit fünfzehn Jahren Soldat wurde. Seine Kameraden schätzten ihn wegen seiner Geduld und Nächstenliebe, hatte die Kindergärtnerin vorgelesen, ein Satz wie ein Schmuckstück, Freddy hatte ihn nicht ganz verstanden, aber das Bild, das er vor sich sah, funkelte: Der Gardeoffizier auf seinem Schimmel macht vor einem Bettler halt, der fast keine Kleider am Leib hat, hört dessen Flehen in der klirrenden Kälte, nimmt kurzerhand seinen Umhang, teilt ihn mit dem Schwert und reicht dem Armen die eine Hälfte. Es war ein fantastischer Anblick, wie das weiße Fell des Pferdes und der rote Umhang einen leuchtenden Kontrast bildeten, vor dem die Schwertklinge aufblitzte.
Als die Kindergärtnerin ihre Schützlinge dazu ermunterte, ein Bild zu der Geschichte zu malen, riss Freddy voller Aufregung den Kasten mit den Wachsmalkreiden an sich, weil er allen zeigen wollte, was er vor seinem inneren Auge so deutlich sah. Doch wollte ihm das Pferd nicht gelingen, die Beine gerieten zu lang, der Kopf sah aus wie der eines Hasen. Freddy wurde wütend, kritzelte mit dicker schwarzer Wachsmalkreide über das Dokument seiner mangelhaften Ausdruckskunst und zerfetzte es am Ende.
Beim Basteln der Laterne riss er sich zusammen. Es glückte ihm, weil es etwas Gegenständliches war. Sobald die dritte Dimension hinzukam, wurde er geschickter, weil dann unter seinen Händen etwas Echtes entstand. Ein Bild war immer nur eine Illusion, eine Laterne aber war eine Laterne, die man vor sich hertragen konnte.
Ein Wunder, dass er beim Umzug überhaupt dabei war. Seine Schwester Anita hatte ihn mitgenommen. Sie war freundlicher zu ihm als früher, seit sie den dicken Bauch und den Mann mit den tätowierten Armen hatte, von dem sie behauptete, er sei nicht so, wie er aussehe, was Freddy nicht verstand, denn er sah nicht viel anders aus als zum Beispiel ihr Bruder Manni. Der hatte auch blaue Bilder auf den Armen, die man jedoch nur selten zu Gesicht bekam, weil Manni meistens auf Montage war, wie Oma sagte.
Auch von seinen anderen Brüdern waren oft welche abwesend. Manche hatte Freddy in seinem ganzen Leben nur wenige Male gesehen. Vielleicht hatte das so sein müssen. Vielleicht hätten sie gar nicht alle in das kleine Haus hineingepasst, wenn nicht immer zwei oder drei Brüder auf Montage und die eine oder andere Schwester bei einem Kerl gewesen wären.
Zu beiden Seiten der Straße stehen Einfamilienhäuser. Hier und da recht jemand im Garten Laub zusammen, und ein wohltuender Geruch nach Gras und feuchter Erde liegt in der Luft; man wird ganz gierig danach, wenn man ihn lange nicht gehabt hat. Beim Hofgang war man vor lauter Rauchen gar nicht zum Riechen gekommen, und außerdem: Hat es da Bäume gegeben?
Freddy bleibt unwillkürlich stehen und blickt auf die Uhr. Seit einer Viertelstunde ist er draußen und fängt schon an zu vergessen, wie es drinnen aussieht.
Eine Frau fegt die Straße, obwohl nicht Samstag ist, sie riskiert nicht einmal einen Seitenblick auf den Passanten, wohl wissend, dass er aus der Vollzugsanstalt kommt, und Freddy weiß, dass sie es weiß; die Frau hat schon viele entlassene Strafgefangene hier vorbeigehen sehen und jedem einzelnen die Wertminderung ihrer Immobilie übel genommen.
Eigentlich sieht die Straße kaum anders aus als die, in der Freddy seine Kindheit verbracht hat. Kleine Häuser von kleinen Leuten, alle ähnlich, nur dass es hier keinen Schandfleck gibt, wie Freddys elternloses Elternhaus einer war.
Anita hatte ihn zum Martinsumzug mitgenommen, Anita hatte ihm die Schultüte gekauft und ihn am ersten Schultag begleitet – und Anita hatte ihm erlaubt, wann immer er wollte, zu Besuch zu kommen, auch wenn ihr tätowierter Kerl jedes Mal murrte, weil Freddy so viel aß. »Der kommt bloß, wenn er Hunger hat«, sagte er, aber das stimmte nicht, denn Freddy hatte immer Hunger, auch wenn er nicht zu Anita ging.
Anita wohnte mit dem Tätowierten und den Kindern in einem ehemaligen Kasernengebäude aus Backstein, in dem Familien mit zu vielen Kindern in zu kleinen Wohnungen keine Ausnahme waren. Im Hof nebenan befand sich eine Autowerkstatt: Lada und Škoda, Reparatur und Verkauf. Die Leuchtreklame über dem Eingang verriet, dass der Eigentümer Dr. Hartmann hieß. In welchem Fach er sich den Doktortitel erworben hatte, wusste niemand. Oft ging Freddy, nachdem er sich in Anitas Küche satt gegessen hatte, hinunter und beobachtete Dr. Hartmann bei der Arbeit, sah zu, wie er den Overall auszog, sich die Haare aus dem Gesicht strich und sich im weißen Hemd an den Schreibtisch setzte, um Papierkram zu erledigen, den Overall dann wieder überzog, bevor er zur Reparatur eines Wagens in die Halle ging.
Freddy guckte schon als Junge jedem Auto hinterher, er kannte alle Marken und Modelle, sogar die amerikanischen, mit denen die GIs herumfuhren, einen Lada oder Škoda erblickte er im Stadtverkehr jedoch so gut wie nie. Trotzdem standen immer welche bei Hartmann in der Halle und auf dem Hof, auch an dem Samstag Anfang November 1981, als Freddy längst kein kleiner Junge mehr und auch kein bloßer Besucher der Werkstatt, sondern bereits Dr. Hartmanns einziger Lehrling war.
Er besaß einen Schlüssel für Hoftor und Werkstatt und wusste, wo der Ersatzschlüssel fürs Büro und dort wiederum der Schlüssel für den Schrank mit den Wagenschlüsseln versteckt war. Mit Kupplung, Gas und Bremse konnte er umgehen, weil er bei der Arbeit täglich Autos im Hof rangierte. Bloß im Straßenverkehr war er noch nicht gefahren.
Er entschied sich für einen blauen 1200er-Kombi, der gerade neue Stoßdämpfer bekommen hatte. Eine Stunde nach Feierabend holte er ihn vom Hof und fuhr damit bei der WG vor. Seine Freunde sahen ihn mit ungläubigem Staunen an, stiegen jedoch umstandslos ein. Tom zog gleich eine TDK aus der Tasche seines Parkas und schob sie in den Kassettenrekorder: David Bowie, Hunky Dory. Finger und Lurch protestierten, sie hielten das für dekadenten Pop und wollten was Ehrliches hören, wie sie es nannten, doch Tom saß vorne und drehte den Lautstärkeregler weiter nach rechts.
Freddy gefiel die Musik. Aber wahrscheinlich hätte ihm jede andere Musik in diesem Moment ebenso gut gefallen, denn er war stolz. Niemand außer ihm hätte es fertiggebracht, einen Wagen zu beschaffen. Er zitterte, weil er die Anerkennung durch die anderen spürte, ein bisschen zitterte er allerdings auch vor Aufregung, denn nun ging es auf die Autobahn. Zum Glück mussten sie nur dreißig Kilometer fahren, doch das Schnellstraßengewirr rund um Frankfurt hatte es in sich, ein Autobahnkreuz folgte dem anderen, jede Ausfahrt verzweigte sich mehrfach, man kam mit dem Lesen der Schilder kaum hinterher, und sobald man abbremste, wurde von hinten aufgeblendet und gedrängelt.
Freddy schwitzte, er hatte Angst, mit dem heimlich geliehenen Auto einen Unfall zu bauen, aber irgendwie funktionierte es, jedenfalls achteten die anderen überhaupt nicht auf die Herausforderungen des Verkehrs, sie diskutierten unentwegt: über die Musik im Auto, über Musik im Allgemeinen, aber auch über die geplante Wiederbesetzung des Hüttendorfgeländes, an der sie sich gleich beteiligen wollten. Lurch schilderte die Brutalität der Polizei bei der Räumung vor ein paar Tagen, als wäre er dabei gewesen. In Wahrheit hatte er nur einen getroffen, der einen kannte, der dabei gewesen war, aber die Geschichte steigerte trotzdem die Spannung. Man wusste nicht, was auf einen zukam, es bestand Anlass zur Vermutung, dass es hart werden konnte, und das wiederum machte ein bisschen ängstlich, aber auch ein bisschen stolz und kühn. Als käme es besonders auf sie an, auf die Besatzung dieses spielzeugblauen Ladas, der in der Abenddämmerung den Rhein überquerte und an Rüsselsheim vorbei nach Mörfelden-Walldorf fuhr, und je näher sie dem Waldgebiet mit der Baustelle kamen, desto aufgekratzter wurde die Stimmung.
Freddy achtete kaum darauf, wie die anderen sich gegenseitig ermutigten und anspornten, er konzentrierte sich aufs Fahren. Auch in ihm machte sich Enthusiasmus breit, aber der gehörte allein ihm. Er musste sich beherrschen, um nicht laut herauszuschreien: »Ich kann fahren! Ich hab die Kiste im Griff!«
Allerdings regte sich in seinem Inneren nicht nur Begeisterung, sondern auch das schlechte Gewissen. Dr. Hartmann kümmerte sich um ihn, bildete ihn aus, gab ihm die Gelegenheit, Geld zu verdienen und dabei etwas zu lernen, und nun hatte Freddy ihn hintergangen. Vermutlich würde er ihn in den nächsten Tagen auch noch anlügen müssen.
Bis sie am Waldrand ankamen, war es dunkel. Sofort fiel ihnen ein, dass sie vergessen hatten, Taschenlampen mitzunehmen. Zum Glück waren jede Menge Leute da, und die mit Lampen in der Hand schienen auch zu wissen, wo es zur Baustelle ging. Das Stimmengewirr, das rund um die geparkten Autos zu hören gewesen war, verlor sich im Wald immer mehr, es herrschte andächtige und gespannte Stille auf dieser Lichterprozession Hunderter, ja Tausender Menschen. Man hörte nur die Flugzeuge starten und landen, doch gar nicht so laut, wie man es so nahe am Flughafen hätte vermuten können, und nach einem Fußmarsch von einer knappen Stunde achtete man nicht mehr darauf, weil aus dem Wald plötzlich andere, unheimliche, nicht zu definierende Geräusche drangen und von Schritt zu Schritt lauter wurden. Bald schimmerte grelles Licht durch die Bäume, die gerodete Fläche wurde von Schweinwerfern erleuchtet, man sah Silhouetten von Demonstranten in diesem Gegenlicht, und dann sah man den Betonzaun, der das Baustellengelände einfasste, den Stacheldraht darauf, die Wachtürme am Tor, die Masten mit Scheinwerfern, gepanzerte Fahrzeuge, Wasserwerfer, Uniformierte in Rüstungen.
Finger, Lurch und Tom sagten lange nichts, sie spürten die bedrohliche Atmosphäre ebenso stark wie Freddy, achteten darauf, dicht beieinanderzubleiben, und wussten eigentlich nicht, was sie nun tun sollten. Keiner der anderen Demonstranten schenkte ihnen Beachtung. Also standen sie einfach da, Finger zog seinen Tabak aus der Tasche, drehte sich eine und gab ihn an Tom weiter, während Lurch, der nicht rauchte, eine Banane aß und Freddy, der meistens Aktive wechselnder Marken rauchte, weil die zu Hause überall herumlagen, eine HB aus der knittrigen Packung wurstelte. Die Andacht, die auf dem Weg hierher geherrscht hatte, wich einem Grummeln und Rumoren. Ausgelöst vom Anblick der Uniformierten, die dicht an dicht hinter dem Zaun standen, als rüsteten sie sich zur Schlacht, und tatsächlich dauerte es nicht lange, bis aus der Menge etwas über den Zaun geworfen wurde, vielleicht Holzstücke, vielleicht Steine, man konnte es nicht genau erkennen.
Die Antwort darauf: Tränengas. Eine Granate nach der anderen wurde in die Menge der Demonstranten geschossen, unwillkürlich rannten alle davon, aber schon nach wenigen Metern blieb Freddy stehen, ging hinter einem Baum in Deckung, hielt sich den Ärmel vor Nase und Mund und verfolgte gebannt, was da vorne, auf der beleuchteten, jetzt von Schwaden durchzogenen Bühne, geschah. Demonstranten mit Helmen und mit Tüchern vorm Gesicht warfen die Tränengasgranaten über den Zaun zurück und ließen Steine folgen, andere rissen mit Wurfankern Stacheldraht vom Betonzaun. Ringsum herrschte jetzt lautes Stimmengewirr, und dann sah man auf dem Wachturm neben dem Tor einen Uniformierten durchs Megafon auf seine Leute hinabschreien, die sich hinter dem Tor drängten. Freddy begriff, dass die Polizisten heißgemacht wurden, dass ein Ausfall bevorstand. Er blickte sich nach seinen Freunden um und sah sie nicht mehr, doch bevor er sich noch sorgen konnte, sie verloren zu haben, war es so weit: Das Tor im Betonzaun ging auf, und die Uniformierten mit den weißen Helmen kamen herausgestürmt wie eine wilde Herde. Sie trugen Plexiglasschilder und Schlagstöcke, kurze schwarze aus Gummi oder lange aus hellem Holz, und Freddy beobachtete von seinem Versteck hinter dem Baum aus, wie sie damit auf jeden einschlugen, der sich ihnen entgegenstellte oder auch nur im Weg war, sie schlugen sogar solche, die stürzten. Als er hinter sich Hilfeschreie hörte, fuhr er herum. Auf der Erde lag eine Frau, die beide Hände schützend um den Kopf gelegt hatte und um Hilfe schrie, während ein Uniformierter ihr so heftig auf den Rücken schlug, dass sein heller Holzstock brach. Verdutzt erstarrte er, besah die Bruchstelle, ließ dabei den Schild sinken, während die Frau sich aufrappelte. In dem Moment erkannte Freddy, dass sie schwanger war, und stürzte sich unversehens auf den Uniformierten. Er packte den Schild mit beiden Händen, entschlossen, dem Polizisten oder Grenzschützer oder was immer es war, damit wehzutun, ihm mindestens den Arm zu brechen. Freddy keuchte, sein Gegner keuchte, sie befanden sich im Nahkampf, und es war ihnen ernst, sie wälzten sich auf der Erde, Freddy nahm aus dem Augenwinkel heraus wahr, wie die Schwangere mit den blonden Locken heulend davonlief, und die Wut schoss wie Lava aus ihm heraus, er riss am Riemen des weißen Helms, wusste nicht, ob er seinen Gegner würgen oder ihm den Kopfschutz herunterreißen wollte, er hatte keinen Plan, er dachte keine Sekunde daran, dass gleich andere Uniformierte ihrem Kollegen beispringen würden, um auf Freddy einzuprügeln, und diese Erfahrung blieb ihm nur deshalb erspart, weil Tom, Finger und Lurch ihn mit vereinten Kräften von dem unter ihm liegenden Gegner wegzerrten und tief in den Wald liefen, wo das Licht der Scheinwerfer nicht hinreichte.
»Ich bin dafür, dass wir den Abgang machen«, sagte Lurch schnaufend.
»Mir wird allmählich auch kalt«, meinte Finger.
Tom sagte nichts. Er schien die anderen gar nicht zu hören, sondern starrte unbewegt zwischen den Bäumen hindurch auf das erleuchtete Schlachtfeld. Es sah aus, als wäre etwas mit ihm passiert.





























