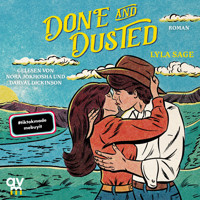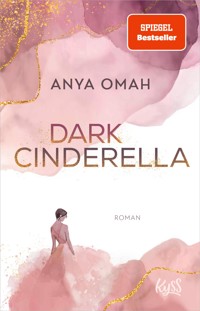8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was geschieht, wenn eine junge Ausreißerin und
ein pedantischer Witwer aufeinanderprallen?
Korbinian Gerhard ist Lehrer und seit dem Tod seiner Frau allein lebend. Er ist kauzig, pedantisch und legt Wert darauf, die Dinge unter Kontrolle zu haben. Billa ist siebzehn, freiheitsliebend und rebellisch – und ohne Dach über dem Kopf, denn sie ist von zu Hause abgehauen. Als Korbinian sie an einem kalten Winterabend hungrig und krank auffindet, nimmt er sie widerwillig mit zu sich nach Hause. Dass seine sorgsam gehütete Ordnung damit bedrohlich ins Wanken gerät, bekommt er bald zu spüren: Billa fegt – nebst ihrer Entourage – wie ein Wirbelwind durch sein Leben und scheut sich nicht, alle vermeintlichen Gewissheiten auf den Kopf zu stellen. Und Korbinian staunt nicht wenig, als er sich plötzlich wiederfindet in dem großen Abenteuer, das man Freundschaft nennt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Buch
Korbinian Gerhard ist Lehrer und seit dem Tod seiner Frau allein lebend. Er ist kauzig, pedantisch und legt Wert darauf, die Dinge unter Kontrolle zu haben. Billa ist siebzehn, freiheitsliebend und rebellisch – und ohne Dach über dem Kopf, denn sie ist von zu Hause abgehauen. Als Korbinian sie an einem kalten Winterabend hungrig und krank auffindet, nimmt er sie widerwillig mit zu sich nach Hause. Dass seine sorgsam gehütete Ordnung damit bedrohlich ins Wanken gerät, bekommt er bald zu spüren: Billa fegt – nebst ihrer Entourage – wie ein Wirbelwind durch sein Leben und scheut sich nicht, alle vermeintlichen Gewissheiten auf den Kopf zu stellen. Und Korbinian staunt nicht wenig, als er sich plötzlich wiederfindet in dem großen Abenteuer, das man Freundschaft nennt ...
Weitere Informationen zu Veronika Peters
sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Veronika Peters
Aller Anfang fällt vom Himmel
Roman
Originalausgabe
1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe September 2015
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Uno Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: plainpicture/Baertels
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-15562-9
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Die Löcher sind die Hauptsache
an einem Sieb.
Joachim Ringelnatz
Für den Lieblingsbruder
Kurz vor Schluss – Pellerow im August
Wach auf, alter Mann, und lass uns eine Bank überfallen!«
Die Stimme klatscht ihm wie ein Schwall kaltes Wasser ins Gesicht. Trotzdem schließt er sofort die Augen wieder, die er im ersten Schreck aufgerissen hat, lehnt sich an die Buche in seinem Rücken, spürt den runden kleinen Vorsprung, wo er letzte Woche den Ast abgesägt hat, spürt die schorfige Rinde am Hinterkopf und die Wärme der Abendsonne auf seinem Gesicht, tut zwei, drei tiefe Atemzüge, bevor er etwas sagt:
»Billa.«
Ganz ruhig spricht er den Namen aus, eine Feststellung, als wäre damit alles geklärt, als könnte er sein Nickerchen jetzt fortsetzen und später, wenn es kühler wird, zurück ins Haus gehen, sich einen Wein eingießen, vielleicht ein Feuer im Ofen anzünden oder sich mit dem Glas in der Hand wieder an den Baum lehnen und zusehen, wie die Sonne über den Wipfeln hinter dem See untergeht in einer glühenden Wolke aus Rot, Blau und Gold. Wenn ihm danach wäre, könnte er auch einen Spaziergang machen, am Ufer entlang bis zum Imbiss, wo er mit den Fischern und den anderen Männern des Dorfs einen Absacker zu sich nehmen und den Erzählungen des Tages zuhören würde, was sie gefangen haben und wie viele Fremde aus der Stadt gekommen sind, um Räucheraal und eingelegte Gurken zu kaufen.
Solange er Billa nicht anschaut, besteht die Möglichkeit, dass sie verschwindet, sich davonmacht, ohne ihn weiter zu behelligen, von selbst bemerkt, dass ihre Anwesenheit gerade eine wohlverdiente Abendruhe stört, dass er hier im Unterhemd sitzt, verschwitzt und schmutzig, nach einem Nachmittag im Kampf mit Brennnessel und Giersch … Nicht auf Besuch eingerichtet. Er ist ganz und gar nicht auf Besuch von ihr eingerichtet.
Es funktioniert nicht. Natürlich. Schritte knirschen im Kies, kommen näher, etwas schiebt sich zwischen ihn und die Abendsonne.
»Bist du noch böse?«, fragt sie. Es klingt besorgt, aber nicht sehr. Er sieht sie an. Saubere Jeans, ein T-Shirt mit Bob-Marley-Aufdruck, Turnschuhe so gut wie neu, sie hat sich schick gemacht.
»Wie kommst du hierher?«, fragt er.
Sie deutet zum Gartentor, wo ein glänzender Schädel hinter dem Busch aufblitzt. Deshalb also hat der Hund nicht angeschlagen, denkt er und ruft: »Schiller, komm schon rein!«
Schiller betritt das Gelände, wehrt den begeisterten Hund ab, schaut sehr schuldbewusst und sagt: »Die Kleine war so hartnäckig, Korb, ich konnte sie nicht länger abwimmeln, und dann fand ich sechs Wochen Pause auch irgendwie genug für dich.«
»So«, sagt er und wundert sich, warum sein Unmut sich nicht deutlicher äußert.
»Musste doch mal schauen, wie es meinem alten Mann geht«, drängt sich die helle Stimme dazwischen.
Mit achtzehn Jahren hört sie sich immer noch an wie ein tumbes kleines Mädchen, das auf liebes Ding macht, denkt er und sagt:
»Ich bin nicht dein alter Mann!«
»Hab Kotelett und Thüringer im Auto«, nuschelt Schiller und stapft wieder zum Gartentor hinaus, der Hund hinterher.
Sie steht dicht vor ihm, nimmt ihm die Sonne, die Hände tief in die Hosentaschen gegraben, die Ellenbogen abgewinkelt, dreht sich in den Hüften hin und her, dreist oder verlegen, schwer zu sagen.
»Schön hast du’s hier.«
Er nickt. Sie tritt von einem Bein aufs andere.
Sie hören die Seitentür von Schillers Transporter scheppern, einen schrillen Pfiff, ein Bellen, dann wieder Schillers tiefen Bass, der sich nähert. »Jajajajaja, für dich fällt schon auch noch was ab!«
Schiller schleppt ächzend eine riesige Kühlbox, himmelblau mit weißem Deckel, und der Hund hängt mit der Nase dran wie festgeklebt. Grinsend setzt er die Box im Kies ab, wischt sich den Schweiß mit dem Saum seines karierten Hemds von der Stirn und schaut von einem zur anderen.
»Was denn? Streitet ihr wieder?«
»Aber nein«, sagt Korbinian versöhnlicher, als es eigentlich seine Absicht war. »Ich will mich nur erst mal ein bisschen frisch machen, bevor ich Gäste empfange. Bin gleich wieder da.«
Als er zehn Minuten später in gebügeltem Hemd und sauberer Hose aus dem Haus tritt, sitzen Billa und Schiller plaudernd auf der Bank unter der Buche – seiner Bank. Beide haben eine Flasche Bier in der Hand, der Hund liegt abseits und kaut an einem Stück rohem Fleisch, ein schönes, ein friedliches Bild. Eigentlich.
Ich bin gespannt, womit sie Schiller eingelullt hat, damit er sie hier herausbringt, denkt er, in ein geradezu ideales Versteck, wenn man in der Stadt mal wieder Mist gebaut hat.
Billa springt etwas zu eilfertig auf, als sie ihn kommen sieht, deutet auf den frei gewordenen Platz neben Schiller und lässt sich selbst ins Gras fallen.
»Willst du auch eins?«, fragt sie und hält ihre Flasche hoch.
Er schüttelt den Kopf. »Nicht für mich. Aber danke.«
Sie stellt die Flasche in einigem Abstand neben sich, als dächte auch sie nicht im Traum daran, sie jetzt zu trinken. Und weil er den bösen kleinen Gedanken, der ihm gerade durch den Kopf schießt, nicht rechtzeitig abwenden kann, fragt er:
»Wie geht’s Manni?«
Zu seiner Überraschung strahlt Billa ihn an, greift sofort das Stichwort auf:
»Vorgestern war Verhandlung. Stell dir vor: Er hat Bewährung gekriegt. Super, oder?«
»Und da suchst du schon gleich wieder Komplizen für einen Banküberfall?«
»War ein Witz! Ich mach nichts mehr, ehrlich. Manni auch nicht, er hat jetzt echt was kapiert, sagt er. Ich soll dich grüßen. Von Emi natürlich auch. Besonders von ihr. Sie vermisst dich. Selbst der rothaarige Idiot fragt nach dir. Ich habe denen natürlich nicht verraten, wo du bist.«
O Gott, denkt er, ich hab sie wieder am Hals. Und die anderen mit Sicherheit auch bald. Alle.
Weil er nicht weiter auf die Grüße eingehen will, fragt er:
»Was versteht einer wie Manni unter kapiert?«
»Im Ernst. Er hat’s mir versprochen.«
»Na dann …«
»Außerdem muss ich keine Bank überfallen, sondern du.«
»Wieso ich?«
»Du wirst Geld brauchen, wenn du Schiller das alles hier abkaufen willst.«
»Wer sagt, dass ich kaufen will?«
»Schiller sagt das.«
Er sieht seinen Freund an, der schulterzuckend einen langen dunklen Ton auf der Öffnung seiner Bierflasche bläst und dann sein Schiller-Grinsen grinst, das ihn, wie so oft, jeglichen Kommentars enthebt.
»Na ja«, sagt Korbinian, »vielleicht hat er recht, und sechs Wochen Pause sind genug. Wollen mal sehen, was sich diesen Sommer noch so ergibt.«
Und dann geht er zur Kühlbox, zieht ein Sternburg zwischen Eisstücken, Fleischpackungen und Würsten heraus und hält es Billa zum Öffnen hin.
All das wäre vor neun Monaten noch absolut unvorstellbar gewesen.
Teil I – Das Fundmädchen
1
Ein kalter Herbststurm hatte die ganze Nacht über der Stadt getobt, und Korbinian Gerhard hatte schlecht und unruhig geschlafen. Dennoch schlug er wie an allen Werktagen der vergangenen Jahre auch an diesem Freitag um Punkt sieben die Decke zur Seite, sobald sein Wecker den ersten Ton von sich gegeben hatte. Er hob die Beine über die Bettkante, richtete sich langsam auf und blieb einen Moment still sitzen, damit der Kreislauf in die Gänge kam. Währenddessen glitten seine Füße in die Hausschuhe, die er am Vorabend bereitgestellt hatte: rechter Winkel zum Bett, parallel nebeneinander, exakt an der richtigen Stelle.
Er fühlte sich nur dann wohl, wenn alles um ihn herum verlässlich strukturiert war, wenn die Welt ihre Ordnung hatte, und sei es nur in Form perfekt positionierter Filzpantoffeln in der Morgenfrühe.
Der Tod seiner Frau Marie, die ihn von dem gerahmten Foto auf der Kommode im Flur verhalten anlächelte, lag sieben Jahre, elf Monate und neun Tage zurück, und er hatte sich so gut in der Gleichförmigkeit seines Witwer-Alltags eingerichtet, wie es eben möglich war.
Der einzige Mensch, der ihn noch gelegentlich auf einen Sonntagnachmittagstee besuchte, war seine jüngere Schwester Emilia, und das auch nur, weil es sich schlicht nicht verhindern ließ.
Nachdem seine Frau so völlig unerwartet gestorben war, hatte er sich das Alleinsein wie einen Mantel umgelegt, der ihn vor dem Mitleid und der Anteilnahme anderer schützte. Die bedeutungsvollen Blicke, das hilflose Gestammel, die Verlegenheit, mit der die Leute ihm begegneten, all das hatte das Unfassbare nur schlimmer gemacht. Kurz nach der Beerdigung hatte er deswegen alles darangesetzt, die Kümmerer und Möchtegerntröster so schnell wie möglich loszuwerden. Er hatte den Anrufbeantworter unbeachtet auf Dauerbetrieb laufen lassen, Kondolenzbriefe direkt zum Altpapier gegeben, wohlmeinende Helfer so lange unter fadenscheinigen Gründen abgewiesen, bis sie es aufgaben. Als endlich Ruhe eingekehrt war, begann er damit, sein Leben ohne Marie in den Griff zu bekommen, was nur und ausschließlich im Alleingang möglich gewesen war.
Seine freien Stunden und Tage verbrachte er seither am liebsten in seiner Wohnung. Er mochte es, endlos in den Kunstbildbänden zu blättern, die seine Regale füllten, sich in Klassiker oder Künstlerbiografien zu vertiefen, die Zeitung ohne Unterbrechung von der ersten bis zur letzten Seite zu lesen, Naturdokumentationen im Fernsehen anzuschauen, all diese angenehmen Dinge zu tun, bei denen die Anwesenheit anderer Menschen nur gestört hätte. Allenfalls ein Gang durch den Park konnte ihn freiwillig aus der Wohnung locken, wobei er auch da nie jemanden direkt ansah oder grüßte, um der Gefahr auszuweichen, in ein Gespräch verwickelt zu werden.
Es genügte ihm völlig, dass er vormittags in der Schule dazu gezwungen war, unablässig mit Kindern, Kollegen und Eltern umzugehen, aber das ließ sich nun mal nicht ändern, wenn er nicht in Frührente gehen wollte.
Alleinsein und Ordnung, das waren die beiden Pfeiler, auf denen Korbinians Existenz als Witwer bis zu diesem vierzehnten November aufgestellt war, Alleinsein und Ordnung hielten ihn beieinander, und genauso wäre es bis an sein Lebensende geblieben, wenn er selbst zu bestimmen gehabt hätte.
Korbinian löste seinen Blick von dem Foto seiner Frau und ging ins Bad. Im Spiegel betrachtete er sein fahles Gesicht, die Tränensäcke unter den Augen, das schütter werdende Haar. Bis dass der Tod euch scheidet. Sie würden einander nie altern sehen.
»Alles um uns herum verändert sich. Nur du nicht«, hatte Marie wenige Tage vor der Katastrophe zu ihm gesagt, und er hatte das damals als Kompliment genommen. An diesem Morgen aber, als ihm ihre Worte und deren mögliche Bedeutung wieder einmal durch den Kopf gingen, war er sich nicht mehr hundertprozentig sicher, ob er sie richtig interpretiert hatte. Und diese Unsicherheit irritierte ihn mehr, als er für möglich gehalten hätte.
Er wusch und rasierte sich, ging danach in die Küche, um sich sein Frühstück zuzubereiten. Zwei Eier der Größe M in der Pfanne verrührt, eine Scheibe Graubrot mit Butter, zwei Tassen Filterkaffee, ohne Milch und ohne Zucker, wie an jedem einzelnen Morgen seit bald acht Jahren.
Als Marie noch am Leben gewesen war, hatte morgens immer sie den Tisch gedeckt, während er noch beim Rasieren gewesen war, und Eier hatte es nur sonntags gegeben wegen des Cholesterinspiegels. Vielleicht war auch der sich damals schon bei ihm abzeichnende Bauch der Grund gewesen, und seine Frau hatte es nur taktvoller auszudrücken versucht.
Während er darüber nachdachte, wandte er sich mit der Pfanne in der Hand vom Herd zum Küchentisch, um sein Ei neben das geschmierte Brot auf den Teller rutschen zu lassen, nahm dabei etwas zu viel Schwung und verfehlte den Teller knapp. Die Eiermasse klatschte mit einem unappetitlichen Schmatzen auf den Küchenboden.
Korbinian schüttelte den Kopf und griff zum Lappen. Wenn etwas durcheinandergeriet, musste man es eben wieder in die Ordnung zurückführen, und dieses kleine Missgeschick hier war leicht zu bereinigen.
Nachdem er die Eierreste in den Mülleimer entsorgt und den Boden gesäubert hatte, verließ er trotz des Malheurs pünktlich um sieben Uhr dreißig das Haus.
Korbinian stemmte sich gegen den immer noch mächtig wehenden Wind. Er drückte mit der einen Hand seine alte Aktentasche an die Brust, verhinderte mit der anderen, dass der Hut weggeblasen wurde, und war erleichtert, als er keine zwanzig Minuten später heil das Schultor passierte.
In den ersten beiden Stunden hatte er die 3b während einer Deutscharbeit zu beaufsichtigen, eine angenehm ruhige Tätigkeit. Im Anschluss war die 4a außerplanmäßig während der Pause davon abzuhalten, die Einrichtung des Klassenzimmers zu zerlegen, da aufgrund des stürmischen Wetters alle Schüler in den Räumen zu bleiben hatten. Eine notwendige Sicherheitsmaßnahme, wie im Auftrag von Direktorin Schmalenberg über die Lautsprecheranlage verkündet worden war. Korbinian ließ die Kinder ihre Frühstücksbüchsen auspacken, bat um Zimmerlautstärke und widmete sich selbst seinem täglichen Apfel.
Nach etwa sieben Minuten Sicherheitsmaßnahme kippte ein dickliches Mädchen mit strähnigem, aschblondem Haar seitlich mit seinem Stuhl um, knallte dabei gegen den Nachbartisch und blutete derart heftig aus der Nase, dass Korbinian sein bestes Stofftaschentuch opfern musste. Weil sich spontan kein Freiwilliger finden ließ, begleitete er die weinende Schülerin persönlich zur weiteren medizinischen Versorgung ins Sekretariat, obwohl das hieß, die Verantwortung für die im Raum verbleibenden Kinder dem zuständigen Klassensprecher zu übertragen, einem Professorensohn, den er für einen intriganten und gefallsüchtigen Streber hielt. Zehn Minuten später musste er dann die empörte Rede der herbeigeeilten und von verletzter Aufsichtspflicht faselnden Mutter über sich ergehen lassen. Die Frau war trotz des verkniffenen Gesichtsausdrucks von derart makelloser Eleganz, dass ihm das dicke hässliche Mädchen daneben selbst dann von Herzen leidgetan hätte, wenn es gerade nicht verheult und blutbeschmiert gewesen wäre. Sie sei Anwältin, verkündete die Mutter, und die Zustände an dieser Schule seien ihr schon lange ein Dorn ihm Auge, ihre Henriette sehe sie tagtäglich den übelsten Nachstellungen ausgesetzt, Mobbing sei das, ein ganz klarer Fall, aber niemand unternehme etwas zum Schutz des Kindes, ein Skandal, und so weiter. Korbinian ließ die Tirade an sich vorbeirauschen, während er sich auf etwas Angenehmes zu konzentrieren versuchte, eine Blumenwiese von Monet zum Beispiel.
Als der Dame angesichts seiner gleichbleibend lächelnden Gesprächsverweigerung nichts mehr einfiel, worüber sie sich beschweren konnte, verstummte sie jäh, und er sah seinen Einsatz gekommen. Mit wenigen, aber warmherzig und verständnisvoll klingenden Worten versprach er, in Zukunft ganz besonders auf das Wohlbefinden der lieben Henriette zu achten, und schickte mit dem nächsten Satz Mutter und Kind samt schuleigenem Eisbeutel in dessen Genick zur weiteren Genesung nach Hause. Die Anwältin nahm das indigniert, aber widerspruchslos hin, bejahte Korbinians Bitte, im Fall eines Arztbesuchs der Schule umgehend Meldung zu machen, und wünschte beim Hinausgehen halbwegs versöhnt einen guten Tag.
Die Sekretärin, vor deren Schreibtisch sich die Szene abgespielt hatte, seufzte auf und sagte: »Herr Gerhard, was hätte ich nur mit dieser grässlichen Person gemacht, wenn Sie nicht bei mir gewesen wären?!« Dabei flammte über ihre Wangen ein so tiefes Rot, dass Korbinian sich wunderte.
»Ach was, Frau Schütz, Sie hätten das auch gut ohne mich hingekriegt«, murmelte er und kehrte in seine Klasse zurück.
Nun reicht es für heute aber wirklich, sonst erwäge ich ernsthaft die Frührente, dachte er, nachdem er das Gepetze des Strebers ignoriert und die aufgeregte 4a mit einem Kurzdiktat, das um einiges über den allgemeinen Leistungsanforderungen lag, wieder zur Ruhe gebracht hatte.
Als er gegen vierzehn Uhr erschöpft, aber mit der Aussicht auf ein entspanntes, stilles Wochenende das Schulgebäude verließ, schlug Korbinian wie üblich den Weg zu Bolles Ochsenglück ein.
Er trat in den schlicht eingerichteten Schankraum, grüßte den glatzköpfigen Wirt mit Handzeichen und schob das »Reserviert«-Schild auf einem kleinen Tisch am äußersten Ende des Raums beiseite, um seinen angestammten Platz hinter einer mannshohen Zimmerlinde einzunehmen. Ohne dass er eigens bestellen musste, wurde ihm eine Viertelstunde später das Tagesgericht mit einer kleinen Apfelschorle serviert, Kassler, Kartoffelbrei, Sauerkraut, eine mittlere Portion.
»Guten!«, sagte der Wirt.
Korbinian senkte dankend den Kopf, nahm sein Besteck und aß.
Nach dem Essen legte er einen Schein unter das geleerte Glas, hob erneut die Hand zum Gruß und ging. Kein einziges Wort hatte er sagen müssen, um gut gesättigt den Heimweg antreten zu können. Das war einer der beiden Gründe, warum er dem Ochsenglück trotz der eher mittelmäßigen und wenig abwechslungsreichen Küche schon seit Jahren die Treue hielt. Der andere Grund war schlicht und einfach Dankbarkeit.
Das Datum, an dem Korbinian das Lokal zum ersten Mal betreten hatte, war tief in sein Gedächtnis gebrannt: Montag, der elfte Dezember 2006. Maries Familie hatte auf einem traditionellen Kuchenbuffet im Anschluss an die Beisetzung bestanden, und er war fest entschlossen gewesen, daran teilzunehmen, seine Pflicht als Schwager und frisch verwitweter Ehemann zu erfüllen, ganz gleich, wie schwer es ihm fiel. Als sich dann aber die Menge vom Friedhof wegbewegte, war er, nachdem er mechanisch unzählige Hände geschüttelt und gut gemeinte Sätze überhört hatte, noch einmal an das offene Grab getreten. Er hatte auf den Sarg hinuntergeschaut, der lose mit Erde und Blumen bedeckt war, und dabei war ihm alles entglitten. Ob jemand aus seiner oder Maries Familie ihn angesprochen oder zum Mitkommen aufgefordert hatte, wie lange er dort stehen geblieben war, er wusste es nicht mehr. Alles, woran er sich erinnerte, war, dass er, statt sich der Trauergemeinde anzuschließen, durch die Straßen gelaufen war, bis er am späten Nachmittag festgestellt hatte, dass er sich in einer Seitengasse nicht weit von seiner Wohnung befand. Er war stehen geblieben, hatte sich umgeschaut, und da war ihm das eigenartige Wirtshausschild aufgefallen, das er zuvor nie bewusst wahrgenommen hatte: Ein grinsender Kuhkopf aus Blech, grün und lila angepinselt, schaukelte an einem eisernen Winkel im Wind. Das Gebilde ähnelte eher einer Schülerarbeit als dem Werk eines professionellen Schmieds. Außer dem kahlen Wirt war nur ein einsamer Trinker an der Theke anwesend gewesen, als er, wie ferngesteuert, die Gastwirtschaft betreten hatte. Korbinian war mitten im Raum stehen geblieben, unschlüssig, was er jetzt tun sollte, und hatte auf die lebensgroße Gipsbüste gestarrt, die streng von einem Regal hinter der Zapfanlage herunterschaute. FriedrichSchiller hatte jemand mit einem dicken Filzstift auf den Gipssockel geschrieben, und Korbinian hatte sich aus einem für ihn unerfindlichen Grund darüber gefreut. Anscheinend eine dichterfreundliche Kneipe, hatte er gedacht, und dass diese Tatsache Marie gefallen hätte. Der Wirt hatte ihn währenddessen aufmerksam gemustert und dann mit ernster Miene gefragt, ob er ihm etwas zu essen bringen dürfe. Korbinian hatte genickt.
»Wusste ich’s doch«, hatte der Wirt gesagt und mit ausgestrecktem Zeigefinger auf den Tisch in der rechten hinteren Ecke gedeutet, wo man sichtgeschützt hinter der üppig wuchernden Zimmerlinde sitzen konnte. Korbinian hatte stumm Platz genommen. Wenig später hatte der Kahlköpfige ohne vorherige Bestellung einen dampfenden Teller Bauernfrühstück und ein frisch gezapftes Bier an den Tisch gebracht, und Korbinian war sich, völlig erstaunt, der Tatsache bewusst geworden, dass er wirklich großen Hunger hatte.
»Pils geht heute aufs Haus«, hatte der Wirt gesagt und das Glas vor Korbinian hingestellt. Dann hatte er ihm kurz, aber energisch auf die Schulter geklopft und war wieder hinter die Theke verschwunden.
Warum auch immer, aber diese etwas raue Geste und der Duft des gebratenen Specks über den Kartoffeln waren das einzig wirklich Tröstliche an diesem zweitschlimmsten aller Tage gewesen, womöglich sogar die Rettung davor, direkt bis zum Kanal durchzumarschieren und dem Elend ein kaltes nasses Ende zu bereiten.
Als Korbinian tags darauf zur Mittagszeit im Ochsenglück erschien, hatte der Wirt ihm freundlich lächelnd denselben Platz wie am Vortag zugewiesen, als seien sie bereits alte Bekannte.
»Großen Hunger?«
»Mittel.«
»Gulasch mit Knödeln und Rotkraut?«
»Gern.«
»Heute musst du dein Bier selbst bezahlen.«
»Ab heute trinke ich Apfelschorle.«
»Auch gut.«
Das war das längste Gespräch, das bislang zwischen ihm und dem glatzköpfigen Wirt stattgefunden hatte, von dem er nicht einmal den Namen wusste. Seitdem war Korbinian Stammgast imOchsenglück, wenn auch immer nur mittags, wenn nicht geraucht wurde und außer ihm sowieso kaum einer kam.
Aufgrund des rauen Wetters verzichtete Korbinian nach dem Essen auf einen Verdauungsspaziergang durch den Park, den er ansonsten zur Einleitung des Wochenendes gern unternahm. Stattdessen ging er direkt zum nahegelegenen Supermarkt. Er brauchte Butter und Fleischwurst für sein Abendbrot, auch die Äpfel gingen zur Neige. Um diese Zeit würde das Geschäft leer, der Einkauf somit vergleichsweise angenehm sein.
Scharfe Böen fegten schon wieder durch die Straßen, der Himmel erschien viel zu dunkel für die Tageszeit. Korbinian wollte sich beeilen, um zu Hause zu sein, ehe die Wetterlage sich weiter verschlechterte, und hastete auf den Eingang des Geschäfts zu.
Wahrscheinlich hätte er die zusammengekauerte Gestalt an der Hauswand hinter den Einkaufswagen gar nicht bemerkt, wäre nicht genau in diesem Moment ein dicker Ast nur einen halben Meter von ihr entfernt heruntergekracht, ohne dass sie sich nur einen Millimeter gerührt hätte. Korbinian blieb stehen und überlegte, ob man etwas für diesen Menschen tun musste. Hier war jemand anscheinend nicht mehr Herr seiner Sinne.
Was, wenn er das nächste Mal getroffen wurde? Es war auf den ersten Blick nicht zu erkennen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte, nur dass er oder sie sehr jung war, ahnte man. Der Kopf war mit einer Kapuze verhüllt, die Arme darüber verschränkt, das Gesicht auf die angewinkelten Knie gedrückt, als sollte die Außenwelt ferngehalten, jeder Annäherungsversuch abgewehrt werden. Für diesen Wunsch hatte Korbinian durchaus Verständnis, aber man hockte sich doch nicht einfach so vor einen Supermarkt, schon gar nicht bei diesem Wetter. Einige Sekunden blieb er stehen, unschlüssig, was er unternehmen sollte, dann zog er sein Portemonnaie unter dem Mantel hervor und suchte eine Euromünze heraus. Ein Spendenbecher oder etwas Ähnliches war aber gar nicht vorhanden. Vielleicht ist Geld nicht erwünscht, dachte Korbinian, so etwas gab es ja.
Eine Filmszene fiel ihm ein, wo die weibliche Hauptfigur durch New Yorks Straßen eilte und im Vorbeigehen einem alten Mann einen Dollar in den Pappbecher warf, den er in den Händen hielt. Empört protestierte der Alte, als Kaffee aus dem Becher schwappte, und die übereifrige Spenderin war blamiert. Marie hatte damals über diese Szene schallend gelacht; ihm selbst war es eher unangenehm gewesen, sich über so ein peinliches Missgeschick zu amüsieren.
Wo sollte er also jetzt mit seinem Euro hin? Korbinian räusperte sich. Keine Reaktion. Schließlich steckte er die Münze in den Schlitz des ersten von mehreren aufgereihten Einkaufswagen, zog ihn heraus, so leise es ging, und schob ihn in den Laden.
Als Korbinian nach seinem Einkauf aus dem Markt trat, war nicht erkennbar, ob sich das magere Häuflein Mensch inzwischen bewegt hatte. Die Haltung schien unverändert, nur auf der rechten Schulter war ein gelblich braunes Herbstblatt liegen geblieben wie auf einer Steinfigur.
Wahrscheinlich schläft er einfach seinen Rausch aus, dachte Korbinian und bemühte sich, den Einkaufswagen möglichst geräuschlos wieder an seinen Platz zu schieben. Jetzt war er sich sicher, dass er einen Mann, eher einen Jungen, vor sich hatte. Der Junge trug eine viel zu große abgewetzte Motorradlederjacke über dem Kapuzenpullover, und seine Jeans war fleckig, die Segeltuchturnschuhe fielen auseinander, die aus den zerschlissenen Jackenärmeln ragenden Hände starrten vor Schmutz, sodass Korbinian sich unwillkürlich abgestoßen fühlte. Das Leben konnte einem leicht entgleiten, klar, aber dieser Mensch hatte offenbar keinen Funken Selbstachtung mehr, dass er derart zu verkommen schien.
Er erwog, die Marktleiterin zu informieren, verwarf die Idee aber gleich wieder. Seinetwegen sollte der jugendliche Penner dort seine Ruhe haben, was ging das ihn an?
Und so machte er sich auf den Heimweg, um sein wohlverdientes Wochenende einzuläuten.
Es war schon Viertel nach sieben, als Korbinian bemerkte, dass er vergessen hatte, Eier einzukaufen. Auch der Kaffee würde nicht bis Montag reichen, und das ärgerte ihn. Normalerweise achtete er darauf, dass mindestens ein oder zwei Packungen vorrätig waren, um genau solche Engpässe zu vermeiden. Aber anscheinend hatte er diesmal nicht rechtzeitig für Nachschub gesorgt.
Ich werde unachtsam, dachte Korbinian und beschloss, die fehlenden Dinge noch rasch zu besorgen, ehe der Supermarkt um zwanzig Uhr schloss.
Der junge Obdachlose saß noch genauso da wie vor einigen Stunden. Augenscheinlich war von niemandem ein Versuch unternommen worden, sich um ihn zu kümmern. Korbinian erschrak fast selbst, als er sich sagen hörte: »Entschuldigung, kann ich etwas für Sie tun?«
Lange rührte sich nichts. Dann ging durch den gebeugten Rücken eine wellenartige Bewegung, der Kopf hob sich wie in Zeitlupe von den Knien, und Korbinian bereute es augenblicklich, sich bemerkbar gemacht zu haben. Ein schmutziges, wie erwartet sehr junges, aber ganz eindeutig weibliches Gesicht wandte sich ihm zu. Hätte er gewusst, dass da eine Frau vor ihm hockte, wäre er nicht so schnell bereit gewesen, sie anzusprechen und seine Hilfe anzubieten. So etwas konnte leicht missverstanden werden.
Ihre Stimme war rau und brüchig, als hätte sie längere Zeit nicht gesprochen.
»Bringst du mir etwas zum Essen von drinnen mit? Geht das?« Fiebrige, aus dunklen Höhlen glänzende Augen, eingefallene Wangen. Die ganze Erscheinung sah angegriffen, geradezu elend aus.
»Äh … Ja … Schon«, stotterte Korbinian. »Was möchten Sie denn?« Bewusst erwiderte er das distanzlose Du nicht.
»Egal. Irgendwas.«
Noch bevor Korbinian einen weiteren Satz herausbrachte, war der Kopf des Mädchens wieder auf die Knie gesunken.
Während er an den Regalen entlangging, Ausschau nach etwas hielt, das er der hungrigen Bettlerin kaufen konnte, fragte er sich, warum er ihr nicht einfach eine Geldmünze gegeben hatte, wie es bereits am Nachmittag seine Absicht gewesen war. Jetzt musste er planlos hier herumirren, um einer Fremden irgendwas Essbares zu besorgen. Gab es dafür nicht Suppenküchen oder Sozialdienste, Leute, die dafür bezahlt wurden, das Richtige in solchen Situationen zu tun?
Im Kühlregal nahe der Käsetheke entdeckte er in Plastikboxen eingeschweißte Sandwiches und nahm kurz entschlossen drei davon mit: eins mit Lachs, das zweite mit Mozzarella und Tomaten, das letzte mit Gouda und Salat. Erleichtert steuerte er die Kasse an, musste dann aber noch einmal umdrehen, um den Kaffee zu holen, den er vor lauter Suchen beinahe wieder vergessen hätte. In der Getränkeabteilung nahm er spontan noch eine Flasche Limonade mit. Wer Hunger litt, hatte wahrscheinlich auch Durst. Draußen legte er die Sachen rasch vor dem Mädchen ab und beeilte sich, von ihr wegzukommen.
»Hey! Danke, Mann!«, hörte er sie noch hinter sich rufen, bevor er das Supermarktgelände verließ, im Grunde nicht viel mehr als ein Krächzen, beklagenswert wie das ganze Geschöpf. Er drehte sich nicht nach ihr um.
Eine gute Tat, dachte er, als er geradezu beschwingt die Straße entlangging, und schämte sich im nächsten Augenblick ein wenig, weil er sich als Wohltäter gefiel. Er hatte ja nichts weiter getan, als kostengünstige Fertigprodukte von zweifelhafter Qualität zu erwerben, sie vor jemandem abzuladen, dem es dadurch kaum, oder wenn, dann nur kurzfristig besser ging. Die junge Frau würde weiterhin in Regen und Kälte sitzen, und wahrscheinlich würde sie, schloss man den Supermarkt, sowieso vom Personal entdeckt und in die Obhut von Polizei, Jugendamt oder Obdachlosenhilfe gegeben werden. Aber das brauchte ihn nun endgültig nicht mehr zu interessieren. Er hatte geholfen, im Gegensatz zu all den anderen Leuten, die vorbeigegangen waren, ohne etwas zu unternehmen.
Bis zu seinem Haus war es nicht weit, ein Fußweg von wenigen Minuten, und wäre er dabei nicht so sehr mit seinen Gedanken beschäftigt gewesen, hätte er auch nur ein einziges Mal zurückgeschaut, wäre ihm wahrscheinlich trotz der Dunkelheit aufgefallen, dass ihm jemand folgte. So aber bekam er einen gewaltigen Schreck, als auf der Schwelle vor seinem Haus, während er noch in seiner Tasche nach dem Schlüssel kramte, etwas seinen Rücken berührte.
Korbinian fuhr derart heftig herum, dass das Etwas hinter ihm zurückwich, dabei die Stufenkante verfehlte, mit dem Rücken in das Rosenbeet neben der Haustür fiel und zunächst reglos dort liegen blieb.
»Scheiiiißeeee!«, stöhnte es nach endlosen Sekunden aus dem Beet. Korbinian fasste sich an die Brust, er konnte seinen Herzschlag deutlich spüren.
»Haben Sie sich verletzt?«, japste er. Gleichzeitig fiel ihm ein, dass er gerade knapp einem dieser Überfälle entgangen sein könnte, die sich in der letzten Zeit in der Gegend häufiger ereigneten. Da er aus prinzipiellen Erwägungen kein Mobiltelefon besaß, hätte er brüllen müssen, um auf sich aufmerksam zu machen. Aber so bedrohlich, dass er seine Nachbarn aufscheuchen und nach der Polizei schreien musste, schien die Lage doch nicht zu sein. Ein Ächzen drang aus dem Dunkel, das Knacken von Gehölz, ein weiterer Fluch … Wenn jemand Hilfe brauchte, dann eher die gestürzte Person im Beet.
Korbinian trug eine kleine Taschenlampe an seinem Schlüsselbund, die er alle halbe Jahre mit einer frischen Batterie versah, für den Fall, dass sie einmal gebraucht wurde. Tatsächlich funktionierte die Lampe jetzt tadellos, als er zwischen die Rosen leuchtete. Mit einer schnellen Bewegung nahm er den Lichtstrahl wieder weg. O Gott, bitte nicht!, dachte er, aber es änderte nichts an der Tatsache, dass das, was dort zwischen den dornigen Zweigen herumzappelte und sich schimpfend aufzurichten versuchte, die junge Bettlerin vom Supermarkt war.
Nicht lange nach ihrem Sturz saß sie im Souterrain des Hauses unter der Treppe zwischen einem Kinderwagen und einem Dreirad, und Korbinian, der ihr, noch halb starr vor Schreck, aufgeholfen und sie mit hineingenommen hatte, sah zu, wie sie in einer schäbigen Stofftasche kramte.
»Bisschen zerquetscht, kann man aber noch essen«, sagte sie, als sie fand, wonach sie gesucht hatte, wobei die letzte Silbe in einem Hustenanfall unterging. Sie trank etwas aus der Limonadenflasche, die sie ebenfalls aus der Tasche hervorgeholt hatte, während Korbinian sie wie eine Geisterscheinung anstarrte.
»Wird gleich besser«, krächzte sie. Von ihrem Handrücken lief etwas Blut aus einem frischen Kratzer.
»Bist du sicher, dass du keine ernsthaften Verletzungen davongetragen hast?« Das Mädchen weiter zu siezen fand er albern.
Sie hustete erneut, trank noch einen Schluck, öffnete dann eine der Sandwichpackungen und hielt sie Korbinian entgegen.
»Ich bin okay. Willst du was abhaben? Ist eh zu viel für mich.«
Er schüttelte den Kopf. »Nein danke. Heb dir den Rest lieber für später auf.«
Sie antwortete mit einem Schulterzucken, fasste das Brot mit beiden Händen und biss hinein. Korbinian hatte erwartet, dass sie das Essen heißhungrig herunterschlingen würde, aber sie nahm nur kleine Bissen, kaute zwischendurch lange, fasste sich mehrmals an den Hals, als würde ihr das Schlucken große Mühe bereiten. Immer wieder lehnte sie den Kopf an die Hauswand, schaffte es offensichtlich kaum, die Augen offen zu halten. Korbinian war es unangenehm, ihr bei diesem qualvollen Essen zuzusehen.
»Dann lasse ich dich mal in Ruhe«, sagte er. »Du machst keinen Unfug hier drinnen, oder?«
Das Mädchen sah ihn bloß mit schweren Lidern an.
Er wollte nur noch in seine Wohnung zurück, für niemanden zu sprechen, schon gar nicht verantwortlich sein. In den Sturm hinaus konnte man sie kaum guten Gewissens schicken, und wenn sie keinen anderen Platz zum Schlafen hatte, mochte für dieses eine Mal das Treppenhaus genügen. Sie war sowieso zu geschwächt, um irgendetwas anzustellen.
»Morgen früh bist du aber endgültig wieder verschwunden, ist das klar?«
»Ist klar.«
»Das hier muss die absolute Ausnahme sein, hörst du?«
Sie nickte schwach.
»Und dass du mir leise bist!«
»Ich will nur schlafen.«
Er zweifelte nicht daran, dass das stimmte.
»In Ordnung. Dann gute Nacht.«
»Danke, Mann! Du bist echt cool!« Ihr fielen die Augen zu, der Kopf sank zur Seite, während sie die Packung mit dem restlichen Sandwich noch immer in der Rechten hielt.
Korbinian sah auf das Mädchen hinunter, überlegte, was eine so junge Person wohl an einem derart ungemütlichen Tag allein, heruntergekommen und hungrig vor den Supermarkt getrieben haben mochte, fragte sich, warum sie um Himmels willen ausgerechnet ihm gefolgt war. Wegen dreier Brote und einem Getränk? Wohl kaum.
Langsam stieg er den unteren Treppenabsatz hinauf, blieb kurz vor der Aufzugtür stehen, lauschte. Nichts war zu hören. Sie würde sich ausruhen und dann weiterziehen, er hatte getan, was in seinen Möglichkeiten lag, jetzt hatte er Feierabend.
Die Aufzugtür schob sich auf, er trat in die Kabine, drückte den obersten Knopf und fuhr hinauf zu seiner Wohnung in den fünften Stock.
Es war immer das gleiche Unbehagen, wenn er diesen leichten Druck im Innenohr fühlte, sobald sich der Fahrstuhl in Bewegung setzte, aber zum Treppensteigen hatte er weder Lust noch Kraft. Marie hatte unbedingt unter dem Dach wohnen wollen. »Schau doch! Was für eine Aussicht! Der Himmel über Berlin könnte uns gehören!«, hatte sie euphorisch gerufen, als er ihr bei der ersten Besichtigung durch die noch unsanierten Räume gefolgt war. Viel zu groß für sie beide, hatte er gedacht, zumal zum Zeitpunkt des Wohnungskaufs bereits festgestanden hatte, dass sie keine Kinder bekommen würden. Aber Marie war nicht zu bremsen gewesen, und er hatte sie auch gar nicht ernsthaft bremsen wollen. Seine Meinung hatte er deshalb für sich behalten. Ihre Begeisterung hatte als Grund für den Wohnungskauf genügt. Noch am selben Tag waren sie zur Unterzeichnung des Vertrags im Maklerbüro gewesen, hatten einen Termin beim Notar gemacht, den Architekten kontaktiert, mit dem Bankberater einen Finanzplan für den Ausbau erarbeitet. In der darauffolgenden Nacht hatten sie sich so leidenschaftlich geliebt wie schon sehr lange nicht mehr. Am nächsten Morgen war Korbinian wie berauscht zur Arbeit gegangen, hatte Marie die Tasche bis zur Straßenbahnhaltestelle getragen, ihr nachgewunken wie ein liebeskranker Abiturient. Dass für sie beide nun ein neues, ein wunderbares Leben begann, hatte für ihn festgestanden, und den Preis, sich dafür täglich in den fünften Stock quälen zu müssen, zahlte er gern. An diesem Tag wäre er mit ihr widerspruchslos an den Südpol oder in den höchsten Wolkenkratzer von New York gezogen, wenn sie es gewünscht hätte. Es war Maries Geld gewesen, ihr Erbe, mit dem sie alles finanziert hatten. Es war Maries Traum, Maries Initiative, Maries »Herzensprojekt«, wie sie es bezeichnete. Er war mit allem einverstanden gewesen, hatte jeden ihrer Vorschläge freudig begrüßt, dass es Marie im Lauf der Sanierung gelegentlich sogar auf die Nerven gegangen war.
»Es wird genauso dein Zuhause sein wie meins, Korbinian, also engagiere dich gefälligst!«
»Du machst das alles so schön für uns, warum sollte ich mich einmischen?«
»Es kann dich nicht kaltlassen, wie wir leben werden!«
»Ist mir doch Wurst, wo und wie ich wohne, solange es nur mit dir ist.«
Da hatte sie ihn geküsst und einen »hoffnungslosen Fall«genannt.
Nicht einmal zwölf Monate hatten sie dann gemeinsam Maries Herzensprojekt bewohnt. Ohne Vorwarnung war von heute auf morgen Schluss gewesen. Zack. Aus. Vorbei. Seither hatte er eine aufwendig hergerichtete Sechszimmerwohnung plus Dachterrasse in guter Hauptstadtlage ganz für sich allein. Hundertsechzig ungeliebte Quadratmeter unter dem Himmel von Berlin, von denen er etwa ein Drittel seit fast acht Jahren nicht mehr betreten hatte. Seine Schule lag fußläufig, der Park in Sichtweite, die Einkaufsmöglichkeiten waren optimal, die Touristenströme noch nicht bis in die Straße, in der die Wohnung lag, vorgedrungen. Alles hätte perfekt gepasst, wenn nicht ein einziges, ein tragendes Detail vom herrlichen Plan schiefgelaufen wäre.
An diesem Punkt musste er seine Gedanken abbrechen, wenn er seinen inneren Frieden nicht gefährden wollte. Das Leben folgte eben keinem Plan. Alles Weitere war eine Frage der Haltung: Es ging ihm gut, es ging ihm gut, es ging ihm … Punkt.
Der Aufzug blieb mit einem nachfedernden Ruck stehen, und Korbinian betrat den Flur zu seiner Wohnung.
Während er in der Küche seine Einkäufe an ihren Platz räumte, Kaffee auf die Ablage über dem Gewürzregal, Eier in den Kühlschrank, ging ihm der letzte Satz des Mädchens noch einmal durch den Kopf. Du bist cool, hatte sie gesagt.Ausgerechnet ihm. Er war der uncoolste alte Knacker, den dieses Pennermädchen je gesehen hat.
Korbinian verließ die Küche, ging mit der festen Absicht ins Wohnzimmer, es sich endlich in seinem großen Lesesessel bequem zu machen, wie er es längst hatte tun wollen. Kaum hatte er aber die Füße hochgelegt und den Ausstellungskatalog mit Werken Frederic Lord Leightons aufgeschlagen, auf dessen ausgiebige Betrachtung er sich schon seit Tagen freute, sah er plötzlich, statt der viktorianischen Ölgemälde auf dem Papier, die junge Obdachlose im Souterrain vor sich. Sie hatte so erbarmungswürdig ausgesehen. Elender, als Dreck und Verwahrlosung allein es erklären konnten. Eventuell war sie ernsthaft krank und hockte nun ganz allein dort unten, wo es nicht viel wärmer war als draußen. Wie lange dauerte es eigentlich, bis im Treppenhaus automatisch das Licht ausging? Würde sie den Schalter finden, um die Beleuchtung wieder anzumachen, falls sie nicht im Dunkeln bleiben mochte? Wie kalt würde es dort im Lauf der Nacht werden? Was, wenn sich ihr Zustand verschlechterte?
»Ich kann nicht mehr für sie tun, als ich bereits getan habe«, versuchte er sich selbst zu entlasten.
Seufzend legte er den Katalog zur Seite, stand auf und trat ans Fenster. Zum Wind war heftiger Regen hinzugekommen, Wasser peitschte gegen die Scheiben, die Bäume in der Straße unten bogen sich, von einem Balkon auf der gegenüberliegenden Seite wurde ein Blumentopf heruntergeweht und zerschellte vor dem Zeitungskiosk. Die zweite schwere Sturmnacht in Folge stand bevor.
Er musste an seine Schwester denken. Normalerweise dekorierte Emilia den Bürgersteig vor ihrem kleinen Blumengeschäft üppig mit Pflanzenkübeln, bunten Töpfen, Sträußen und Gestecken. Korbinian, dessen Weg dort vorbeiführte, wenn er gelegentlich zum Schreibwarenladen ging, war dieser Urwald vor ihrem Laden suspekt. Was für ihn störende Unordnung war, nannte sie »kreative Freiheit«. Wenn seine Schwester ihr Chaos allerdings heute nicht vorsorglich weggeräumt hatte, würde sie es morgen früh ganz unkreativ auf der gesamten Länge der Straße einsammeln können, so viel war sicher.
Weitere Blumentöpfe zerschellten, Blätter und Äste flogen durch die Luft, ein Mann im dritten Stock gegenüber versuchte die Kübel auf seinem Balkon dichter an die Hauswand zu zerren, während eine Frau in der offenen Tür hinter ihm hektisch mit den Armen fuchtelte.
Emilia würde wissen, was man mit einer jungen Obdachlosen anfing.
Korbinian begann zu frieren und beschloss, sich seine Strickjacke aus dem Arbeitszimmer zu holen. Dort fiel sein Blick auf eine alte Decke, die zusammengefaltet auf dem Sofa lag. Er hatte das Stück sowieso längst zur Altkleidersammlung geben wollen, eine blassgrüne Scheußlichkeit, die eine Tante ihm vor mindestens fünfundzwanzig Jahren zu einem längst vergessenen Anlass geschenkt hatte. Er nahm die Decke und verließ damit die Wohnung.
Das Mädchen schlief fest, am Boden zusammengerollt wie ein kleines Tier. Es war fast ein bisschen anrührend, wenn sie nicht so ungepflegt gerochen hätte.
»Hallo?« Korbinian flüsterte.
Sie reagierte nicht. Vorsichtig breitete er die Decke über den schlafenden Körper, löste dann die kleine Taschenlampe von seinem Schlüsselbund und legte sie neben die Stofftasche, die sich das Mädchen als Kopfkissen untergeschoben hatte. Als er die Decke höher ziehen wollte, bemerkte er, dass ihre Wange auffallend heiß war. Er sah sich um, als befürchtete er, beobachtet zu werden, und legte schließlich ganz leicht zwei Finger auf ihre Stirn. Sie glühte. Korbinian rannte fast zurück zum Aufzug und fuhr in seine Wohnung hoch. Die Nummer seiner Schwester hatte er gewählt, noch bevor er sich überlegt hatte, was er ihr eigentlich sagen wollte.
»Korb! Was ist passiert?«
Er war froh, dass ihm die Einleitung damit abgenommen wurde. »Muss denn immer etwas passiert sein, wenn ich dich anrufe?«
»Beim letzten Mal, als du dich von dir aus gemeldet hast, das war vor vier Jahren, da hast du mich über Mutters Schlaganfall informiert. Beim Anruf davor hast du mir den Beerdigungstermin deiner Frau mitgeteilt. Also?«
Er zögerte, plötzlich unfähig, etwas zu sagen.
»Bin gleich bei dir.«
Und schon hatte sie aufgelegt.
Korbinian griff sich an die Brust. Was war nur mit ihm los? Warum hatte er ausgerechnet Emilia angerufen und nicht irgendeinen medizinisch-sozialen Dienst, der die Kranke abgeholt hätte? Die entsprechende Nummer hätte sich schon herausfinden lassen, notfalls über den Polizeiruf. Er hatte einfach reflexartig den Kontakt mit einer Behörde gescheut. Seit er am Abend von Maries Tod gezwungen war, zwei Polizisten völlig überflüssige Fragen zu beantworten, bevor er zum Leichnam seiner Frau vorgelassen wurde, und sich die folgenden Tage mit Papierkram hatte quälen müssen, machte er den größtmöglichen Bogen um Ämter. Selbst das Passamt war ihm ein Gräuel, und gegen den Schulinspektor, der gelegentlich während des Unterrichts die Klassenräume kontrollierte und den anwesenden Lehrkräften dämliche Ratschläge erteilte, war er geradezu allergisch.
Wie auch immer, seine Schwester war jetzt auf dem Weg. Sie konnte das Notwendige veranlassen, wenn sie schon ungebeten bei ihm antanzen musste.
Auf der Kommode, gleich neben dem Telefon, war das Lächeln seiner Frau konserviert hinter entspiegeltem Glas. Er ließ seinen Zeigefinger über den Rahmen gleiten, entfernte etwas Staub, schob das Bild parallel zur Wand und murmelte: »Ein einziges Durcheinander alles …«
2
Noch bevor der Aufzug im Erdgeschoss zum Stehen kam, drang die Stimme seiner Schwester zu ihm. Er glaubte seinen Namen zu hören, war versucht, sich die Ohren zuzuhalten, fand sich selbst kindisch und vollkommen lächerlich.