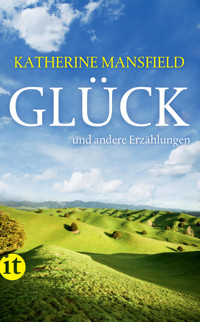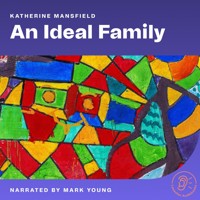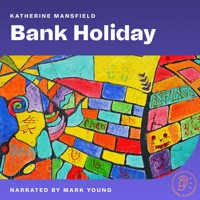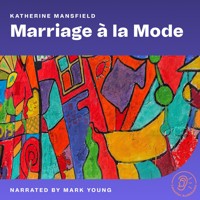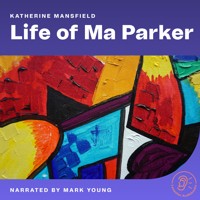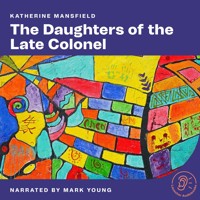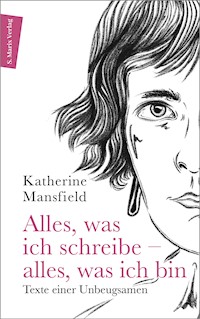
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: marixverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Autor:innenreihe 10
- Sprache: Deutsch
Sie gilt als Erneuerin der Kurzgeschichte und war die einzige Schriftstellerin, auf deren Stil Virginia Woolf neidisch war. Kompromisslos beharrt sie in ihrem Schreiben auf Wahrhaftigkeit und setzt sich dabei über Konventionen hinweg, um ihren eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Katherine Mansfield bringt neben Präzision und Musikalität einen neuen Tonfall in die Literatur, neue Perspektiven – wichtiger als die Handlung sind ihr die Menschen in ihren Geschichten –, einen von vielen unterschätzten Humor und Sinnlichkeit im Übermaß. Ihre psychologisch motivierten Texte, die oft autobiografisch geprägt sind, schildern alltägliche Ereignisse und scheinbar Nebensächliches, rücken dabei aber immer einen einschneidenden Erkenntnismoment ihrer Charaktere in den Mittelpunkt. Aus ihrem Werk von insgesamt 88 Kurzgeschichten, versprengten Gedichten, Tagebüchern, Briefen und Rezensionen hat Ingrid Mylo eine Auswahl getroffen, die diefaszinierenden Aspekte von Katherine Mansfields Persönlichkeit auf besondere Weise mit ihrem Werk verknüpft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Katherine Mansfield
Alles, was ich schreibe – alles, was ich bin
Katherine Mansfield
Alles, was ich schreibe – alles, was ich bin
Texte einer Unbeugsamen
Herausgegeben von Ingrid Mylo
Inhalt
EINLEITUNG
» – MAN KANN SO VIELE PERSONEN SEIN.«
Vorbemerkung: Schreiben ist leben noch einmal
Tagebucheinträge 1916-1922
Ausgewählte Briefe I
Rezensionen von Katherine Mansfield
»ABER ETWAS LIEBEN MUSS MAN.«
Vorbemerkung: Alle Arten von Liebe
Tagebucheinträge 1917-1921
Ausgewählte Briefe II
Die Dillgurke
Feuille D’Album
Der Kanarienvogel
»WARUM MUSS ES IMMER TOMATENSUPPE SEIN?«
Vorbemerkung: Wer braucht schon Konventionen
Tagebucheinträge 1907-1920
Frau Fischer
Frau Brechenmacher geht auf eine Hochzeit
Seligkeit
» – DANN IST ALLES, WAS SONSTWO GESCHIEHT, WUNDERBAR.«
Vorbemerkung: Nicht krank zu sein, nicht fern des Lebens
Tagebucheinträge 1918-1922
Ausgewählte Briefe III
Filmen
Der Mann ohne Temperament
Miss Brill
»ERINNERST DU DICH, KATIE?«
Vorbemerkung: Das Gold vergangener Tage
Tagebucheinträge 1907-1921
Ausgewählte Briefe IV
Prélude
Das Puppenhaus
»WIE WIR DEN TOD IN EINER BLUME SEHEN«
Vorbemerkung: Der Tod und das Lachen
Tagebucheinträge 1919-1921
Ausgewählte Briefe V
Der verwundete Vogel
An der Bucht
Die Töchter des verstorbenen Colonel
Das Leben der Ma Parker
Die Fliege
QUELLENVERZEICHNIS
LITERATUR
Einleitung
WELCHES MEINER VIELEN ICHS
I.
»Ich werde – natürlich – damit enden, dass ich mich umbringe.« Wer schreibt so etwas, wer notiert sich, jung an Jahren, so einen Satz ins Tagebuch? Und legt, einen Monat später, am 18. März 1908, noch einmal nach: »Ich erkaufe mir meine Klugheit mit meinem Leben – Es wäre besser, ich wäre tot – wirklich.« So dramatisch, so von sich überzeugt, und so – wie sich zeigen wird – prophetisch.
Als sie das schreibt, ist Katherine Mansfield (die am 14. Oktober 1888 als Kathleen Mansfield Beauchamp in der Tinakori Road 11 in Wellington, Neuseeland, geboren wird) noch keine zwanzig, verachtet ihre Eltern, denen sie sich überlegen fühlt, für ihren »vulgären« Materialismus und hadert mit der Engstirnigkeit der neuseeländischen Gesellschaft: Dass es hier keinen Spielraum für Entwicklungen gäbe, schreibt sie an ihre ältere Schwester Vera, »keine intellektuellen Beziehungen und keine Hoffnung, sie irgendwo zu finden.« Sie rebelliert auf ihre Weise, macht Erfahrungen: mit der Maoriprinzessin Maata Mahupuku und anderen Schulfreundinnen, dem Cellisten Arnold Trowell, den sie Caesar nennt, dem adonisgleichen Passagier F. R. auf der langen Seereise von London (wo sie dreieinhalb Jahre das Queen’s College besucht hat) zurück nach Neuseeland, mit der Illustratorin Edith Bendall. Mit einem Engländer ist sie, »weil sein Körper so wunderschön ist«, im Sommer 1907 drei Wochen lang verlobt. »Ich will alles so weit treiben, wie es geht«, feuert sie sich, in Abwandlung eines Zitats von Oscar Wilde, in ihrem Journal an. Um dann wieder alle zu hassen, sich selbst und ihr Leben zu verabscheuen, sie hat Launen und Wutausbrüche und Anfälle von Eifersucht: und gibt sich ihnen, ungezügelt, wie sie ist, mit Leib und Seele hin. In anderen Momenten dankt sie dem Himmel, »dass ich gerade, obwohl ich verdammenswert bin, niemanden liebe, außer mich selbst.«
Mansfield ist kein Vorzeigemodell, nicht sittsam, nicht sonderlich gesellschaftsfähig, sie hat ihren eigenen Kopf. Sie passt nicht, eckt an (oft genug rufen ihre Äußerungen, ihr Verhalten äußerste Missbilligung hervor), sie weiß um ihr Anderssein, weiß, was Alleinsein heißt, und weiß, dass ihr »äußeres Leben nur ein Phantomleben« ist: Das Wesentliche spielt sich in ihrem Inneren ab. Sie ist Künstlerin, sie will etwas: von sich, von der Welt, mehr als etwas, sie will alles, will frei sein und ungehindert leben, ohne Rücksicht auf Menschen und Konventionen, um unverstellt schreiben zu können und so, dass sie eins wird mit den Worten, dass sie ist, was sie schreibt. Denn aufs Schreiben, das spürt sie früh, läuft es schließlich hinaus. »Ich müsste eine gute Autorin abgeben«, befindet sie am 28. Dezember 1907, über den nötigen »Ehrgeiz und die Ideen« verfügt sie. Selbst wenn sie anfangs kurz an Musik gedacht hat: Das Liebäugeln mit einem Cello war eher ein Techtelmechtel mit dem, der es spielte.
Im Juli 1908 verlässt sie Neuseeland an Bord der Papanui für immer, trifft am 24. August in London ein, ersetzt Arnold durch seinen Zwillingsbruder, den Violinisten Garnet Trowell, für den sie das Gedicht Sleeping Together verfasst, von dem sie ein Kind erwartet: um am 2. März 1909 den elf Jahre älteren Gesangslehrer George Bowden zu heiraten und in derselben Nacht wieder zu verlassen. Das Kind verliert sie Ende Juli in Bad Wörishofen, angeblich durch das Hochstemmen eines schweren Schrankkoffers. Sie flüchtet sich in die Affäre mit Floryan Sobienowsky, einem polnischen Kritiker, der sie nicht nur elf Jahre später mit ihren Briefen erpresst, er hängt ihr zudem einen Tripper an, der ihren frühen Tod in den Weg leitet: Die Infektion, zu spät erkannt und wohl in jenen Jahren auch nicht gut zu behandeln, verteilt sich überall in ihrem Körper, in dem eine Krankheit nach der anderen ausbricht: Bauchfellentzündungen, Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen, Brust- und Rippenfellentzündungen, schwerste Erkältungen, das bloße Wort Influenza trägt für sie »eine schwarze Feder auf dem Kopf und einen Schwanz aus dem Sägemehl von Särgen«, bis sich im Dezember 1917 mit einem »FLECK in meiner rechten Lunge« ihre Tuberkulose bemerkbar macht, an der ihre Abwehrkräfte am 9. Januar 1923 schließlich zerschellen. Zu diesem Zeitpunkt lebt sie, seit gut elf Jahren, mal mehr, meist weniger glücklich, mit John Middleton Murry zusammen.
II.
Sie will – außer Schriftstellerin sein, außer leben – so vieles: Will reisen, in Ruhe gelassen werden, »mehr als alles liebe ich es, allein zu sein. Dann lege ich mich hin und rauche und schaue ins Feuer und beginne mir eine AUSSERGEWÖHNLICH gute Geschichte über Marseille auszudenken.« Andere unterhalten, »ich will die Vortragskunst revolutionieren und wiederbeleben«, schreibt sie am 4. November 1908 an Garnet Trowell. Zwischen Blumen und kleinen Bächen mit Murry im Gras liegen. Unabhängig sein. Lieber zu wenig als zuviel geliebt werden. In London sein. Auf dem Land leben, »Städte sind zu abscheulich. Ich würde nie etwas schreiben, müsste ich in ihnen leben.« Endlich einen Roman schreiben. Ein Theaterstück schreiben, um Geld zu verdienen. »Macht, Reichtum und Freiheit. Es ist eine hoffnungslos abgeschmackte Doktrin, dass Liebe das einzige auf der Welt ist, den Frauen beigebracht, in sie gehämmert, von Generation zu Generation, es engt uns auf grausame Weise ein. Wir müssen dieses Schreckgespenst loswerden – und dann, dann bietet sich die Gelegenheit zu Glück und Freiheit.« Sie will mit Murry »ein eigenes Haus haben und ein Kind und eigene Bäume und Früchte …« Kind sein – mit Mitte 20 noch – und geliebt werden: Ihrem Vater will sie »auf die Brust springen und darauf herumtrampeln und schreien, ›du musst mich lieben!‹«
Sie will schießen lernen. Einfach sein. Einen Gott, mit dem sie »ihre Visionen teilen« kann, aber: »nein, es gibt keinen Gott … Ich dachte an Die Götter, doch sie sind Marmorstatuen mit abgebrochenen Nasen. Es gibt keinen Gott oder Himmel oder Hilfe irgendwelcher Art außer der Liebe.« (Und in einem Brief vom 24. Februar 1920 fragt sie Murry danach, wer Gott erschaffen habe, und setzt in Klammern hinzu: »Ich war es jedenfalls nicht«). Nach den ersten Anzeichen des Frühlings Ausschau halten. Keinesfalls sesshaft sein. »Dem Gefängnis des Fleisches entfliehen«. Arbeiten, weil sie sonst unglücklich ist. Noch mehr arbeiten, »ein Leben ohne Arbeit – ich würde mich umbringen.« Den Tatsachen ins Gesicht sehen, »wenn man das nicht tut, fallen sie dir in den Rücken und werden zu Schrecken, Alpträumen, Riesen, Entsetzen«. Nach Neuseeland zurück.
Keine Angst vor der Dunkelheit haben, im Sommer 1913 schreibt sie an Murry: »Den ganzen Tag über bin ich eine Löwin, mein Liebling, aber mit dem letzten Tageslicht beginne ich mich in ein Lamm zu verwandeln und um Mitternacht – mon Dieu! – um Mitternacht ist aus der ganzen Welt ein Schlachter geworden!« Keine Angst vor dem Tod haben. Überhaupt: keine Angst haben, »ich glaube, das allergrößte Versagen ist es, ängstlich zu sein.« Sich in einen Baum verlieben. Klar sein, auch wenn sie weiß: »In meiner Bemühung, klar zu sein, bin ich grob.« Mit Tschechow lange Gespräche führen. »Handeln und nicht träumen«. Crabbage spielen und Murry gewinnen lassen, damit er Grimassen schneidet. Ein Kind haben (als sie während ihres Aufenthaltes in Bad Wörishofen die Fehlgeburt erleidet, kümmert sie sich wochenlang um den achtjährigen, unterernährten Charlie Walter, den ihre Freundin Ida Baker in einem Londoner Slum gefunden und zu Mansfield geschickt hat: Danach sieht sie ihn nie wieder. Und schreibt die Kurzgeschichte Frau Fischer, in der die Ich-Erzählerin das Kinderkriegen als »schmachvollsten Beruf« abtut). Unterwegs sein. Nicht mehr »ewig durch Zimmer wandern, die mit Vögeln tapeziert sind, mit Chrysanthemen in Urnen und Bündeln von Bändern, und möbliert mit geschwärzter Eiche und Spitzenvorhängen …« Allein leben, denn »selbst wenn ich, durch irgendeinen furchtbaren Zufall, ein Haar auf meinem Brot mit Honig finden sollte – es wäre in jedem Fall mein eigenes Haar.« Einen Menschen, »der mich verstehen würde«. Geld haben, obwohl sie Geld hasst, »aber es ist das Fehlen von Geld, das ich am meisten hasse«. Mehr als eine Frau sein. Von einem Liebhaber am Denken gehindert werden. Einen Ort, »wo ich meinen Hut aufhängen und von dem ich sagen könnte: Hier gehöre ich hin, doch es gibt auf der ganzen Welt keinen solchen Ort für mich.« Stark sein, und Stärke heißt für sie, sich mit der Realität auseinanderzusetzen, wie unbequem, wie garstig sie auch sein mag, heißt Haltung zu beziehen, »wir müssen zu unserer Haltung stehen und riskieren, mit ihr zu fallen.« Lachen, mit anderen, vor allem aber über sich selbst. »Durch die Bäume ins weit entfernte himmlische Blau« schauen. Aufrichtig sein, sie ist »all dieser Täuschungen müde«. Lesen: und sie liest wie eine Besessene, alles, was ihr unter die Augen kommt und bis zur letzten Seite, »ganz egal, wie schlecht es ist«. Nicht nachgeben, nicht aufgeben. »Sich selbst verstehen, um andere zu verstehen«. Frei sein, sie hat »einen Horror vor dem Mangel an persönlicher Freiheit.« Ein russisches Baby adoptieren und es Anton nennen. Nichts erklären müssen. Im Leben verwurzelt sein, »lernen, wünschen, wissen, fühlen, denken, handeln. Das ist es, was ich will. Und nicht weniger.« Keine Spuren hinterlassen.
III.
»I contain multitudes«, singt Bob Dylan auf seinem letzten Album Rough and Rowdy Ways, die Zeile hat er sich aus Walt Whitmans Gedicht Song of Myself geborgt, dort heißt es »Widerspreche ich mir? Sehr gut, dann widerspreche ich mir (ich bin groß – in mir sind viele)«. Und Dylan singt von seinem verräterischen Herzen, das er mit Edgar Allan Poe teilt, genau wie die Skelette in der Wand, von seinen vier Pistolen und zwei großen Messern singt er und davon, Beethoven-Sonaten zu spielen, Anne Frank und Indiana Jones in sich zu tragen und wie William Blake „songs of experiences“ zu singen, »ich bin ein Mann der Widersprüche und vielen Launen«, singt er, und dass er auf die Wahrheit trinkt.
Und Mansfield schreibt, sie »will alles sein, was zu werden mir möglich ist«. Und gleichzeitig wahrhaftig. Die Wahrheit ist das Banner, das sie vor sich herträgt, ist oberstes Gebot, ist das, was sie sich abverlangt, ist ihr Leitstern, ihr Anker, ihr Altar, davon schreibt sie, wieder und wieder. Schon mit 14 will sie, wie ihre treueste Freundin (und oft, wie Mansfield es sieht, ihre ärgste Feindin) Ida Baker in ihren Erinnerungen erzählt, »um die Wahrheit zu finden, tief hinab in ihr Innerstes gehen, als würde sie auf den Grund eines dunklen Brunnens sinken. Auf dem Grund wartend, würde die Wahrheit zu ihr kommen.« Sie dringt auf Aufrichtigkeit, ehrlich will sie sein, muss sie sein, »treu sich selbst gegenüber.« Und da fängt das Dilemma an: »Welchem Selbst? Welchem meiner vielen – ja, wirklich, darauf läuft es hinaus – Hunderten von Ichs?« Sie schreibt von ihrer »gespaltenen Natur«, aus der nichts von Wert hervorgehen kann, nennt sich gefühllos und feinfühlig, arrogant und erbärmlich, fühlt sich allen anderen überlegen und »wie ein Kind mit runden Augen«, findet sich widerlich und ein paar Sätze später »kolossal interessant«. Sie glaubt an die Ehe, heiratet gleich zweimal und schreibt: »Ich werde nie eine Ehefrau sein.« Sie weiß, sie ist tyrannisch und voller Mitgefühl und besitzt neben ihrer Brutalität einen »ungeheuer empfindsamen Geist, der jeden Eindruck aufnimmt, und das ist der Grund, warum ich mich so hinreißen und überwältigen lasse.« Und sie weiß, dass für sie eine der größten Schwierigkeiten im Leben darin besteht, einen Weg zwischen ihren Extremen zu finden, das Pendel nicht zu weit ausschlagen zu lassen. Meistens, auch das weiß sie, scheitert sie: Die Worte »scheitern« und »versagen«, häufig fallen sie in ihren Tagebüchern, Peitschenhiebe, mit denen sie sich antreibt, ein besserer Mensch, eine bessere Schriftstellerin zu werden.
Sie ist sich ihrer eigenen Bedeutung sehr wohl bewusst, hält sie für grenzenlos und wird gleichzeitig zu ihrem »unaussprechlichen Kummer von einer unverkennbaren Schüchternheit« gepackt. Ihr Wille oszilliert zwischen »erzwinge es!« und »lass es bleiben!«. Ihr kühler, kalkulierender Verstand wetteifert mit ihrer Seele, in der sich »die Gedanken überschlagen«. Sie will weinen und lacht, sehnt sich danach, allein zu sein, und »ist schrecklich allein«. Sie hört, wie »die Einsamkeit ihr Netzt spinnt«, in dem sie sich verfängt wie eine der Fliegen, von denen sie so oft schreibt. Und dieses Schreiben, sagt sie, ist wichtiger als das Leben, wobei Schreiben gleichzeitig Leben ist, dann wieder will sie »nicht schreiben; ich will leben.« Es ist nicht einfach und sie nicht wohltemperiert.
Katherine Mansfield ist nicht aus einem Guss, nicht »durch und durch dieselbe«, von ihr kann man nicht »immer weiter Scheibe für Scheibe abschneiden und wissen, man würde nie eine Pflaume oder eine Kirsche ans Tageslicht fördern – nie ein Stück Schale.« Sie hat viele Facetten, ist voller Widersprüche. Und lebt sie bedingungslos aus. Sie besteht darauf, sie selbst zu sein, auch in ihrer Widersprüchlichkeit: Und dann ist sie eben, weil sie sich gerade wie ein Reh fühlt, bei der einen ein Reh, und kehrt bei dem anderen die Wilde hervor, und in Gesellschaft gibt sie die ägyptische Königin, gibt die Geisha, den Clown. Ihre Wahrheit hat weniger mit Fakten zu tun als vielmehr mit der Person, die sie in diesem Augenblick aus ihrem Inneren zaubert und die sie mit allen Fasern ist, aufrichtig und wahr bis in ihr tiefrot geschminktes Herz.
Sie macht sich nichts vor: anderen möglicherweise schon. Sie ist eine »bis auf die Knochen verschwiegene Kreatur«. Fremden Menschen (nein, sie müssen nicht einmal fremd sein, Freunde tun’s auch) zu offenbaren, was in ihr vorgeht, käme einem Verrat an ihrem Selbst gleich. Doch Mansfield hat nie nur einen Grund: Sie befürchtet zudem, wenn sie anderen zeigen würde, wie sie wirklich ist, »würden die vor Überraschung« – vielleicht auch vor Schreck – »aus dem Fenster springen«. Und sie weniger schätzen. Und obwohl sie ihr eigenes Bedürfnis nach Anerkennung verurteilt, siegt es hin und wieder über ihren Wahrheitsanspruch, dann legt sie eine gemäßigtere Version ihrer selbst an den Tag. Oder betont jenen ihrer Züge, von dem sie glaubt, er finde den größten Gefallen. Sie sei so gemacht, schreibt sie, dass sie, sobald andere bei ihr wären, »auf ihre Meinungen und Wünsche Rücksicht zu nehmen beginne«, und dabei seien sie nicht die Hälfte der Rücksichtnahme wert, die sie selbst verdiene. Klar, dass ihr Verhalten Anstoß erregt, klar, dass die, die nicht genau hinschauen, sich von ihr getäuscht fühlen.
Sie hasst, bei all ihrer Lust zu burlesker Unterhaltung, Gesellschaften, von denen sie sagt: »Tratsch – Geschwätz – das Verbreiten von Neuigkeiten – all das erfüllt mich mit Horror.« Sie nimmt trotzdem teil. Obwohl sie die Menschen eher verabscheut (»man muss die Menschheit als Ganzes wahrhaft hassen, so leidenschaftlich hassen, wie man die wenigen, die sehr wenigen liebt«), obwohl sie sich in »hübschen Räumen, mit hübschen Leuten, hübschem Kaffee und Zigaretten aus einem silbernen Behälter« dumm vorkommt und unecht. Obwohl sie sich »mit ›charmanten‹ Frauen nicht unterhalten« kann und sich »wie eine Katze unter Tigern« fühlt. Und ihrerseits Tiger genannt wird.
IV.
So unterschiedlich wie Mansfield ist und sich gibt, so unterschiedlich erscheint sie denen, die sie kennen und sich zu ihr äußern. Manche vor, manche nach ihrem Tod. (Bisweilen fragt man sich, ob da von derselben Person die Rede ist.)
»Tollkühnheit, Mut und einen unglaublichen Sinn für Humor«, bescheinigt ihr die Freundin und Malerin Dorothy Brett. »Sie war wie ein glitzernder Bach – wie Quecksilber. Ihre Stimmungswechsel geschahen schnell und waren verwirrend; ein fröhlicher Augenblick voller Lachen konnte durch eine unpassende Bemerkung plötzlich in beißenden Zorn umschlagen … Katherine hatte eine Zunge wie ein Messer, sie konnte einem damit das bloße Herz herausschneiden, um im nächsten Moment ihre grandiose Grausamkeit zu bereuen. Sie konnte grausam sein. Sie zeigte keine Toleranz gegenüber Dummen oder Langsamen. Ihr Geist war schnell, so klar und den Gedanken und Gesprächen der anderen so weit voraus, wenn sie ihr hinterherhinkten, wurde sie ungeduldig, gelangweilt und schließlich wütend. Katherine konnte Aufgaben – seltsame Aufgaben – nur um der Erfahrung willen annehmen. Aus demselben Grund ging sie seltsame Beziehungen zu Leuten ein. Es bereitete ihr großes Vergnügen, so zu tun, als sei sie jemand anders … während sie mit dem Bus fuhr oder in einem Café in Soho aß … Sie konnte komplett in der Rolle aufgehen, bis sie selbst nicht mehr wusste, wer oder was sie war.«
Aldous Huxley hält sie für »eine unglückliche Frau, dazu fähig, jede beliebige Rolle zu spielen, ohne wirklich zu wissen, wer sie eigentlich war.«
Für Virginia Woolf hat sie etwas Katzengleiches, »fremd, gefasst, immer allein – eine Beobachtende.« Woolf sieht in ihr eher eine Konkurrentin als eine Freundin (Mansfield ist die einzige, auf deren Art zu schreiben sie eifersüchtig ist. Als sie von ihrem Tod erfährt, weiß sie nicht, ob sie einen Schock empfindet oder Erleichterung darüber, »eine Rivalin weniger« zu haben). Mansfields ordinäre Art widert sie an, ihr Schauspielerei mag sie nicht, ihre Klugheit und Unbedingtheit, was das Schreiben betrifft, bewundert sie hingegen, nachträglich befindet Woolf, dass »wir vielleicht etwas gemeinsam hatten, das ich bei niemandem sonst mehr finden werde.«
Nach Leonard Woolfs Ansicht war Mansfield »von Natur aus zügellos, zynisch, amoralisch, obszön, geistreich. Als wir sie kennenlernten, war sie außergewöhnlich unterhaltsam. Ich glaube nicht, dass irgendjemand mich mehr zum Lachen gebracht hat als sie in jenen Tagen. Sie konnte sehr aufrecht auf der Kante eines Stuhls oder eines Sofas sitzen und ungeheuer ausführlich über ihre Erfahrungen als Schauspielerin erzählen … Da war nicht der geringste Schatten oder Schimmer eines Lächelns … und die bemerkenswerte Komik der Geschichte wurde noch durch das Aufblitzen ihres beißenden Witzes verstärkt.«
Bertrand Russel, der trotz des intimen Briefwechsels zwischen ihnen eine Liebesbeziehung zu ihr später bestritt, schätzte ihren scharfen Verstand, ihre grenzenlose Wissbegier, seine Gefühle ihr gegenüber waren dagegen »ambivalent; ich verehrte sie leidenschaftlich, war aber von ihren dunklen Hassgefühlen abgestoßen. Ihre Art zu Reden war wunderbar, viel besser als ihr Schreiben, vor allem, wenn sie von den Dingen erzählte, über die sie schreiben wollte.«
Ihr Freund Samuel S. Koteliansky betrachtet ihr Schreiben als eine der »unwichtigsten Manifestationen ihres Seins. Es ist ihr Sein, das, was sie war, ihre Austrahlung, die ich liebe. Sie tat Dinge, ich die absolut nicht leiden konnte, übertrieb und erzählte die Unwahrheit, aber die Art, wie sie das tat, war so bewundernswert, einzigartig, dass mir das, was sie sagte, nichts ausmachte …«
Für Lady Ottoline Morell ist sie ein Geschöpf aus dem frühen 16. Jahrhundert, das mit dem 20. nur unter Schmerzen zurechtkam. Sie hätte »diese schöne, verschwiegene aber impulsive und emotionale Frau liebend gern gekannt, bevor sie vom Leben herumgestoßen und verletzt wurde, vielleicht auch bevor ihr Ehrgeiz, eine Künstlerin und große Schriftstellerin zu sein und Leute dafür zu benutzen, ein derart aufreibendes Spiel geworden ist … Sie ist brilliant, geistreich im Beschreiben von Leuten und ganz sicher nicht nett oder nachsichtig.«
Lady Morells Tochter Julian hat sie ganz anders in Erinnerung: »Zu mir als Kind war sie immer sehr nett – ich glaube, für Kinder hegte sie große Sympathie. Sie hatte eine sanfte Stimme und eine ruhige Art.«
Elizabeth von Arnim, Schriftstellerin und Mansfields Cousine, war in ihrer Gegenwart »schrecklich verlegen – ich fürchtete, ihr zu missfallen, dumm zu sein, langsam. Ich habe sie so – nun ja, demütig bewundert, und mein Bestreben, sie zufriedenzustellen, verwandelte meine geistigen Finger in lauter Daumen. Ich verließ sie immer in dem Gefühl, meine Haut sei abgezogen worden und mir war elend zu mute, weil ich überzeugt war, ich hätte sie gelangweilt und abgestoßen. Und doch habe ich sie angebetet … Wenn ich nur nicht soviel Angst vor Katherine gehabt hätte! … Aber wenigstens hatte ich genug Intelligenz, ihre zu verehren.«
Ihre Freundin Frieda Lawrence bezeichnet sie rückblickend als »exquisit«, und das umfasst die ganze Bandbreite von ausgesucht, herrlich, feinfühlig, erlesen. Sie habe, in der Art von Charles Dickens, »die Neigung, selbst unerheblichen Ereignissen einen Drall ins Komische zu verpassen«. Lawrence traut Mansfield nicht, »aber ich liebe sie. Selbst wenn sie Lügen erzählt, weiß sie doch mehr über die Wahrheit als andere Leute.«
V.
Ihr ständiger Kampf um Wahrhaftigkeit, ihr Bemühen, offen zu sein, aufrichtig, hat herzlich wenig mit Tugendhaftigkeit zu tun: Dieser Kampf ist das Schärfen der Werkzeuge, mit denen sie ihre Arbeit als Schriftstellerin verrichtet. »Nur dadurch, dass ich dem Leben gegenüber wahrhaftig bin«, schreibt sie, »kann ich der Kunst gegenüber wahrhaftig sein. Und dem Leben gegenüber wahrhaftig sein, heißt, gut zu sein, ernsthaft, einfach, ehrlich.« Sie will die Dinge so sehen, wie sie sind, unverbrämt, ungeschönt. Sie kann »das Böse und den Schmerz in der Welt« nicht ignorieren, kann es nicht leiden, wenn andere aus Furcht, ihr Gemüt könnte vom Anblick einer Grausamkeit, einer Katastrophe blaue Flecken davontragen, den Kopf abwenden, kann »Sentimentale oder dumme Optimisten« nicht ertragen (und kreidet sich ihrerseits die Sentimentalität an, die sie sich beispielsweise in der Erzählung Sixpence hat durchgehen lassen). Und wenn nicht nur die sprichwörtliche Scheiße zum Himmel stinkt, wird sie sich nicht die Nase zuhalten, sondern auch zu dem Geruch noch ein Wörtchen zu sagen haben. (Es gibt Momente wie den am 5. Oktober 1920, da ist ihr das mit der Wahrheit zuviel, da schreibt sie an Murry, sie habe es »vollkommen aufgegeben, ein Tagebuch zu führen«, weil es, wenn man nicht die Wahrheit sagt, sinnlos sei, und »tatsächlich wage ich es nicht, die Wahrheit zu sagen« – und fährt im selben Monat mit ihrem Tagebuch fort).
Sie schreibt – anders als die von ihr spöttisch als »Bloomsberries« bezeichneten Künstler der Bloomsbury-Gruppe um Lytton Strachey, Aldous Huxley, Dora Carrington, Betrand Russel, Virginia Woolf, die sie »eine Bande von Feiglingen« nennt, – über den Krieg (der ihr einmal mehr ihr negatives Menschenbild bestätigt, die Menschheit sei, schreibt sie, »in der Tat so abstoßend, dass man es, würde eine Bombe auf sie fallen, letztendlich nicht sonderlich grausam finden würde«), sie sympathisiert mit den »Sinn Feiners« in Irland und fragt sich nach dem Tod des von den Briten inhaftierten Bürgermeister von Cork in einem Brief an Murry vom 1. November 1920, warum ihn die Sinn Feiners nicht gewaltsam freigezwungen haben, warum sie nicht »anstelle eines Hungerstreiks« beispielweise einen englischen Politiker ermordet haben. Sie liest Bücher von Sinaida Hippius und Iwan Alexejewitsch Bunin über die russische Revolution, über den Horror und Schrecken in Petrograd, »man muß darüber lesen, um Bescheid zu wissen. Aber Engländer, Leute wie wir, würden niemals überleben, wie einige der russischen Intellektuellen überlebt haben. Wir würden an so vielen Dingen sterben, Ungeziefer, Angst, Kälte, Hunger, selbst wenn wir nicht ermordet würden. Im gegenwärtigen Moment ist das Leben in Russland, wie es vor vier Jahrhunderten war. Und jeder, der mit dem Bolschewismus sympathisiert, hat einiges zu beantworten …«
Die Autobiografien ihrer Zeitgenossen schätzt sie nicht sonderlich: Was dafür erforderlich wäre und »was die englischen Autoren vermissen lassen«, ist Lebenserfahrung, etwas, das hingegen sie im Übermaß besitzt. Sie »weiß ganz sicher mehr als andere: weil ich mehr gelitten, mehr ertragen habe«. Was keinesfalls heißt, dass ihr das Schreiben zu therapeutischen Zwecken dient, das käme einer Geringschätzung der Literatur gleich, was sie gesehen, erlebt, empfunden hat, muss bearbeitet, in Form gebracht, melodisch gemacht und dadurch zu etwas vollständig Neuem werden. Sie glaubt unbedingt an den »sehr grundlegenden Unterschied zwischen jeder Art von Geständnis und kreativer Arbeit«. Und hört nicht auf, sich mit der Notwendigkeit, wahr zu sein, auseinanderzusetzen: »Aufrichtigkeit (warum?) ist das Einzige, das einen höheren Wert als das Leben, der Tod, überhaupt alles zu haben scheint. Sie allein bleibt bestehen. Am Ende ist Wahrheit das einzige, das zu besitzen sich lohnt: Sie ist aufregender als Liebe, beglückender und leidenschaftlicher. Sie kann schlicht nicht versagen. Alles andere versagt. Ich jedenfalls werde ihr und ihr allein den Rest meines Lebens widmen. Ich würde gerne eine lange, lange Geschichte darüber schreiben und sie Letzte Worte an das Leben nennen. Sie muss geschrieben werden. Und eine andere über den HASS.« (Ja, vor Hass kann sie außer sich geraten, dann ist ihre getreue Freundin Ida Baker ihr »tödlicher, tödlicher Feind«, dann ist sie von »Tod und Fäulnis« erfüllt, dann wird sie grün im Gesicht, dann zerreißt sie Bücher und hasst sich für all das selbst am meisten).
Ihre Wahrnehmung, nicht nur sich selbst gegenüber, ist unbestechlich, man kann genausogut sagen: gnadenlos. Mansfield weiß von sich, sie habe »nie ein großes Talent besessen, mir Dinge vorzustellen«. Also erfindet sie nicht. Sie beobachtet. Sie ist eine glänzende, eine unermüdliche Beobachterin, ihrem scharfen Blick entgeht nichts, nicht die »klauenartigen, mit Juwelen überladenen Hände« ihrer Cousine Elizabeth von Arnim, nicht »die abgekauten Fingernägel, der schmutzige Hals, der Belag auf den Zähnen« ihrer Freundin Dorothy Brett, nicht der eine übriggebliebene Zahn im Mund einer alten Frau, der »eine Art Familiengrabmahl für die 31 gegangenen« ist, nicht das Taschentuch, das Virginia Woolf in die Ecke eines Sessels gestopft und dort vergessen hat. Was Mansfield, laut Ida Baker, zu der Bemerkung veranlasst: »Wenn Virginia auf dem Weg zum Esstisch die Hälfte des Wackelpuddings fallenlässt, sehe ich schon, wie sie ihn aufhebt und auf die Schale zurücktut, während sie ins Zimmer geht«, sie sei »mit ihrem Kopf immer ganz woanders«. Sie bemerkt, dass Aldous Huxley »wie eine Kerze flackert, die erwartet, mit der nächsten offenen Tür zu erlöschen«, bemerkt den Vollmond, der »wie verzerrte Musik ist, die man durch eine geschlossene Tür vernimmt«, bemerkt, dass Jack »im Garten gräbt, als wolle er einen verhassten Körper exhumieren oder für einen geliebten ein Loch machen«, bemerkt das »alles absorbierende Interesse der Franzosen am Stuhlgang. […] Sie sind allesamt Opfer der erstaunlichsten Flatulenz, die man sich vorstellen kann«, man dürfe »kein Streichholz an sie halten«. Sie bemerkt die Regentropfen, die »wie silberne Fische von den Bäumen hängen«, die wie eine Hand mit abgespreizten Fingern gefaltete Serviette und dass Ida Baker »Bananen so außerordentlich mag. Aber sie isst sie so langsam, so entsetzlich langsam. Und sie wissen es – irgendwie; sie realisieren, was da auf sie zukommt, wenn sie die Hand nach ihnen ausstreckt. Ich habe Bananen auf ihrem Teller vor Schreck leichenblass werden sehen – oder aschgrau.«
Ihr Geist ist wie ein Eichhörnchen, er sammelt, was er kriegen kann, Eindrücke, Anblicke, Erinnerungsschnipsel, Geräusche, Gefühle, sammelt und versteckt es, »für den langen ›Winter‹, in dem ich all diese Schätze wiederentdecken würde – und wenn mir jemand zu nahe kam, flitzte ich den höchsten, dunkelsten Baum hinauf und verbarg mich in den Zweigen.«
VI.
Beobachten steht am Anfang, es ist ihr längst nicht genug. Sie geht weiter, will einen Prozess der Durchdringung, will – wie oft spricht sie, schreibt sie davon – die Dinge werden, über die sie in ihren Erzählungen schreibt, will die Wirklichkeit spüren, mit all ihren Sinnen, in ihren Knochen, in ihrem Blut, bis in die letzte Faser ihres Seins, bis in die Seele, und »mit Seele meine ich das ›Ding‹, das den Geist wirklich bedeutsam macht«, sie will aufgehen in dem, was sie vor Augen hat: »Wenn ich einen ›Anderen‹ beschreibe, will ich mich so in der Seele dieses Anderen verlieren, dass ich selbst nicht mehr bin …«
Sie denkt in Bildern, in Metaphern und Vergleichen: Häuser sind »mit einer hässlichen Stahlschere ausgeschnitten »und auf einen grauen, papiernen Himmel geklebt. Vor dem Fenster zerlegt ein alter Mann Steine, er klopft und klopft, »als ob es ein Herz wäre, das da draußen schlüge«. Ein Fetzchen rosafarbenes Löschpapier ist »unglaublich weich und schlaff und beinahe feucht, wie die Zunge eines kleinen toten Kätzchens«. Beim Anblick der unzähligen Dinge in der Handtasche seiner Frau geht dem Ehemann der Gedanke durch den Kopf: »In Ägypten würde sie mit all diesen Dingen beerdigt werden«. Der Kellner eines tristen Cafés steht da, »als würde er darauf warten, in Verbindung mit einem scheußlichen Mord fotografiert zu werden«. Ein langweiliger, erstickender Tag »hängt kraftlos wie eine Fahne herunter«. Das Glück zieht am Herzen einer Frau, »als ob es versuchte, sich loszureißen«. Eine Wolke wird über den Himmel geschleift »wie ein zerrissenes Hemd«. Die Dahlien in den fünfzig Töpfen auf den fünfzig Hoteltischen sehen aus, »als würden sie zu tanzen beginnen …«
Mansfield streut Einfälle und Assoziationen wie eine klare Nacht Sterne und fügt so der Welt, die sie beschreibt, im Beschreiben weitere Welten hinzu, unbekannte, erstaunliche, und man findet sich unversehens in einem Geisterschloss wieder, in einem Irrgarten, in einer Wunderkammer. Hat man einen ihrer Sätze betreten, wer weiß, wo man herauskommt und was man unterwegs erlebt.
Die Menschen, von denen sie erzählt, hält sie, wie ein Fotograf, in einer erhellenden Bewegung fest, in einer verräterischen Situation, in einem Augenblick der Erwartung oder Enttäuschung: und macht auf diese Weise das Leben sichtbar, spürbar, das sie in ihren Geschichten führen. Mit der Art, wie ein Junge Erdbeeren isst oder ein Frau »ihr Haar an einem windigen Morgen kämmt«, muss für sie alles gesagt sein, was es über den Jungen, die Frau zu sagen gibt. Sie sagt es indirekt, sie sagt nicht: freudlos, sie sagt nicht: Sehnsucht, sie beschreibt den beinahe abstoßend erbärmlichen Zustand einer Aloe mit ihren dicken, grau-grünen, dornig geränderten Blättern, von denen einige alt sind, schwarz und geborsten, andere verschrumpelt, verdorrt, und auf die Frage ihrer Tochter, ob dieses Ding jemals blühen wird, antwortet die Mutter: »Alle hundert Jahre einmal.« Und wenn Linda in Prélude über ihren Neufundländer nachdenkt, den sie »tagsüber so gern hat«, auf den sie stolz ist, den sie »liebt und bewundert und ungeheuer respektiert, mehr als irgendeinen sonst auf der Welt«, der eine »Seele von Wahrheit und Anstand ist, leicht zufriedenzustellen und leicht zu verletzen«: dann weiß man nicht, ob sie nicht längst von ihrem Mann redet, selbst oder gerade wenn sie fortfährt, »wenn er sie nur nicht so anspringen, so laut bellen und sie so begierig und liebevoll beobachten würde«.
Zwei, drei Sätze von ihr: Und die Figur ist da, man kennt sie, man fürchtet um sie oder wünscht ihr sonstwas an den Hals. Mansfield schürt, ohne gefühlig zu sein, Gefühle. Es sind nicht die großen Schwünge, mit denen ein Roman aufs Papier geworfen wird, die sie auszeichnen: Es sind diese unglaublich genauen, unglaublich treffsicheren, unglaublich stimmungsträchtigen Schilderungen, mindestens sosehr Gemälde wie Geschichten. Aber nicht Gemälde, die etwas vorstellen, nicht, als sei eine Szene aufgetragen worden, nicht Schichten von Farbe auf Leinwand, sondern Gemälde, die etwas freilegen, als wäre die Welt an dieser Stelle durchsichtig gemacht worden, abgetragen, und gäbe den Blick frei auf die Wahrheit dahinter. Mansfield muss bei Van Goghs Sonnenblumen etwas Ähnliches empfunden haben, das Bild bleibt ihr lange im Gedächtnis. Zehn Jahre, nachdem sie es gesehen hat, schreibt sie an Dorothy Brett: »Dieses Bild schien etwas zu enthüllen, das ich, bevor ich es sah, nicht begriffen hatte.«
Zufrieden mit dem, was sie schreibt, ist sie selten: Ihre Ansprüche an sich sind himmelhoch. Klar, dass sie ihnen nicht genügt, klar, dass sie sich und ihr Versagen ein ums andere Mal an den Pranger stellt. Doch selbst, wenn sie sich in Grund und Boden kritisiert, wenn sie sich Faulheit vorwirft, Trivialität, Nachlässigkeit, mangelnde Tiefe und mangelnde Klarheit, wenn sie unerbittlich mit sich ins Gericht geht, sich nicht für eine gute Schriftstellerin hält (»Ich erkenne meine Fehler besser als irgend ein anderer sie erkennen könnte. Ich weiß genau, wo ich versage«), selbst wenn sie immer wieder daran scheitert, etwas zu schreiben, »das meine ganze Kraft enthält«: Sie liebt ihre Arbeit, »das Schreiben bereitet mir solche Freude, dass ich sogar noch im Schlaf damit fortfahre«, liebt ihren Beruf, will schreiben, nichts als schreiben, »selbst lieber noch als reden oder lachen oder glücklich sein«.
»Wird es mir eines Tages gelingen«, fragt sie sich am 31. Mai 1919 in ihrem Tagebuch, »meine Liebe zur Arbeit auszudrücken – meine Sehnsucht, eine bessere Schriftstellerin zu sein – mein Verlangen, größere Anstrengungen auf mich zu nehmen. Und die Leidenschaft, die ich fühle? Sie tritt an die Stelle der Religion – sie ist meine Religion – der Menschen – ich erschaffe meine Menschen: des ›Lebens‹ – sie ist das Leben.«
VII.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: