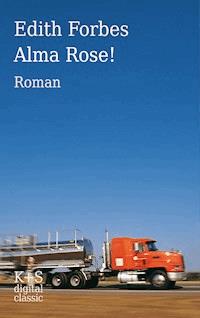
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Krug & Schadenberg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Pat führt ein beschauliches Leben in Kilgore, einem verschlafenen Farmerstädtchen irgendwo an der Interstate im Mittleren Westen. Gemeinsam mit ihrem Vater betreibt sie die örtliche Tankstelle mitsamt Gemischtwarenladen. Pats Alltag verläuft wenig ereignisreich. Bis eines Tages ein Truck vor der Tür hält, eine blondgelockte Frau in spitzen Cowboystiefeln hereinstürmt und lauthals eine Coke und Tampax verlangt: Alma Rose! Voller Überschwang und Abenteuerlust ist die Truckerin das genaue Gegenteil der scheuen Pat. Alma Rose umwirbt sie, weckt ihr Begehren, macht sie kühn und kreativ. Doch dann werden die Pausen zwischen Alma Roses Besuchen länger, und Pat verfällt auf eine geniale Idee, um die Geliebte zurückzugewinnen. Ein bezaubernder kleiner Roman über das große Thema Liebe – zeitlos schön!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FRAUEN IM SINN
Verlag Krug & Schadenberg
Literatur deutschsprachiger und internationaler
Autorinnen (zeitgenössische Romane, Kriminalromane,
historische Romane, Erzählungen)
Sachbücher und Ratgeber zu allen Themen
rund um das lesbische Leben
Edith Forbes
Alma Rose!
Roman
Für meine Mutter Sal
Prolog
Als Alma Rose nach Kilgore kam, lebten hier fast nur noch diejenigen, denen die Interstate ein Auskommen verschaffte. Alle anderen waren weggezogen. Im Zentrum waren die meisten Häuser mit Brettern vernagelt, und um die Auffahrt- und Abfahrtspuren des Highways drängten sich die übriggebliebenen Geschäfte wie Zecken, die ihren Rüssel in eine Vene gebohrt haben. Wir besaßen ein Pizza Hut, ein Motel 6, eine Fernfahrer-Raststätte, drei Tankstellen, ein Royal Comfort Inn und ein Country Kitchen.
Vor langer, langer Zeit, als die Straßen noch schmaler und holpriger waren und die Menschen noch nicht so weit und schnell reisten, war Kilgore eine Drehscheibe gewesen. Eine sehr kleine zwar nur, aber immerhin. Ringsum erstreckten sich mehrere hundert Quadratmeilen weit rotbraune, felsige Spitzkuppen, Krüppelkiefern, Beifuß, Staub und hie und da auch genügend Grasbüschel, um eine Kuh zu ernähren, sofern ihr längere Fußmärsche nichts ausmachten. Von den Kühen lebten die Ranches und von den Ranches wir, die Menschen, die »in der Stadt«, also in Kilgore, wohnten und arbeiteten.
Auch als Kilgore noch eine Drehscheibe gewesen war, hatte es nicht viel zu bieten gehabt: etwa acht bis zehn Läden und ebenso viele Bars. Damals besaßen wir jedoch mehr als eine Straße, was Kilgore zu einer richtigen Kleinstadt machte und somit von den zahlreichen Pünktchen unterschied, die zwar auf Straßenkarten eingezeichnet, aber nicht mehr als ein Streckenabschnitt mit Fünfunddreißig-Stundenmeilen-Tempolimit inklusive Bar und Tankstelle sind.
An die Jahre vor dem Bau der Interstate erinnere ich mich nur noch verschwommen. Sie erreichte uns, als ich acht oder neun Jahre alt war. Zu Anfang begrüßte das Städtchen ihre Ankunft so begeistert, wie vielleicht frühe Siedlerinnen und Siedler die Postkutsche empfangen haben, nämlich als einen Boten aus der glamourösen, modernen großen Welt. Die Café- und Tankstellenbesitzer malten sich schon die Touristenschwärme aus, die mit prallen Geldbeuteln aus dem Osten über uns hereinbrechen würden. Die Ladenbesitzer deckten sich mit Andenken und Geschenkartikeln ein. Und alle waren wir ganz entzückt darüber, wie leicht es nun sein würde, die fünfundsechzig Meilen nach Seco Springs, der Kreisstadt, zurückzulegen, die mit ihren zehntausend Einwohnern, zwei Kinos, der Kegelbahn, der Rollschuhbahn und dem Rodeoplatz in Originalgröße fast schon eine kleine Großstadt war.
Eine Zeitlang brachte die Interstate erstaunlich wenig Veränderungen. Es ergossen sich keine Touristenströme nach Kilgore. Die Vergnügungen der Großstadt verloren rasch ihren Reiz. Man kehrte wieder in die alten Geleise zurück und lebte genau wie zuvor. Als die Veränderung dann kam, geschah dies so schleichend, dass wir sie zuerst gar nicht bemerkten. Vermutlich begann alles mit ein paar mageren Jahren im Viehhandel. Den Ranchern, die dies zu spüren bekamen, erschien es jetzt lohnend, die fünfundsechzig Meilen nach Seco Springs zu fahren und ihre Futtermittel und Gerätschaften in den größeren und billigeren Geschäften dort einzukaufen. Und wenn sie den weiten Weg schon einmal gemacht hatten, kauften sie auch gleich noch Kleider und Lebensmittel. Der Laden für Rancherbedarf war das erste Geschäft in Kilgore, das seine Pforten schloss. Dann folgte Dan’s Western Wear und dann der Supermarkt und schließlich noch einige andere. Etwa zur gleichen Zeit fuhren wohl einige Konzernmanager über die Interstate, um in den Rockies Urlaub zu machen. Und als sie die Schilder mit der Aufschrift »Nächste Tankstelle 65 Meilen« erblickten, rochen sie das große Geld. Ehe wir uns versahen, ragten ein halbes Dutzend riesiger Leuchtreklamen mit schreiend bunten Werbelogos auf Pfählen in den Himmel – eines immer noch ein wenig höher als das vorherige – und winkten die erschöpften Fahrer von der Straße herunter. Auf Reisende aus dem Osten, die von Hunderten von Meilen scheinbar öder Landschaft ganz betäubt waren, müssen sie wie Leuchttürme gewirkt haben, die sie in einem vertrauten Hafen willkommen hießen.
Die Landschaft erschien einem wahrscheinlich tatsächlich öde, wenn man mit Höchstgeschwindigkeit auf der Interstate daran vorbeibrauste. Anders als die alten Bundesstraßen folgte sie nicht den Spuren der Siedler. In diesem Landstrich bedeutete Besiedlung Wasser, und die alten Straßen folgten den mäandernden Routen der gelegentlich vorkommenden Wasserläufe. Die Interstate dagegen war eher so etwas wie eine Kreisgrenze, ein Strich auf der Landkarte. Die Planer entschieden, welche Kleinstädte groß genug waren, um eine Ausfahrt zu rechtfertigen, und entwarfen dann mit Hilfe des Kompasses die Verbindungsrouten, ohne Rücksicht auf Bewohner oder Topographie – immer vorausgesetzt natürlich, die stellten kein Hindernis für die Bauarbeiten dar. Kilgore war zwar kaum groß genug, um die Kriterien für eine Ausfahrt zu erfüllen, doch war es für die nächsten fünfzig Meilen in beiden Fahrtrichtungen das einzige Städtchen, das größer als ein Pünktchen war, und daher musste die Interstate hindurchführen.
Nach der Ankunft jenes ersten Schwungs greller Leuchtreklamen gewöhnte sich der Ort an einen Zustand, der sich im Grunde nicht mehr veränderte. Besagte Gastronomiebetriebe krallten sich alle Leute, die – schon wegen der Entfernung bis zur nächsten Übernachtungsmöglichkeit – von der Straße zu locken waren. Und wir besaßen eben auch keine anderen natürlichen oder von Menschen geschaffenen Reize, die ihre Zahl hätten vergrößern können. Wir hatten weder ein Schlachtfeld noch prähistorische Felsenwohnungen, weder einen Reptilienpark noch Höhlen, weder Wasserfälle noch verlassene Goldminen noch ein Cowboymuseum, einfach nichts, was die Stadt auf einer Werbetafel hätte anpreisen können, um dem Gast nach all der Monotonie zwischen Kilgore und dem Mississippi ein wenig Abwechslung in Aussicht zu stellen.
Im ehemaligen »Zentrum« von Kilgore hatten nur zwei Geschäfte überlebt. Das eine war das Cloverleaf Donut Hole, ein Café, das Marge Gorzalka praktisch als Ein-Frau-Betrieb führte. Wahrscheinlich hatte sie sich nie hingesetzt und ausgerechnet, was ihr Stundenverdienst gewesen wäre, hätte sie ihre kleinen Gewinne durch die Arbeitsstunden – von vier Uhr früh bis drei Uhr nachmittags und das sechs Tage in der Woche – geteilt. Wahrscheinlich wollte sie es auch gar nicht wissen. Denn hätte sie diese Rechnung je angestellt, so hätte sie der Tatsache ins Auge blicken müssen, dass sie weniger als die Schulmädchen bei Pizza Hut verdiente.
Sie betrieb das Donut Hole seit fast dreißig Jahren, jedenfalls so lange, wie meine Erinnerung zurückreichte. Fast alle, die in Kilgore arbeiteten, schauten irgendwann am Tag einmal bei ihr vorbei, ob nun zum Frühstück, zur Kaffeepause oder zum Lunch. Und jedes Jahr arbeiteten ein paar Leute weniger hier, so dass Marge jedes Jahr ein bisschen weniger verdiente.
»Wenn ich mir meinen Lebensunterhalt nur noch damit verdienen kann, dass ich einen Papierhut aufsetze und Touristen und LKW-Fahrern Fertigpizzas serviere, dann kann ich mich ja gleich einschläfern lassen«, sagte sie. Wenn auch immer etwas anders, sagte sie das Gleiche alle drei Monate, wenn sie mal wieder ihre Buchhaltung machen musste. Ich kannte Marge ziemlich gut, denn ich war eine ihrer wenigen verbliebenen Stammkundinnen. Jeden Tag um halb zwei kam ich auf einen Kaffee und ein Sandwich vorbei. Der Kaffee und ich erreichten die Theke immer zur selben Zeit, und dann sagte sie: »Tag, Pat. Das Übliche?«
An den meisten Tagen nickte ich, was bedeutete: Truthahn und Käse auf Vollkornbrot und Krautsalat. Manchmal verlangte ich aber auch Schinken oder einen Cheeseburger, und dann lächelte Marge immer und eilte geschäftig hin und her, als handele es sich um einen besonderen Anlass.
Die halbe Stunde, die ich mit Essen verbrachte, füllte Marge mit Geplauder, hauptsächlich aus den Neuigkeiten bestehend, die sie früher am Tag von den anderen Stammgästen erfahren hatte. Sie stellte eine einzige ritualisierte Frage, nämlich: »Wie läuft das Geschäft im Mercantile?« Und ich antwortete: »Nicht übel.« Darüber hinaus erwartete sie keinen Gesprächsbeitrag von mir.
Ich war als stiller Mensch bekannt. Über die Jahre hatte ich mich auf angenehm-bequeme Weise mit diesem Ruf arrangiert. Niemand erwartete von mir, dass ich etwas sagte, also sagte ich auch nichts. Die Leute mochten mich recht gern, auch ohne dass ich mich groß äußerte. Hätte ich plötzlich das Maul aufgerissen, es hätte meinem Ansehen nur schaden können.
Ich arbeitete im zweiten noch übriggebliebenen Geschäft im Ortszentrum, dem Kilgorer Mercantile – eine dreisilbige Bezeichnung für etwas, das im Grunde nicht mehr als eine Tankstelle und ein Lebensmittelladen war. Wir leisteten uns auch ein paar Regale mit Kleidung, Haushaltswaren und Sportartikeln, doch die waren größtenteils nur Staubfänger und machten bloß zusätzliche Arbeit bei der Inventur. Die Lebensmittel und das Bier brachten den Gewinn.
Pops, mein Vater, war der Besitzer des Ladens, so dass ich zumindest einen sicheren Arbeitsplatz hatte. Wir teilten uns in die Ladenzeiten. Er arbeitete vormittags, ich nachmittags beziehungsweise abends. Tagsüber hatten wir zwei Teilzeitlageristen und einen Aushilfskassierer, aber nach halb sieben Uhr abends war ich ganz allein.
Obwohl Pops, sobald ich angekommen war, sofort hätte gehen können, blieb er oft bis zum Abendessen und manchmal sogar bis zum Ladenschluss. Nach Moms Tod hatte er keinen Grund mehr, nach Hause zu gehen. Er war ein Witzbold und Geschichtenerzähler, und er war nicht gern allein.
Pops war ein kleiner, verhutzelter Mann, der immer kahler wurde. Er war kleiner als ich, und ich war nicht einmal besonders groß für eine Frau. Vom Temperament her gehörte er zu denen, die in der Kneipe einem doppelt so großen Kerl eines verpassen, aber völlig zusammenbrechen, wenn ihre Frau stirbt. Da ich sein einziges Kind war, brachte er mir bei, wie man jagt, fischt und einen Baseball wirft, aber weil ich eine Frau war, traute er es mir nicht so ganz zu, den Laden ordentlich zu führen. »Frauen haben keinen Sinn fürs Geschäftliche«, meinte er. Das sagte er sogar noch zu Zeiten, als ich schon fast alle notwendigen Entscheidungen traf. »Wie auch immer, die Leute hier bei uns erwarten, dass ein Mann die Verantwortung trägt«, fügte er dann stets hinzu, und damit hatte er recht.
Das Gleiche hatte er zwanzig Jahre lang – solange sie als Angestellte in seinem Laden arbeitete – zu meiner Mutter gesagt. Falls sie sich je darüber ärgerte, so zeigte sie es nicht. Sie hatte in den Büchern, die sie kiloweise von einem Discount-Taschenbuch-Club bezog, in ihrem Garten und in den vielen Stunden am Klavier Trost gefunden. Sie war zu früh geboren, als dass sie je zu der Überzeugung hätte gelangen können, sie dürfe mehr für sich fordern. Spät genug jedoch, um sich für ihre Tochter mehr zu wünschen. Sie war entschlossen, mich aufs College zu schicken. Als man gegen Ende meines vorletzten High-School-Jahres Krebs bei ihr feststellte, sah ich den verzweifelten Blick in ihren Augen. Er entsprang nicht dem Wissen, dass sie sterben musste, sondern der schmerzlichen Überzeugung, dass sie sterben würde, ehe sie sichergestellt hatte, dass ich eine andere Laufbahn einschlug als sie.
Den ganzen Sommer und Herbst hindurch ertrug sie jede Art von Chemo- und Strahlentherapie, jede Operation, von der die Ärzte behaupteten, dass sie ihr Leben um ein paar Wochen oder Monate verlängern könnte. Die kurzen Zwischenzeiten, in denen sie genügend Kraft und Geistesklarheit besaß, verbrachte sie damit, mich zum Schreiben der Aufsätze und zum Ausfüllen der Bewerbungsformulare für die nächstgelegene Universität und mehrere angesehene Westküstenuniversitäten anzutreiben. Den ganzen Winter hielt sie noch durch, mit einer besessenen Energie, die die Ärzte erstaunte. Im Januar hörte ich zufällig mit an, wie sie meinem Vater mitteilte, der Krebs habe alle wichtigen Organe ihres Körpers befallen und sie werde keinen Monat mehr leben.
Die erste Zusage von einem College traf am 18. April ein, am Morgen ihres Begräbnisses.
Wäre es die Beerdigung meines Vaters gewesen und hätte meine Mutter mit dem Alleinsein zurechtkommen und sich und den Laden über Wasser halten müssen, während ich tausend Meilen weit weg war, so hätte sie gesagt: »Jetzt mach, dass du ins Flugzeug kommst. Ich komme schon zurecht.«
Teil I
1
»Du warst schon immer ein merkwürdiges Kind, Pat.« Mrs. Chase hatte das viele Male gesagt, doch damals, als ich erklärte, dass ich jetzt doch nicht aufs College ginge und sämtliche Zusagen zerrissen hätte, sagte sie es mit besonderem Nachdruck.
Mrs. Chase war die Geschichtslehrerin an der High-School von Kilgore. Gleichzeitig war sie auch für die Schülerberatung zuständig, da die Schule nicht groß genug war, um sich eine extra Stelle dafür leisten zu können. In ihrer Ausbildung lernt eine Beratungslehrerin ja vielleicht tatsächlich, wie man Heranwachsenden durch ihre eigentümlichen Qualen hindurchhilft. Im Falle von Mrs. Chase wurde der Posten jedoch zu einer Art Sortiertor, wie auf dem Viehhof. Die Schülerinnen und Schüler liefen über eine aus vier Klassen bestehende Rampe und erwarben sich unterwegs Notenpunkte und einen gewissen Ruf. Wenn sie am Ende der Rampe bei Mrs. Chase anlangten, schwang sie das Tor in die eine oder die andere Richtung. Du bist klug genug für die Universität. Du solltest dich mit einem Community College zufriedengeben. Und du solltest dir am besten einen Job suchen.
Sie kannte uns alle recht gut, da sie uns zumindest ein Jahr und manchmal sogar bis zu drei Klassen in Sozialkunde und Geschichte unterrichtet hatte. Und vielleicht trafen ihre Urteile eher zu als die der Spezialisten, die jeden Schüler nur bei Beratungsgesprächen erlebten. Problematisch war nur, dass sie keine Zeit hatte, mehr zu tun, als uns in die ihrer Meinung nach richtige Richtung zu schubsen. Ihr Unterrichtspensum war nur um einen Kurs reduziert worden, und in der daher knapp bemessenen Beratungszeit verhandelte sie zum Beispiel mit dem Sheriff darüber, wie man mit Fred McNeil und Marty Alderman verfahren solle, nachdem sie im Suff jeden Briefkasten zwischen Kilgore und Wister, dem fünfzehn Meilen weiter nördlich gelegenen Pünktchen auf der Landkarte, mit einem Dutzend Kugeln durchlöchert hatten.
Mrs. Chase kannte mich fast so gut wie Marty und Fred – nicht weil ich auf Briefkästen ballerte, sondern weil ich, wie sie sagte, ein merkwürdiges Kind war. Ich gehörte zu jenen Schülerinnen und Schülern, die für eine Beratungslehrerin leicht zur Obsession werden. Offensichtlich war ich gescheit – gescheit genug, um gute Noten zu bekommen, wenn ich es darauf anlegte, und die Erwartung zu wecken, dass ich es möglicherweise noch einmal weit bringen würde. Gleichzeitig war ich auf irritierende Weise verschroben. Meine Wunderlichkeit beschränkte sich nicht nur auf eine gewisse Maulfaulheit, obwohl die bereits ausreichte, um die meisten Lehrer glauben zu machen, sie müssten mich ändern. Es gab noch etwas anderes an mir, das den Erwachsenen Sorge bereitete. Die Kinder bezeichneten mich lediglich als komisch und beließen es dabei. Die Erwachsenen aber fühlten sich verantwortlich. Sie glaubten, mich vor Kummer bewahren zu müssen.
Oft wurde ich in Mrs. Chases Büro gerufen, vorgeblich, um meine großartige Zukunft zu planen, tatsächlich aber nur deshalb, weil sie die Ursachen meiner mangelnden Anpassung erforschen wollte. »Warum nimmst du nie an irgendwelchen Unternehmungen teil? Magst du keine Partys?«, fragte sie.
»Eigentlich nicht. Manchmal gehe ich aber doch zu einer.« Ich konnte schon reden, wenn jemand mich geradeheraus etwas fragte.
»Hast du Freundinnen?«
»Eigentlich nicht.«
»Magst du denn keines von den anderen Mädchen?«
»Die meisten kichern mir zu viel.«
»Lachst du denn nicht auch gerne?«
»Lachen ist nicht das gleiche wie Kichern.«
»Hast du einen Freund?«
»Nein.«
»Und was ist mit Chuck?«
»Ich bin mit ihm befreundet, aber er ist nicht mein Freund.«
Chuck wollte mein Freund sein. Er hatte mich einmal – sehr vorsichtig – geküsst, und ich hatte ihn aus wissenschaftlicher Neugier wiedergeküsst. Sein Mund war feucht und schmeckte nach Zigaretten. Ich war nicht gerade in Leidenschaft entbrannt und schlug ihm daher so taktvoll wie möglich vor, dass wir doch lieber Freunde bleiben sollten. Damals dachte ich, er sei einfach nicht der Richtige. Später, als die Jahre vergingen und keiner mich auch nur gelinde zum Beben brachte, kam ich zu dem Schluss, dass ich eben kein Interesse an Sex hatte.
»Warum trägst du eigentlich immer so düstere Farben?«, fragte mich Mrs. Chase bei einer anderen Gelegenheit.
»Weil sie mir gefallen.«
»Mit deinem dunklen Haar würdest du in Rot oder einem leuchtenden Blaugrün sehr hübsch aussehen. In Braun wirkst du so traurig.«
Ich zuckte die Achseln.
»Hübsch auszusehen ist wichtig. Das ist ein Zeichen von Selbstachtung.«
Wieder zuckte ich die Achseln.
»Du stößt die Menschen ab, wenn du dich wie ein Penner anziehst und dich immer so ernst gibst. Ist es dir denn egal, ob man dich mag oder nicht?«
Und wieder zuckte ich die Achseln. Mrs. Chase stotterte schon fast vor lauter Frust. Sie sah doch so deutlich, was mir zu meinem Glück fehlte, und ich stand steif, stur und dumm da und ließ mir einfach nicht helfen. Es war doch so simpel. Wäre ich nur nett zu den Leuten, würde ich lächeln und reden und mich hübsch anziehen, dann würden sie mich auch mögen. Und mochten einen die Leute, dann war man auch glücklich. Das war doch eine ganz einfache Rechnung.
Was Mrs. Chase aber nicht verstand und was ich ihr auch nicht erklären konnte, war die Tatsache, dass ich mich gar nicht unglücklich fühlte. Sie nahm an, dass jedes Mädchen, die in weiten braunen Flanellhemden herumlief, den größten Teil ihrer Zeit allein mit Lesen und Zeichnen verbrachte und deren einziger Freund ein raubeiniger, zwei Jahre älterer Junge war, per definitionem unglücklich sein musste. Der Begriff »geringes Selbstwertgefühl« war noch nicht zur populären Sammeldiagnose geworden, wie seitdem geschehen, so dass Mrs. Chase das passende Etikett fehlte. Dennoch war sie überzeugt, dass ich ein Problem hatte. Da ich dies aber nun durchaus nicht glaubte, konnte man wohl auch nicht von mir erwarten, dass ich darauf erpicht war, mir helfen zu lassen.
Als ich ihr erzählte, dass ich nun doch nicht aufs College ginge, gab sie es schließlich auf und kam zu der Überzeugung, ich sei einfach ein hoffnungsloser Fall. Ich war nicht nur merkwürdig, sondern auch undankbar. Drei Jahre lang hatte sie größte Hoffnungen in mich gesetzt, auf eine Schülerin, die intelligent genug war, um vielleicht nach Stanford oder Berkeley zu gehen. Während der Bewerbungszeit hatte sie mit mir gebangt. Hatte sich persönlich darum gekümmert, dass ich die notwendigen Empfehlungen erhielt. Von den verzweifelten Ambitionen, die meine Mutter auf dem Krankenbett für mich hegte, hatte sie zumindest einen Eindruck erhalten. Als die Zusagen dann schließlich kamen, waren sie ein Triumph, nicht nur für mich, sondern auch für sie, für die Schule und für die ganze Stadt. Und ich hatte sie zerrissen.
»Du warst schon immer ein merkwürdiges Kind, Pat«, sagte sie. Anstatt Verständnis oder den Wunsch, mir zu helfen, zum Ausdruck zu bringen, spuckte sie mir die Worte voller Zorn und Enttäuschung ins Gesicht.
Ich antwortete nicht. Eigentlich sah ich Mrs. Chase weder an, noch hörte ich ihr zu. Zwei Bilder standen mir vor Augen. Ich sah das Gesicht meiner Mutter: kalt, reglos und abgemagert. Die Haut spannte sich wie Seidenpapier über ihre zarten Knochen. Das Gesicht sah aus wie die gedörrten Überreste eines toten Vogels. Und in mir war die gleiche Reglosigkeit, die tief in den Knochen sitzende Überzeugung, dass Anstrengung und Ehrgeiz sinnlos waren, ein Trick Gottes, um uns abzulenken, während er uns seine letzte Falle stellte und sie zuschnappen ließ.
Dann sah ich meinen weinenden Vater vor mir, wie er sich an mich klammerte und flehte: »Lass mich nicht allein, Schätzchen!«
Das erste Bild war mein ganz privates und ging niemanden etwas an. Das zweite war nicht meines, und doch konnte ich nicht darüber sprechen. Ich brachte es nicht fertig, das Schauspiel, das Smoky Lloyd, der muntere, sympathische Smoky, geboten hatte, als er sich schluchzend und hilfesuchend an seine Tochter klammerte, publik zu machen. Es war ein peinlicher Anblick, und ich wollte nicht, dass jemand davon erfuhr. Also sagte ich nichts, weder zu Mrs. Chase noch zu sonst jemandem.
Nach dem Schulabschluss begann ich ganztags im Mercantile zu arbeiten. Und von einem kurzen Experiment abgesehen, blieb ich auch dort.
Das Experiment startete ich vor etwa zwölf Jahren, als ich zweiundzwanzig war. Pops hatte seinen Verlust inzwischen verschmerzt und fühlte sich ganz glücklich in seiner Rolle als nicht festzunagelnder Junggeselle, die er für alle Witwen, geschiedenen Frauen und alten Jungfern in Kilgore und Umgebung spielte. Ich kam zu dem Schluss, dass ich fortmusste, um einmal in der Stadt zu leben. Ein wichtiger Teil der menschlichen Erfahrung entginge mir, so glaubte ich, wenn ich immer in dem Ort blieb, in dem ich aufgewachsen war. Außerdem war ich überzeugt, dass alle »merkwürdigen Kinder« in die Städte zogen, wo sie nicht so sehr auffielen, und dass ich vielleicht ein paar von ihnen dort treffen würde. Also zog ich nach Chicago.
Sechs Monate lang hielt ich es aus. Den ersten Monat verbrachte ich in einem Zustand nervöser Verstörung, die letzten fünf in einer Abwärtsspirale der Einsamkeit und Apathie. Durch den Lärm, die dauernde Bewegung, die Allgegenwart von Menschen gerieten all meine normalen Denkprozesse völlig durcheinander. Umgeben von Mauern, Autos, Reklametafeln und Menschen konnte ich nicht mehr träumen. Und ohne meine Träume war ich verloren. Ohne meine Tagträume besaß ich nur noch die äußere Realität. Die aber bestand aus einem geistlosen Job, einsamen Abenden in einem winzigen und anonymen modernen Apartment und aus Langeweile, endloser, ununterbrochener, abstumpfender Langeweile.
Ich hatte keine Ahnung, wie man in der Großstadt überlebt. Ich war so hilflos wie ein Junge aus der Bronx, den man mit dem Hubschrauber über der Wildnis Alaskas abwirft. Auf mich wirkte diese Million fremder Menschen so unbelebt und unergründlich wie dem ungeübten Auge eine Million Bäume ununterscheidbar erscheinen. Falls es unter dieser Million »merkwürdige Kinder« wie mich gab – ich hätte nicht gewusst, woran ich sie hätte erkennen sollen. Und hätte ich sie erkannt, so wäre ich viel zu scheu gewesen, um sie anzusprechen. Abgesehen von den Leuten, die ich bei der Arbeit sah, lernte ich keinen – weder einen merkwürdigen noch sonst einen – Menschen kennen.
Nach sechs Monaten gab ich es auf. Zum zweiten Mal belud ich meinen Wagen und brach auf, zurück nach Westen. Später konnte ich mich in aller Deutlichkeit nur noch an die beiden Fahrten erinnern, an die erste in östlicher Richtung, bei der die Landschaft immer kleinteiliger wurde und das Land immer fruchtbarer, die Hügel sanfter, die Farmen kleiner, die Farben lebhafter und leuchtender wurden; wogegen später in umgekehrter Richtung das Land sich weiter und weiter ausdehnte und alles immer karger wurde, als würden die gleiche Menge an Regen, Pflanzen, Farben und Menschen über eine immer größere Fläche verteilt.
Als ich wieder in Kilgore ankam, wollte Pops eine große Party für mich geben. Ich ließ es nicht zu. Schlimmer, als von einer Million Fremder umgeben zu sein, war nur noch, in einem Zimmer voller Bekannter im Mittelpunkt zu stehen. Pops musste sich damit zufriedengeben, jeden, der den Fuß über die Schwelle des Mercantile setzte, mit der Nachricht zu begrüßen: »Pat ist wieder da. Gestern Abend zurückgekommen. Hat das wilde Großstadtleben einfach nicht ertragen, nicht wahr, Schätzchen?«
Und dann legte er mir den Arm um die Schultern und drückte mich an sich. »Pat hat sich nie viel aus Partys und Ausgehen gemacht. Ihre Mom und ich mussten uns nie Gedanken machen, wo sie sich nachts um elf rumtrieb. Und jetzt ist sie wieder da, wo sie hingehört.« Nur ein paar Details hatten sich verändert. Um in Chicago eine Anstellung zu finden, hatte ich einige neue Kleidungsstücke kaufen müssen. Zum ersten Mal waren das Sachen, die nicht aussahen wie Restbestände der chinesischen Armee in Übergröße. Und da ich sie nun schon einmal besaß, zog ich sie auch weiterhin an. Mindestens ein Dutzend Leute fragte mich, ob ich abgenommen oder eine neue Frisur hätte, was beides nicht zutraf. So machten sie mir taktvoll ein Kompliment zu meiner neuen Garderobe. Sie konnten ihre Komplimente nicht direkt aussprechen. Damit hätten sie nämlich stillschweigend zugegeben, dass ihnen mein früherer schlampiger Aufzug aufgefallen war.
Bald nach meiner Rückkehr hob ich alle meine Ersparnisse ab und kaufte ein Stück Land – nicht viel, nur etwa vierzig Acres, die fünf Meilen außerhalb von Kilgore lagen. Außer einem eingestürzten Schuppen und alten Grundmauern, auf denen, ehe es niederbrannte, einmal das Haus gestanden hatte, gab es nichts auf dem Grundstück. Da der Viehhandel sich gerade in einer tiefen Flaute befand, war Land billig. Und mein Grundstück war sowieso zu klein, als dass man etwas Gescheites damit hätte anfangen können. Es konnte vielleicht ein, zwei Kühe oder ein halbes Dutzend Schafe ernähren. Sieben Bäume, Pappeln und Holunder, verteilten sich um das alte Fundament, und eine Handvoll Krüppelkiefern stand auf dem Hügelkamm hinter dem Haus.
Der beste Teil des Grundstücks und der Grund, warum ich es gekauft hatte, war der gewaltige nackte Felskamm. Die Hinterseite des Hügels fiel sanft ab, aber die mir zugewandte Seite oberhalb der Grundmauern stürzte schroff und senkrecht gegen das Bachbett und das ebene Land, wo einmal das Haus gestanden hatte, herab. Oben am Kamm hatten Wind und Regen die Erde fortgetragen und nur das nackte Gebein des rotbraunen Felsens zurückgelassen, das jetzt drohend wie die Mauer einer alten Burg über dem engen Tal aufragte.
Wenn mich einmal eine trübe Stimmung ergriff, wenn Pops mir auf die Nerven ging oder ich mich zu fragen begann, ob ich jemals zur menschlichen Rasse gehören würde, dann kletterte ich dort hinauf. Ich kraxelte die steile Hügelseite hoch, auf der Grasbüschel, Yuccas und Feigenkakteen wuchsen, und hockte mich auf einen der Felsvorsprünge. Manchmal nahm ich ein Buch oder einen Zeichenblock mit. Manchmal saß ich einfach nur da und schaute hinaus über die vielen Meilen lebendigen Landes.
Vom Felsen aus sah ich keine der Ansammlungen toter Gegenstände, mit denen sich die Menschheit umgibt, weder Bauholz noch Beton, weder Plastik noch Metall. Alles, was man sah, war lebendig. Umgeben von der trockenen, rissigen Erde, den gemeißelten Spitzkuppen, den stets ihren Lauf verändernden Bächen, der Intensität der Sommerhitze und den trockenen, bitteren Winterwinden, spürte ich wie nirgends sonst den wilden, hartnäckigen Puls des Lebens an sich. Nichts hier begünstigte Leben, und doch gab es überall, wohin ich sah, lebende Dinge: die kleinen, den Boden bereitenden Flechten, die das Erdreich für andere Samen aufbrachen, die sehnige, trockene Vegetation, die behutsam und pragmatisch Meilen von wassersammelnden Wurzeln verlegte, ehe sie es wagte, mit ihrem Grün zu protzen. Der Wille zum Überleben wurde zur greifbaren Wirklichkeit, die mich völlig durchdrang, und ehe ich mich’s versah, war es mir schon wieder ganz egal, ob ich je sein würde wie der Rest der Menschheit.
2
»Entschuldigen Sie, aber wo haben Sie denn die Tampax?«, erklang eine Stimme in meinem Rücken. Ich kniete neben mehreren offenen Kartons mit Cornflakes- und Müslipackungen. Es war Viertel nach acht, beinahe Ladenschluss. Ich füllte Regale auf, um mir diese normalerweise tote Zeit am Abend zu verkürzen. Gerade war ich mit dem Einsortieren der Sugar Pops ins untere Regal beschäftigt.
Ich drehte mich um, um zu gucken, wer da mit mir sprach. Als Erstes erblickte ich ein Paar raffiniert gearbeitete, sehr schmale und spitze schwarze Cowboystiefel. Schon von dem Anblick taten mir die Zehen weh. Ich hob den Blick, um zu sehen, wer zu den Stiefeln gehörte. Sie war schlank und hatte sehr blondes, lockiges Haar, das ihr auf die Schultern herabfiel. Sie wiederholte ihre Frage und fuhr, ehe ich antworten konnte, auch schon fort: »Der Laden bei der Fernfahrer-Raststätte hat keine Tampax vorrätig. Da werden sie wohl nicht oft verlangt. Sie hatten zwar siebenundzwanzig verschiedene Kondomsorten und ein ziemlich reichhaltiges Angebot an Deodorants und Rasierwasser, aber nur eine beschissene Sorte Tampons. Genau die, die ich nicht nehme. Plastikzeugs, das zwickt, wenn man’s reinschiebt. Ich bin ein bisschen eigen, wenn’s darum geht, was ich mir da reinstecke.«
Mehrere Fragen schossen mir durch den Kopf, etwa die, was man sich denn sonst noch alles da reinstecken könnte und wo sie wohl weniger eigen sein mochte. Da ich diese Fragen nicht stellen konnte und ich die Frage, mit der die ganze Unterhaltung begann, schon längst vergessen hatte, blieb ich einfach auf den Knien und starrte sie an. »Ist Ihnen das peinlich?«, fragte sie. »Manchmal vergesse ich, dass es ja manche geniert. Ich dachte, als Frau hätten Sie Verständnis. Aber vielleicht kaufen Sie ja die Plastiksorte, und jetzt sind Sie sauer auf mich.«
»Ich bin nicht sauer«, brachte ich schließlich über die Lippen.
»Da bin ich jedenfalls schon mal froh. Ich trete oft ins Fettnäpfchen. Das passiert eben, wenn man erst redet und dann denkt. Auf die Weise hab ich schon mehrere Jobs verloren. Mir ist einfach nicht schnell genug eingefallen, dass ich ja mit einem Typen rede, der mich feuern kann. Ich lass mich von meinem eigenen Gequassel fortreißen – es klingt so überzeugend, wissen Sie –, und ehe ich mich’s versehe, ist schon jemand sauer auf mich oder tomatenrot oder sonst was.«
Zuerst hatte ich die Frau für durchgeknallt gehalten. Jetzt, nachdem ich einen etwas ausführlicheren Blick auf sie geworfen hatte, sah ich, dass sie noch keinen Moment lang völlig ernst gewesen war. Sie grinste freundlich und spöttisch zugleich, und plötzlich fiel mir auch auf, wie hübsch sie war.
»Ich schätze, Sie kennen das gar nicht: reden, ohne nachzudenken«, sagte sie.
Ich begann zustimmend den Kopf zu schütteln, aber ihre Gedanken waren bereits wieder vorausgeprescht, und schon sprach sie weiter. »Sie muss ich mir mal vornehmen. Ich mag’s nämlich, wenn Leute spontan drauflosreden. Da sind sie am ehrlichsten. Der Verstand ist ein großer Filter. Er filtert die Wahrheit heraus, so dass nur noch die harmlosen und höflichen Sachen übrigbleiben, und die kommen einem dann über die Lippen. Ich heiße übrigens Alma Rose.«
Sie streckte mir die Hand entgegen und blickte mich erwartungsvoll an.
»Pat«, sagte ich und schüttelte ihr die Hand. In ihrer Erwartung war sie so absolut und dennoch auf so entwaffnende Weise verletzlich wie ein Vogeljunges mit offenem Schnabel. Man konnte sich einfach nicht entziehen.
»Ist das Ihr Laden?«, fragte sie.
»Er gehört meinem Vater. Ich arbeite für ihn.«
»Dann sind Sie also hier aufgewachsen.«
»Ja.«
»Ich könnte nicht für meinen Vater arbeiten. Da würde ich durchdrehen. Wir sind uns einfach nie einig. Das heißt, vielleicht sind wir uns doch in einer Sache einig, nämlich darin, dass ich es nie zu was bringen werde. Er ist Banker, also würde ich sowieso nie für ihn arbeiten wollen. Kommen Sie mit Ihrem Vater klar?«
Ich zuckte die Achseln. »Es geht.«
Sie sah mich aufmerksam an, als sei sie sich sicher, dass sich hinter meiner Antwort eine Geschichte verbarg, die sie unbedingt hören wollte. Sie schwieg tatsächlich volle zehn Sekunden lang und wartete, ob ich wohl näher darauf einging. Ihr Schweigen wurde jedoch nicht belohnt. Ich konnte länger schweigen als sonst jemand und mit Sicherheit länger als Alma Rose.
Plötzlich grinste sie. »Sie sind eine ziemlich harte Nuss, wie ich sehe. Ich hol mir mal besser erst die Tampax. Haben Sie zufällig eine Toilette?«
Ich deutete erst auf die Tampax und dann in Richtung Toilette.
Als sie zurückkam, sagte sie: »Das war das sauberste Damenklo, das ich seit Wochen zu Gesicht bekommen habe.«
»Ich muss es selber ja auch benutzen.«
»Heißt das, das Männerklo ist ein Dreckloch?«
»Nee, es wird einem zur Gewohnheit, auf Sauberkeit zu achten.«
»Nicht jedem«, sagte sie. »Haben Sie vielleicht eine gekühlte Cola light?«
»Eine Dose?«
»Ja.«
»Hol ich Ihnen.«
Einen Moment lang wünschte ich mir, ich müsste mich mit der Machete durch den Dschungel schlagen und menschenfressende Tiger in Schach halten, um die Cola zu holen. Einer so hübschen und charmanten Frau sollte man Trophäen zu Füßen legen. Leider gab es weder Dschungel noch Tiger zwischen mir und dem Kühlschrank. Nur einen Gang mit Kartoffelchips und kleinen Napfkuchen und ein paar Meter Linoleum. In dieser kurzen Zeit sah ich keine Möglichkeit, mein ordentliches, praktisches Selbst in eine Person zu verwandeln, die ihrer fortgesetzten Aufmerksamkeit würdig war.
Ich dachte daran, die gewinnende Hanswurst-Methode auszuprobieren, zu stolpern und mich wie ein Tollpatsch zu gebärden und dann etwas Selbstironisches und wahnsinnig Komisches zu sagen. Das Problem war nur, dass mir nicht schon im Vorhinein etwas wahnsinnig Komisches einfiel und ich nicht so ganz überzeugt war, dass mir, sobald ich auf dem Boden landete, eine Erleuchtung käme. Also ging ich völlig normal zum Kühlschrank, um die Cola zu holen, und kehrte ebenso normal wieder zurück. Alma Rose dankte mir und bezahlte die Cola und die Tampax. Ich hatte erwartet, dass sie anschließend gehen würde, doch das tat sie nicht. Sie riss die Metallasche der Dose auf und legte den Kopf in den Nacken, um ein paar lange, genüssliche Schlucke zu tun. Ich beobachtete die zarte Wellenbewegung an ihrer Kehle, während sie trank.
Sie stellte die Dose wieder auf den Ladentisch und stützte die Ellbogen darauf, als ob sie eine Weile bleiben wolle. »Erzählen Sie mir doch was über Kilgore«, sagte sie.
»Was denn? Suchen Sie einen Ort, wo Sie hinziehen können?«
»Gott bewahre. Ich bin nur heute hier, will hier übernachten. Mein Sattelschlepper steht drüben an der Raststätte.«
»Sie haben einen eigenen Sattelschlepper?«
»Schön wär’s. Er gehört der Firma. Normalerweise mach ich ein bisschen weiter östlich halt, aber heute Abend dachte ich mir, ich bleib mal hier. Kilgore – der Name gefällt mir. Ich wollte schon immer mal anhalten und gucken, wie’s hier aussieht. Also, wie ist Kilgore?«
»Klein.«
»Ist das alles?«
»So ziemlich.«
»Und was hält Sie dann hier?«
Die Antwort darauf wäre meine ganze Lebensgeschichte gewesen. Ich sagte: »Ich hab wohl nicht allzu viel für Menschen übrig. Nicht, wenn sie in Massen auftreten.«
»Was mögen Sie denn dann?«
»Die meisten anderen Arten.«
»Sogar Elstern?«, fragte sie.
»Die stören mich nicht.«
»Wie steht’s mit Klapperschlangen?«
»Die stören mich auch nicht, solange ich nicht auf eine trete.«
»Was ist mit Eschenahornkäfern?«
»Jetzt übertreiben Sie aber«, sagte ich.
Sie lachte. »Ich hab mal in einer Wohnung gelebt, in der es Eschenahornkäfer gab. Man konnte seinen Eistee nicht zwei Minuten abstellen, ohne dass ein Eschenahornkäfer drin herumschwamm. Ich wollte ein Glas mit einer Art Klappdeckel erfinden, um die Käfer abzuhalten, wenn man das Glas abstellt. Glauben Sie, dass es für so was Nachfrage gäbe?«
»In Kilgore schon, aber das ist kein besonders großer Markt.«
»Na ja, war auch nur so eine Idee.« Sie trank wieder einen Schluck Cola.
»So schlimm wie Küchenschaben sind sie ja wohl nicht«, sagte sie. »In meiner jetzigen Wohnung gibt’s Schaben. Ich liege nachts wach und höre, wie sie in der Küche herumflitzen. Gut, dass ich so viel unterwegs bin.«
Sie blieb noch eine halbe Stunde, lehnte am Ladentresen und redete. Sie brauchte keine Stichwortgeberin. Die Sätze flossen nur so von ihren Lippen, und ich hörte ihr gern zu. Sie hatte eine hohe, lebhafte Stimme, die jung klang, viel jünger, als sie aussah. Sie erinnerte mich an gewisse Country-Sängerinnen, nicht an die mit den näselnden tiefen Schmetterorganen, sondern an die mit den süßen, zarten Mädchenstimmen. Sie erinnern einen an Kätzchen und rosa Blümchen, obwohl sie vermutlich so zäh und haltbar sind wie gedörrtes Rindfleisch.
Ich erfuhr eine Menge über sie in dieser halben Stunde. Seit eineinhalb Jahren fuhr sie einen Sattelschlepper. Irgendwo gab es einen Ex-Mann, wo, wusste sie aber nicht. Er hatte sie ein paar Jahre zuvor verlassen, und seitdem hatte sie nichts mehr von ihm gehört.
»Ich war ihm zu unruhig«, sagte sie. »Ich wollte alle ein, zwei Jahre umziehen. Eine Zeitlang akzeptierte er es. Aber dann meinte er, er würde wieder nach Minnesota ziehen und sich eine Frau suchen, die sesshafter ist und Kinder will.«
Sie war in St. Paul, in einem schönen Haus, einem reichen Viertel aufgewachsen. Für mich passte das nicht zusammen. So wie sie lebte, erwartete ich, dass sie aus einem harten Milieu, einer kaputten oder armen Familie stammte und deswegen so bindungslos war. Doch ihr Vater war Bankier. Die Eltern waren noch immer verheiratet und lebten auch noch in dem Haus, in dem sie aufgewachsen war. Ihre älteren Geschwister hatten alle das College besucht und machten Karriere. Auch sie war aufs College gegangen, hatte jedoch nie einen Abschluss gemacht.
»Ich bin das schwarze Schaf, ist ja wohl klar«, sagte sie. »Aber Sie doch bestimmt nicht, wo Sie zu Hause geblieben sind und im Geschäft Ihres Vaters arbeiten.«
»Nein, mich kann man wohl kaum als schwarzes Schaf bezeichnen«, erwiderte ich. War es für ein Einzelkind überhaupt möglich, das schwarze Schaf zu sein? Dies war wohl eine der kleinen Entschädigungen: der Vergleich mit Geschwistern blieb einem erspart.
»Zu wievielt sind Sie in Ihrer Familie?«, fragte sie.
»Nur zu zweit: Pops und ich.«
»Ist Ihre Mutter gestorben?«
Ich nickte, was nicht gerade zu weiteren Fragen ermunterte.
Einen Moment dachte ich, sie würde trotzdem fragen. Doch dann lenkte sie das Gespräch in eine andere Richtung. »Ich wünschte, ich käme besser mit meiner Familie klar«, sagte sie. »Vor allem mit meinem Vater. Nichts, was ich mache, passt ihm. Ich hab versucht, am College Betriebswirtschaft zu studieren, aber ich konnt’s einfach nicht ertragen. Also fahre ich jetzt einen Sattelschlepper, und das passt ihm ja nun überhaupt nicht.«
Ihr Gesicht verzog sich traurig entlang der schon tief eingegrabenen Linien. Diese Stimmung musste sie wohl oft überkommen. Gern hätte ich die Hand ausgestreckt und die Falten fortgestrichen. Sie hatte ein hübsches Gesicht mit feinen Zügen und schön geschwungenen Lippen. Und es kam mir nicht richtig vor, dass ein solches Gesicht sich zu einer Trauermiene verfestigen sollte. Es erschien mir wie eine Abweichung von der natürlichen Ordnung.
Ich gehöre nicht zu den Menschen, die einer Fremden tröstend den Arm um die Schultern legen. Ich blieb reglos und wie angewurzelt ein paar Schritte von ihr entfernt auf der anderen Seite des Ladentisches stehen.
Nach einer Weile schüttelte sie sich und sagte: »Ach, ich langweile Sie bestimmt mit meinem Gejammer. Ich sollte lieber gehen und mich mal ausschlafen.« Sie sah auf ihre Uhr. »Oje, schon so spät. Wann schließen Sie denn normalerweise?«
»Um halb neun. Aber es macht nichts. Ich hatte sowieso nichts vor.«
»Es war sehr nett hier. Vielleicht komme ich irgendwann mal wieder vorbei.«
»Sie sind immer willkommen«, sagte ich, ohne zu erwarten, dass ihr »vielleicht irgendwann« je eintreten würde.
3
Dieser kurze Besuch von Alma Rose zerstörte die heitere Ruhe meines Daseins. In einer einzigen Stunde hatte sie die sechzehn Jahre Arbeit, mir mein Leben einigermaßen passend und ohne allzu viele Zwänge einzurichten, zunichte gemacht. Ehe sie auftauchte, hatte ich keine Wünsche gehabt. Jetzt wollte ich, dass sie zurückkam und sich weiter mit mir unterhielt.
Ich hatte gelernt, mit dem, was ich hatte, zufrieden zu sein. Meine Arbeit verrichtete ich automatisch, so dass ich den Kopf frei hatte, um über die gelesenen Bücher nachzudenken oder über eine geplante Zeichnung oder meine Collies. Ich fühlte mich nicht einsam. Zwar besaß ich keine engen Freunde, doch ich kannte jeden am Ort. Alle, die in den Laden kamen, blieben in der Regel eine Weile bei mir stehen und unterhielten sich mit mir.
Meinen einzigen echten Freund, Chuck Eiseley, hatte ich nach seiner Heirat aus den Augen verloren. Seine Frau konnte nicht verstehen, dass er mit einem Mädchen befreundet war. Nach einer Weile wurde der Druck, den sie ihm wegen unserer Treffen machte, zu stark, und ich konnte nicht mit jemandem befreundet sein, den ich nie allein sah. Dann starb sein Vater, Chuck verkaufte die Ranch und zog fort, um auf den Ölfeldern zu arbeiten, wo er günstigere Arbeitszeiten hatte und besser verdiente.
Unmittelbar vor seiner endgültigen Abreise kam er mich besuchen. Es war Januar und höllisch kalt.
»Hab dir was mitgebracht«, sagte er. »Jetzt hab ich keine Verwendung mehr für sie.«
Er öffnete seine Jacke und zog zwei schwarzweiße Collie-Welpen heraus. »Es sind beides Hündinnen. Sie waren die besten des Wurfs. Vielleicht kannst du jetzt mal all das gebrauchen, was ich dir beigebracht habe.«
Schon als Kind hatte Chuck Talent für das Abrichten von Hunden gezeigt. Anders als die meisten Rancher rund um Kilgore hielten die Eiseleys Schafe, und die Collies waren Arbeitstiere. Ich hatte zwar nicht Chucks Geschick zum Abrichten, aber er hatte mir alles technische Wissen vermittelt, das ich dazu brauchte.
»Du musst dir ein paar Schafe anschaffen und sie auf deinem Stück Land halten«, sagte er. »Damit die Hündchen es lernen können.«
»Das werde ich wohl auch tun«, sagte ich. Mir war nach Heulen zumute, doch ich verkniff es mir. Chuck sah sowieso schon verlegen genug aus. Wenn ich jetzt auch noch weinte, dann wäre das der Gipfel der Peinlichkeit für ihn gewesen.
»Das wär’s dann wohl«, sagte er. »Beth ist draußen im Wagen. Ich sollte sie wohl besser nicht warten lassen.«
»Viel Glück«, sagte ich.
Wir umarmten uns nicht. Abgesehen von jenem misslungenen Kuss hatten wir uns wahrscheinlich, seit wir die Ringkämpfe der Kindheit aufgegeben hatten, nicht mehr berührt. Mit vierzehn begann Chuck plötzlich in die Höhe zu schießen und hörte nicht mehr auf, bevor er eins neunzig maß, und das nahm einem Ringkampf mit ihm jeden Reiz.
Er hatte immer eine melancholische Ader gehabt. Auf der High-School äußerte sie sich darin, dass er sich oft betrank, zu schnell Auto fuhr, mit jedem raufte, der ihm gewachsen war, und gelegentlich auch darin, dass er lange und ernste Gespräche mit mir führte. Unsere Gespräche hatten nichts Intellektuelles. Chuck war kein Intellektueller. Er war ein großer, starker, aufrichtiger Junge, der gern arbeitete und Tiere liebte und mit dem unerschütterlichen Glauben aufgewachsen war, dass er zu nichts taugte. Der Zorn, der von dieser Überzeugung herrührte, konnte ihn jeden Augenblick packen, und dann trank er oder zog los, um sich jemanden zu suchen, mit dem er einen Streit vom Zaun brechen konnte. Aber nie ließ er seine Wut an mir aus. Ich glaube, für ihn fiel ich unter die gleiche Kategorie wie seine Hunde: stumme, hilflose Geschöpfe, die er lieben, schützen und unterweisen musste.
Wir freundeten uns an, als ich in die dritte und er in die fünfte Klasse ging. Da ich in Mathe ein Jahr voraus und er eines zurück war, waren wir in derselben Gruppe. Die Schule war so klein, dass die Übergänge zwischen den Klassen sowieso fließend waren. Oft half ich ihm bei seinen Mathe-Hausaufgaben. Und obwohl ich ein Mädchen und jünger war, störte es ihn nicht. Das lag wohl daran, dass ich mir bereits den Ruf eines besonders schlauen Köpfchens erworben hatte und daher die normalen Vergleichsmaßstäbe auf mich nicht angewendet wurden. Ich war eine Anomalie, fast eine andere Spezies. Von mir Nachhilfe in Mathe zu bekommen war nicht beschämender, als gegen Kasparow im Schach zu verlieren.
Keiner von uns beiden hatte viele Freunde. Meine überwältigende Schüchternheit schreckte andere Kinder ab, und Chucks Wutausbrüche machten ihnen angst. Wenn ich jedoch das Kürzen von Brüchen erklärte, war ich gar nicht schüchtern, und Mädchen gegenüber, die jünger und kleiner als er waren, hatte Chuck keine Wutanfälle. Und so wurden wir Freunde.
Manchmal verbrachte ich den Sonntagnachmittag auf der Ranch seiner Familie, aber nur zu den Jahreszeiten, in denen er nicht zu sehr mit Arbeit eingedeckt war, mit der Versorgung von Lämmchen, mit Schafescheren oder Heumachen. An diesen Sonntagnachmittagen brachte er mir alles über Hunde bei. »Das Wichtigste ist, dass du nie die Beherrschung verlierst«, sagte er. Ich versuchte, mir das Gesicht des Schuldirektors, von Mrs. Chase oder dem Sheriff vorzustellen, wenn sie ihn das hätten sagen hören. »Wenn du zornig wirst, verängstigst du sie nur. Und sie lernen nichts dadurch.«
Er war ein ganz anderer Mensch, wenn er einen Welpen zum Unterricht mit auf die Wiese nahm. Er war vorsichtig und behutsam. Die Hunde beobachteten ihn aufmerksam. Nie wurde er laut oder fuchtelte mit den Händen. Er hielt sich ganz bewusst zurück, um sich ihre Aufmerksamkeit zu erhalten, so wie ein geschickter Redner ein Publikum durch leises, langsames Sprechen immer stärker in seinen Bann zieht.
In meinem vorletzten Schuljahr musste er einen seiner Hunde erschießen.
»Er ist bösartig geworden. Ich weiß nicht, warum. Letzte Nacht hat er ein Schaf getötet, also hab ich ihn erschossen.«
Er sprach völlig sachlich. Es war ein Gesetz, das er nicht in Frage stellte.
Am nächsten Abend wurde er in Seco Springs festgenommen. Zuerst hatte er einem Burschen in der Antler Bar eines verpasst, nur weil der größer war als er und zu laut mit seiner Harley-Davidson angab. Dann hatte er den Kopf eines ausgestopften Widders von der Wand gerissen, die Hörner als Sturmbock verwendet und eine ganze Reihe Glasrahmen mit Fotos der führenden Geschäftsleute von Seco Springs zertrümmert. Die Bilder hingen zwischen dem Regal mit den Billardqueues und den Toilettentüren. Chuck war bloß mit dem Widderkopf klirr-knall-klirr daran vorbeigegangen, bis zwei Polizisten ihn packten. Er hatte sich bereit erklärt, für den Schaden aufzukommen, und bekam Bewährung.
Ich heulte nicht, auch dann nicht, als sich die Tür hinter ihm schloss und ich allein mit den zwei zappelnden Welpen in meinen Armen zurückblieb. In einer Stunde musste ich im Laden sein. Vorher aber musste ich den Hündchen noch einen Platz herrichten und Schüsseln für Wasser und Futter suchen, eine Decke und ein paar entbehrliche Dinge, auf denen sie herumkauen konnten. Als ich damit fertig war, war es zum Weinen schon zu spät.
Lulu und Tess besaß ich immer noch. Außerdem hatte ich drei jüngere Hunde, Lulus Tochter Lucy und zwei von Lucys Welpen, die ich abrichtete, um sie als Arbeitshunde zu verkaufen. Die beiden Alten wurden allmählich steif und halsstarrig, aber sie arbeiteten noch immer gern mit den Schafen.
So sehr ich meine Hunde auch liebte, ich gab mich nicht der Illusion hin, dass ihre Gesellschaft mir Chuck ersetzen könnte. Sie waren zwar besser als nichts, aber sie redeten nicht mit mir, verstanden nicht, wenn ich einen Witz machte, und ich bildete mir auch nicht ein, dass sie mich verstanden, wenn ich heimkam und klagte, dass Peggy Treadwell mir mit ihrem Wohltätigkeitsbasar im Nacken saß, in dessen Ausschuss sie mich unbedingt haben wollte.
Über die Jahre hatte ich mich daran gewöhnt, dass die meisten Gespräche, die ich führte, Selbstgespräche waren und dass ich vor mich hin lachte, wenn mir ein komischer Gedanke kam.
Als sich die Tür hinter Alma Rose schloss, dachte ich: Das war eine Frau, mit der ich genauso eng hätte befreundet sein können wie mit Chuck. Ich wusste nicht, ob ich Bedauern oder Erleichterung empfand. Das blöde Gebimmel der Kuhglocke an der Tür klang mir wie das Rasseln eines Weckers in den Ohren. Falls ich mich mit Alma Rose anfreundete, würde sie mich zwangsläufig verlassen, genau wie Chuck. Ich wollte nicht noch einmal zehn oder fünfzehn Jahre damit verbringen, mich wieder an mein vorheriges Leben zu gewöhnen. Es war viel besser, wenn sie schon jetzt verschwand und ich mir meinen harterkämpften Seelenfrieden erhalten konnte.
4
Da saß ich aber einem Irrtum auf, denn mein Seelenfrieden war bereits dahin. Meine Gedanken gehörten nicht mehr mir allein. Wann immer es ihr passte, machte sich Alma Rose mit der Arroganz der Besitzerin darin breit. Manchmal grinste sie mich an oder versuchte mich zu necken oder machte Witze. Dann wieder sah sie so traurig aus, dass ich sie in den Arm nehmen und trösten oder irgendetwas Närrisches anstellen wollte, damit sie wieder lächelte. Im Geiste wiederholte ich mir jedes Wort, das wir in jener Stunde gesprochen hatten.
Ich sah ihr Gesicht direkt vor mir, ganz deutlich. Die Wimpern der blauen Augen waren leicht getuscht. Ihre Nase war schmal und ein wenig spitz. Die Lippen waren voll und geschwungen, die Zähne zwar nicht ganz, aber nahezu perfekt. Ich sah noch, wie sie die Cola trank, so wie es Models in der Fernsehreklame tun, mit geschlossenen Augen und zurückgelegtem Kopf, so dass Kinn und Kehle der Kamera eine schöne Linie präsentieren.
»Ich hab gefragt, ob du da hinten vielleicht noch Erdbeereis versteckt hast. In der Kühltruhe ist keines mehr.«
Gladys Gardner stand auf der anderen Seite des Tresens und wartete darauf, dass ich wieder zu mir kam und anfing, ihre Sachen einzutippen.
»Tut mir leid«, erwiderte ich. »Ich hab an was anderes gedacht. Erdbeereis hast du gesagt?«
Als ich mit dem Eis zurückkam, meinte Gladys: »Einen Augenblick lang dachte ich schon, du bist womöglich zu einer von diesen chinesischen Religionen übergetreten und hast dich in Trance versetzt.«
»Hab wohl nur geträumt.«
»Mit Sicherheit warst du woanders. Ich hab drei Mal nach dem Eis gefragt. War schon ein bisschen unheimlich, weil du mich auch die ganze Zeit dabei angestarrt hast.«
»Tut mir furchtbar leid«, sagte ich.
Gladys lachte. »Das macht doch nichts. Aber ich hab mich schon gefragt, ob ich wohl ein Zauberwort sagen muss, damit du wieder zu dir kommst.«
Falls sie das Zauberwort wusste, dann sollte sie es doch in Gottes Namen sagen. Leider entsprach Gladys Gardner nicht gerade der Vorstellung, die man sich von einer Zauberin macht. Sie war eine mollige Frau mittleren Alters mit rundem, sonnengerötetem Gesicht und mit dem Aufseher von der Coon Creek Ranch verheiratet. Die einzige Beschwörungsformel, die ich mir aus ihrem Munde vorstellen konnte, lautete in etwa so: »Jetzt schlaf dich erst mal gründlich aus, und zum Frühstück back ich dir ein schönes Blech Zimtbrötchen, und dann fühlen wir uns schon tausendmal besser.« Andererseits war ihre Methode wahrscheinlich genauso wirksam wie irgendeine Nummer mit Fledermausblut oder rückwärts gesprochenem Latein.
Ich versuchte mich abzulenken. Stundenlang trainierte ich die Welpen. Bei meinem Buchclub bestellte ich mir ein Dutzend neue Bücher. Ich meißelte und bemalte ein paar von den blöden Steinskulpturen, die ich ins Schaufenster des Mercantile stellte und von denen ich gelegentlich auch mal eine an einen Touristen verkaufte. Ich kletterte auf meinen Felsen hinauf und zeichnete. Nichts half. Die Hunde irritierten mich, und ich gab das Abrichten für eine Weile auf, damit meine schlechte Stimmung nicht zu einer Unbeherrschtheit führte, die monatelanges Training zunichte gemacht hätte. Die Bücher stellten sich bei der Ankunft als langweilig, trivial und nichtssagend heraus. Meine Skulpturen, die gewöhnlich die Form von Fröschen, Kaninchen oder Kühen annahmen, sahen jetzt lediglich wie bemalte Felsbrocken aus. Statt Landschaften strichelte mein Bleistift ziellose Linien aufs Papier, von denen einige an menschliche Formen – allerdings von zerstückelten und zerrissenen Menschen – erinnerten.
Von Pops hielt ich mich fern, soweit das möglich war. Nicht weil ich fürchtete, dass er meine Stimmung registrieren und mich darauf ansprechen würde. Ich war mir sicher, dass er sie nicht mitbekam, und das war weit schlimmer.
»Was ist denn so am Brodeln da draußen in der wirklichen Welt, mein Schatz?«, fragte er immer, wenn ich zum Arbeiten kam.
Er fragte das jeden Tag, und jeden Tag antwortete ich denselben altgewohnten Blödsinn: »Schildkrötensuppe.« Oder: »Schweinsfüße.« Oder: »Schwarzer Kaffee und Toast – die Welt ist auf Diät.« Jetzt war die Speisekarte in meinem Hirn völlig leer, und ich sagte nur: »Wahrscheinlich das Übliche.«
Damit hatte sich unser Gespräch auch schon erschöpft. Pops unterhielt sich eigentlich nie richtig, weder mit mir noch mit sonst jemandem. Er erzählte Geschichten und wartete dann darauf, dass sein Publikum lachte. Auch wenn er zu einem richtigen Gespräch in der Lage gewesen wäre, wäre es ihm schwergefallen, ein Thema zu finden, das uns beide interessierte. Die einzige Freizeitaktivität, die wir beide mochten, war das Jagen, und das hatten wir aufgegeben. Als ich noch jünger war, waren wir jeden Herbst in einem vier Autostunden von Kilgore entfernten Nationalpark auf Wapiti-Jagd gegangen. Dann ging der Rancher, der uns die Pferde und die Ausrüstung geliehen hatte, in Rente und verkaufte sein Land, und Pops beschloss, sich ebenfalls zurückzuziehen – auf seinen Barhocker, von wo aus er Jagdgeschichten erzählen konnte.
Wie immer, wenn ich zur Arbeit kam, befand sich Pops gerade mitten in einer Geschichte. Diesmal erzählte er Father Paul, dem neuen katholischen Pfarrer, von Peggy Treadwells letztem Tobsuchtsanfall. Pops begrüßte mich und nahm den Faden exakt dort wieder auf, wo er ihn hatte fallenlassen, da nämlich, wo Peggy zum Wohnwagenpark am Ortsende fuhr, um zu gucken, wer die beiden Fichtenbäumchen vom Schulgrundstück geklaut hatte.
»Sie kennen Peggy ja, und diese Wohnwagenleute hat sie wirklich auf dem Kieker«, sagte Pops. »Sie war sich absolut sicher, dass sie die Bäumchen neben irgendeiner Hintertür eingepflanzt findet. Sie kämmt also den ganzen Park durch, schnüffelt in jedem Gärtchen rum, findet sie aber nicht.«
Ich konnte mir gut vorstellen, wie Peggy – die Handtasche sicherheitshalber unter den Arm geklemmt – die Reihe der Wohnwagen auf und ab marschierte und in die winzigen Gärten spähte, in denen kaum Platz für eine Wäscheleine und ein paar Spielsachen war, ganz zu schweigen von zwei Fichten, die in ausgewachsenem Zustand einen Schatten von sechs Metern Durchmesser werfen würden.
»Und da war Peggy mit ihrem Latein am Ende. Sie konnte ja nicht den ganzen Landkreis absuchen. Also fängt sie an, Marv zu bearbeiten, und erzählt ihm, als Schuldirektor wäre es seine Pflicht, diese Bäume zu finden. Überredet ihn, in der Schule eine Versammlung einzuberufen, um die Sache an die Öffentlichkeit zu bringen. Armer Marv. Er hatte nicht mal die Chance, sich das Ganze gründlich zu überlegen, sonst hätte er es sicher nicht getan. Peggy gibt keinem die Chance, groß nachzudenken, und schon gar nicht ihrem Mann.





























