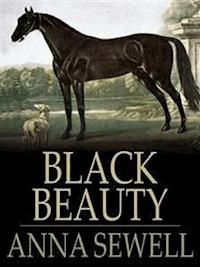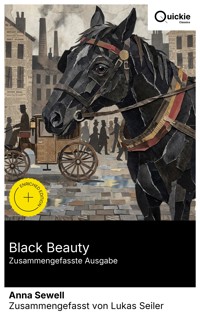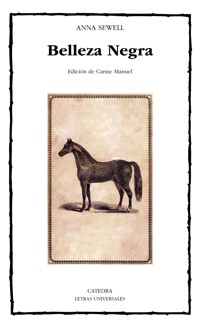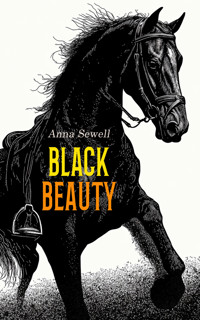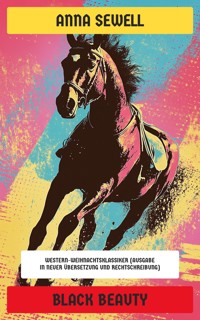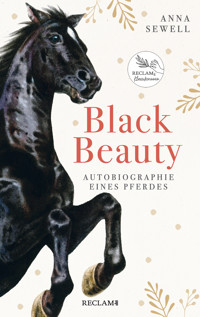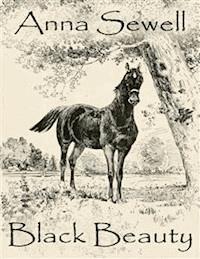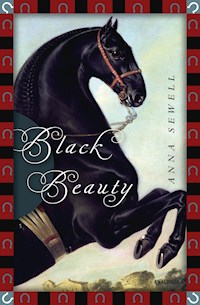
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Anaconda Kinderbuchklassiker
- Sprache: Deutsch
Nach einer behüteten Jugend führt der schwarze, stattliche Hengst Black Beauty in der liebevollen Umgebung eines Gutshofs das Leben eines Reit- und Kutschpferdes. Eines Tages jedoch muss sein Besitzer ihn aus Geldnot verkaufen und Black Beauty gerät in die Fänge skrupelloser und egoistischer Menschen. Ein Ende seiner grausamen Leidenszeit scheint schon nicht mehr in Sicht, da nimmt ein kleiner Junge sich seiner an und sein Leben eine Wende. Mit ihrem aufrüttelnden Tierroman »Black Beauty« schuf die englische Schriftstellerin Anna Sewell 1877 das große Vorbild aller modernen Pferdegeschichten – ein Muss!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Anna SewellBlack Beauty
Anna Sewell
BLACK BEAUTY
Roman
Aus dem Englischen neu übersetzt von Felix Mayer
Anaconda
Titel der englischen Originalausgabe: Black Beauty: his grooms and companions. The autobiography of a horse. Translated from the original equine, by Anna Sewell (London: Jarrold & Sons 1877).Textgrundlage dieser Übersetzung ist die Ausgabe London: Wordsworth 1993.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind imInternet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2011 Anaconda Verlag GmbH, KölnAlle Rechte vorbehalten.Umschlagmotiv: Johann Georg Hamilton (1672–1737),»A black horse performing the Courbette«, Kunsthistorisches Museum,Wien / bridgemanart.comUmschlaggestaltung: www.katjaholst.deLektorat: Dr. Jan Strümpel, GöttingeneISBN 978-3-7306-9100-7 ISBN [email protected]
Inhalt
KAPITEL EINS
KAPITEL ZWEI
KAPITEL DREI
KAPITEL VIER
KAPITEL FÜNF
KAPITEL SECHS
KAPITEL SIEBEN
KAPITEL ACHT
KAPITEL NEUN
KAPITEL ZEHN
KAPITEL ELF
KAPITEL ZWÖLF
KAPITEL DREIZEHN
KAPITEL VIERZEHN
KAPITEL FüNFZEHN
KAPITEL SECHZEHN
KAPITEL SIEBZEHN
KAPITEL ACHTZEHN
KAPITEL NEUNZEHN
KAPITEL ZWANZIG
KAPITEL EINUNDZWANZIG
KAPITEL ZWEIUNDZWANZIG
KAPITEL DREIUNDZWANZIG
KAPITEL VIERUNDZWANZIG
KAPITEL FÜNFUNDZWANZIG
KAPITEL SECHSUNDZWANZIG
KAPITEL SIEBENUNDZWANZIG
KAPITEL ACHTUNDZWANZIG
KAPITEL NEUNUNDZWANZIG
KAPITEL DREISSIG
KAPITEL EINUNDDREISSIG
KAPITEL ZWEIUNDDREISSIG
KAPITEL DREIUNDDREISSIG
KAPITEL VIERUNDDREISSIG
KAPITEL FÜNFUNDDREISSIG
KAPITEL SECHSUNDDREISSIG
KAPITEL SIEBENUNDDREISSIG
KAPITEL ACHTUNDDREISSIG
KAPITEL NEUNUNDDREISSIG
KAPITEL VIERZIG
KAPITEL EINUNDVIERZIG
KAPITEL ZWEIUNDVIERZIG
KAPITEL DREIUNDVIERZIG
KAPITEL VIERUNDVIERZIG
KAPITEL FÜNFUNDVIERZIG
KAPITEL SECHSUNDVIERZIG
KAPITEL SIEBENUNDVIERZIG
KAPITEL ACHTUNDVIERZIG
KAPITEL NEUNUNDVIERZIG
KAPITEL EINS
Mein erstes Zuhause
Der erste Ort, an den ich mich erinnern kann, ist eine große, behagliche Wiese, in deren Mitte ein Teich mit klarem Wasser lag. Am Ufer des Teichs standen einige Bäume und an seinem tiefen Ende wuchsen Schilfgras und Seerosen. Auf der einen Seite der Wiese konnten wir über eine Hecke auf einen gepflügten Acker sehen, auf der anderen über ein Gatter auf das Haus unseres Herrn, das an einer Straße stand. Oberhalb der Wiese lag ein Tannenwäldchen, und am unteren Ende, am Fuß einer steilen Böschung, floss ein Bach vorbei.
Als ich jung war, lebte ich von der Milch meiner Mutter, denn ich konnte noch kein Gras fressen. Tagsüber lief ich an ihrer Seite, und nachts lag ich eng an sie geschmiegt. Wenn es heiß war, standen wir im Schatten der Bäume am Ufer des Teichs, und für die kalten Tage hatten wir einen hübschen warmen Unterstand in der Nähe des Wäldchens.
Sobald ich alt genug war, Gras zu fressen, ging meine Mutter morgens weg, um zu arbeiten, und kam erst abends wieder.
Außer mir gab es noch sechs Fohlen auf der Weide, die alle älter waren als ich; manche waren schon fast so groß wie ausgewachsene Pferde. Ich tollte oft mit ihnen herum, und dabei hatten wir viel Spaß. Runde um Runde galoppierten wir zusammen um die Wiese, so schnell wir nur konnten. Manchmal ging es dabei ziemlich ruppig zu, denn die anderen galoppierten nicht nur, sondern bissen auch häufig oder schlugen aus.
Eines Tages, als sie besonders oft ausschlugen, wieherte meine Mutter zu mir herüber und rief mich zu sich. Dann sagte sie: »Ich möchte, dass du gut zuhörst bei dem, was ich dir jetzt sagen werde. Die Fohlen, die hier leben, sind alles prächtige Fohlen, aber es sind Arbeitspferde und daher ist es ganz normal, dass sie kein anständiges Benehmen gelernt haben.
Du hingegen bist aus guter Zucht und von guter Abstammung; dein Vater genießt hohes Ansehen hier in der Gegend und dein Großvater hat beim Rennen in Newmarket zweimal den Pokal geholt; deine Großmutter war das sanftmütigste Pferd, das ich je gekannt habe, und auch mich hast du wohl niemals ausschlagen oder beißen sehen.
Ich hoffe, dass du ein gutmütiges und braves Pferd wirst und dir nie schlechte Manieren angewöhnst. Sei mit ganzem Einsatz bei deiner Arbeit; hebe deine Füße ordentlich, wenn du trabst, beiße niemals und schlage nicht aus, auch nicht zum Spaß.«
Diese Ermahnungen meiner Mutter habe ich nie vergessen; sie war, wie ich wusste, ein kluges altes Pferd, und unser Herr hielt große Stücke auf sie. Ihr Name war Duchess, aber oftmals nannte er sie Pet.
Unser Herr war ein guter, freundlicher Mensch. Er gab uns ordentliches Futter, sorgte für gute Unterbringung und hatte immer nette Worte für uns; er sprach so einfühlsam mit uns wie mit seinen kleinen Kindern. Wir mochten ihn alle gern, und auch meine Mutter liebte ihn sehr. Wenn sie ihn am Gatter entdeckte, wieherte sie vor Freude und trabte zu ihm hinüber. Dann tätschelte und streichelte er sie und sagte: »Na, meine alte Pet, wie geht’s deinem kleinen Darkie?« Mein Fell war mattschwarz, daher nannte er mich Darkie.
Oft gab er mir ein Stück Brot, was mir ganz besonders schmeckte, und manchmal brachte er meiner Mutter eine Karotte mit. Auch die anderen Pferde scharten sich um ihn, aber ich glaube, uns hatte er am liebsten. Und an den Markttagen war es meine Mutter, die ihn in einem Gig, einem leichten Einspänner, in die Stadt brachte.
Einer der Ackerknechte, der Dick hieß, kam ab und zu auf unsere Weide, um Brombeeren von einer Hecke zu pflücken. Wenn er sich sattgegessen hatte, machte er sich, wie er es nannte, einen Spaß mit uns Fohlen, indem er Stöcke und Steine nach uns warf, damit wir losgaloppierten. Er störte uns nicht sonderlich, denn wir konnten ja vor ihm davonlaufen; aber manchmal wurden wir doch von einem Stein getroffen, und das tat weh.
Einmal war er wieder mit seinem Spiel beschäftigt, ohne zu wissen, dass unser Herr sich auf der angrenzenden Wiese aufhielt und von dort aus das Geschehen beobachtete. Im Nu war er über die Hecke gesprungen, packte Dick am Arm und versetzte ihm eine solche Ohrfeige, dass er vor Schmerz aufschrie. Kaum hatten wir unseren Herrn entdeckt, trabten wir näher, um zu sehen, was da vor sich ging.
»Du frecher Bengel«, schimpfte er, »du frecher Bengel! Jagd auf die Fohlen zu machen! Es ist nicht das erste Mal, dass du das tust, aber es wird das letzte Mal sein. Da, nimm deinen Lohn und verschwinde; lass dich nie wieder auf meinem Hof blicken.« Und so haben wir Dick nie wieder gesehen.
Der alte Daniel, der sich um die Pferde kümmerte, war ein ebenso liebenswürdiger Mensch wie unser Herr, und daher hatten wir es gut.
KAPITEL ZWEI
Die Jagd
Als ich noch keine zwei Jahre alt war, geschah etwas, das ich nie vergessen sollte.
Es war zu Anfang des Frühlings; in der Nacht zuvor hatte es leicht gefroren und über den Pflanzungen und Wiesen hing noch ein dünner Nebelschleier.
Als ich mit den anderen Fohlen im unteren Teil der Weide graste, hörten wir weit in der Ferne etwas, das wie Gekläff von Hunden klang.
Das älteste Fohlen hob den Kopf, spitzte die Ohren, rief: »Die Hunde kommen!« und preschte los; wir anderen folgten ihm hinauf ans obere Ende der Weide, von wo aus wir über die Hecke sehen konnten, hinter der sich etliche Felder erstreckten. Meine Mutter und ein altes Reitpferd unseres Herrn standen neben uns, und sie wussten offensichtlich, was es mit all dem auf sich hatte.
»Sie haben einen Hasen aufgespürt«, sagte meine Mutter, »und wenn sie hier entlang kommen, dann können wir die Jagd sehen.«
Kurz darauf rannten die Hunde allesamt durch ein Feld mit grünem Weizen neben unserer Wiese. Nie zuvor hatte ich solch ein Lärmen gehört. Es war kein Bellen und auch kein Jaulen oder Heulen, sondern sie belferten fortwährend mit voller Lautstärke: »Jo! Jo, o, o! Jo! Jo, o, o!« Eine Gruppe von Reitern folgte ihnen auf dem Fuß; manche von ihnen trugen grüne Jacken und alle galoppierten, so schnell sie konnten.
Das alte Pferd schnaubte und sah ihnen gespannt nach, und wir jungen Fohlen wollten ihnen hinterhergaloppieren, aber sie hatten schon die weiter unten liegenden Felder erreicht. Dort blieben sie allem Anschein nach stehen; die Hunde hörten auf zu bellen und stoben dann in alle Richtungen davon, die Schnauzen auf den Boden geheftet.
»Sie haben die Witterung verloren«, sagte das alte Pferd, »vielleicht kommt der Hase davon.«
»Welcher Hase?«, fragte ich.
»Nun ja, ich weiß nicht, welcher Hase genau; aber es kann gut sein, dass es einer von unseren aus der Pflanzung ist. Jeder Hase, der ihnen unterkommt, taugt den Hunden und Menschen zur Jagd.«
Schon bald fingen die Hunde wieder mit ihrem »Jo! Jo, o, o!« an, dann kamen sie alle zurückgerannt und hielten geradewegs auf unsere Wiese zu, auf die Stelle, wo unterhalb der hohen Böschung und der Hecke der Bach vorbeifloss.
»Jetzt sehen wir gleich den Hasen«, sagte meine Mutter, und genau in diesem Augenblick sauste ein Hase vorbei, außer sich vor Angst, und rannte auf die Pflanzung zu. Dahinter kamen die Hunde, gefolgt von den Jägern. Die Hunde stürzten die Böschung hinab, sprangen über das Wasser und jagten weiter über die Wiese. Sechs oder acht der Reiter setzten mit ihren Pferden geradewegs über Hecke und Bach und blieben den Hunden auf den Fersen. Der Hase versuchte, sich durch den Zaun zu zwängen, aber der war zu eng, und so machte er eine Kehrtwendung und rannte in Richtung Straße.
Aber ach, es war zu spät! Schon stürzten sich die Hunde mit wildem Gekläff auf ihn. Wir hörten ein Quieken, und das war das Ende des Hasen. Einer der Jäger ritt hinzu und vertrieb mit seiner Peitsche die Hunde, die den Hasen sonst noch in Stücke gerissen hätten. Der Jäger hielt ihn, zerfleischt und blutig, an den Läufen hoch, und die Herren wirkten alle sehr zufrieden.
Ich war über all das so verwundert, dass ich erst gar nicht bemerkte, was unten am Bach passierte; doch als ich hinübersah, bot sich mir ein trauriger Anblick. Zwei herrliche Pferde waren dort gestürzt, und jetzt versuchte das eine, sich aus dem Wasser aufzurappeln, während das andere stöhnend auf der Wiese lag. Einer der beiden Reiter kam, starrend vor Dreck, aus dem Wasser, der andere lag regungslos da.
»Er hat sich das Genick gebrochen«, sagte meine Mutter.
»Das geschieht ihm ganz recht«, erwiderte eines der Fohlen.
Ich war derselben Meinung, aber meine Mutter sah es anders.
»Nein«, sagte sie, »so dürft ihr nicht reden. Ich bin nun schon ein altes Pferd und habe so manches gehört und gesehen, aber ich habe nie begreifen können, weshalb die Menschen so auf diesen Sport versessen sind. Sie verletzen sich oft dabei, reiten tüchtige Pferde zuschanden und machen die Äcker kaputt; und all das nur wegen eines Hasen, eines Fuchses oder eines Hirschen, den sie auf andere Weise viel leichter erlegen könnten. Aber wir sind nur Pferde und verstehen das nicht.«
Während meine Mutter das sagte, verfolgten wir weiter das Geschehen. Viele der Reiter waren zu dem jungen Mann hingegangen, aber erst mein Herr, der den Vorfall beobachtet hatte, hob ihn auf. Sein Kopf fiel nach hinten und seine Arme hingen herab, und alle sahen sehr besorgt aus.
Kein Laut war mehr zu hören, selbst die Hunde schienen zu wissen, dass etwas nicht stimmte, und waren still. Man trug den Verletzten ins Haus unseres Herrn. Später erfuhr ich, dass der junge Mann George Gordon war, der einzige Sohn des Gutsherrn, ein schöner und großer Junge, der Stolz seiner Familie.
Dann ritten die Leute in alle Richtungen davon, zum Arzt, zum Pferdearzt und sicher auch zu Squire Gordon, um ihm von seinem Sohn zu berichten.
Der Pferdearzt Mr. Bond kam und untersuchte das schwarze Pferd, das stöhnend auf der Wiese lag. Er tastete es am ganzen Körper ab und schüttelte dann den Kopf – das Pferd hatte sich ein Bein gebrochen. Daraufhin lief jemand zum Haus unseres Herrn und kam mit einem Gewehr zurück. Wenig später waren ein lauter Knall und ein furchtbarer Schrei zu hören, dann war alles ruhig und das schwarze Pferd bewegte sich nicht mehr.
Meine Mutter wirkte sehr aufgewühlt. Sie erzählte uns, dass sie dieses Pferd schon seit Jahren kannte. Es hieß Rob Roy und war ein braves, tapferes Pferd ohne den geringsten Fehler. Sie ging danach nie wieder zu jenem Teil der Wiese.
Einige Tage später hörten wir, wie die Kirchenglocke lange läutete, und als wir über das Gatter schauten, sahen wir eine langgestreckte, seltsame schwarze Kutsche, die mit schwarzem Stoff behängt war und von schwarzen Pferden gezogen wurde. Danach kam noch eine, und noch eine, und noch eine; alle waren sie schwarz. Und die Glocke läutete und läutete. Sie brachten den jungen Gordon zum Friedhof, um ihn dort zu begraben. Er würde nie wieder reiten. Was sie mit Rob Roy gemacht haben, weiß ich nicht, aber all das geschah nur wegen eines kleinen Hasen.
KAPITEL DREI
Das Einreiten
Allmählich wuchs ich zu einem stattlichen Pferd heran; mein Fell war weich und schmiegsam geworden und glänzte schwarz. An einem meiner Füße aber war es weiß, und ich hatte auch einen hübschen weißen Stern auf der Stirn. Die Leute fanden mich sehr ansehnlich. Mein Herr wollte mich nicht verkaufen, bevor ich vier Jahre alt war; er sagte, dass Jungen nicht wie Männer arbeiten sollten und Fohlen nicht wie Pferde, bis sie richtig ausgewachsen waren.
Als ich vier war, kam Squire Gordon, um mich zu begutachten. Er untersuchte meine Augen und mein Maul und tastete meine Beine bis ganz unten ab. Dann musste ich vor ihm in Schritt, Trab und Galopp laufen. Ich schien ihm zu gefallen und er sagte: »Wenn er gehörig eingeritten ist, wird er ein sehr gutes Pferd sein.« Mein Herr kündigte an, er werde mich selbst einreiten, weil er nicht wollte, dass man mich dabei scheu machte oder verletzte. Er verlor auch keine Zeit damit, und so begann das Einreiten schon am nächsten Tag.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!