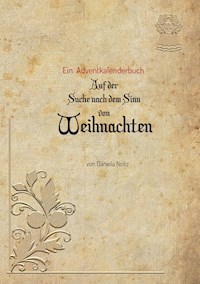Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Anonym mit dem Untertitel Begegnungen ist eine Sammlung von eher obskuren Geschichten. Namengebend ist die erste Geschichte, in der ein anonymer Brief auftaucht. Wie die Protagonist*innen darauf reagieren entscheidet über den Fortgang. Oder wäre es sowieso so gekommen, wie es gekommen ist, egal, was sie tun? Was wir tun oder auch unterlassen, hat einen Einfluss. Wie groß dieser ist, kann man oft erst im Nachhinein beurteilen. Dennoch müssen wir Entscheidungen treffen, die auf unzureichenden Informationen beruhen. Wir urteilen aufgrund der Gefühlslage, des Wissenstandes im Moment der Tat. Oder auch Unterlassung. Wie es sich auswirkt müssen wir abwarten. Vor allem löst unsere Aktion eine Reaktion aus. So wichtig wir uns auch immer nehmen wollen, auf diese haben wir keinen Einfluss. Die Geschichte geht ihren Gang und dieser wird bestimmt durch eine Verkettung von Vorkommnissen. Wer kann im Nachhinein sagen, was dazu führte. Schuld ist schnell zugesprochen, wenn man ein singuläres Ereignis aus der Kette herausgreift. Anonym ist der Großteil an Dingen, die nicht in unserem Einflussbereich liegen. Sie liegen oft auch außerhalb unserer Wahrnehmung. Es kommt natürlich durchaus auch vor, dass wir bewusst Teile nicht wahrnehmen, die nicht in unser Weltbild passen. Dabei handelt es sich um solche, die nicht passen und nicht passend gemacht werden können. Unvoreingenommenheit, sich zusprechen lassen und die Wahrheit annehmen, das ist auch eine der Botschaften dieser Geschichten. Erwachsen sein, heißt damit umgehen können, dass nicht alles in unserer Sicht auf die Welt stimmig ist. Es zu verleugnen, macht es nicht besser. Ganz im Gegenteil Wir werden immer weniger verstehen. Die Geschichten in Anonym sind auch ein Plädoyer für Offenheit. Ebenso wie Gelassenheit gegenüber dem, was wir selbst nicht beeinflussen können. Klug ist, wer unterscheiden kann zwischen dem Unbeeinflussbaren und dem, was der Moment von uns fordert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
Anonym
Regen
Vergessen
Dia.log
Der Übersetzer
Adele feiert Begräbnis
Über Dich und andere Absurditäten
Begegnungen
Der Antrag
Und schuld war nur das Eis
Eine missglückte Entführung
Was man nicht halten kann, muss man loslassen
Das Geständnis
Das Drama mit dem „Happy End“
Weitere Bücher der Autorin
Anonym
„Schau mal, was ich heute im Briefkasten gefunden habe“, sagtest Du wie nebenbei, während ein weißer, länglicher Umschlag in meinem Schoß landete. Langsam legte ich mein Buch zur Seite und warf einen Blick darauf.
„Dass Du überhaupt den Briefkasten gefunden hast“, erwiderte ich sarkastisch, „Du warst doch sicherlich seit Ewigkeiten nicht mehr dort.“
„Wozu auch? Es schreibt doch heutzutage keiner mehr Briefe, so richtig mit der Hand und mit Adresse am Briefumschlag und Briefmarke“, merktest Du lächelnd an, „Aber heute hatte ich so ein Gefühl, dass da was drinnen sein könnte. Ich meine, es ist ja oft was drinnen, in dem Briefkasten, aber lauter nutzloses Zeug, doch heute, da war es dieser Brief ...“
„Und man sieht, dass Du ihn gefunden hast, so wie
Du in malträtiert hast“, meinte ich mit einem Blick auf die ausgefransten Ränder, „Du hast ihn einfach aufgerissen. Du und Deine Ungeduld, Deine Neugierde.“
„Da redet sie mal wieder groß! Hast Du einen Brieföffner eingesteckt?“, fragtest Du.
„Nein, habe ich nicht, aber ich für meinen Teil bin durchaus in der Lage einen Brief so lange ungeöffnet zu lassen, bis ich zu meinem Schreibtisch komme und dort meinen Brieföffner verwende“, entgegnete ich lapidar.
„Du kannst da gar nicht mitreden, weil Du keine Briefe bekommst!“, sagtest Du spöttisch. Du kamst mir vor wie eine Tennisspielerin mitten in einem Doppel beim Netz, und ich spielte Dir den Ball direkt auf den Schläger, so dass Du locker parieren konntest.
„Und was soll ich mit dem Brief?“, fragte ich ausweichend, während ich den Umschlag näher betrachtete. Die Handschrift war eckig und hart, aber zumindest sehr gut leserlich.
„Denkst Du auch, dass er von einem Mann ist?“, lenktest Du ab.
„Es sieht danach aus, aber mit Handschriften habe ich nichts am Hut. Ich bin ja schon froh, wenn es leserlich ist“, entgegnete ich, „Aber was soll ich machen damit?“
„Lesen!“, meintest Du, und es klang ein wenig genervt. Ich nahm das Blatt also aus dem Umschlag.
Das wird was Aufregendes sein, dachte ich, während ich es auseinanderfaltete. „Oha, ein Dichter“, entfuhr es mir unwillkürlich.
„Oder eine Dichterin!“, schobst Du ein, „Halt Dich doch nicht so lange mit Nebensächlichkeiten auf und lies.“
„Ein kurzes, heftiges Liebesgedicht. Gut formuliert, eindringlich, ohne schmalzig zu sein“, gab ich meine Meinung ab, „Da hast Du Dir einen Verehrer eingefangen. Wer ist es? Verrat es endlich!“
„Genau das ist der Punkt“, erklärtest Du ernst, „Ich weiß es nicht wer das geschrieben hat. Es ist ja nicht unterzeichnet. Aber seinen Worten nach klingt das, als würden wir uns schon ewig kennen.“
„Ja, das stimmt, und Du hast wirklich keine Idee?“, sagte ich ernst. Resigniert schütteltest Du den Kopf.
War es Feigheit sich in der Anonymität zu verschanzen? Oder war es einfach ein Versehen?
Vielleicht war der Schreiber auch bloß nicht ganz richtig im Kopf? Natürlich, es waren schmeichelnde Zeilen, die wohltaten, aber taten sie das auch noch, wenn man wusste, dass man eigentlich nicht gemeint war, sondern irgendwer anderer oder bloß ein Hirngespinst? Könnte das nicht nach hinten los gehen? Was würde sein, wenn sich der Schreiber getäuscht fand? Würde er es auf seine eigene Täuschung zurückführen oder behaupten, sie wäre von Dir ausgegangen?
Bedächtig faltete ich das Blatt zusammen und schob es zurück in den Umschlag. „Egal was Du vorhast, sei vorsichtig. Das kann auch noch ins Gegenteil umschlagen“, merkte ich ernst an.
„Ach was, ich habe einen Verehrer und Du missgönnst ihn mir oder sie. Gib es zu, Du bist bloß eifersüchtig!“, sagtest Du in Deiner gekonnt leichtfertigen Art.
„Ich wünschte, Du hättest recht“, gab ich düster zurück.
Bereits zwei Tage später kam der nächste Brief, der nicht mehr ganz so nett war. Sollte ich wirklich recht behalten?
* * *
Nachdenklich sah ich Dir zu, wie Du Dich mit dem Brief in der Hand vor den Kamin setztest.
Eifersüchtig? Auf Dich? Meine wunderschöne, heitere, kleine Schwester?
Ja, man könnte meinen, dass Eifersucht mit im Spiel war. Zehn Jahre warst Du jünger als ich. Und diese Jugend, voll Freude und Feuer, trugst Du wie ein Schild vor Dir her. Anmutig warfst Du Dein blondes, langes Haar zurück. Die blauen Augen blitzten. Mit Deinen knapp zwanzig Jahren hattest Du tatsächlich noch alles vor Dir. Du standest am Anfang. Nicht, dass ich meinte, dass man mit dreißig schon alt wäre, aber ich, ich kam mir alt vor. Ich war müde von diesen dreißig Jahren Leben, und bei Dir wirkte es, als hättest Du Dich zwanzig Jahre vorbereitet, um nun zu beginnen. So lange ich Dich kannte, warst Du immer diejenige, die im Mittelpunkt stand, die die Herzen der Menschen zu verzaubern vermochte. Ich kannte niemanden, der sich Deiner Anmut und Heiterkeit zu entziehen vermochte.
Auch ich nicht. Ich liebte Dich, und hatte darüber hinaus auch noch das große Glück, dass Du meine Schwester warst.
Marlene war der Name, den Du Dir als Künstlernamen auserkoren hattest. Dein Taufname war Marlies, aber das war Dir wohl zu bieder.
Marlene, ein Name, bei dem unweigerlich die Erinnerung an die große Marlene Dietrich mitschwingt. Darstellende Künstlerin warst Du.
Manchmal dachte ich insgeheim, dass Du wohl wirklich eine Darstellerin warst, eine Lebensdarstellerin, aber darin warst Du wahrhaftig eine Künstlerin. Es war mir noch niemand begegnet, der es Dir hierin gleichtun konnte. Darstellende Künstlerin und Muse, das warst Du gerade. Du hattest noch nicht viel unternommen in Deinem jungen Leben, aber was Du unternommen hattest, das war gelungen. Vor Dir öffneten sich die Türen, die Du durchschreiten wolltest, als hättest Du diese mit zauberträchtigem Feenstaub bestreut.
„Ich werde Dich Glöckchen nennen“, sagte ich unvermittelt. Du wandtest mir Dein schmales Gesicht zu, das vor Aufregung strahlte.
„Wieso das?“, fragtest Du irritiert.
„Weil Du mich an die kleine Fee Peter Pans erinnerst“, erklärte ich Dir, woraufhin Du auf mich zugeflogen kamst und Dich auf die Couch warfst. Ich konnte gerade noch mein Buch vor Dir retten.
„Ach, meine süße, traurige Beatrice. Du tust mir so gut. Du bringst Ruhe in mein Leben“, sagtest Du, und trotz aller Positivität klang es in meinen Ohren wie ein Vorwurf.
„Eigentlich heiße ich Beatrix, und Du wirst meiner wohl bald überdrüssig sein. Es wird nicht lange dauern, und Du wirst Dich langweilen“, entgegnete ich ernst.
„Wie könnte ich? Niemals werde ich Deiner überdrüssig. Du bist der Ruhepol in meinem Leben.
Zu Dir kann ich immer zurückkommen“, entgegnetest Du verhalten.
„Eher Ruhekissen, auf dem man einen langen, traumlosen Schlaf verbringt. Du bist ein Kind, ein verspieltes, glückliches Kind“, sagte ich nachdenklich, „Ich hoffe, Du wirst noch lange in diesem Glück bleiben dürfen, aber das Leben kann auch ganz anders sein.“
„Das weiß ich doch!“, entgegnetest Du mit Überzeugung, „Und Du, Du siehst immer alles viel zu schwarz. Kein Wunder, ist ja auch an Dir alles schwarz. Mach doch mal ein bisschen Farbe in Dein Gesicht oder Deine Kleidung. Du wirst Dich gleich ganz anders fühlen. Aber vielleicht liest Du einfach nur zu viel, alles so abgründig und so voll schwerer Gedanken. Das macht Dir den Kopf düster und dann ist es klar, dass Du nicht mehr fliegen kannst.“
„Süße kleine Marlene, Farbe und ich, das verträgt sich nicht. Natürlich weißt Du, dass es auch anders sein kann, aber Du hast es noch nicht erlebt, das ist der Unterschied. Hättest Du erlebt, was ich erlebt habe ...“. doch ich brach ab. Es war nicht notwendig.
„Lassen wir es, und Dich in Deinem glücksverklärten Zustand. Alles wird gut für Dich.
Dafür werde ich sorgen.“ Gedankenverloren strich ich mit der Hand durch Dein seidiges Haar.
„Dafür werde ich sorgen. Niemand und nichts wird Dir weh tun“, fügte ich hinzu. Vielleicht war es härter ausgefallen, als ich wollte, denn Du setztest Dich ruckartig auf.
„Du machst mir Angst!“, sagtest Du schlicht.
„Das tut mir leid. Sei ruhig! Alles ist gut und bleibt es für Dich“, erklärte ich so sanft wie möglich.
Ja, vielleicht könnte man meinen, dass ich eifersüchtig war, denn ich war ein Schatten neben Dir, kleiner, bunter Schmetterling mit den glänzenden und so verletzlichen Flügeln.
„Hast Du wieder einen Brief bekommen?“, fragte ich.
„Ja!“, bestätigtest Du, „Und Du wirst sehen, er wird genau so nett sein wie der erste.“
* * *
Der zweite anonyme Brief wies die gleiche Handschrift auf. Es war wohl davon auszugehen, dass er vom selben Verfasser stammte. Allerdings, es wurden nur mehr so wenige Briefe geschrieben, und unter diesen musste wohl der Anteil der anonymen verschwindend sein, so dass ich daraus schloss, es wäre beinahe unmöglich von zwei verschiedenen Verfassern innerhalb von drei Tagen einen anonymen Brief zu erhalten. Vielleicht hattest Du recht und ich las tatsächlich zu viel, aber in all den Geschichten, die ich kannte, waren anonyme Briefe immer ein Vorspiel zu einer großen Tragödie.
Wäre es denn denkbar, dass ein anonymer Wohltäter die Lebensumstände seiner Adressaten auskundschaftete, um sie dann mit motivierenden, aufbauenden, anteilnehmenden Botschaften zu versorgen?
Der Hund der Frau, die im obersten Stockwerk wohnte, war überfahren worden. Niemand kümmerte sich darum, weil sie mit niemandem sprach, aber am nächsten Tag war da ein anonymer Brief gekommen, der wie folgt lautete:
„Liebe Frau K.!
Anhänglich und treu ist der Hund als Gefährte des Menschen. Gestern wurde Ihr Hund überfahren. Ich kann Ihren tiefen Schmerz nachvollziehen. Allein und einsam bleiben Sie zurück, doch Sie können einem anderen Lebewesen helfen. Unten am Fluss wurden zwei Welpen ausgesetzt. In Gedenken an Ihren Struppi, nehmen Sie sich ihrer an.
Mein herzlichstes Beileid, ein Freund.“
Und die Frau würde zum Fluss gehen und die Welpen finden und sich ihrer annehmen. Sie hätte wieder eine Aufgabe und würde den Verlust von Struppi verwinden. Darüber hinaus würden sich noch die Nachbarskinder mit ihr anfreunden. Die Eltern würden entdecken, dass Frau K. keine Hexe ist, sondern gut als Leihomi geeignet oder wozu auch immer.
Es wäre eine positive Geschichte. Nein, so etwas gibt es nicht. Wenn jemand schon so viel Energie investiert, dann in nichts Gutes. Die Motivation, seinen Mitmenschen Böses anzutun, ist weitaus größer als das Gegenteil. Ich durfte mir da nichts vormachen. Natürlich könnte man darüber nachdenken, was alles Positives geschehen könnte, würden diese Kräfte anderweitig eingesetzt, aber es war ein müßiger Gedankengang, denn das würde nur passieren, wenn der Mensch nicht mehr der Mensch wäre, der er war.
„Also, was steht in Deinem Brief?“, fragte ich ruhig.
„Ich weiß es noch nicht. Ich musste doch zuerst Deinen Brieföffner holen“, sagtest Du lächelnd, und tatsächlich konnte ich beobachten, wie Du den Brieföffner sorgfältig anwendetest.
„So ist es viel besser“, konnte ich mir nicht verkneifen anzumerken, während Du langsam den Brief aus dem Umschlag befördertest. Rasch überflogen Deine Augen die wenigen Zeilen, die noch immer in Gedichtform angeordnet waren. Dein Lächeln schwand und eine ungekannte Blässe überzog Dein Gesicht, als Du mir endlich den Zettel hinhieltst.
„Ich habe es geahnt“, sagte ich leise, nachdem ich die wenigen Zeilen überflogen hatte, „Ich denke, es wird Zeit, dem ein Ende zu bereiten.“
„Aber warum ist er denn plötzlich so gemein zu mir?“, fragtest Du ratlos.
„Weil er Dich für jemanden hält, der Du nicht bist.
Offenbar liebt er diese andere Person, doch sie hat ihn enttäuscht. Vielleicht ist sie auch nur eine Fiktion, aber dieses Schreiben beinhaltet eine unverhohlene Drohung. Ich werde das nicht einfach hinnehmen. Ich habe gesagt, dass ich Dich beschütze, und das tue ich“, entgegnete ich überzeugt.
„Was hast Du vor?“, fragtest Du bang.
„Mach Dir keine Sorgen und misch Dich nicht ein.
Verbrenn den Brief am besten im Kamin“, schlug ich vor, „Und lass mich einfach tun, was ich zu tun habe.“
* * *
Niemand darf meiner kleinen, süßen Schwester weh tun.
Viel zu lange hatte ich Dich alleine gelassen. Jetzt würde ich bleiben, zumindest in Deiner Nähe, denn ich war mir sicher, dass Du in die Stadt gehörtest und nicht hier aufs platte Land, in einen Ort mit gerade mal zehn Häusern und zwei Gaststätten.
Dein Platz war dort, wo das Leben pulsierte. Die Liebe würde Dich treffen, wie mich damals. Nur Du würdest nicht davor davonlaufen, sondern sie mit beiden Händen ergreifen, so wie Du das Leben mit offenen Armen empfingst, sie Dir füllen ließt, als gäbe es kein Morgen. Und vielleicht sollte man es auch so halten, den Moment ausschöpfen bis zur Neige.
„Ich werde mich ein wenig zurechtmachen“, sagtest
Du leichthin, und der Brief schien völlig vergessen, der Brief, den ich noch immer in Händen hielt.
Langsam legte ich ihn weg und griff nach meinem Buch.
„Gehst Du noch fort? Hast Du etwas vor heute Abend?“, fragte ich wie nebenbei, eigentlich schon wieder in der Lektüre verloren, doch nicht so sehr wie sonst.
Warum eigentlich war ich damals weggegangen? Wie hatte ich das nur fertiggebracht? Damals, Dich alleine zu lassen, Hals über Kopf, gedankenlos, aber ich war auf der Flucht vor etwas, das mich sonst erdrückt hätte, dachte ich zumindest. Zehn Jahre musste ich in Irland verbringen, bevor ich den Weg zurückfand. Es waren zumindest keine schlechten Jahre, aber Du, letztendlich warst Du auf Dich alleingestellt. Natürlich, Du warst gut aufgehoben, in dem Internat während der Schulzeit, und den Sommer und die anderen Ferien verbrachtest Du bei mir auf der grünen Insel, aber letztendlich hatte ich Dich doch abgeschoben, um mein eigenes Leben zu leben.
Dabei war das, was ich mein eigenes Leben nannte, nichts weiter als eine Fata Morgana, eine Täuschung. Zehn Jahre verwendete ich darauf, sie zu fassen, zehn Jahre, bis ich es endlich einsah. Dann erst hatte ich die Kraft zurückzukehren, auch zu Dir.
Ich hatte Dich um Verzeihung gebeten. Du meintest nur, dass es nichts zu verzeihen gäbe. Und ich musste zugeben, dass Du recht hattest, denn das, was ich Dir angetan hatte, das konnte man nicht verzeihen. Dachtest Du noch daran? Du warst so teilnahmslos dem allem gegenüber, dass ich es nicht auszusprechen vermochte. Die Schuld blieb. Aber hatte ich denn eine Wahl gehabt?
Ein schneidendes Geräusch riss mich aus meinen Gedanken.
„Machst Du auf?“, hörte ich aus dem Badezimmer rufen, „Das muss Pünktchen sein. Sag ihm, ich bin in Null Komma Nichts fertig.“ Und während ich noch an Pünktchen und Anton dachte, ging ich zur Türe.
„Wer bitte heißt Pünktchen?“, fragte ich leichthin.
„Eigentlich nennt er sich ‚Le Point Noir’. Du weißt schon, wegen der Eigenart seine Bilder mit einem schwarzen Punkt zu signieren. Du hast sicher von ihm gehört“, tönte es wiederum aus dem Badezimmer, „Er will mich malen, hat er gesagt. Ich bin seine Muse.“ Ein helles Lachen begleitete Deine Worte, als wäre es ein guter Scherz, den er gemacht hatte. Aber wer hätte nicht von ihm gehört? Seit einigen Wochen war sein Name in aller Munde. Er wurde schon als der neue Picasso gehandelt, doch leider war es nur sein Name, der durch die Medien ging. Könnte auch sein, dass ich auf Bilder von ihm nicht geachtet hatte. Hätte ich es getan, ich wäre vorbereitet gewesen.
„Martin? Du?“, fragte ich, und meine Stimme trug sie weiter, meine Unruhe, meine Angst, während jener Abend neu vor meinen Augen erstand. Nasskalt und dunkel war es gewesen, an diesem 11. November vor nunmehr über zehn Jahren. Ich sah mich stehen, an dem Ort, an dem wir uns verabredet hatten, doch Du kamst nicht. Zwei Stunden hatte ich auf Dich gewartet, und dann fasste ich einen Entschluss. Ich ging weg und wollte nie mehr wieder kommen.
Doch jetzt, wo er wieder vor mir stand, jetzt war es mir, als wäre der 12. November vor zehn Jahren.
Gerade mal eine Nacht lag dazwischen, schien es mir, was mir im Durchleben wie eine Ewigkeit erschienen war.
* * *
An jenem 11. November vor nunmehr immerhin zehn Jahren war es geschehen, und doch durchströmte mich dieselbe Wärme, die ich damals in seiner Gegenwart verspürt hatte. Das durfte nicht sein. Aber dann sah ich, dass die Sonne gerade unterging, die Nacht sich ankündigte. Es war die Zeit, zu der ich besonders zugänglich war für emotionale Schwingungen. Ich schob es auf diesen Umstand, um mir nicht eingestehen zu müssen, dass er mich noch immer anrührte. Eigentlich sollte ich nicht Wärme verspüren, sondern Wut.
„Warum hast Du mich damals einfach so sitzen gelassen?“, hätte ich fragen können, wollte ihm vorgaukeln, es wäre mir egal. Ihm, aber auch mir.
Und wozu auch noch fragen? Wozu in alten Wunden wühlen? Ich kannte ja den Grund. Er war schlicht und einfach feig gewesen. Letztendlich hatte eine andere Frau mehr Einfluss auf ihn gehabt als ich, nämlich seine Mutter. Bitterkeit sollte sich eigentlich in mir ausbreiten, aber es geschah nicht.
Was blieb, war nur die Wärme.
An der Bushaltestelle wollten wir uns treffen, um miteinander durchzubrennen. Ich war so aufgeregt, dass ich zwei Stunden zu früh dort war. Still saß ich in der hinteren Ecke des Wartehäuschens, den Skizzenblock in der Hand. Ich wartete gerne, und während ich mit dem Stift in der Hand über das Papier strich, stellte ich mir unser zukünftiges Leben vor. Natürlich, es würde nicht einfach werden, aber wir waren jung und mutig. Das Leben lag vor uns wie ein unberührtes Feld, das nur darauf wartete von uns bearbeitet zu werden, so dass die herrlichsten Früchte wachsen würden. Ich hatte niemanden mehr, der auf meine Entscheidung hätte Einfluss nehmen können, außer Marlies, doch ich redete mir ein, sie sei in guten Händen, jetzt, da unsere Eltern nicht mehr da waren. Doch Martin, er hatte zu kämpfen. Seine Mutter war gegen unsere Verbindung. Zu düster, zu extravagant war ich für sie. Und das Bild, das ich bot, bestätigte wohl ihre Ansicht, aber disqualifizierte mich das automatisch als Gefährtin für ihren Sohn? Alles war vorbereitet gewesen. Die Papiere waren vollständig, so dass wir sofort heiraten hätten können. Ich ertappte mich dabei, dass mir fast ein Lächeln ausgekommen wäre bei dem Gedanken daran wie zuvorkommend er mich behandelt hatte.
„Es soll alles seine Ordnung haben, und ich möchte, dass Du weißt, dass ich immer zu Dir stehe. Wir gehören zusammen“, das waren seine Worte, und dann kam der verabredete Zeitpunkt, doch wer nicht erschien war Martin.
Ich wartete. Es begann zu regnen. Wilde Blitze zuckten über den Himmel, doch ich wartete. Erst als der Morgen graute, stieg ich in den Bus und fuhr weg um einen anderen zu heiraten. Weit weg wollte ich. Niemals wieder würde ich zurückkommen, mir niemals wieder weh tun lassen, das war mein Plan, und während der nächsten zehn Jahre schaffte ich es tatsächlich, diesen Plan durchzuhalten.
„Was machst Du denn hier?“, fragte Martin verdutzt.
„Ich wohne hier“, gab ich lapidar zurück, „Und Du, was machst Du hier?“
„Ich wollte eigentlich zu Marlene“, entgegnete er, immer noch verwirrt.
„Marlene ist meine Schwester“, erwiderte ich kühl.
„Aber das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht wahr“, murmelte er vor sich hin, als Du endlich kamst und Martin umarmtest. Er hingegen, er erwiderte die herzliche Begrüßung nicht. Irritiert sahst Du zuerst ihn, dann mich an.
„Kennt ihr euch etwa?“, fragtest Du stirnrunzelnd, doch wie auf ein geheimes Zeichen hin, verneinten wir beide. Du schienst nicht restlos überzeugt, aber
Du warst nicht der Mensch, der sich lange Gedanken über etwas machte.
„Na, dann wollen wir aufbrechen“, sagtest Du, voll unverhohlener Fröhlichkeit.
„Ich wünsche Euch viel Spaß!“, hörte ich mich noch erwidern. Dann fiel die Türe ins Schloss. Langsam ging ich zurück ins Wohnzimmer und ließ mich auf die Couch fallen.
„Warum nur hast Du mir das angetan, meine eigene Schwester?“, fragte ich mich, „Aber nein, Du weißt es nicht, kannst es nicht wissen.“
* * *
Ich saß auf der Couch und beobachtete, wie die Nacht hereinbrach. Starr sah ich aus dem Fenster.
Nichts denken, bloß nichts denken, denn meine Gedanken zogen sich bedrohlich wie eine Gewitterwolke um einen Punkt zusammen.
„Ist ja alles gut, Babu“, sagte ich leise und beschwichtigend, als sich mein kleiner schwarzer Hund zu mir legte, die Schnauze auf meine Oberschenkel bettend. Doch wem wollte ich etwas vorgaukeln? Einem Menschen gegenüber war es leicht, so zu tun als ob, doch dieser kleine Hund, dem konnte ich nichts vormachen. Er ließ mich reden und machte sich doch nichts aus meinen Worten, die meinem Gemütszustand so sehr zuwiderliefen. Da klopfte es abermals an der Türe.
„Hast Du was vergessen, Marlies?“, fragte ich, während ich die Türe öffnete, doch da stand nicht Marlies, sondern mein eigenes Spiegelbild. Ich wusste nicht ob ich meinen Augen trauen konnte.
Babu, der mich zur Türe begleitet hatte, musste es ähnlich ergehen, denn neben der Frau, die genauso angezogen war wie ich, die gleiche Frisur hatte und sogar die obligatorischen Handschuhe trug, stand ein schwarzer Hund, der Babu zum Verwechseln ähnlichsah. Ruhig und vorsichtig beschnüffelten sich die beiden. Zumindest die Hunde waren sich schnell einig und trollten sich in den Garten.
„Guten Abend, Frau O’Fallon!“, grüßte sie höflich.
„Guten Abend, Frau ....“, kam es stotternd, „Es tut mir leid, aber ich kenne Ihren Namen nicht.“
„O’Neill, Clara O’Neill“, half sie mir aus, „Ich bin Ihre neue Nachbarin von gegenüber.“
Automatisch folgte mein Blick der Richtung, in die ihr Finger wies, doch da war nur ein Hügel. Wobei das mit der Nachbarschaft in diesem kleinen Ort im Waldviertel ein dehnbarer Begriff war, da die wenigen Häuser, die es hier gab, weit voneinander entfernt standen, getrennt durch das, was hier noch im Überfluss vorhanden war, Platz. Äcker und Felder, Wiesen und Wälder, das war es, was hier das Landschaftsbild bestimmte. Dazwischen wirkten die einzelnen Häuser und Höfe wie verloren.
„Ich wusste gar nicht ...“, murmelte ich sinnend.
„... dass jemand eingezogen ist? Ja, das ist auch nicht schwer“, sagte die Unbekannte ernst, „Obwohl, eigentlich kann man hier nichts geheim halten.
Irgendjemand sieht immer irgendwas und trägt es ins Wirtshaus. So sind die Menschen.“
„Ja, im Wirtshaus, da hätte ich es erfahren können, wenn ich denn hinginge“, sagte ich kryptisch, „Sie sind Irin? Oder haben Sie auch bloß einen Iren geheiratet?“
„Nein, ich bin Irin“, entgegnete sie, „Aber bis auf das, dass es hier kälter ist als in der Heimat, fühlt man sich doch gut aufgehoben, von der Weite und der Ruhe.“
„Wenn man das will“, merkte ich an, als mir endlich auffiel, wie unhöflich ich erscheinen musste,
„Wollen Sie vielleicht hereinkommen? Auf einen Tee oder einen Whiskey oder beides?“
„Oder beides klingt gut“, nahm sie meine Einladung an und folgte mir ins Wohnzimmer, wo ich ihr einen Platz auf der Couch anbot, während ich in die Küche ging, um den Tee zuzubereiten.
„Das duftet aber herrlich“, sagte sie höflich.
„Ich trinke sehr gerne Tee, aber zumeist alleine“, entgegnete ich, „Möchten Sie Zucker?“
„Ach ja, gerne“, antwortete die neue Nachbarin.
„Ich merke gerade, ich habe den Zucker vergessen“, sagte ich, verärgert über meine eigene Vergesslichkeit und ging, um den Zucker zu holen.
Kurz darauf war ich wieder im Wohnzimmer. „Hier bitte!“, sagte ich, und reichte ihr den Zucker. „Wann sagten Sie, sind Sie hierhergezogen?“
„Ich hatte noch gar nichts gesagt“, entgegnete Clara O’Neill, „Vor sechs Monaten, kurz bevor Ihr Mann starb. Sie müssen wissen, ich kannte ihn. Sie haben ihn mir weggenommen. Nichts haben Sie gemerkt, und nun, wo Sie es wissen, müssen Sie es für sich behalten.“
„Natürlich“, bestätigte ich irritiert. Das war nicht schwer, schließlich wusste ich niemanden, dem ich es hätte erzählen können.
„Ich bin mir sicher, dass Sie niemandem mehr etwas erzählen werden“, merkte Clara O’Neill an, während mir schwarz vor Augen wurde. War da was im Tee gewesen?
* * *
Du warst nicht nach Hause gekommen, die ganze Nacht warst Du nicht nach Hause gekommen. Ich war zu Bett gegangen. Seltsam, der Hund der Nachbarin war hiergeblieben. Ich fand die beiden Vierbeiner, nahe beieinander, schlafend. Sie hatten sich offenbar müde gespielt, so müde, dass sie nicht einmal mehr Hunger verspürt hatten. Morgen würde ich ihn zurückbringen, dachte ich. Als ich am Vormittag aufstand, warst Du immer noch nicht da, aber Du warst jung und tatendurstig. Ich dachte mir nicht viel dabei. Erst am frühen Nachmittag, als es an der Haustüre klopfte, dachte ich zunächst, Du wärst es. Aber warum klopftest Du? Du hattest wahrscheinlich bloß Deinen Schlüssel vergessen, doch da stand ein Mann vor der Türe, ein großer, starker Mann. Schwerfällig wirkte er.
„Frau O’Fallon?“, sagte er, und sah mich fragend an.
„Ja, die bin ich“, bestätigte ich. Nicht mehr. Sah ihn an, wartend.
„Chefinspektor Max Krämer. Darf ich reinkommen?“, fragte er, während er mir seine Dienstmarke unter die Nase hielt. Es würde wohl seine Ordnung haben, war ich überzeugt. Doch hätte ich eine gefälschte Dienstmarke überhaupt als solche erkannt? Ach was, rief ich mich selbst zur Ordnung, so etwas gibt es doch nur in schlechten Kriminalromanen.
„Setzen Sie sich bitte“, bot ich dem Chefinspektor an, nachdem ich ihn ins Wohnzimmer geleitet hatte, und er kam meiner Aufforderung nach.
„Ich möchte nicht um den heißen Brei herumreden“, begann er zu berichten, „Ihre Schwester, Marlies Merkado, ist heute Nacht ermordet worden.“
Ein kurzer Satz, aber ich war wie betäubt.
„Das ist doch nicht möglich ... Wer sollte denn ... Wer hätte denn ... Was ist passiert?“, stammelte ich, unzusammenhängend, verdattert.
„Es ist ganz eindeutig. Ich muss Sie nun bitten mir zu sagen, wo Sie letzte Nacht gewesen sind“, fuhr Chefinspektor Krämer ruhig fort.
„Ich war hier“, antwortete ich kurz und tonlos.
„Kann das jemand bezeugen?“, fragte er.
„Sie meinen außer dem Hund?“, bemerkte ich sarkastisch, „Nein, ich fürchte nicht.“
„Kam niemand vorbei oder auf Besuch?“, bohrte er unbeirrt weiter.
„Die Nachbarin, ja, die Nachbarin mit ihrem Hund, die war einen Sprung da, um mit mir Tee zu trinken“, fiel mir ein, „und sie hat ihren Hund vergessen.“
Als wenn sie auf ihr Stichwort gewartet hatten, kamen plötzlich zwei kleine schwarze Hunde ins Wohnzimmer und auf mich zugestürmt.
„Das ist also Ihr Hund und der der Nachbarin?“, fragte der Chefinspektor.
„Ja, sieht sehr nach Hund aus“, bemerkte ich trocken.
„Ihr Sarkasmus wird Ihnen schon noch vergehen“, meinte der Chefinspektor, „Sie stehen immerhin unter Mordverdacht!“
„Was heißt ich stehe unter Mordverdacht? Sie glauben doch nicht im Ernst, ich hätte meine eigene Schwester ermordet?“, erwiderte ich ungläubig.
„Doch, das glauben wir. Sie wurde mit Ihrer Haarnadel erstochen und Sie haben kein Alibi“, erklärte mir Chefinspektor Krämer kurz.
„Was ist mit dem Motiv? Was hätte ich für ein Motiv gehabt?“, fragte ich, krimigeschult wie ich war.
„Eifersucht! Ein klassisches Motiv“, kam es postwendend zurück, während er mich ganz genau beobachtete, „oder wollen Sie bestreiten, dass Martin Rosenzweig vor einigen Jahren mit Ihnen sehr, sehr gut befreundet war?“
„Sehr gut befreundet ist vielleicht ein Euphemismus“, erklärte ich lakonisch, „Doch Sie sagen es selbst, das ist Jahre her. Ich war lange fort.
Zehn Jahre habe ich in Irland gelebt. Gestern Abend sah ich ihn zum ersten Mal wieder, seit ich fortging.“
„Was macht das schon“, sagte Chefinspektor Krämer ruhig, „Zeit hat nichts zu sagen. Manchmal festigt sie auch Gefühle, besonders, wenn sie sehr stark sind. Wann genau war die Nachbarin da?“
„Ich weiß es nicht. Ich habe keine Uhr im Haus und weiß nie, wie spät es ist“, antwortete ich wahrheitsgemäß, „Es war schon dunkel.“
„Nun, dann werden wir mit der Nachbarin reden. In der Zwischenzeit muss ich Sie bitten, das Haus nicht zu verlassen.“
Er ging. Und ich war allein. Zuerst hatte mich mein Vater verlassen, dann meine Mutter, dann mein Mann und jetzt auch noch meine Schwester. Ich war inmitten der Dunkelheit.
* * *
Chefinspektor Krämer saß mit Magdalena März, seiner Kollegin, in einem kleinen Restaurant in der Nähe seines Büros.
„Nun, möchten Sie mir erzählen, was Sie über die Familie erfahren haben?“, fragte Chefinspektor Krämer, nachdem sie fertig gegessen hatten, denn er war der Ansicht, dass man immer eine Sache nach der anderen tun sollte. Jetzt war er satt und konnte seiner Kollegin seine ungeteilte Aufmerksamkeit widmen, die auch pflichtbewusst ihr Tablet auspackte, um ihre Notizen zu öffnen.
„Die Tote heißt Marlies Merkado. In ihren Kreisen war sie als Marlene bekannt. Sie war gerade mal 20 Jahre alt, aber es wurde ihr eine große Zukunft vorausgesagt. Damit ist es jetzt ja wohl vorbei“, begann Magdalena März zu berichten.
„Zukunft als was?“, unterbrach sie der Chefinspektor, während er seinen Kaffee umrührte.
„Als Darstellerin, wurde mir gesagt. Was auch immer das heißen mag“, antwortete Magdalena März, während sie sich fragte, warum Max Krämer ständig in seinem Kaffee umrührte, wo er weder Zucker noch Milch hineingegeben hatte, „Ihre Schwester Beatrix O’Fallon, unsere Hauptverdächtige, ist zehn Jahre älter. Die letzten zehn Jahre verbrachte sie in Irland. Nach dem Tod ihres Vaters, Stefan Merkado, hat sie Hals über Kopf das Land verlassen, um sich mit Conor O’Fallon zu vermählen. Ihre kleine Schwester überließ sie der Obhut eines Internats. Nur in den Ferien fuhr Marlies regelmäßig zu ihrer Schwester nach Irland.“
„Was war mit der Mutter?“, unterbrach Max Krämer abermals.
„Das ist eine interessante Geschichte. Stefan und Anna Merkado waren mehr als ein Ehepaar. Sie scheinen so etwas wie eine symbiotische Beziehung gehabt zu haben. Man könnte sagen, Anna Merkado war ihrem Mann hörig. Zu seinem Geburtstag schickte sie die Mädchen zu einer Tante, um mit ihrem Mann alleine zu sein. Offenbar wollte sie sehr intensiv feiern und besorgte Kokain. Dieses jedoch war gestreckt. Allerdings nicht mit den gängigen Zusatzstoffen, sondern mit Strychnin. Stefan Merkado war sofort tot. Manche meinen aber auch, seine Frau hätte das Strychnin zugesetzt. Sie hatte vor, mit ihrem Mann zu sterben, damit sie ihn endlich ganz für sich hätte, dass sie immer zusammen wären, doch sie hatte die Wucht des Eindrucks unterschätzt, der sich ihr offenbarte, als er tot vor ihr lag, so dass sie sich nicht mehr rühren, nichts mehr tun konnte. Das meinte zumindest ihr Psychiater. Die Mädchen fanden den toten Vater und die Mutter, die in einem Stuhl saß und unentwegt sagte, er schlafe nur. Seitdem ist sie in der Psychiatrie“, erzählte Magdalena März.
„Die Mutter hat also den Vater ermordet“, fasste Max Krämer prosaisch zusammen.
„Kann man so sagen. Nur belangt kann sie dafür nicht werden, da sie nicht zurechnungsfähig ist“, entgegnete Magdalena März.
„Und wenn sie ihren Zustand nur vortäuscht?“, fragte Max Krämer nachdenklich.
„Seit zehn Jahren?“, fragte Magdalena März, „Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das zehn Jahre lange durchhält. Schließlich wird sie regelmäßig untersucht. Aber eines scheint sicher zu sein, der Hang zu morden liegt in der Familie. Beatrix soll das Temperament ihrer Mutter geerbt haben. Auch ihre Taten zeichnen sich durch Bedingungs- und Rücksichtslosigkeit aus. Damit komme ich zum zweiten Mord. Gestern Abend, so erzählte Martin Rosenzweig, der unter dem Künstlernamen Le Point Noir bekannt ist, habe er sie zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder gesehen. Nach seiner Darstellung hatte Beatrix ihn vor zehn Jahren einfach im Stich gelassen und war quasi in ihre Ehe geflohen, mit diesem Verleger. Allerdings glaubte sie, dass Martin Rosenzweig sie versetzt hatte. Er war gerade auf dem Weg zum Treffpunkt, als er von einem betrunkenen Autofahrer angefahren wurde.
Monatelang war er im Krankenhaus, doch vor allem hatte er keine Möglichkeit, Beatrix eine Nachricht zukommen zu lassen, denn sie war auf und davon, und Martin selbst wurde Tag und Nacht von seiner Mutter bewacht, die von Anfang an gegen die Beziehung war.“
„Eine Frau von schnellem Entschluss“, fasste Max Krämer zusammen, „Es erscheint mir immer wahrscheinlicher, dass sie es wirklich getan hat, und dennoch, die Frau, die ich kennenlernte war kühl und ganz und gar nicht emotional, als wäre der