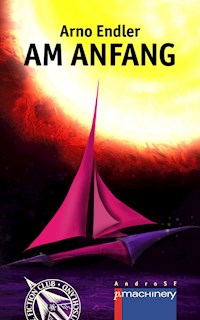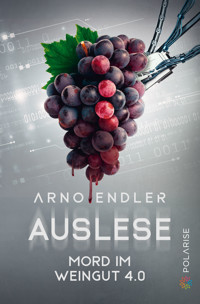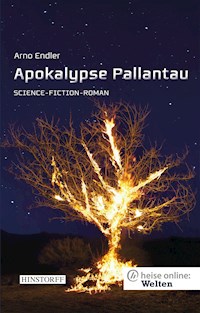
12,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hinstorff Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Milliarden Menschen kolonisieren Planeten, deren Ökosysteme das Überleben ermöglichen. Die Erde, Ursprung genannt, ist für viele nicht mehr als ein Mythos, von wenigen Auserwählten bewohnt, den Parentes, die die Schicksale der Menschheit lenken. Doch dann ereignet sich in einer Kolonie unerwartet eine geothermische Katastrophe. Eine Familie, bei der Evakuierung vergessen, muss versuchen, den Raumhafen zu erreichen. Die Technik, an die sich die Menschen gewöhnt haben, versagt, der Countdown läuft unerbittlich ab. Und welchen Plan verfolgen die Parentes? Welche Entwicklung ist möglich angesichts von evolutionierenden Künstlichen Intelligenzen? Und findet sich ein Heilmittel gegen eine den Bestand der Menschheit bedrohende Seuche? Arno Endler erzählt spannend von der Auseinandersetzung zwischen der Natur und dem Glauben der Menschen, sie beherrschen zu können. Und gibt zudem seine Antwort auf die Frage, was Mensch und Maschine unterscheidet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Einfältig, wie die Menschen nun mal waren, kam es ihnen gar nicht in den Sinn, dass sie das Gleichgewicht zerstörten, dass sie auf einem denkenden Wesen herumtrampelten, seine Haut aufrissen, Dinge entfernten, um Fremdes zu pflanzen und zu bauen. Da war es kein Wunder, dass Rannuiemmi sich schüttelte, die Parasiten abwerfen wollte.
Milliarden Menschen kolonisieren Planeten, deren Ökosysteme das Überleben ermöglichen. Die Erde, Ursprung genannt, ist für viele nicht mehr als ein Mythos. Doch dann ereignet sich in einer Kolonie unerwartet eine geothermische Katastrophe. Eine Gruppe Menschen, die spät von der dringend nötigen Evakuierung erfährt, muss versuchen, den rettenden Raumhafen zu erreichen. Der Countdown läuft unerbittlich – und die Technik, an die sich die Siedler gewöhnt haben, versagt immer wieder …
Arno Endler, geboren 1965, lebt im Hunsrück. Er schreibt Kurzgeschichten, die u.a. in c´t Magazin für Computertechnik erschienen, verfasste einen Roman und zwei Folgen der Cotton Reloaded-Serie. Seit dem Jahr 2016 gehört Endler zu den Stammautoren der Serie Perry Rhodan NEO.
Jürgen Kuri, geboren 1959 in Freiburg im Breisgau, ist stellvertretender Chefredakteur von heise online und immer wieder Gesprächspartner für Fernsehsender und Rundfunkstationen.
in Zusammenarbeit mit
Arno Endler
Apokalypse Pallantau
Science-Fiction-Roman
Herausgegeben von Jürgen Kuri
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Epilog
Prolog
Er vermisste die Sonne intensiver als seine Frau.
Macon Errki, vierundzwanzigjähriger Energie-Ingenieur und derzeit einziger Diensthabender der E-Station EINS, seufzte, während er das Foto anstarrte, das auf der Kontrollkonsole vor ihm stand und ihn zu verhöhnen schien.
Sabi, seine Frau, lächelte ihm entgegen. Das Bild war am höchsten Feiertag Rannuiemmis, dem Gründungstag, aufgenommen worden. Vor drei Jahren. Im Hintergrund glitzerte das Meer, und die pralle Sonne verlieh Sabis Haar eine Art Glanz, den Macon so liebte.
Dennoch war es Ranu, die Sonne des Aspix-Systems, die Macon seufzen ließ.
Das fehlende Tageslicht in der unterirdischen Anlage bedeutete eine emotionale Belastung, unter der alle Schichtarbeiter litten. Energiestation EINS nannte man den Komplex. Macon blickte auf die Kupferplatte mit dem Schriftzug direkt über der Ausgangstür.
Energiestation EINS! Als wenn es mehr als eine gäbe. Macon unterdrückte den Impuls, auf den Boden zu spucken. Es war sein Job, hier zu sein. Die Kolonie auf Rannuiemmi kannte nur diese eine Stromquelle. Rund einhundert Meter unter der Oberfläche nutzte man die ehemalige Forschungsstation zur Kontrolle der geothermischen Energieanlage.
Auf den Monitoren vor Macon wechselten die Anzeigen. Die Skala der Energieausbeute lag deutlich im giftgrünen Bereich. Macon erzeugte fast die dreifache Kapazität, die benötigt wurde. Die junge Kolonie hatte zur Zeit noch wenig Verwendung für die gewaltigen Energiemengen, die Rannuiemmi in seinem Innern bereithielt.
Sogar die Verlustrate bei der Energieübertragung via Mikrowellenstrahl zur Orbitalstation und von dort zurück zum Mount Elias, Raumflughafen und zugleich Hauptstadt der Kolonie, war ob des Überangebots akzeptabel.
In Planung befand sich jedoch bereits eine oberirdische Leitung, die den Strom verlustfrei zum anderen Kontinent Rannuiemmis liefern würde.
Macon seufzte ein weiteres Mal. Tausende Kilometer lagen zwischen ihm und seiner Frau. Getrennt durch Raum und Zeit.
Seit drei Monaten fristete er das überaus langweilige Dasein eines Schichtarbeiters, weit entfernt von allen Annehmlichkeiten des jungen Ehelebens.
Natürlich war die Bezahlung gut und Sabi würde ihn sicherlich mit offenen Armen und einem warmen Körper empfangen. Dennoch halfen diese guten Gründe nicht gegen das Selbstmitleid.
Die blauen Augen, die blonden Haare. Er liebte sie wie am ersten Tag.
Vielleicht vermisste er seine Frau doch mehr als Ranu.
Ein Warnsignal in Form eines leisen Piepens weckte ihn aus seinen Gedanken.
Einer der Wärmetauscher meldete gefährlich hohe Temperaturen.
Macon runzelte die Stirn.
Mit einigen schnellen Befehlen rief er sich die schematische Darstellung der Lage des gefährdeten Tauschers auf.
Die gewaltige Magmablase neben einem solchen Wärmetauscher erwärmte das umliegende Gestein so stark, dass man die Einheit rund zwei Kilometer entfernt montiert hatte.
Doch nun stiegen die Temperaturen unaufhörlich.
Macon initiierte einen Tiefenscan, um die Stabilität der Magmablase zu kontrollieren.
Der Computer meldete die Auslösung der Messung und ein Countdown zeigte an, dass es zwei Minuten dauern würde, bis die Ergebnisse in Form eines 3-D-Holos vorliegen würden.
Ein rotes Leuchten der Standleitungskommunikation blinkte auf.
Macon gab die Verbindung frei. „Energiestation EINS. Ingenieur Errki spricht.“
Mit der üblichen zwei bis drei Sekunden-Verzögerung antwortete eine Stimme aus Mount Elias: „Hier Zentrale. Wir empfangen einige sehr alarmierende Meldungen von der Automatik. Was können Sie uns sagen, Ingenieur Errki?“
Dann Stille aus den Lautsprechern. Macon schaute kurz nach, wie lange es noch bis zum Scanergebnis dauern würde, und sagte dann: „Ein Wärmetauscher meldet ungewöhnlich hohe Temperaturen. Kein Grund zur Beunruhigung. Ich habe bereits einen Tiefenscan veranlasst. Im Zweifel werde ich den Tauscher aus der Gefahrenzone ziehen lassen. Falls ich ihn abschalten muss, so dürfte die Kapazität lediglich um fünfzehn Prozent fallen. Errki Ende.“
Die letzte Anmerkung hatte Macon vorsorglich verlauten lassen, damit sich niemand über einen eventuellen Totalverlust des Tauschers beunruhigte. Der Strom würde fließen. Das war schließlich sein Job. Und er machte ihn gut.
„Zentrale hier“, meldete sich der Errki unbekannte Mann von der Antipoden-Seite Rannuiemmis. „Ingenieur Errki. Wir erhalten hier Daten von der Automatik, die auf steigende kritische Hitzewerte bei allen Wärmetauschern hindeuten. Können Sie das bestätigen?“
Macon spürte sein Gesicht erröten, tippte wild auf der Tastatur herum, bis er alle Anzeigen von den acht Tauschern auf einen Blick sehen konnte.
Die Automatik hatte der Zentrale korrekte Daten übermittelt.
In sämtlichen Bereichen erhöhten sich die Temperaturen. Kritisch waren sie jedoch nur bei einem Tauscher.
„Palla-Dung!“, fluchte Macon leise und ließ sich die Wärmeentwicklung in einem Graphen darstellen. „Da stimmt etwas ganz und gar nicht. Wo bleibt der Scan?“
Der Countdown verharrte bei dreißig Sekunden.
„Das kann doch nicht sein.“ Seit siebzehn Jahren blieben die Daten, der Energieausstoß und die Lage der Magmablase, die man anzapfte, stabil. Was geschah hier?
Das Warten half nichts. Er musste der Zentrale Rede und Antwort stehen.
„Ich bestätige die steigenden Temperaturen an den Wärmetauschern. Der Scan sollte in circa dreißig Sekunden abgeschlossen sein, dann kann ich mehr Informationen liefern. Errki Ende.“
Endlich sprang der Countdown wieder an. Macon trommelte mit den Fingern auf die Konsolenplatte. „Mach schon, mach schon, mach schon“, murmelte er.
Gleichzeitig mit dem erneuten Einfrieren des Countdowns meldete sich die Zentrale: „Ingenieur Errki? Präsident Wuhannen ist vor Ort und wünscht einen Lagebericht.“
Macon erschrak zunächst. Der Präsident der Energiedirektion? Offenbar schien die Lage schlimmer zu sein, als er vermutete.
Der verdammte Countdown lief einfach nicht weiter. Was auch immer den Scan erschwerte, interessierte seinen Chef sicherlich nicht. Macon schlug mit der flachen Hand auf die Konsolenplatte. „Jetzt komm schon! Ich will nicht länger warten!“
Der Fotorahmen mit Sabis Abbild am Meer machte einen Sprung und fiel dann um.
„Zentrale hier, Ingenieur Errki! Der Präsident wartet.“
Macon ignorierte die Stimme, blickte auf den Rahmen mit dem Bild seiner Frau und wollte ihn gerade wieder aufstellen, als der Scan endlich 100 Prozent meldete.
Er drückte die Abspieltaste und sah nun in grauenhaft guter holografischer 3-D-Darstellung das Unheil, welches auf die Wärmetauscher zukam.
Von allen Seiten bohrten sich Magmaflüsse wie Adern durch das Gestein. Ein beinahe surrealer Anblick. Errki konnte sich nicht vorstellen, welche Quelle die Magmablase so sehr speiste, dass sie diese Abflüsse erzeugen musste, um den Druck abzuleiten. Es war auch vollkommen egal. Fakt war, dass …
„Zentrale? Hier Ingenieur Errki. Es scheint auf einen mehrfachen Vulkanausbruch hinauszulaufen. Ich sehe in dem Scan jede Menge Magmaadern, die sich nicht vorhersagbar ihren Weg suchen. Es sieht so aus, als wenn es zu mehreren Durchbrüchen nach oben kommen wird. Sie sollten die Bevölkerung vor Eruptionen warnen. Einige Wärmetauscher befinden sich in unmittelbarer Nähe zu den neuen Magmaschloten, aber den Messwerten zufolge erhöht sich die Temperatur im gesamten Scanbereich. Die Quelle des Magmas kann ich nicht bestimmen, doch sie dürfte näher am Kern liegen. Ich starte einen weiteren Scan und ziehe gleichzeitig die gefährdeten Tauscher in kühlere Regionen zurück. Errki Ende.“
Macons Finger flogen nur so über die Tastatur, während er alle Befehle in die verschiedenen Anwendungen übertrug.
Zufrieden sah er, wie drei der Wärmetauscher aus der Gefahrenzone entfernt wurden. Er erwartete eine Anweisung von Präsident Wuhannen, einem rechthaberischen Bürokraten, dessen einzige Qualifikation gerüchteweise darin bestanden hatte, zu zwanzig Prozent die Gene eines Parentes zu besitzen. Aber die Zentrale schwieg.
Der neue Scan würde erst in zehn Minuten fertig sein, da Macon das Areal ausgedehnt hatte.
Es knackte im Lautsprecher und eine tiefe Baritonstimme erklang: „Zivis Errki? Hier spricht Primus Arneus. Wie ist die Lage? Was hat der neue Scan ergeben?“
Nun wurde es Macon mulmig. Der Leiter der Kolonie, und damit nominell der Herrscher über Rannuiemmi, schaltete sich persönlich ein. Da war Vorsicht angebracht, eine gewisse Diplomatie.
„Der neue Scan“, begann der Ingenieur, „ist initiiert und läuft. Die Lage ist nicht kritisch. Die Wärmetauscher arbeiten nach wie vor. Das Gestein hat sich allgemein erhitzt. Somit ist die Energieversorgung gewährleistet, selbst wenn wir uns von der ursprünglichen Wärmequelle entfernen. Ingenieur Errki Ende.“
Er wartete.
„Vielleicht sollte ich noch einen Live-Scan initiieren“, murmelte er, als ihm die Stille zu viel wurde.
Die Messgeräte für die Echtzeitüberwachung fraßen Energie und ohne Genehmigung der Zentrale hätte er es üblicherweise nicht gewagt. Doch nun? In einer Ausnahmesituation.
Macon begann mit der Befehlseingabe.
„Zivis Errki“, meldete sich der Primus. „Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit einer vulkanischen Eruption? Uns fehlen die Vergleichsdaten, jedoch könnte Gefahr für die Kolonisten bestehen. Ich würde Sie bitten, größtmögliche Datenmengen zu sammeln.“
Macon zögerte nicht. „Den Live-Scan habe ich schon vor wenigen Minuten eigenständig in Auftrag gegeben. Ich erwarte in kürzester Zeit die Echtzeitdaten, Primus. Dann wissen wir mehr. Was die Austritte des Magmas angeht, so vermute ich, dass es zwangsläufig geschehen wird. Die Magmaströme bahnen sich den Weg des geringsten Widerstandes. Die Bodenschichten werden nach oben hin durchlässiger, also wird es unausweichlich zu Eruptionen kommen. Errki Ende.“
Macon lehnte sich im Stuhl zurück. Nun blieb ihm nichts als zu warten.
Überlaut hörte er die Klimaanlage. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und zog die Jacke aus. Die Anzeige für den Livescan verkündete glatte neunzig Prozent. Vielleicht noch zwei Minuten, dann konnte er sich einen Überblick über die Bedrohung verschaffen.
Was bis zum Kontakt mit dem Primus ein klarer Nachteil gewesen war, nämlich alleine während der Schichten zu sein, konnte nun zu einem unschätzbaren Vorteil werden. Den Ruhm, in katastrophaler Lage einen ruhigen Kopf bewahrt zu haben, würde er nicht teilen müssen. Macon grinste kurz. Plötzlich unterbrachen mehrere Warnsignale seine Gedanken.
Drei weitere Wärmetauscher meldeten Überhitzung.
Schnell gab er die Befehle für den Rückzug in kühlere Regionen. Ihm blieb keine Zeit, die Ausführung zu verfolgen, weil nun beinahe alle Wärmetauscher die Gefahrenmeldungen abgaben.
„Palla-Dung!“ Er tippte hektisch, nahm nur peripher das Okay für die Holo-Darstellung des Live-Scans wahr, drückte auf Execute und fixierte die Anzeigen.
„Zivis Errki? Wie sehen die Ergebnisse aus?“, fragte Primus Arneus via Standleitung. Die Lautsprecher knarzten, es gab Interferenzen, die sich in einem Rauschen und in Tonausfällen manifestierten.
Macon beendete möglichst schnell die Eingaben und starrte dann auf die Echt-Zeit-Holo-Darstellung, die nicht nur das Areal für die Wärmetauscher wiedergab, sondern auch eine schematische Risszeichnung der Energiestation.
„Nein“, flüsterte er und spürte, wie der Schweiß auf der Stirn kühl wurde.
„Zivis! Können Sie mich hören?“
Macon starrte auf die vielfarbige Visualisierung des unterirdischen Areals, sah den Magmaströmen zu, die sich aufteilten und unaufhaltsam in Richtung der Station bewegten.
Er drückte den Verbindungsknopf, krächzte, da sein Mund vollkommen trocken war, einige unverständliche Laute, schluckte, benetzte seine Lippen und sagte: „Primus Arneus, hier spricht Ingenieur Errki. Es ist schlimmer als vermutet.“ Er stockte kurz, holte tief Luft, da ihm der Atem weggeblieben war.
„Ich muss die Station aufgeben. Ich sende die Bilder direkt an die Zentrale, damit man sich dort einen Eindruck von der Katastrophe bilden kann. Wie lange die Station dies hier überstehen wird, ist mir nicht klar, aber ich schalte alles auf Automatik.“ Macon wischte sich den Schweiß von der Stirn, hörte das Röhren der Ventilatoren, die gegen die unmenschliche Hitze ankämpften, jedoch die Schlacht allmählich verloren.
Nun verstand er, weshalb ihm so warm war.
Die unterirdischen Magmaströme würden die Station vernichten. Sie kamen näher, die hellgelben Flüsse griffen wie Finger nach ihm, bereit, ihn einzuschließen und zu töten.
„Es wird eine gewaltige Eruption stattfinden, Primus. Irgendwohin müssen die flüssigen Gesteinsmassen. Etwas schürt den Ofen, drückt den Kern in Richtung Kruste. Ich befürchte, wir können nichts dagegen unternehmen. Ich selbst werde jetzt den Lift an die Oberfläche nutzen, solange er noch funktioniert. Falls ich es bis zum Ozean schaffe, nehme ich das Schiff, um zum Mount Elias zu kommen. Ich melde mich via LR-Verbindung, sobald ich an Bord bin. Wenn Sie mir noch etwas mitteilen wollen, beeilen Sie sich bitte mit der Antwort. Meine Zeit wird knapp. Errki Ende.“
Macon initiierte die Notfallprotokolle und Automatiken. Sämtliche Daten sollten an die Zentrale gesendet werden.
Mit Schrecken sah er, dass einer der Magmaströme steil nach oben abbog und sich dem Fahrstuhlschacht zur Oberfläche näherte. Der Ingenieur schaute auf die Zeitanzeige. Er würde höchstens dreißig Sekunden warten.
Zu seiner Überraschung kam die Antwort prompt. „Zivis Errki! Wir danken Ihnen für Ihren Einsatz und wünschen Ihnen alles Gute für die Heimkehr. Bringen Sie sich in Sicherheit. Primus Arneus, Ende!“
Macon sprang so schnell auf, dass sein Stuhl nach hinten kippte.
Er rannte zur Tür, die sich automatisch öffnete, dahinter war der Flur, über den er zu dem Lift gelangte. Es schien Ewigkeiten zu dauern, bis die Schiebetür beiseitegeglitten war. Macon quetschte sich hindurch, wartete nicht, bis sich die Türen in der Endposition befanden, sondern hämmerte auf den Schließen-Button.
Macon drückte die Automatik-Steuerung weg, wechselte auf dem Kontroll-Display zur manuellen Bedienung und gab den Notfall-Code für den Express-Aufstieg ein.
Nun würde er rund eine Minute bis zur Oberfläche benötigen, zehnmal schneller als üblich.
Er legte sich mit dem Rücken auf den Boden, um dem Andruck möglichst zu entgehen, fluchte innerlich, weil die Türen nur langsam schlossen, und sah dann dem Countdown auf dem Display zu.
3, 2, 1. Mit einem Ruck, der ihm den Atem nahm, sauste die Zwei-mal-ein-Meter-Kabine in die Höhe.
Macon spürte Hitze an seinem Rücken, vermutete jedoch, dass er es sich lediglich einbildete. Das Material war hochgradig hitzeabweisend. Es konnte nicht sein.
Doch dann dachte er an die Wärmetauscher, die Überhitzung gemeldet hatten. Wie hoch mussten die Temperaturen sein, damit ein solches Gerät überhitzte?
Macon wollten die Zahlen nicht einfallen. Irgendwie funktionierte sein Kopf nicht so gut wie üblich.
Die Fahrt wurde merklich langsamer.
War er schon oben?
Der Lift stoppte. Aber die Türen öffneten sich nicht.
Macon hypnotisierte das Display, auf dem die Zahl Minus 15 auftauchte.
Der verdammte Fahrstuhl war kurz vor der Oberfläche zum Halten gekommen.
„Weiter! Los jetzt!“
Ein Ruck fuhr durch die Kabine, danach zerfetzte ein metallisches Kreischen Macons Nervenkostüm. Die Geräusche wurden lauter und lauter, bis der Ingenieur sich mit den Händen die Ohren zuhielt.
Minus 14.
Der Lift bewegte sich wieder.
Irgendetwas in der Röhre musste ihn aufhalten und nur langsam setzte sich die schiere Kraft der Notfall-Express-Maschinen durch. Hoffentlich hielten die Plast-Seile.
Macon sah zu, wie die Anzeige auf Minus 12 wechselte.
„Oh, bitte. Ich will Sabi wiedersehen“, flehte er stumm einen Gott an, an den er schon lange nicht mehr geglaubt hatte.
„Hilf mir bitte!“
Minus 10.
„Bitte.“
Macon spürte eine schmerzende Hitze seine Nackenhaare versengen. Er rückte von der Kabinenwand ab. Tränen traten ihm in die Augen. Ihm wurde nun klar, dass ein Magmastrom, der den Fahrstuhlschacht erreichte, mit enormer Geschwindigkeit nach oben schießen würde.
Er steckte in einer Todesfalle.
Minus 8.
Dann presste Macon der Andruck einer plötzlichen Beschleunigung zu Boden. Sein Kopf schlug auf dem harten Plast-Stahl auf und für einen kurzen Moment verlor er den Bezug zur Wirklichkeit.
Als er wieder klar sah, schoben sich die Türen auseinander. Kühle Luft füllte den Raum. Macon rappelte sich auf, rannte aus dem Lift und aus dem winzigen Gebäude, das als oberirdischer Zugang zur Energiestation diente. Draußen hinderte Nebel seine Sicht. Der Pfad hinunter zum Meer, wo das Schiff lag, war jedoch deutlich zu erkennen, da man das allgegenwärtige Gras mit einem plattenbedeckten Weg zurückgedrängt hatte.
Macon lief, bis ihm der Atem wegblieb. Seitenstechen ließ ihn kurz innehalten und schließlich langsamer weitergehen.
Er überlegte, wie viel Zeit ihm wohl blieb. Wenn es zu einem Ausbruch kommen würde, dann war es auf dem Meer am sichersten. Während der gesamten Kolonisierungsphase und der Erforschungsperiode Rannuiemmis hatte es niemals Hinweise auf vulkanische Aktivitäten gegeben. Was in den nächsten Stunden geschehen würde, darüber konnte man nur spekulieren.
Es gab keine Vulkankegel oder ehemalige Calderas an der Oberfläche. Woher kamen also diese unerwarteten Magmaströme?
Macon keuchte in der schwülen, stickigen Luft. Das Seitenstechen ließ nach, als er kurz stoppte.
Der Nebel irritierte ihn. Es grummelte unter seinen Füßen, ein dumpfes Grollen näherte sich. Macon vermisste das Plätschern der sanften Brandung am Anlegeplatz. Es konnte doch nicht mehr weit sein.
Der Nebel vor ihm wechselte die Farbe in ein giftiges Grüngelb. Ein stechender Duft, der ihn an Schwefel erinnerte, jedoch nicht ganz so ekelig war, eher süßlich und verführerisch, drang ihm in die Nase.
Er musste niesen.
Irgendwo in der Nähe zischte es laut, bis das Geräusch in einen hellen, singenden Pfeifton überging.
Macon schleppte sich weiter. Das Seitenstechen quälte ihn bis hin zum Schmerz.
Endlich erreichte er die Plattform, die auf das Meer hinausragte. Inzwischen war der Nebel so dicht, dass er gerade mal die Bretterstruktur der Anlegestelle erkennen konnte. Darüber hinaus versank alles im diffusen grüngelben Schleier.
Auf welcher Seite des Steges hatte er das Schiff festgemacht?
Macon schimpfte sich innerlich einen vergesslichen Idioten. Er ließ sich auf alle Viere nieder, hustete und krabbelte weiter voran, um den Pfosten nicht zu verpassen, an den das Schiff gebunden war.
Der süßliche Geruch wurde stärker, das Donnergrollen von der Station her verklang, wurde ersetzt durch ein Rauschen, das viel bedrohlicher auf Macon wirkte.
„Wo bist du? Wo bist du?“, murmelte er, suchte im immer dichter werdenden Dunst mit der Hand am Rand des Steges entlang, bis er endlich ein Tau ertastete.
„Ja! Da bist du!“
Macon zog daran und registrierte einen unerbittlichen Widerstand. Das Schiff ließ sich nicht näher ziehen.
„Verdammt!“
Er krabbelte weiter vor, bis er die Planke fand, über die der Steg mit dem Schiff verbunden war. Auch von diesem schmalen Brett sah Macon nur die nächsten fünfzig Zentimeter. Der Rest versank im Nichts.
Vorsichtig kroch er darauf, stellte fest, dass es abwärts ging, obwohl er sich sonst auf einer Ebene vom Schiff zum Steg bewegt hatte.
Nach gut drei Metern Unsicherheit packten seine Hände die Reling des Schiffes. Er sprang an Bord und stürzte sofort zur Seite, rollte, bis ihn die Schiffswand schlug.
Er versuchte zu Atem zu kommen.
Dann wurde ihm seine Situation bewusst.
„Palla-Dung“, schrie er seine Verzweiflung hinaus.
Er saß in der Falle.
Das Schiff lag im Trocknen auf Schlagseite.
Er sprang über die Reling und landete im Schlamm, dem einstigen Meeresboden. In einigen verbliebenen Pfützen brodelte Wasser. Er umrundete den Schiffsrumpf.
Wie weit hatte sich das Meer zurückgezogen?
Ein Tsunami. Dieser Gedanke schreckte ihn auf. Doch er schob ihn gleich wieder beiseite.
Es gab keine tektonischen Verwerfungen auf Rannuiemmi. Keine Platten, die Erdbeben oder Seebeben auslösen konnten. Das fehlende Wasser musste einen anderen Grund haben.
Schritt für Schritt entfernte Macon sich vom Schiff.
Je weiter er kam, umso klarer wurde die Sicht, bis er endlich das Meer sah. Gut zwanzig Meter lagen zwischen Wasser und Steg. Sollte das Meer nicht freiwillig zurückkehren, nutzte ihm das Schiff nichts. Höchstens als Unterschlupf. Doch retten konnte er sich damit nicht.
Im Schlickboden des freigelegten Meeresuntergrunds bewegte sich etwas.
Macon, der gelernt hatte, dass es im Ozean Ranniuemmis nur Algen, aber keine Fische oder Krebse gab, starrte verwundert auf die sich windende Masse. Sie erinnerte ihn an Darstellungen von Schlangennestern. Unterarmdicke Tentakel, die sich umeinander wanden. Plötzlich stoppte die Bewegung.
Macon wich sicherheitshalber zurück und beschloss, in einer Kabine des Schiffs Schutz zu suchen. Dort hatte er auch zu Beginn seiner Schicht die Armilla für den LR-Kontakt deponiert. Er würde mit der Zentrale reden müssen. Vielleicht gab es doch noch einen Ausweg.
Nach wenigen Schritten im schwergängigen Schlamm verdichtete sich der Nebel und Macon roch wieder den süßlich schwefeligen Duft.
Er erreichte das Schiff und wuchtete sich über die Reling an Bord. Die Schieflage war ärgerlich, aber man konnte sich daran gewöhnen.
In der Ferne zischte es laut und penetrant. Es erinnerte an das Pfeifen eines Überdruckventils einer Gaseinheit.
Macon fummelte das Sicherheitsschloss zur Kabine auf. Warum hatte er es überhaupt benutzt? Vorschriften.
Dabei war er der einzige Mensch auf dem Kontinent Nicäa. Wer also hätte einbrechen können?
Seine Finger glitten, feucht vom Schweiß, immer wieder vom Zahlenschloss ab.
Endlich klickte es. Die gespeicherte Kombination gab den Mechanismus frei. Macon schob die Tür auf.
Hinter sich hörte er ein schabendes Geräusch.
Er wandte sich um, glaubte, einen sich bewegenden Schatten erkennen zu können.
„Ist da wer?“, fragte er und war sich der Unsinnigkeit seines Rufes doch sofort bewusst.
Da!
Auf dem Boden!
Macon lehnte sich an den Rahmen der Tür und versuchte seinen Blick zu fokussieren.
Zuerst dachte er an ein Tau. Allerdings bewegte es sich eigenständig, wie ein Ast im Wind. Hin und her. Aber die Richtung schien eindeutig, auf ihn zu.
Macon kletterte in die Kajüte, schob die Tür zu, doch sie ließ sich nicht ganz schließen. Vielleicht hatte sie in der Feuchtigkeit gelitten oder es lag an der Schlagseite des Schiffes.
Er stürzte sich auf seinen Schrank, riss ihn auf und nahm die Armilla heraus, schnallte sie sich um das Handgelenk und betätigte den Einschaltknopf.
Das Gerät suchte nach der Verbindung zum LR-Netz und verkündete nach wenigen Sekunden: „Kein Netz vorhanden!“
So sehr die Entwickler des Sprachgenerators auch an einer möglichst optimierten angenehmen Stimmlage gearbeitet hatten. Diese drei Worte hätten Macon nicht härter treffen können.
Seine letzte Chance auf Rettung war dahin.
Er schluchzte.
Dann hörte er wieder das schabende Geräusch.
Er schaute auf.
Durch den Spalt in der Tür zwängte sich eine Art armdicker Wurm. „Es gibt keine Tiere auf Rannuiemmi außer den Pallantauriern“, flüsterte Macon, der gleichzeitig fasziniert wie angewidert dem Eindringling zusah. Kein erkennbarer Kopf. Und die Bewegungen erinnerten eher an die eines Regenwurms.
Das Ziel der Kreatur hockte am Ende der Kajüte und suchte hektisch nach irgendetwas, mit dem es sich verteidigen konnte.
Er musste das Geschehen der Zentrale melden, doch die Armilla erleichterte ihn nicht mit der Meldung, dass es doch wieder ein Netz gäbe.
Der Wurm schien kein Ende zu nehmen. Immer mehr des Körpers zwängte sich in die Kabine, pulsierte auf Macon zu.
Es blieb ihm kein Ausweg. Er trat mit seinem rechten Fuß zu.
Die Kreatur wich blitzschnell aus und wickelte sich dann plötzlich um Macons Knöchel.
Er spürte ein Zerren.
Macon schrie in Panik. Er schnappte nach Luft, roch wieder diesen süßlichen Duft, dann stach ihn etwas in den Oberschenkel. Er sah mit Entsetzen, dass sich der Wurm um sein komplettes Bein gewickelt hatte.
Nun traten die stechenden Schmerzen am ganzen Bein auf. Tausende Nadeln, die gleichzeitig in ihn drangen.
Macon schloss mit seinem Leben ab.
Eine Hitzewelle überrollte seinen Körper.
Schließlich begann er zu schweben. Es war so leicht, so kühl, so anheimelnd.
Sabi saß neben ihm. Am Kai des Hafens von Mount Elias. Ranu schickte sich an, im Meer zu versinken.
Eine angenehme Brise wehte vom Wasser zu ihnen herüber.
„Ist es nicht schön?“, fragte Sabi.
„Ja“, entgegnete Macon.
„Es ist unsere neue Heimat.“
„Ja.“
„Hier werden wir unsere Kinder großziehen.“
Kinder? Er wollte Kinder mit Sabi haben.
„Machst du ein Foto von mir, Liebster?“, hörte Macon Sabi fragen, während die Welt sich um ihn herum auflöste und er seinen letzten Atemzug tat.
1
Über die Jugend Genba Sumahamis ist nicht viel bekannt. Folgende Dateien können jedoch gesichert ihrer Studienzeit zugeordnet werden:
Auszug aus – Hausaufgabe im Fach Lebendige Geschichte –
„Über das Leben auf ruralen Kolonien“
Von Genba Sumahami, 1. Trimester im Jahr 2811
Die romantisierenden Vorstellungen von Raumfahrt und der hochtechnisierten Lebensweise der Menschheit im Menschenraum sind auf den Welten der frühen Kolonisierungswelle weit verbreitet.
Was es bedeutet, eine neue Heimat zu besiedeln, ist den meisten Menschen nicht bewusst. Die mediale Aufbereitung in Holo-Vids-Soaps und Spielfilmen ist auch nicht gerade dazu angetan, ein realistisches Bild zu malen.
Rund viertausend Milliarden Mäuler müssen ernährt werden, und so wundert es nicht, dass zwei Drittel der Heimatwelten landwirtschaftlich geprägt waren.
Die Wirklichkeit in diesen Kolonien bestand aus einer zweigeteilten Gesellschaft und Lebensweise. Im und um den jeweiligen Raumhafen residierte die Elite, bestehend aus der Verwaltung, Händlern, Raumfahrern und Technikern. Weiter draußen lebten die Menschen sehr einfach, verfügten manchmal nicht einmal über die simpelsten technischen Hilfsmittel. Ein Siedlerleben, wie es auch aus den uralten historischen Aufzeichnungen auf Ursprung bekannt wurde.
Rannuiemmi, der 5. von 12 Planeten im Aspix-System, stellt keine Ausnahme dar. Die 212. Heimat des Menschenraums verfügt über keinen Mond, umkreist in 625 Standardtagen die Sonne Ranu. In 23 Standardstunden rotiert er um die eigene Achse. Seine Schwerkraft und Größe entsprechen nahezu der des Ursprungs.
Er wurde 2625 entdeckt und zehn Jahre später zur Besiedlung freigegeben, da ein Terraforming nicht notwendig war.
2642 begann die erste Welle der Besiedlung auf dem Hauptkontinent Pallantau. Die zweite, unbesiedelte Landmasse wurde Nicäa genannt.
Rannuiemmi ist zu 84 Prozent von Meeren bedeckt und verfügt über einen Raumport auf dem Mount-Elias-Plateau.
Im Jahr 2700 ergab die Volkszählung eine Einwohnerzahl von 22.367, die meisten von ihnen waren einfache Farmer.
Auszug aus – Hausarbeit im Fach Sozialphilosophie –
„Über die Parentes“
Von Genba Sumahami, 2.Trimester im Jahr 2812
Es gibt wohl nur wenige Eingeweihte außerhalb des Kreises der Parentes, die mit Sicherheit beurteilen konnten und können, ob die Parentes noch Menschen oder darüber hinaus evolutioniert sind.
Nur vereinzelte Informationen halten einem Faktencheck stand.
Wer sind die Entscheidungsträger oder, wenn man es so sagen will, die Herrscher im Menschenraum?
Es sind die Parentes.
Wo residieren die Parentes und ihre Familien?
Auf Ursprung, dem Planeten, dem die Menschheit entstammte.
Alle Fragen, die sich die durchschnittlichen Menschen sonst stellen, bleiben unbeantwortet. Oder man spekuliert, fantasiert oder mystifiziert.
Niemand weiß mit Bestimmtheit, in welchen Erscheinungsformen Parentes auftreten können. Die Anzahl der unterschiedlichen Phänotypen tendiert gen unendlich.
Natürlich treffen die Primusse der Kolonien mit Parentes zusammen. Doch sie berichten nicht allzu viel, was die Herrscher angeht. Aus dem wenigen, was den Weg in Aufzeichnungen gefunden hat, schließe ich, dass die Parentes wirksam verhindern, dass die Primusse mehr erzählen. Es scheint beinahe so, als wenn ein Schleier über jene seltenen Begegnungen gedeckt, das Gedächtnis eines Primus getrübt oder seine Wahrnehmung eingeschränkt würde.
Parentes reisen zumeist in ihren eigenen Privatraumern und erlauben nur in Ausnahmefällen, dass man sie persönlich kontaktiert.
Untereinander jedoch pflegen sie einen regen Gedankenaustausch.
Dabei spielt die räumliche Entfernung zwischen ihnen oder der zeitliche Ablauf des Gesprächs keine Rolle.
Die Parentes leben für den Diskurs, lieben Dialog, Diskussion und Kommunikation unter ihresgleichen.
In dem ausgehöhlten Mond des URSPRUNGS speichern Milliarden von Datenspeichern alle Konversationen der Parentes, damit sie theoretisch jederzeit für die Nachwelt abrufbar bleiben.
Jedermann ist es erlaubt, diese Aufzeichnungen anzufordern. Niemandem wurde bislang eine Anfrage verweigert.
So darf sich jeder sein eigenes Bild von den Parentes machen.
– Über einen Aspekt moderater Langeweile –
Die Individual-Cams liefern zwei Drei-D-Hologramme, die nebeneinander abgespielt werden.
Zu sehen ist auf der rechten Seite ein Tal, umgeben von schroffen Felsformationen, in dem ein Gebirgsbach einen kleinen See speist. Der Standort des Beobachters liegt deutlich erhöht auf einem Plateau, dahinter eine Fensterfront, die sich wie die Absperrung eines Höhleneingangs in den Fels zu graben scheint. Was sich hinter der Fensterfront befindet, verbleibt im Dunkeln, da die Scheiben getönt sind und die Sonneneinstrahlung zusätzlich spiegelt.
Am Himmel treiben vereinzelt bauschige Wolken, die an den Rändern von Böen zerfranst werden. Der Wind jagt die Wolken schnell über den Tageshimmel. Eine Sonne ist nicht zu sehen, aber es ist sehr hell, die Luft klar, die Sicht außerordentlich gut.
Der Beobachter tritt an den Rand des Plateaus, bleibt vor einer fünfzig Zentimeter hohen Brüstung stehen.
Man sieht, dass sich direkt dahinter ein mehrere hundert Meter tiefer Abriss im Berg anschließt. Die Tonaufnahme lässt erahnen, dass es auch hier stürmt, so laut klingt das Sausen und Pfeifen.
Der Beobachter schwankt nicht im Wind. Sein Körper ist nicht zu sehen.
Das linke Hologramm bietet deutlich weniger Einzelheiten in der Videodatei.
Hier steht der Beobachter auf einem freien Feld. Die Pflanzen, die an dieser Stelle einmal wuchsen, sind abgeerntet. Einige Reste der Stängel vermodern im Matsch.
Der schlammige Boden ist voller Pfützen. Die Sichtweite beträgt nur rund zehn Meter, dann verschwindet alles im Grau des Bindfadenregens.
Auch in dieser Video-Aufzeichnung ist der Körper des Beobachters nicht sichtbar.
Der Diskurs beginnt mit Worten aus dem Regenhologramm.
„Ich grüße dich, Freund. Wie ich sehe, liebst du noch immer die Einsamkeit.“ Der Beobachter des Regenhologramms sieht natürlich die Bilder der anderen Übertragung.
„Soporo. Freund. Gleichfalls grüße ich dich. Augenscheinlich genießt du es nach wie vor, dem Regen standzuhalten. Wann wirst du dein Domizil wieder aufsuchen?“
„Ach, Anodyneon. Du weißt, wie sehr ich in den Tag lebe. Es ist das Hier und Jetzt, was wichtig ist. Jeden Regentropfen möchte ich zählen, ihn streicheln, denn er ist einzigartig auf der Welt.“
„Man könnte gleichwohl sagen: Du liebst es, nass zu werden. Unter Umständen sogar, dass du zu gleichgültig bist, um dir einen Schutz vor dem Niederschlag zu suchen.“
Das Hologramm im Regen erzittert, als dieser Beobachter während des Lachens zuckt.
„Du bist mein innigster Freund und mein vehementester Kritiker, Anodyneon. Was würde ich mich ohne deine scharfe Zunge langweilen.“
„Ist dem so?“
„Aber natürlich. Wie sehr vermisse ich unsere gemeinsame Zeit auf dem Einhundertsiebzehnten. Wie wir erkundeten, stritten, Entscheidungen trafen und die Schicksale von vielen beeinflussten. Wohin sind die Jahre gegangen?“
„Du zeigst einen ausgeprägten Hang zur Sentimentalität, Soporo. Könnte es vielleicht sein, dass die Stunde nahe ist, dein Leben zu ändern?“
„Erneut?“
„Es ist Dekaden her, dass du zum Ursprung zurückkehrtest. Wie lange verharrst du da aktuell im Regen?“
„Ich weiß es nicht, Anodyneon. Ich vergaß, die Zeit zu stoppen, verlor mich in meinen Gedanken und Wonnen.“
„Das sieht dir ähnlich. Dennoch möchte ich darauf hinweisen, dass wir nicht nur für die eigenen Genüsse geboren wurden. Ich schlage ein Treffen vor, liebster Soporo. Wir beide. Du wählst den Ort.“
„Gibt es außer der Sorge um meinen emotionalen Zustand noch weitere Gründe für deinen Vorschlag?“
„In der Tat.“
„Du siehst mich erstaunt.“
„Ich bitte dich.“
„Einverstanden, Anodyneon. Sobald der Regen endet. Die fallenden Regentropfen komponieren eine ganz eigene, nicht wiederholbare Symphonie. Ein exquisiter Genuss. Ich möchte diese Darbietung nicht missen.“
„Es ist die Langeweile, an der du dich ergötzt, nicht wahr?“
„Möglicherweise.“
„Ein Intellekt wie der deinige benötigt Herausforderungen, keinen Stillstand.“
„Ein Aspekt der Langeweile ist es, dass man sie moderat durchaus goutieren kann. Es ist der Geist, der, befreit von einer sinnvollen Aufgabe, sich zu höheren Ebenen aufschwingt. So fordere ich meinen Verstand heraus.“
„Ich muss nicht deiner Meinung sein, Soporo.“
„Waren wir das jemals, Anodyneon?“
– Ende der Aufzeichnung –
Parrer Savea untersuchte die Sichel auf Scharten und beschloss, sie zu schärfen, bevor er weitersenste.
Der Tag versprach, etwas wärmer zu werden. Bereits in den Morgenstunden schwitzte Parrer. Doch der Farmer liebte es, das Ergebnis seiner Hände Arbeit sehen zu können.
Heute, wie auch in den letzten vier Tagen, befreite er ein weiteres Areal vom allgegenwärtigen Steppengras. Dort, wo die Pallantaurier nicht grasten, wuchs es ungehemmt in die Höhe. Grau, kräftig, bis zu drei Meter hoch. Seine Struktur verlieh ihm eine Widerstandsfähigkeit, die den Einsatz der üblichen Solar-Mäher verhinderte.
Der Agrar-Senator hatte zwar versprochen, dass die Konstruktion eines auf pallantaurische Verhältnisse angepassten Mähers schon angestoßen wäre, aber Parrer wusste, was das hieß: Monate, wenn nicht Jahre der Entwicklung und schließlich ersten Erprobung in den großen Farmen, zu denen seine eigene sicherlich nicht gehörte.
Also blieb nur die gute alte Sense. Ordentlich geschärft, von kräftigen Armen durchgezogen, erledigte sie das, was Maschinen nicht vollbrachten.
Parrer Savea verfügte nicht über die finanziellen Mittel, um die dauerhaften Wartungszyklen der solarbetriebenen Geräte bezahlen zu können. Auf seiner Farm arbeiteten alle mit Muskelkraft. Unabhängig zu sein, eigenständig und stolz darauf, war Saveas Motto.
Er streckte seine mehr als 1,90 Meter in die Höhe, lockerte die Muskulatur und gähnte herzhaft. Dann packte er die Sense und begann mit ökonomischen Bewegungen, das Gras zu bearbeiten.
Schnitt. Ausholen. Schnitt. Ausholen. Schnitt. Immerzu. In einem beinahe hypnotischen Rhythmus.
Das Gras fiel, er setzte die Füße voran und weiter ging es.
Irgendwann befreite sich sein Verstand von dieser Aufgabe, die nun seine Muskeln automatisch vollbrachten. Von der Konzentration auf die Arbeit, die er tat, entledigt, verirrten sich die Gedanken in Tagträume.
Von seiner Frau Nahita, die bald ihr erstes Kind erwartete. Er erinnerte sich an das nachdenkliche Gesicht der Natalmedizinerin, die das Ergebnis via Ferndiagnosesystem ermittelt hatte, als seltsam farblose, unwirklich erscheinende Nachbildung eines echten Menschen aus dem Monitor hinausstarrte und sagte: „Ich rate Ihnen, spätestens drei Monate vor der Geburt nach Mount Elias zurückzukehren. Sie sind weit ab von jeglicher schnellen Hilfe und es ist Ihr erstes Kind, Zivisa Savea. Da besteht ein Restrisiko.“
Nahita schüttelte energisch den Kopf. „Das ist Haupterntezeit. Ich werde meinen Mann nicht alleine lassen.“
„Ich spreche die Warnung nur ungern aus, aber es geht um Ihr Kind.“
„Ja, ich verstehe. Allerdings haben Frauen jahrtausendelang Kinder weitab von medizinischen Einrichtungen und ohne die Hilfe von Ärzten zur Welt gebracht. Ich schaffe das.“
„Diese Frauen lebten auch auf Ursprung, Zivisa. Ihre Geburt wird auf einer sehr jungen Heimatwelt stattfinden. Auf einem Planeten, der primär nicht für die Menschen vorgesehen war. Wir müssen, trotz aller gegenteiligen Forschungen, in Betracht ziehen, dass es irgendwo auf dieser neuen Heimat Krankheitskeime gibt, die Ihnen oder Ihrem Kind schaden könnten. Vier bis fünf Tage brauchen Sie im Notfall, um nach Mount Elias zu kommen. Selbst Ihr nächster Nachbar ist weit …“
„Ich will das nicht hören, Zivisa. Die Entscheidung ist getroffen.“