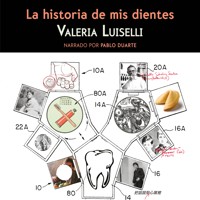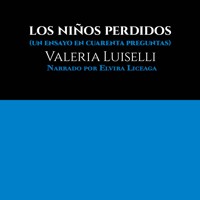19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Mutter, ein Vater, ein Junge und ein Mädchen packen in New York ihre Sachen ins Auto und machen sich auf in die Gegend, die einst die Heimat der Apachen war. Sie fahren durch Wüsten und Berge, machen Halt an einem Diner, wenn sie Hunger haben, und übernachten, wenn es dunkel wird, in einem Motel. Das kleine Mädchen erzählt Witze und bringt alle zum Lachen, der Junge korrigiert jeden, der etwas Falsches sagt. Vater und Mutter sprechen kaum miteinander. Zur gleichen Zeit machen sich Tausende von Kindern aus Zentralamerika und Mexiko nach Norden auf, zu ihren Eltern, die schon in den USA leben. Jedes hat einen Rucksack dabei mit einem Spielzeug und sauberer Unterwäsche. Die Kinder reisen mit einem Coyote: einem Mann, der ihnen Angst macht. Sie haben einen langen Marsch vor sich, für den sie sich Essen und Trinken einteilen müssen. Sie klettern auf Züge und in offene Frachtcontainer. Nicht alle kommen bis zur Grenze. Mit literarischer Virtuosität verknüpft Valeria Luiselli Reise und Flucht zu einem vielschichtigen Roman voller Echos und Reflektionen, zu einer bewegenden und brandaktuellen Geschichte darüber, was Flucht und was Menschlichkeit bedeuten in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Zum Buch
Eine Familie aus New York bricht zu einer Reise auf. Das Ziel ist Apacheria, das Land, in dem einst die Apachen zu Hause waren. Gleichzeitig sind Tausende von Kindern aus Südamerika auf dem Weg in den Norden. Meisterhaft verknüpft Archiv der verlorenen Kinder Reise und Flucht zu einem vielschichtigen Roman voller Echos und Reflektionen.
Eine Mutter, ein Vater, ein Junge und ein Mädchen packen in New York ihre Sachen ins Auto und machen sich auf in die Gegend, die einst die Heimat der Apachen war. Sie fahren durch Wüsten und Berge, machen Halt an einem Diner, wenn sie Hunger haben, und übernachten, wenn es dunkel wird, in einem Motel. Das kleine Mädchen erzählt Witze und bringt alle zum Lachen, der Junge korrigiert jeden, der etwas Falsches sagt. Vater und Mutter sprechen kaum miteinander.
Zur gleichen Zeit machen sich Tausende von Kindern aus Zentralamerika und Mexiko nach Norden auf, zu ihren Eltern, die schon in den USA leben. Jedes hat einen Rucksack dabei mit einem Spielzeug und sauberer Unterwäsche. Die Kinder reisen mit einem Coyote: einem Mann, der ihnen Angst macht. Sie haben einen langen Marsch vor sich, für den sie sich Essen und Trinken einteilen müssen. Sie klettern auf Züge und in offene Frachtcontainer. Nicht alle kommen bis zur Grenze.
Mit literarischer Virtuosität verknüpft Valeria Luiselli Reise und Flucht zu einem vielschichtigen Roman voller Echos und Reflektionen, zu einer bewegenden und brandaktuellen Geschichte darüber, was Flucht und was Menschlichkeit bedeuten in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist.
»Fesselnd und immer überraschend – ein leidenschaftlich engagiertes Buch, eine wunderschöne, liebevolle Hommage an die Kinder, die wir behüten sollen.«
THE NEW YORKER
Über die Autorin
Valeria Luiselli, geb. 1983 in Mexiko City, schreibt für Magazine und Zeitungen wie Letras Libres und die New York Times. Sie hat bisher zwei Romane veröffentlicht, „Die Schwerelosen“ und „Die Geschichte meiner Zähne“, sowie die Essays „Falsche Papiere“. Ihre Bücher wurden in über 20 Sprachen übersetzt und mit Preisen ausgezeichnet. „Archiv der verlorenen Kinder“ ist der erste Roman, den sie in Englisch geschrieben hat. Sie lebt in New York.
VALERIA LUISELLI
Archiv der verlorenen Kinder
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Brigitte Jakobeit
Verlag Antje Kunstmann
Für Maia und Dylan
INHALT
TEIL I: FAMILIEN-SOUNDSCAPE
Umzüge
Schachtel I
Wege & Wurzeln
Schachtel II
Ohne Papiere
Schachtel III
Vermisst
Schachtel IV
Abschiebungen
TEIL II: WIEDERHOLUNG
Deportationen
Landkarten & Schachteln
Schachtel V
Kontinentale Wasserscheide
Verloren
TEIL III: APACHERIA
Staubtäler
Herz des Lichts
Echo Canyon
TEIL IV: ARCHIV DER VERLORENEN KINDER
Schachtel VI
Dokumentieren
Schachtel VII
TEIL I
Familien-Soundscape
UMZÜGE
Ein Archiv setzt einen Archivar voraus,
eine Hand, die sammelt und ordnet.
ARLETTE FARGE
Weggehen heißt ein wenig sterben.
Ankommen heißt nie ankommen.
MIGRANTENGEBET
ABFAHRT
Sie schlafen mit offenem Mund und dem Gesicht zur Sonne. Junge und Mädchen, mit Schweißperlen auf der Stirn und trockenem weißem Speichel auf den roten Wangen. Sie belagern den gesamten hinteren Raum des Wagens, alle viere von sich gestreckt, schwer und friedlich. Vom Beifahrersitz werfe ich hin und wieder einen Blick nach hinten, drehe mich dann wieder um und studiere die Karte. Im zähflüssigen Verkehr kriechen wir über die George Washington Bridge der Stadtgrenze entgegen und fädeln uns in die Interstate ein. Ein Flugzeug zieht über uns hinweg und hinterlässt eine gerade lange Narbe im Rachen des wolkenlosen Himmels. Mein Mann, der am Steuer sitzt, rückt seine Mütze zurecht und wischt sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn.
FAMILIENLEXIKON
Ich weiß nicht, was mein Mann und ich unseren Kindern später mal sagen werden. Ich bin mir nicht sicher, welche Teile unserer Geschichte wir für sie auswählen und bearbeiten, welche wir hin und her schieben und wieder einfügen, um eine endgültige Version zu erhalten – auch wenn das Auswählen, Umstellen und Bearbeiten von Tönen und Klängen vermutlich am besten zusammenfasst, womit mein Mann und ich unseren Lebensunterhalt verdienen. Aber die Kinder werden fragen, weil Kinder nun mal so sind. Und wir werden ihnen einen Anfang, eine Mitte und ein Ende erzählen müssen. Wir werden ihnen eine Antwort geben, eine richtige Geschichte erzählen müssen.
Der Junge wurde gestern zehn, einen Tag vor unserer Abreise aus New York. Wir kauften ihm schöne Geschenke. Er hatte ausdrücklich gesagt:
Kein Spielzeug.
Das Mädchen ist fünf und fragt seit Wochen unablässig:
Wann werde ich sechs?
Da sie keine unserer Antworten zufriedenstellt, sagen wir meistens etwas Schwammiges wie:
Bald.
In ein paar Monaten.
Schneller, als du denkst.
Das Mädchen ist meine Tochter, der Junge der Sohn meines Mannes. Ich bin die biologische Mutter des Mädchens, die Stiefmutter des Jungen und in der Praxis für beide die Mutter. Mein Mann ist Vater und Stiefvater für jeweils eines der beiden Kinder, aber auch einfach Vater. Folglich sind das Mädchen und der Junge: Stiefschwester, Sohn, Stieftochter, Tochter, Stiefbruder, Schwester, Stiefsohn, Bruder. Und weil Bindestriche und unwichtige Nuancen die Sätze der Alltagsgrammatik verkomplizieren – das wir, das sie, das unser, das euer –, entschieden wir uns, nachdem wir zusammenzogen, als der Junge fast sechs und das Mädchen noch ein Kleinkind war, für das viel schlichtere unsere, wenn wir über die beiden sprachen. Sie wurden: unsere Kinder. Und manchmal: der Junge, das Mädchen. Die beiden lernten rasch die Regeln unserer privaten Grammatik und gewöhnten sich die generischen Substantive Mama und Papa an, oder manchmal nur Ma und Pa. Und zumindest bis heute bestimmte unser Familienlexikon den Rahmen und die Grenzen unseres gemeinsamen Lebens.
FAMILIENPLOT
Mein Mann und ich lernten uns vor vier Jahren bei Tonaufnahmen für eine Soundscape von New York kennen. Wir gehörten zu einem großen Team von Leuten, die für das Center for Urban Science and Progress der New York University arbeiteten. Die Soundscape sollte sämtliche für die Stadt symbolischen Grundgeräusche und Hörmarken stichprobenartig erfassen und sammeln: quietschend zum Stehen kommende U-Bahn-Wagen, Musik in den langen unterirdischen Gängen der Forty-Second-Street, Prediger in Harlem, Glocken, Gerüchte und Gemunkel in der Wall Street. Doch auch alle anderen Geräusche und Klänge, die eine Stadt erzeugt und die meist gar nicht als Lärm wahrgenommen werden, sollten erhoben und eingeordnet werden: auf- und zuspringende Registrierkassen in Delis, ein Text, der in einem leeren Broadway-Theater einstudiert wird, Unterwasserströmungen im Hudson, Schwärme von Kanadagänsen, die auf den Van Cortlandt Park scheißen, schwingende Schaukeln auf Spielplätzen in Astoria, ältere Koreanerinnen, die wohlhabenden Frauen in der Upper West Side die Fingernägel feilen, ein in einem alten Mietshaus in der Bronx ausgebrochenes Feuer, ein Passant, der einen anderen mit Schimpfwörtern überschwemmt. In unserem Team waren Journalisten, Klangkünstler, Geografen, Stadtplaner, Schriftsteller, Historiker, Akustemologen, Anthropologen, Musiker und sogar Hydrografen, die mit komplizierten Geräten wie Mehrstrahl-Echoloten die Tiefe und Konturen von Flussbetten und wer weiß was sonst noch vermessen. Zu zweit oder in Gruppen wurden Wellenlängen in der ganzen Stadt erhoben und gesampelt, als dokumentierten wir die letzten Laute einer gewaltigen Bestie.
Wir zwei wurden zusammengespannt und damit beauftragt, sämtliche in der Stadt gesprochenen Sprachen über einen Zeitraum von vier Kalenderjahren aufzunehmen. Unsere Aufgabenbeschreibung lautete: »eine Erhebung der sprachlich mannigfaltigsten Metropole auf dem Planeten und die Aufzeichnung sämtlicher Sprachen, die ihre Erwachsenen und Kinder sprechen«. Wie sich herausstellte, machten wir unsere Sache gut, vielleicht sogar sehr gut. Wir waren ein perfektes Zweierteam. Nach wenigen Monaten Zusammenarbeit verliebten wir uns – total, unvernünftig, vorhersehbar und Hals über Kopf, wie sich vielleicht ein Stein in einen Vogel verlieben würde, ohne zu wissen, wer der Stein und wer der Vogel war – und im Sommer beschlossen wir, zusammenzuziehen.
Das Mädchen erinnert sich natürlich nicht an diese Zeit. Der Junge behauptet, er erinnere sich daran, dass ich immer eine alte blaue, bis zu den Knien reichende Strickjacke trug, an der ein paar Knöpfe fehlten, und dass ich sie manchmal, wenn wir mit der U-Bahn oder dem Bus fuhren – wo die Klimaanlage immer eiskalte Luft verströmte –, auszog und als Decke benutzte, um ihn und das Mädchen zu wärmen, und dass sie nach Tabak roch und kratzte. Unser Zusammenziehen war eine unbedachte Entscheidung – chaotisch, verwirrend, zwingend und so schön und wirklich, wie das Leben ist, wenn man nicht über die Folgen nachdenkt. Wir wurden ein Stamm. Dann kamen die Folgen. Wir lernten die Verwandten des jeweils anderen kennen, heirateten, gaben gemeinsame Steuererklärungen ab, wurden eine Familie.
BESTANDSAUFNAHME
Auf den Vordersitzen: er und ich. Im Handschuhfach: Versicherungsnachweis, Fahrzeugschein, Benutzerhandbuch und Straßenkarten. Auf der Rückbank: die beiden Kinder, ihre Rucksäcke, eine Taschentuchbox und eine blaue Kühltasche mit Wasserflaschen und begrenzt haltbaren Snacks. Und im Kofferraum: eine kleine Reisetasche mit meinem digitalen Sony PCM-D50 Audiorekorder, Kopfhörer, Kabel und Ersatzbatterien; eine große Porta-Brace-Tasche für seine Teleskopangel, Mikro, Kopfhörer, Kabel, Korb- und Fell-Windschutz, und den Sound Devices 702T. Außerdem: vier kleine Koffer mit unseren Kleidern und sieben Archivschachteln (40x30x25) mit verstärkten Böden und soliden Deckeln.
KOVALENZ
Trotz unserer Bemühungen, alles fest zusammenzuhalten, gab es, im Hinblick auf die eigene Position in der Familie, bei jedem eine gewisse Unsicherheit. Wir ähneln jenen komplizierten Molekülen, die man aus dem Chemieunterricht kennt, mit kovalenter statt ionischer Bindung – oder andersrum. Der Junge hatte seine leibliche Mutter bei der Geburt verloren, ein Thema, über das nie gesprochen wird. Mein Mann verkündete mir diese Tatsache gleich am Anfang unserer Beziehung in einem Satz, und ich begriff sofort, dass keine weiteren Fragen erwünscht waren. Und weil auch ich nicht gerne über den biologischen Vater des Mädchens spreche, haben wir beide uns immer an einen respektvollen Schweigepakt über diese Aspekte unserer Vergangenheit und der unserer Kinder gehalten.
Vielleicht wollten die Kinder deshalb immer Geschichten über sich und uns hören. Sie wollen alles darüber wissen, wann sie beide unsere Kinder und wir eine Familie wurden. Sie sind wie Anthropologen, die kosmogonische Narrative studieren, nur mit etwas mehr Narzissmus. Das Mädchen will ständig dieselben Geschichten hören. Der Junge fragt nach Momenten ihrer gemeinsamen Kindheit, als läge sie Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte zurück. Also erzählen wir ihnen. Wir erzählen ihnen sämtliche Geschichten, an die wir uns erinnern können. Und sobald wir einen Teil auslassen, eine Kleinigkeit verwechseln oder nur geringfügig von der ihnen bekannten Version abweichen, unterbrechen und verbessern sie uns und verlangen, dass die Geschichte noch einmal erzählt wird, und diesmal richtig. Dann spulen wir das Band in unseren Köpfen zurück und spielen es von vorne ab.
GRÜNDUNGSMYTHEN
Unseren Anfang markieren eine fast leere Wohnung und eine Hitzewelle. In dieser Wohnung – derselben Wohnung, die wir gerade auflösten – saßen wir im Wohnzimmer auf dem Fußboden, alle vier in Unterwäsche, verschwitzt und müde, und aßen Pizza aus der Hand.
Wir hatten ein paar unserer Habseligkeiten und die Sachen, die wir an dem Tag gekauft hatten, ausgepackt: einen Korkenzieher, vier neue Kopfkissen, Fensterreiniger, Spülmittel, zwei kleine Bilderrahmen, Nägel, Hammer. Dann maßen wir die Größe unserer Kinder und malten die ersten Striche an die Flurwand: 84 und 107 Zentimeter. Dann hämmerten wir zwei Nägel in die Küchenwand und hängten zwei Postkarten aus unseren jeweiligen früheren Wohnungen auf: ein Porträt von Malcolm X, aufgenommen kurz vor seiner Ermordung, wo er den Kopf auf die rechte Hand stützt und jemanden oder etwas genau betrachtet; das zweite zeigt den aufrecht stehenden Emiliano Zapata, ein Gewehr in einer und einen Säbel in der anderen Hand, mit einer über die Schulter geschlungenen Schärpe und dem doppelten Patronengürtel über Kreuz auf der Brust. Das Glas vor der Postkarte von Zapata hatte noch den Schmutzfilm – oder war es Ruß? – aus meiner alten Küche. Wir hängten beide Bilder neben dem Kühlschrank auf. Aber selbst danach sah die neue Wohnung noch zu leer aus, die Wände zu weiß, fühlte sich fremd an.
Der Junge schaute sich Pizza kauend im Wohnzimmer um und fragte:
Und jetzt?
Das Mädchen, damals zwei Jahre alt, wiederholte seine Frage:
Ja, was jetzt?
Wir wussten beide keine Antwort, obwohl ich scharf nachdachte, denn vermutlich war es eine Frage, die uns insgeheim selbst die ganze Zeit beschäftigt hatte.
Und jetzt? bohrte der Junge nach.
Schließlich antwortete ich:
Jetzt geht ihr euch die Zähne putzen.
Aber unsere Zahnbürsten sind noch nicht ausgepackt, sagte der Junge.
Dann spült euch im Bad den Mund über dem Waschbecken aus und geht schlafen, erwiderte mein Mann.
Sie kamen aus dem Bad zurück und sagten, sie hätten Angst, allein in dem neuen Schlafzimmer zu schlafen. Wir erlaubten ihnen, eine Weile bei uns im Wohnzimmer zu bleiben, wenn sie versprachen zu schlafen. Sie krochen in einen leeren Pappkarton, und nach einigem Gerangel um die gerechte Platzaufteilung fielen sie in einen tiefen, schweren Schlaf.
Mein Mann und ich öffneten eine Flasche Wein und rauchten am Fenster einen Joint. Dann setzten wir uns auf den Fußboden, machten nichts, sagten nichts, beobachteten die schlafenden Kinder. Von unserem Platz aus sahen wir nur ein Durcheinander von Köpfen und Hintern: sein Haar schweißverklebt, ihre Locken ein wirres Nest; sein Po flach wie eine Tablette, ihrer mit runden Apfelbacken. Sie sahen aus wie ein Paar, das seine gemeinsame Zeit überschritten hat, zu schnell gealtert, einander überdrüssig, aber einigermaßen zufrieden. Sie schliefen in totaler, einsamer Gemeinschaft. Hin und wieder wurde unser leicht angetörntes Schweigen unterbrochen: der Junge schnarchte wie ein Betrunkener, und aus dem Körper des Mädchens drangen lange laute Fürze.
Ein ähnliches Konzert hatten sie schon früher am Tag gegeben, als wir in der U-Bahn vom Supermarkt in unsere neue Wohnung zurückfuhren, umgeben von weißen Plastiktüten mit riesigen Eiern, sehr rosa Schinken, Biomandeln, Maisbrot und kleinen Päckchen mit Biomilch – gesunde Produkte der neuen, verfeinerten Kost einer Familie mit zwei Gehältern. Nach ein paar Minuten in der U-Bahn schliefen die Kinder, die Köpfe auf unserem Schoß, verfilztes feuchtes Haar, ein angenehm salziger Geruch von den warmen Brezeln, die wir kurz zuvor an einer Straßenecke gegessen hatten. Sie waren engelsgleich, wir noch einigermaßen jung, und zusammen bildeten wir einen schönen Stamm, eine beneidenswerte Truppe. Plötzlich fing er an zu schnarchen und sie zu furzen. Die wenigen Fahrgäste, die nicht an ihren Handys hingen, bekamen es mit, schauten das Mädchen an, uns, den Jungen, und lächelten – schwer zu sagen, ob aus Mitleid oder Komplizenschaft mit der öffentlichen Schamlosigkeit unserer Kinder. Mein Mann erwiderte das Lächeln der lächelnden Fremden. Ich dachte kurz daran, ihre Aufmerksamkeit von uns wegzulenken und den alten Mann, der ein paar Sitze weiter schlief, vorwurfsvoll anzusehen oder vielleicht die junge Frau im vollen Joggingoutfit. Was ich natürlich nicht tat. Ich nickte nur ergeben oder resigniert und lächelte die Fremden an – ein verkniffenes schmallippiges Lächeln. Vermutlich hatte ich die Art von Lampenfieber, die einen in bestimmten Träumen überkommt, wenn man feststellt, dass man in der Schule ist und vergessen hat, eine Unterhose anzuziehen; eine jähe, tiefe Verletzlichkeit vor all diesen Fremden, denen wir einen kurzen Einblick in unser noch sehr neues Leben boten.
Am Abend jedoch, zurück in der Privatsphäre unserer neuen Wohnung, als die Kinder schliefen und ständig diese wunderschönen Geräusche von sich gaben – wahre Schönheit ist immer unbeabsichtigt –, konnte ich ihnen aufmerksam und ohne lästige Befangenheit lauschen. Die Darmgeräusche des Mädchens wurden durch die Pappwand verstärkt und wanderten unsichtbar durch das fast leere Wohnzimmer. Nach einer Weile hörte der Junge sie irgendwo tief im Schlaf – so jedenfalls kam es uns vor – und antwortete mit Wortfetzen und Gemurmel. Mein Mann stellte fest, dass wir eine der Sprachen der städtischen Soundscape hörten, verwendet im zirkulären Akt der Unterhaltung:
Ein Mund antwortet einem Po.
Ich unterdrückte kurz das Bedürfnis zu lachen, merkte dann aber, dass auch mein Mann mit geschlossenen Augen die Luft anhielt, um nicht zu lachen. Vielleicht waren wir mehr stoned, als wir dachten, jedenfalls konnte ich nicht mehr, meine Stimmbänder gaben ein eher schweineartiges als menschliches Geräusch von sich. Er ließ ebenfalls los, prustete und gluckste, seine Nasenflügel bebten, die Augen verschwanden fast in seinem verzerrten Gesicht, und er schaukelte vor und zurück wie eine kaputte Piñata. Die meisten Menschen sehen furchterregend aus, wenn sie herzhaft lachen. Mir waren schon immer Leute suspekt, die nur mit den Zähnen klicken, und ich fand es ziemlich beunruhigend, wenn jemand beim Lachen keinen Ton von sich gibt. In meiner Familie väterlicherseits gibt es einen genetischen Defekt, der sich am Ende jeder Lachsalve in Schnauben und Grunzen Bahn bricht. Bis alle Tränen in den Augen haben und sie ein Schamgefühl überkommt.
Ich atmete tief durch und wischte mir eine Träne von der Wange. Im selben Moment wurde mir klar, dass mein Mann und ich uns zum ersten Mal lachen gehört hatten, das heißt aus vollem Herzen – enthemmt, befreit, völlig idiotisch. Vielleicht kennen wir uns erst richtig, wenn wir wissen, wie der andere lacht. Schließlich beruhigten mein Mann und ich uns wieder.
Eigentlich ist es gemein, dass wir auf Kosten unserer Kinder lachen, oder? fragte ich.
Ja, völlig daneben.
Wir beschlossen, dass wir diesen Augenblick festhalten sollten, und holten unsere Aufnahmegeräte. Mein Mann schwenkte seine Tonangel durch den Raum; ich hielt meinen Voicerekorder nah an den Jungen und das Mädchen ran. Sie lutschte am Daumen, und er murmelte Worte und merkwürdige Schlafgeräusche hinein; im Mikro meines Mannes waren auf der Straße vorbeifahrende Autos zu hören. In kindlicher Komplizenschaft nahmen wir ihre Geräusche auf. Ich bin mir nicht sicher, welche tieferen Gründe uns dazu bewegten, die Kinder an diesem Abend aufzunehmen. Vielleicht lag es einfach an der Sommerhitze, plus dem Wein, minus dem Joint, multipliziert mit der Aufregung des Umzugs, geteilt durch das Recyceln der vielen Pappkartons, das uns noch bevorstand. Oder wir folgten dem Impuls, den Augenblick zuzulassen, weil er sich anfühlte wie der Beginn von etwas Neuem, um eine Spur zu hinterlassen. Schließlich hatten wir unseren Verstand darauf trainiert, Aufnahmegelegenheiten zu nutzen, unsere Ohren trainiert, dem täglichen Leben zu lauschen, als wäre es Rohmaterial. Alles, wir und sie, hier und dort, innen und außen, wurde festgehalten, gesammelt und archiviert. Vielleicht müssen neue Familien wie junge Nationen nach gewaltsamen Unabhängigkeitskriegen ihre Anfänge in einem symbolischen Augenblick verankern und in der Zeit festnageln. Dieser Abend war unser Fundament, der Abend, an dem unser Chaos ein Kosmos wurde.
Später, als wir müde waren und unseren Schwung verloren hatten, trugen wir die Kinder in ihr neues Zimmer und legten sie auf ihre Matratzen, die nicht viel größer waren als der Pappkarton, in dem sie geschlafen hatten. Dann fielen wir in unserem Schlafzimmer auf unsere eigene Matratze, schlangen die Beine ineinander und schwiegen, aber unsere Körper sagten, vielleicht später, vielleicht morgen, morgen lieben wir uns, schmieden Pläne, morgen.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
MUTTERSPRACHEN
Als ich zur Mitarbeit an dem Soundscape-Projekt eingeladen wurde, fand ich es zunächst protzig, megalomanisch, irgendwie zu didaktisch. Ich war jung, wenn auch nicht viel jünger als heute, und sah mich noch als politische Hardcore-Journalistin. Außerdem gefiel mir nicht, dass das Projekt, obwohl vom Center for Urban Science and Progress der NYU organisiert und später für dessen Tonarchiv gedacht, zum Teil von einigen multinationalen Konzernriesen finanziert wurde. Ich recherchierte ein bisschen über ihre CEOs – gab es Skandale, Betrügereien, irgendwelche faschistischen Verbindungen? Aber ich hatte eine kleine Tochter. Als ich erfuhr, dass der Vertrag auch Krankenversicherung einschloss, und feststellte, dass ich von dem Gehalt leben konnte, ohne tausend journalistische Kleinaufträge annehmen zu müssen, hörte ich auf zu recherchieren und so zu tun, als könnte ich es mir leisten, mir über Firmenethik den Kopf zu zerbrechen, und unterschrieb den Vertrag. Ich bin mir nicht sicher, welche Gründe meinen Mann dazu bewegten – damals war er noch ein auf Akustomologie spezialisierter Fremder und nicht mein Ehemann oder Vater unserer Kinder –, aber ungefähr zur selben Zeit unterschrieb er seinen Vertrag.
Wir stürzten uns beide voll und ganz in das Soundscape-Projekt. Jeden Tag gingen wir, während die Kinder in der Krippe und der Schule waren, in die Stadt, ohne zu wissen, was uns erwartete, aber immer sicher, wir würden etwas Neues entdecken. Wir zogen durch die fünf Bezirke, interviewten Fremde und baten sie, in ihrer Muttersprache zu sprechen und etwas darüber zu erzählen. Er mochte die Tage, die wir in Durchgangsräumen wie Bahnstationen, Flughäfen und Bushaltestellen verbrachten. Ich mochte die Tage in den Schulen, wo wir Kinder befragten. Mit hochgehaltener Tonangel und über die rechte Schulter geschlungener Porta-Brace schlenderte er durch volle Cafeterias und nahm das Durcheinander von Stimmen, Besteck und Schritten auf. Ich hielt den Kindern in Gängen und Klassenzimmern meinen Rekorder dicht vor den Mund, während sie meine Fragen beantworteten. Ich wollte wissen, ob sie sich an Lieder und Sprichwörter erinnern, die sie zu Hause hörten. Ihr Akzent war oft anglisiert und angepasst, die Sprachen ihrer Eltern waren ihnen mittlerweile fremd. Ich erinnere mich, wie sie mit ihren rosa Zungen ernst und diszipliniert versuchten, die Eigenheiten und Laute ihrer zunehmend fernen Muttersprachen zu bewältigen: die schwierige Stellung der Zungenspitze beim spanischen erre, die schnellen Zungenschläge gegen den Gaumen in den vielen mehrsilbigen Wörtern der Kichwa und Karif, das weiche, abwärts gewölbte Zungenbett beim aspirierten arabischen h.
Monatelang nahmen wir Stimmen auf und sammelten Akzente. Wir hatten jede Menge Material, auf dem Menschen sprachen, Geschichten erzählten, Pausen machten, Lügen auftischten, beteten, zögerten, beichteten, atmeten.
ZEIT
Wir sammelten auch immer mehr Dinge: Pflanzen, Teller, Bücher, Stühle. In wohlhabenden Vierteln nahmen wir Sachen mit, die auf der Straße standen. Später stellten wir dann fest, dass wir nicht noch einen Stuhl oder ein Bücherregal brauchten, stellten das Gesammelte in unserem weniger wohlhabenden Viertel auf den Gehsteig zurück und fühlten uns dabei wie die unsichtbare linke Hand der Umverteilung von Besitztümern – die Anti-Adam-Smiths der Bürgersteige und Bordsteinkanten. Eine Zeit lang sammelten wir weiter Sachen von der Straße, bis wir eines Tages im Radio von einer Wanzenplage in der Stadt hörten und es sein ließen, Sperrmüll durchzuwühlen und Besitztümer umzuverteilen. Es wurde Winter, und dann kam der Frühling.
Es ist nie ganz klar, was eine Wohnung in ein Heim verwandelt und ein Lebensprojekt in ein Leben. Irgendwann passten unsere Bücher nicht mehr in die Regale, und aus dem großen leeren Raum in unserer Wohnung war unser Wohnzimmer geworden, der Ort, wo wir uns Filme ansahen, Bücher lasen, Puzzles zusammensetzten, Nickerchen machten, den Kindern bei den Hausaufgaben halfen. Wir saßen dort mit Freunden zusammen, führten nach ihrem Aufbruch lange Diskussionen, vögelten, sagten schöne und schreckliche Dinge zueinander und räumten hinterher schweigend auf.
Keine Ahnung, wie die Zeit vergangen und wohin sie verschwunden war, aber der Junge war plötzlich acht, dann neun und das Mädchen fünf. Sie besuchten dieselbe öffentliche Schule. Die vielen kleinen Fremden, die sie kennengelernt hatten, waren jetzt ihre Freunde. Es gab Fußballteams, Turnen, Theateraufführungen am Schuljahresschluss, Übernachtungspartys, immer zu viele Geburtstagsfeiern, und die Striche im Flur, mit denen wir die Größe unserer Kinder markierten, erzählten eine vertikale Geschichte. Sie waren so groß geworden! Mein Mann fand, dass sie zu schnell wuchsen. Unnatürlich schnell, sagte er, wegen der Biovollmilch, die sie aus diesen kleinen Päckchen tranken; seiner Ansicht nach war die Milch chemisch verändert, um bei Kindern frühzeitiges Wachstum zu fördern. Vielleicht, dachte ich. Aber vielleicht war auch einfach nur Zeit vergangen.
ZÄHNE
Wie weit noch?
Wie lange noch?
Vermutlich ist das bei allen Kindern so: Wenn sie im Auto wach sind, wollen sie beachtet werden, Pinkelpausen machen, Snacks essen. Aber am häufigsten fragen sie:
Wann sind wir endlich da?
Meistens antworten wir den beiden, dass es nicht mehr lange dauert. Oder wir sagen:
Spielt mit euren Spielsachen.
Zählt alle weißen Autos, die vorbeifahren.
Versucht zu schlafen.
Als wir in der Nähe von Philadelphia an einer Zahlstelle halten, wachen sie plötzlich auf, als würden sie ihren Schlaf miteinander und, etwas schwerer erklärbar, mit den wechselnden Fahrtgeschwindigkeiten abstimmen. Das Mädchen ruft von hinten:
Wie viele Straßen noch?
Nur noch ein Weilchen, dann machen wir halt in Baltimore, sage ich.
Aber wie viele Straßen noch, bis wir ganz da sind?
»Ganz da« ist in Arizona. Geplant ist, dass wir von New York in die südöstliche Ecke des Staates fahren. Auf der Fahrt in südwestlicher Richtung zu den Grenzgebieten werden mein Mann und ich an unseren neuen Tonprojekten arbeiten und Feldaufnahmen und Umfragen machen. Ich werde Interviews führen und Gesprächsfetzen zwischen Fremden einfangen, Nachrichten aus dem Radio und Stimmen in Dinern aufnehmen. In Arizona werde ich meine letzten Aufzeichnungen machen und anfangen, alles zu bearbeiten. Dazu bleiben mir vier Wochen Zeit. Dann muss ich wahrscheinlich mit dem Mädchen zurück nach New York fliegen, doch das steht noch nicht endgültig fest. Wie der genaue Plan meines Mannes aussieht, weiß ich nicht. Ich betrachte sein Profil. Er konzentriert sich auf die Straße. Er wird den Wind mitschneiden, der in Ebenen oder auf Parkplätzen weht; Schritte auf Kies, Beton oder Sand; Kleingeld, das in Registrierkassen fällt, Zähne, die Erdnüsse zerkauen, eine Kinderhand, die in einer Jackentasche voller Kieselsteine wühlt. Ich weiß nicht, wie lange sein neues Projekt dauert oder was als Nächstes kommt. Das Mädchen unterbricht unser Schweigen und beharrt auf seiner Frage:
Ich hab euch was gefragt, Mama, Papa. Wie viele Straßen noch, bis wir ganz da sind?
Wir müssen uns ermahnen, geduldig zu sein. Wir wissen – und vermutlich weiß es auch der Junge –, wie verwirrend es sein muss, in der zeitlosen Welt einer Fünfjährigen zu leben: einer Welt, in der Zeit im Überfluss vorhanden ist. Mein Mann gibt dem Mädchen schließlich eine Antwort, die es offensichtlich zufriedenstellt:
Wir sind ganz da, wenn du unten deinen zweiten Zahn verlierst.
VERKNOTETE ZUNGEN
Als das Mädchen mit vier die Vorschule besuchte, verlor sie frühzeitig einen Zahn. Unmittelbar danach fing sie an zu stottern. Wir wussten nicht, ob es einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Schule, Zahn und Stottern gab. In unserer Familiengeschichte jedoch verband sich alles drei zu einem verwirrenden, emotional aufgeladenen Knoten.
Eines Morgens während unseres letzten Winters in New York unterhielt ich mich mit der Mutter einer Klassenkameradin meiner Tochter. Wir warteten in der Schulaula, um neue Elternvertreter zu wählen, standen eine Weile in der Schlange und tauschten Geschichten über die sprachlichen und kulturellen Schwächen unserer Kinder aus. Meine Tochter hat ein Jahr lang gestottert, erzählte ich ihr, und phasenweise gar nicht mehr gesprochen. Sie fing jeden Satz an, als müsste sie gleich niesen. Irgendwann stellte sie fest, dass sie nicht stottert, wenn sie einen Satz singt, anstatt ihn zu sprechen. Ihr Sohn, erzählte mir die Frau, hatte seit fast sechs Monaten kein Wort gesagt, in keiner Sprache.
Wir fragten einander, woher wir kamen und welche Sprachen wir zu Hause benutzt hatten. Sie kam aus der Mixteca-Region. Ihre erste Sprache war Trique. Ich hatte diese Sprache noch nie gehört und wusste nur, dass es eine der komplexesten tonalen Sprachen ist, mit mehr als acht Tonhöhen. Meine Großmutter war Hnahnu und sprach Otomí, eine einfachere tonale Sprache als Trique, mit nur drei Tonhöhen. Aber meine Mutter lernte diese Sprache nicht, und so lernte ich sie natürlich auch nicht. Meine Frage, ob ihr Sohn Trique beherrsche, verneinte sie und fügte hinzu:
Unsere Mütter bringen uns das Sprechen bei, und das Leben gewöhnt es uns wieder ab.
Nachdem wir gewählt hatten und uns verabschieden wollten, stellten wir uns einander vor, was eigentlich umgekehrt hätte laufen sollen. Sie hieß Manuela, genau wie meine Großmutter, ein Zufall, den sie weniger amüsant fand als ich. Ich fragte, ob ich sie irgendwann einmal aufnehmen dürfe, und erzählte ihr von der fast abgeschlossenen Tondokumentation, an der mein Mann und ich arbeiteten. Von Trique hatten wir bisher noch keine Stichprobe – es war eine seltene Sprache, an die nicht leicht heranzukommen war. Sie willigte zögernd ein, und als wir uns ein paar Tage später im Park neben der Schule trafen, bat sie mich als Gegenleistung für ihre Mitarbeit um einen Gefallen. Sie hatte zwei ältere Töchter – acht und zehn Jahre alt –, die gerade in Amerika angekommen waren; die beiden hatten die Grenze zu Fuß überquert und wurden in einer Notunterkunft in Texas festgehalten. Sie brauchte jemanden, der ihre Papiere möglichst günstig oder umsonst aus dem Spanischen ins Englische übersetzte, damit sie einen Anwalt engagieren konnte, der ihre Töchter vor der Abschiebung bewahrte. Ich erklärte mich bereit, ohne zu ahnen, worauf ich mich da einließ.
VERFAHREN
Anfangs ging es nur um die Übersetzung von Dokumenten: die Geburtsurkunden der Mädchen, Impfpässe, ein Schulzeugnis. Dann folgte eine Reihe von Briefen, die ein Nachbar in Mexiko geschrieben und an Manuela geschickt hatte, mit detaillierten Berichten über die dortige Lage: die unzähmbaren Wellen der Gewalt, das Militär, die Gangs, die Polizei, das plötzliche Verschwinden von Menschen – meist jungen Frauen und Mädchen. Eines Tages dann bat mich Manuela, sie zu einem Treffen mit einer möglichen Anwältin zu begleiten.
Wir trafen uns zu dritt in einem Warteraum des New Yorker Einwanderungsgerichts. Die Anwältin ging einen kurzen Fragebogen durch, stellte ihre Fragen auf Englisch, und ich übersetzte für Manuela ins Spanische. Sie erzählte ihre Geschichte und die der Mädchen. Die Familie stammte aus einer kleinen Stadt an der Grenze zu den Provinzen Oaxaca und Guerrero. Vor ungefähr sechs Jahren, als das jüngere der beiden Mädchen zwei wurde und das andere vier war, ließ Manuela sie in der Obhut ihrer Großmutter zurück. Das Essen war knapp, es war unmöglich, zwei Mädchen unter diesen ärmlichen Bedingungen großzuziehen, erklärte sie. Sie überquerte ohne Papiere die Grenze und ließ sich in der Bronx nieder, wo sie eine Cousine hatte. Sie fand einen Job und fing an, Geld nach Hause zu schicken. Geplant war, in kurzer Zeit möglichst viel zu sparen und bald wieder zurückzukehren. Aber sie wurde schwanger, das Leben wurde kompliziert, und die Jahre vergingen schnell. Die Mädchen wurden größer, telefonierten mit ihr, hörten Geschichten über Schnee, über große breite Straßen, Brücken, Verkehrsstaus und später über ihren kleinen Bruder. Als die Situation in Mexiko immer schwieriger und unsicherer wurde, bat Manuela ihren Chef um ein Darlehen und bezahlte einen Schlepper, um die Mädchen zu ihr in die Vereinigten Staaten zu bringen.
Die Großmutter traf die Vorbereitungen, sagte den Mädchen, es würde eine lange Reise werden, packte ihre Rucksäcke: Bibel, Wasserflaschen, Nüsse, für jede ein Spielzeug, Ersatzwäsche. Sie nähte ihnen identische Kleider, und am Tag vor der Abreise nähte sie Manuelas Telefonnummer an die Krägen der Kleider, weil die Mädchen es nicht geschafft hatten, die zehn Zahlen auswendig zu lernen, und schärfte ihnen immer wieder ein: Diese Kleider sollten sie nie ausziehen, niemals, und sobald sie in Amerika waren und dem ersten Amerikaner begegneten, egal ob Polizist oder Privatperson, sollten sie ihm oder ihr die Unterseite des Kragens zeigen. Die Person würde dann die Nummer anrufen und sie mit ihrer Mutter sprechen lassen. Der Rest würde sich ergeben.
Und das tat er, nur nicht wie geplant. Die Mädchen schafften es sicher bis zur Grenze, doch der Schlepper brachte sie nicht hinüber, sondern ließ sie mitten in der Nacht in der Wüste zurück. Im Morgengrauen wurden sie von der Border Patrol gefunden; sie saßen am Straßenrand in der Nähe eines Kontrollpunktes und wurden in ein Auffanglager für unbegleitete Kinder gebracht. Ein Beamter rief Manuela an und erklärte ihr, dass man die Mädchen gefunden hatte. Er klang freundlich und nett, sagte sie, zumindest für einen Officer der Border Patrol. Laut dem Gesetz, sagte er, müssten Kinder aus Mexiko und Kanada, anders als Kinder aus anderen Ländern, sofort zurückgeschickt werden. Es sei ihm gelungen, sie in Gewahrsam zu nehmen, doch von jetzt an bräuchte sie einen Anwalt. Bevor er auflegte, durfte sie mit den Mädchen sprechen. Er gab ihnen fünf Minuten. Es war das erste Mal seit ihrer Abreise, dass sie ihre Stimmen wieder hörte. Das ältere Mädchen sagte, es ginge ihnen gut. Das jüngere atmete nur in den Hörer und schwieg.
Nachdem die Anwältin Manuelas Geschichte gehört hatte, bedauerte sie, den Fall nicht annehmen zu können. Er sei nicht »hieb- und stichfest«, weitere Gründe lieferte sie nicht. Manuela und ich wurden aus dem Raum geführt, durch Gänge, Aufzüge nach unten und zum Gebäude hinaus. Wir gingen zum Broadway – es war später Vormittag – und die Stadt vibrierte, der Himmel war strahlend blau, die Sonne schien über hohen, soliden Gebäuden, als wäre nichts Schlimmes passiert. Ich versprach, ihr bei der Suche nach einem guten Anwalt zu helfen und sie auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen.
GEMEINSAMES ARCHIVIEREN
Es wurde Frühling, mein Mann und ich reichten unsere Steuererklärung ein und wir lieferten das Material für das Soundscape-Projekt ab. In New York gab es über achthundert Sprachen, und nach vier Jahren Arbeit hatten wir von fast allen Stichproben. Endlich konnten wir weitermachen. Es ging voran, aber nicht unbedingt gemeinsam.
Ich hatte mich weiter mit der Rechtssache gegen Manuelas Töchter beschäftigt. Der Anwalt einer Non-Profit-Organisation hatte den Fall schließlich angenommen. Die Mädchen waren zwar noch immer nicht bei ihrer Mutter, aber zumindest von einer brutalen, halb geschlossenen Jugendstrafanstalt in Texas in eine angeblich humanere Umgebung verlegt worden – ein ehemaliges Walmart-Zentrum in der Nähe von Lordsburg, New Mexico, das man in eine Notunterkunft für Minderjährige umgebaut hatte. Um in dem Fall auf dem Laufenden zu bleiben, hatte ich mich ein wenig mit Einwanderungsrecht befasst, Anhörungen im Gericht besucht und mit Anwälten gesprochen. Manuelas Fall war einer von Zehntausenden ähnlicher Fälle im ganzen Land. Mehr als achtzigtausend Kinder ohne Papiere aus Mexiko und dem Nördlichen Dreieck Zentralamerikas, vorwiegend aber aus Letzterem, waren allein in den vergangenen sechs oder sieben Monaten an der südlichen Grenze in den Vereinigten Staaten verhaftet worden. Diese Kinder flohen aus Verhältnissen, die von schlimmem Missbrauch und systematischer Gewalt geprägt waren, flohen aus Ländern, in denen Gangs wie Parastaaten agierten und die Macht und die Herrschaft des Gesetzes übernommen hatten. Sie waren in die Vereinigten Staaten gekommen, um Schutz zu finden, und suchten nach bereits früher ausgewanderten Müttern, Vätern oder Verwandten, die sie vielleicht aufnahmen. Sie suchten nicht den amerikanischen Traum, wie es gewöhnlich immer heißt. Die Kinder suchten nur einen Weg aus ihrem täglichen Albtraum.
Um diese Zeit fingen einige Radiosender und Zeitungen an, über die vielen Kinder zu berichten, die ohne Papiere ins Land gekommen waren, aber niemand schien die Lage aus der Sicht der betroffenen Kinder zu schildern. Ich wandte mich an die Direktorin des Columbia University Center for Oral History und präsentierte ihr eine noch rohe Idee, wie man die Geschichte aus einem anderen Blickwinkel erzählen könnte. Nach einigem Hin und Her und ein paar Zugeständnissen meinerseits erklärte sie sich bereit, mir bei der Finanzierung einer Tondokumentation über die Krise der Kinder an der Grenze zu helfen. Keine große Produktion: nur ich, meine Aufnahmegeräte und ein strenger Zeitplan.
Auch mein Mann hatte mit der Arbeit an einem neuen Projekt begonnen, ohne dass ich es zunächst bemerkte. Es begann mit ein paar Büchern über die Geschichte der Apachen, die sich auf seinem Schreibtisch und Nachttisch stapelten. Da er sich schon immer für das Thema interessiert hatte und den Kindern oft Geschichten über die Apachen erzählte, fand ich es nicht merkwürdig, dass er all diese Bücher las. Dann hingen plötzlich Landkarten von indianischem Territorium und Bilder von Häuptlingen und Kriegern an den Wänden um seinen Schreibtisch. Ich ahnte, dass sich sein lebenslanges Interesse allmählich zu offizieller Recherche auswuchs.
Woran arbeitest du? fragte ich ihn eines Nachmittags.
Nur ein paar Geschichten.
Worüber?
Apachen.
Warum Apachen? Und welche?
Er sagte, er interessiere sich für Häuptling Cochise, Geronimo und die Chiricahua, weil es die letzten Apachen-Führer – moralisch, politisch, militärisch – der letzten freien Völker auf dem amerikanischen Kontinent gewesen waren, die letzten, die sich ergaben. Natürlich war das ein mehr als zwingender Grund, um Recherchen anzustellen, aber doch nicht ganz der, den ich hören wollte.
Später bezeichnete er diese Recherche als sein neues Tonprojekt. Er kaufte ein paar stabile Archivschachteln und füllte sie mit Büchern, Karteikarten mit Notizen und Zitaten, Zeitungsausschnitten, Landkarten, Feldaufnahmen und Tonstudien, die er in öffentlichen Bibliotheken und Privatarchiven fand, sowie einer Reihe kleiner brauner Notizbücher, in die er täglich fast zwanghaft schrieb. Ich fragte mich, welche Art von Klangcollage sich irgendwann aus alldem ergeben könnte. Als ich ihn auf die Schachteln, ihren Inhalt und seine Pläne ansprach und wissen wollte, wie sie sich mit unseren gemeinsamen Plänen vereinbaren ließen, antwortete er nur, das wisse er noch nicht, aber er gebe mir bald Bescheid.
Als er es ein paar Wochen später tat, diskutierten wir unsere nächsten Schritte. Ich sagte, ich wolle mich auf mein Projekt konzentrieren und Geschichten von Kindern und ihren Anhörungen im New Yorker Einwanderungsgericht aufnehmen. Ich sagte außerdem, dass ich daran dachte, mich für einen Job bei einem lokalen Radiosender zu bewerben. Seine Antwort fiel aus, wie ich erwartet hatte. Er wollte an einer Dokumentation über die Apachen arbeiten, hatte sich für ein Stipendium beworben und es erhalten. Das Material, das er für sein Projekt sammeln musste, war an bestimmte Orte gebunden, denn seine Soundscape sollte diesmal anders werden. Er sprach von einem »Echo-Register«, das die Geister Geronimos und der letzten Apachen enthalten würde.
Das Dumme am Leben mit einem anderen ist, dass man ihn jeden Tag sieht und bei einer Unterhaltung all seine Gesten vorhersagen kann, dass man die Absichten hinter seinem Handeln lesen und seine Reaktionen auf bestimmte Umstände ziemlich genau einschätzen kann, dass man sicher ist, den anderen in- und auswendig zu kennen – und trotzdem kann er eines Tages plötzlich ein Fremder werden. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass mein Mann sagen würde, er brauche Zeit für sein neues Projekt, mehr Zeit als nur einen Sommer. Außerdem brauche er Stille und Einsamkeit. Und er müsse für längere Zeit in den Südwesten des Landes ziehen.
Was heißt längere Zeit? fragte ich.
Wahrscheinlich ein bis zwei Jahre, vielleicht auch länger.
Und wo im Südwesten?
Weiß ich noch nicht.
Und was ist mit meinem Projekt? fragte ich.
Dein Projekt ist wichtig, mehr sagte er nicht.
ALLEIN ZUSAMMEN
Ich nehme an, mein Mann und ich hatten uns schlicht nicht auf den zweiten Teil unseres Zusammenseins vorbereitet, den Teil, in dem wir einfach das Leben führten, das wir uns aufgebaut hatten. Ohne ein künftiges gemeinsames berufliches Projekt drifteten wir in anderer Hinsicht langsam auseinander. Vermutlich hatten wir – oder vielleicht auch nur ich – den weitverbreiteten Fehler gemacht, uns einzubilden, dass die Ehe eine absolute Interessengemeinschaft darstellt, die keine Grenzen kennt, anstatt sie schlicht als Pakt zwischen zwei Menschen zu begreifen, die bereit sind, Hüter der Einsamkeit des anderen zu sein, wie Rilke oder irgendein anderer gleichmütiger Philosoph es vor langer Zeit formuliert hatte. Aber kann man sich darauf vorbereiten? Kann man Folgen in Angriff nehmen, bevor man Ursachen entdeckt?
Bei unserer Hochzeitsfeier vor einigen Jahren hatte uns ein Freund mit der orakelhaften Aura eines Betrunkenen kurz vor dem Absturz gesagt, die Ehe sei ein Festmahl, zu dem die Leute zu spät kamen, wenn alles schon halb aufgefuttert war, alle schon zu müde waren und gehen wollten, aber nicht so recht wussten, wie und mit wem.
Aber ich, meine Freunde, kann euch sagen, was zu tun ist, damit eine Ehe ewig hält! sagte er.
Dann schloss er die Augen, ließ das bärtige Kinn auf die Brust sinken und gab den Geist auf.
EINZELPOSTEN
Es folgten viele schwierige Abende, an denen wir, nachdem die Kinder im Bett lagen, das Organisatorische rund um den Plan meines Mannes, für längere Zeit in den Südwesten zu ziehen, ausgiebig diskutierten. Viele schlaflose Nächte, in denen wir verhandelten, stritten, vögelten, neu verhandelten und Lösungen suchten. Ich verbrachte Stunden mit dem Versuch, sein Projekt zu begreifen oder mich zumindest damit anzufreunden, und noch mehr Stunden, ihn mit Argumenten von seinem Plan abzubringen. Eines Abends verlor ich die Nerven und warf sogar mit einer Glühbirne und einer Rolle Klopapier nach ihm, begleitet von einer Reihe lahmer Beschimpfungen.
Doch die Zeit verging, und die Vorbereitungen für die Reise wurden getroffen. Er sah sich im Internet um und bestellte Sachen: Kühltasche, Schlafsack, technischen Schnickschnack. Ich kaufte Landkarten von den Vereinigten Staaten. Eine große vom ganzen Land und mehrere von den Staaten im Süden, die wir vermutlich durchqueren würden. Ich studierte sie bis tief in die Nacht. Als die Reise immer konkreter wurde, versuchte ich mich mit dem Gedanken zu versöhnen, dass ich keine andere Wahl mehr hatte, als eine bereits getroffene Entscheidung zu akzeptieren, und schrieb dann meine eigenen Bedingungen in den Handel, sehr darum bemüht, unser gemeinsames Leben nicht in Einzelposten aufzulisten wie in einer Steuererklärung und eine Art moralische Aufrechnung von Verlusten, Guthaben und steuerpflichtigen Gewinnen zu erstellen. Mit anderen Worten, ich bemühte mich sehr, nicht jemand zu werden, den ich irgendwann verabscheuen würde.
Ich könnte diese neuen Umstände nutzen, sagte ich mir, um mich beruflich neu zu erfinden, mein Leben anders zu gestalten – und ähnliche Ideen, die nur in Horoskopen bedeutungsvoll klingen oder wenn jemand durchdreht und jeden Sinn für Humor verloren hat.
An besseren Tagen, wenn ich meine Gedanken ein wenig vernünftiger sortierte, sagte ich mir, dass unsere berufliche Trennung keinen tieferen Bruch in unserer Beziehung zur Folge haben musste. Eigenen Projekten nachzugehen sollte nicht zwangsläufig zur Auflösung unseres gemeinsamen Lebens führen. Wir könnten in Richtung Süden fahren, sobald das Schuljahr der Kinder endete, und an unseren jeweiligen Projekten arbeiten. Ich wusste noch nicht wie, aber ich könnte vielleicht anfangen zu recherchieren und langsam ein Archiv aufbauen und meinen Fokus auf die Flüchtlingskinderkrise über das New Yorker Einwanderungsgericht hinaus auf die geografischen Brennpunkte in den südlichen Grenzländern erweitern. Das war eine naheliegende Entwicklung in der Recherche an sich, aber auch eine Möglichkeit, unsere beiden sehr unterschiedlichen Projekte miteinander zu vereinbaren. Zumindest fürs Erste. Und zumindest insofern, uns als Familie auf eine Reise in den Südwesten zu begeben. Danach würde uns etwas einfallen.
ARCHIV
Ich studierte Berichte und Artikel über Flüchtlingskinder und versuchte, Informationen darüber zu sammeln, was in den Auffanglagern und Notunterkünften an der Grenze, jenseits des New Yorker Einwanderungsgerichts, vor sich ging. Ich nahm Kontakt mit Anwälten auf, besuchte Konferenzen der New Yorker Anwaltskammer, traf mich mit Mitarbeitern von Non-Profit-Organisationen und Gemeindegruppen. Ich sammelte Notizen, Zeitungsausschnitte, Karteikarten mit Zitaten, Briefe, Landkarten, Fotos, Wortlisten, mitgeschnittene Zeugenaussagen. Als ich langsam in meinem hausgemachten dokumentarischen Labyrinth unterzugehen drohte, kontaktierte ich einen alten Freund, einen auf Archivkunde spezialisierten Professor an der Columbia University, der mir einen langen Brief schrieb und mir eine Liste mit Artikeln und Büchern schickte, die mein Chaos vielleicht ein wenig erhellten. Ich las und las, verbrachte lange schlaflose Nächte lesend über Archivfieber, darüber, wie diasporische Erzählungen das Gedächtnis auffrischten oder wie man sich in der »Asche« des Archivs verliert.
Als ich schließlich klarer sah und eine vernünftige Menge an gut gesichtetem Material zusammenhatte, das mir bei der Umsetzung meiner Dokumentation über die Krisensituation der Kinder an der Grenze hilfreich sein könnte, packte ich alles in eine der Schachteln, die mein Mann noch nicht mit seinen Sachen gefüllt hatte. Ich hatte ein paar Fotos, einige Rechtsdokumente, Aufnahmefragebögen für gerichtliche Prüfverfahren, Karten von den Wüsten im Süden, auf denen Fundorte von toten Migranten verzeichnet waren, und eine Mappe mit zahllosen, aus dem Netz ausgedruckten »Migranten-Mortalitätsberichten« mit Angaben zur wahrscheinlichen Todesursache und dem genauen Fundort. Ganz oben in die Schachtel legte ich ein paar Bücher, die ich gelesen hatte und die mir helfen konnten, mein Projekt aus einer gewissen erzählerischen Distanz zu betrachten: DiePforten des Paradieses von Jerzy Andrzejewski; Der Kinderkreuzzug von Marcel Schwob; Belladonna von Daša Drndić; Der Geschmack des Archivs von Arlette Farge; und ein kleines rotes, noch ungelesenes Buch mit dem Titel Elegien für verlorene Kinder von Ella Camposanto.
Als mein Mann sich darüber beklagte, dass ich eine seiner Schachteln benutzte, beklagte ich mich zurück, dass er vier Schachteln hatte, ich dagegen nur eine. Er meinte, ich als Erwachsene könne mich doch nicht ernsthaft über die Anzahl der von ihm benutzten Schachteln beschweren. Da er in gewisser Weise recht hatte, nahm ich seine Antwort lächelnd zur Kenntnis. Seine Schachtel benutzte ich trotzdem.
Dann beschwerte sich der Junge. Wieso bekam er keine Schachtel? Da uns Argumente gegen seine Forderung fehlten, gestanden wir ihm eine zu.
Natürlich beschwerte sich dann auch das Mädchen. Sie bekam ihre Schachtel. Auf unsere Frage, was sie denn in ihre Schachteln packen wollten, erwiderte der Junge, er wolle seine vorläufig leer lassen:
Damit ich unterwegs Sachen sammeln kann.
Ich auch, sagte das Mädchen.
Wir hielten dagegen, dass leere Schachteln Platzverschwendung seien. Aber unsere Argumente fanden gute Gegenargumente, oder vielleicht waren wir es leid, überhaupt Gegenargumente zu finden, und damit war die Sache erledigt. Insgesamt hatten wir sieben Schachteln. Sie würden im Kofferraum des Autos, das wir noch kaufen mussten, als unsere Anhängsel mitreisen. Ich nummerierte sie sorgfältig mit einem schwarzen Filzstift. Die Schachteln I bis IV gehörten meinem Mann, Schachtel VI gehörte dem Mädchen, Schachtel VII dem Jungen. Mir gehörte Schachtel V.
APACHERIA
Am Beginn der Sommerferien, die nur noch einen guten Monat entfernt waren, wollten wir Richtung Südwesten fahren. In der Zwischenzeit führten wir unser Leben in der Stadt weiter, als würde sich nichts Wesentliches zwischen uns ändern. Wir kauften ein billiges gebrauchtes Auto, einen Volvo-Kombi, Baujahr 1996, schwarz, mit einem riesigen Kofferraum. Wir gingen zu zwei Hochzeiten und hörten auf beiden, was für eine wundervolle Familie wir doch seien. So hübsche Kinder, und sie sehen sich gar nicht ähnlich, sagte eine alte Frau, die nach Talkumpuder roch. Wir kochten Abendessen, sahen uns Filme an und schmiedeten Pläne für die Reise. An mehreren Abenden studierten wir alle vier die große Karte, wählten Routen aus und gingen geflissentlich darüber hinweg, dass wir vielleicht die Straße zu unserer Trennung festlegten.
Aber wo genau fahren wir denn hin? fragten die Kinder.
Wir wussten es immer noch nicht, hatten uns auf nichts einigen können. Ich wollte nach Texas, dem Bundesstaat mit den meisten Internierungslagern für Kinder. Es gab Tausende von Kindern, die in Galveston, Brownsville, Los Fresnos, El Paso, Nixon, Canutillo, Conroe, Harlingen, Houston und Corpus Christi weggesperrt waren. Mein Mann wollte, dass die Reise in Arizona endete.
Warum Arizona? fragten wir alle.
Und wo in Arizona? wollte ich wissen.
Eines Abends schließlich breitete mein Mann die große Karte auf unserem Bett aus und rief die Kinder und mich ins Schlafzimmer. Er fuhr mit dem Zeigefinger von New York bis nach Arizona, klopfte dann zweimal auf eine Stelle, einen winzigen Punkt in der südwestlichen Ecke des Staates, und sagte:
Da.
Was ist da? fragte der Junge.
Da sind die Chiricahua Mountains, sagte er.
Und? fragte der Junge.
Da ist das Herz der Apacheria, antwortete er.
Und da fahren wir hin? fragte das Mädchen.
Ja, genau, erwiderte mein Mann.
Und warum dahin? wollte der Junge wissen.
Weil dort die letzten Chiricahua-Apachen gelebt haben.
Na und? gab der Junge zurück.
Und gar nichts, da fahren wir hin, zur Apacheria, wo die letzten freien Völker auf dem gesamten amerikanischen Kontinent gelebt haben, bevor sie sich den Bleichgesichtern ergeben mussten.
Was ist ein Bleichgesicht? fragte das Mädchen, das sich vermutlich ein schreckliches Wesen vorstellte.
So haben die Chiricahua die weißen Europäer und Amerikaner genannt.
Warum? wollte sie wissen, und auch ich war neugierig, doch der Junge schnappte sich die Zügel der Unterhaltung und lenkte sie in seine Richtung.
Aber warum Apachen, Pa?
Darum.
Darum was?
Weil sie die Letzten einer Epoche waren.
PRONOMEN
Es war entschieden. Wir würden bis zur Südostspitze von Arizona fahren, wo er bleiben würde, oder besser, wo er und der Junge für eine unbestimmte Zeit bleiben würden, das Mädchen und ich jedoch vermutlich nicht. Wir würden die ganze Strecke mit ihnen fahren und am Ende des Sommers zurückkehren. Ich würde die Tondokumentation über Flüchtlingskinder beenden und mir dann einen Job suchen müssen. Sie würde wieder zur Schule gehen. Ich konnte nicht einfach nach Arizona ziehen und alles hinter mir lassen, außer ich fand eine Möglichkeit oder einen Grund, meinem Mann in sein neues Abenteuer zu folgen, ohne meine eigenen Pläne und Projekte aufzugeben. Wobei mir nicht klar war, ob er abgesehen von diesem gemeinsamen Sommer überhaupt wollte, dass man ihm folgte.
Ich, er, wir, sie: Während wir die Bedingungen des Umzugs aushandelten, wechselten die Pronomen in unserer verwirrten Syntax ständig den Platz. Wir unterhielten uns jetzt zögerlicher über alles, selbst über Banalitäten, wir redeten auch leiser, als gingen wir mit unseren Zungen auf Zehenspitzen, wir waren vorsichtig, als hätten wir panische Angst, auf dem plötzlich sehr instabilen Boden unseres Familienterrains auszurutschen und zu fallen. Es gibt ein Gedicht von Anne Carson, es heißt »Zurückhaltendes Sonett«, das im Grunde auch nicht weiterhilft. Darin heißt es, Pronomen seien »Teil eines Systems, das mit Schatten streitet«, aber vielleicht meint sie auch, wir – Menschen, nicht Pronomen – seien »Teil eines Systems, das mit Schatten streitet«. Andererseits ist wir ein Pronomen, und sie beabsichtigt vielleicht diese Doppelbedeutung.
Jedenfalls wurde die Frage, wie die endgültige Stellung all unserer Pronomen letztlich unser Leben bestimmte, unser Schwerpunkt. Sie wurde der dunkle, stumme Kern, um den unsere Gedanken und Fragen kreisten.
Was machen wir, wenn wir in der Apacheria sind? fragte der Junge wiederholt in den folgenden Wochen.
Ja, was dann? fragte ich meinen Mann später, als wir ins Bett krochen.
Dann sehen wir weiter, sagte er.
Die Apacheria gibt es natürlich nicht mehr wirklich. Aber sie existierte im Kopf meines Mannes und in den Geschichtsbüchern des neunzehnten Jahrhunderts, und sie beschäftigte zunehmend die Fantasie der Kinder:
Gibt es da Pferde?
Gibt es da Pfeil und Bogen?
Haben wir Betten, Spielzeug, Essen, Feinde?
Wann fahren wir los?
Wir erklärten ihnen, dass wir am Tag nach dem zehnten Geburtstag des Jungen aufbrechen würden.
KOSMOLOGIEN
Während der letzten Tage in New York hatten wir plötzlich eine Ameisenplage in unserer Wohnung. Große schwarze Ameisen, geformt wie Achten, mit einem selbstmörderischen Hang zu Zucker. Wenn wir ein Glas mit etwas Süßem in der Küche stehen ließen, schwammen darin am nächsten Morgen zwanzig Ameisenleichen, ertrunken in ihrer eigenen Genusssucht. Sie erforschten Küchentheken, Schränke, die Spüle – alle üblichen Schlupfwinkel für Ameisen. Und dann krabbelten sie auf unsere Betten, unsere Nachttische und schließlich auf unsere Ellbogen und Hälse. Eines Abends war ich überzeugt, wenn ich lange genug still säße, könnte ich hören, wie sie in den Wänden herummarschierten und die unsichtbaren Adern unserer Wohnung übernahmen. Wir versuchten, jede Ritze zwischen Wand und Boden mit Klebeband abzudichten, aber nach wenigen Stunden löste es sich. Der Junge hatte die viel bessere Idee, die Ritzen mit Plastilin zu verkleben, und eine Zeit lang erfüllte es seinen Zweck, aber die Ameisen fanden bald wieder einen Weg in die Wohnung.
Eines Morgens ließ das Mädchen nach dem Duschen eine schmutzige Unterhose auf dem Badezimmerboden liegen, und als ich sie ein paar Stunden später aufhob, um sie in den Wäschekorb zu werfen, wimmelte sie von Ameisen. Ich sah darin einen groben Verstoß, ein schlechtes Zeichen. Der Junge fand das Ganze faszinierend, das Mädchen höchst amüsant. Beim Abendessen erzählten die Kinder den Vorfall ihrem Vater. Ich hätte gern gesagt, dass diese ominösen Ameisen nichts Gutes bedeuteten. Aber wie sollte ich meine Befürchtung erklären, ohne verrückt zu klingen? Also sagte ich nur zum Teil, was ich dachte:
Eine Katastrophe.
Mein Mann lauschte dem Bericht der Kinder, nickte, lächelte und erklärte ihnen dann, dass Ameisen in der Mythologie der Hopi als heilig galten. Ameisen-Menschen waren Götter, die Leute in der Oberwelt vor Katastrophen retteten, indem sie sie in die Unterwelt brachten, wo sie in Ruhe und Frieden lebten, bis die Gefahr vorüber war und sie wieder in die Oberwelt zurückkehren konnten.
Und vor welcher Katastrophe wollen uns die Ameisen hier retten? fragte der Junge.
Ich fand die Frage gut, unfreiwillig spitz vielleicht. Mein Mann räusperte sich, antwortete aber nicht. Dann fragte das Mädchen:
Was ist eine Katastrophe?
Etwas ganz Schlimmes, sagte der Junge.
Sie saß schweigend da, betrachtete hoch konzentriert ihren Teller und drückte mit ihrer Gabel den Reis platt. Dann blickte sie sehr ernst zu uns auf und gab einen merkwürdigen Wust von Ideen zum Besten, als wäre der Geist eines deutschen Hermeneutikers aus dem neunzehnten Jahrhundert in sie gefahren:
Die Ameisen, sie marschieren einfach herein, fressen meine Oberwelthöschen, sie bringen uns dahin, wo es keine Katastrophen gibt, nur schöne Trophäen und Popofreiheit.
In mancher Hinsicht sind Kinderworte die Rettung aus Familienkrisen, indem sie uns in ihre merkwürdig lichte Unterwelt führen, die vor unseren bürgerlichen Katastrophen sicher ist. Ich glaube, von diesem Tag an ließen wir unser Schweigen von den Stimmen unserer Kinder verdrängen. Wir ließen unsere Angst und Trauer um die Zukunft von ihrer Fantasie in eine Art erlösendes Delirium alchemisieren: Popofreiheit!
Unterhaltungen in Familien sind wie sprachliche Archäologie. Sie bilden unsere gemeinsame Welt ab, beschriften sie schichtweise wie ein Palimpsest und verleihen unserer Gegenwart und Zukunft Bedeutung. Die Frage ist, ob sich dann, wenn wir irgendwann unser persönliches Archiv öffnen und unser Familienband abspielen, eine Geschichte daraus ergibt. Eine Soundscape. Oder ob alles nur Bandsalat, Krach und Müll ist.
VORBEIGEHENDE FREMDE
In Walt Whitmans Gedicht »Grashalme« gibt es eine Stelle, die für meinen Mann und mich früher, als wir noch ein frisches Paar mit Plänen und Träumen von einer gemeinsamen Zukunft waren, eine Art Urtext oder Manifest darstellte. Es beginnt mit den Zeilen:
Fremdling, der du vorbeigehst! Du weißt nicht, wie sehnsüchtig ich nach dir blicke,
Du musst der sein, den ich suchte, oder die, die ich suchte (es kommt mir vor wie aus einem Traum).
Ich habe sicherlich irgendwo ein Leben der Freude mit dir gelebt,
Alles ist wieder wach, da wir aneinander vorbeihuschen, flüchtig, zärtlich, keusch, gereift.
Du wuchsest auf mit mir, warst Knabe mit mir oder Mädchen mit mir,
Ich aß mit dir und schlief mit dir …
Das Gedicht erklärte, so dachten wir jedenfalls, warum wir beschlossen hatten, unser Leben allein, aber zusammen dem Aufnehmen fremder Stimmen und Klänge zu widmen. Trotz der Flüchtigkeit der Begegnungen, oder vielleicht gerade deshalb, erfuhren wir beim Einfangen ihrer Stimmen, ihres Lachens, ihres Atems eine unglaubliche Intimität: Einen kurzen Moment lang nahmen wir am Leben dieser Fremden teil. Und im Gegensatz zum Filmen ermöglichte uns die Arbeit mit Ton den Zugang zu einer tieferen, unsichtbaren Schicht der menschlichen Seele, ähnlich einem Hydrografen, der die Lotung eines Gewässers durchführt, um die Tiefe eines Ozeans oder eines Sees zu kartografieren.
Das Gedicht endet mit einem Schwur an den vorbeigehenden Fremdling: »Ich will darauf achten, dass ich dich nicht verliere.« Es ist ein Versprechen der Beständigkeit: Dieser flüchtige, intime Augenblick zwischen dir und mir, zwei Fremden, wird eine Spur hinterlassen und für immer nachhallen. Bei einigen Fremden, die wir im Laufe der Jahre trafen und aufnahmen, haben wir dieses Versprechen in vielerlei Hinsicht gehalten – ihre Stimmen und Geschichten sind uns immer wieder präsent. Aber wir hätten uns nie vorgestellt, dass dieses Gedicht und besonders die letzte Zeile auch eine gewisse Warnung an uns war. Bei all dem Engagement und der Aufmerksamkeit, mit der wir die Nähe zu Fremden suchten und ihren Stimmen lauschten, wäre uns nie in den Sinn gekommen, dass zwischen uns beiden jemals Schweigen entstehen könnte. Uns wäre nie in den Sinn gekommen, dass wir uns irgendwann inmitten der Menge verlieren könnten.
STICHPROBEN & SCHWEIGEN
Nach all dem Sampeln und Mitschneiden besaßen wir ein volles Archiv mit Fragmenten von fremden Leben, doch von unserer Familie besaßen wir so gut wie nichts. Wir ließen die von uns geschaffene Welt hinter uns, und es gab fast keine Aufzeichnung, keine Soundscape von uns vieren, die unsere Veränderung im Laufe der Zeit dokumentiert hätte: das Radio frühmorgens, wenn der letzte Nachhall unserer Träume sich mit Nachrichten über Krisen, Entdeckungen, Epidemien und Schlechtwetter vermischte; die Kaffeemühle, die harte Bohnen zu Pulver mahlte; der Gasherd, aus dem Funken sprühend eine kreisrunde Flamme wuchs; das Gurgeln der Kaffeemaschine; die langen Duschen des Jungen und das beharrliche »Los, beeil dich, wir kommen zu spät« seines Vaters; die zögernden, fast philosophischen Gespräche zwischen uns und den beiden Kindern auf dem Weg zur Schule; die langsamen, vorsichtigen Schritte des Jungen durch lange Gänge, wenn er Unterricht schwänzte; das metallische Quietschen beim Anhalten der U-Bahnen und die fast schweigsamen Fahrten in Zugwaggons während unserer täglichen Pendelei zu Feldaufnahmen in Manhattan oder draußen in den Bezirken; das Summen der vollen Straßen, wo mein Mann mit seiner Tonangel vereinzelte Geräusche einfing, während ich mit dem Rekorder in der Hand die Flut fremder Stimmen, Akzente und Geschichten aufnahm; das Anreiben eines Streichholzes, das die Zigarette meines Mannes anzündete, und das lange tiefe Einsaugen des Rauchs beim ersten Zug, gefolgt von einem langsamen gelösten Ausatmen; das merkwürdige weiße Rauschen, das große Kindergruppen auf Spielplätzen produzieren – ein Wirbel aus hysterischem, chaotischem Geschrei –, und dazwischen die herrlich klaren Stimmen unserer beiden Kinder; die unheimliche Stille, die sich nach Einbruch der Dunkelheit über Grünanlagen senkt; das Rascheln und Knistern von trockenen Laubhaufen im Park, wo das Mädchen nach Würmern, nach Schätzen, nach was immer man finden kann gräbt, was meistens nichts ist, weil darunter nur Zigarettenkippen, versteinerte Hundehaufen und kleine, hoffentlich leere Ziplockbeutel sind; das Flattern unserer Mäntel bei Nordwind im Winter; unsere angestrengt strampelnden Füße auf rostigen Fahrrädern entlang des Flusswegs im Frühling; unser schweres Keuchen beim Einatmen der schädlichen Dämpfe aus dem grauen Flusswasser, und die stummen, ätzenden Schwingungen von übereifrigen Joggern und vereinzelten Kanadagänsen, die regelmäßig den Migrationszug ihrer Gefährten verpassen; die Schimpfsalven von Radprofis, alle in voller Montur, männlich und mittleren Alters: »Platz da!« und »Schau nach links!«; und als Antwort unser entweder leise gemurmeltes: »Sorry Sir, sorry Sir« oder laut zurückgerufene, tief empfundene Beleidigungen – leider immer verkürzt oder erstickt im rauschenden Wind; und schließlich die leisen Momente, die wir allein verbrachten, in denen jeder von uns Bruchstücke der Welt auf die bestmögliche Weise sammelte. Der Sound von allem und jedem in unserer Umgebung, der Lärm, den wir beitrugen, und die Stille, die wir zurücklassen.
ZUKUNFT
Und dann wurde der Junge zehn. Wir führten ihn in ein gutes Restaurant aus, überreichten ihm seine Geschenke (kein Spielzeug). Ich schenkte ihm eine Polaroidkamera und mehrere Schachteln Film, schwarz-weiß und Farbe. Sein Vater schenkte ihm Ausrüstung für die Reise: ein Schweizer Armeemesser, ein Fernglas, eine Taschenlampe und einen kleinen Kompass. Auf seinen Wunsch wichen wir von der geplanten Route ab und verbrachten den nächsten Tag – unseren ersten Reisetag – im National Aquarium von Baltimore. Dort lebte Calypso, die zweihundertfünfundzwanzig Kilo schwere Schildkröte mit der fehlenden Vorderflosse, von der er nach einem Schulprojekt völlig besessen war.
An diesem Abend packte mein Mann nach dem Essen seinen Koffer, ich packte meinen, und die Kinder durften ihre packen. Als sie schliefen, packte ich für sie um. Sie hatten die verrücktesten Sachen ausgewählt. Ihre Koffer waren tragbare Katastrophen à la Duchamp: Minikleidung für eine Familie von Minibären, ein kaputtes Laserschwert, eine einsame Inliner-Rolle, Ziplockbeutel mit allen möglichen winzigen Plastikteilen. Ich ersetzte alles durch richtige Hosen, richtige Kleider, richtige Unterwäsche, richtiges Sonstwas. Dann stellten mein Mann und ich die vier Koffer in einer Reihe neben die Tür, plus unsere sieben Schachteln und unsere Arbeitsutensilien.
Als wir fertig waren, saßen wir im Wohnzimmer und teilten uns schweigend eine Zigarette. Ich hatte ein junges Paar gefunden, an das wir die Wohnung zumindest für den nächsten Monat untervermieteten, und irgendwie gehörte sie ihm schon jetzt mehr als uns. In meinem müden Kopf dachte ich nur an die vielen Umzüge, die diesem vorangegangen waren: als wir vor vier Jahren zu viert eingezogen waren; die vielen Umzüge meines Mannes und meine davor; die Umzüge von Hunderten von Menschen und Familien, die wir für das Soundscape-Projekt interviewt und mitgeschnitten hatten; die der Flüchtlingskinder, deren Geschichte ich nun dokumentieren wollte; und die der letzten Chiricahua-Apachen, deren Geistern mein Mann bald hinterherjagen würde. Alle gehen weg, wenn sie müssen oder können oder gezwungen werden.
Am nächsten Tag nach dem Frühstück wuschen wir das letzte Geschirr ab, und dann gingen auch wir.
SCHACHTEL I
§ VIER NOTIZBÜCHER (20 × 15 cm)
»Über Sammeln«
»Über Archivieren«
»Über Inventarisieren«
»Über Katalogisieren«
§ ZEHN BÜCHER
Das Museum der bedingungslosen Kapitulation, Dubravka Ugrešić
Wiedergeboren, 1947–1963, Susan Sontag
Ich schreibe, um herauszufinden, was ich denke, 1964–1980, Susan Sontag
The Collected Works of Billy the Kid, Michael Ondaatje
Relocated: Twenty Sculptures by Isamu Noguchi from Japan, Isamu Noguchi, Thomas Messer und Bonnie Rychlak
Rundfunkarbeiten, Walter Benjamin
Tagebuch der Falschmünzer, André Gide
Dada aus dem Koffer. Die verkürzte Geschichte der tragbaren Literatur, Enrique Vila-Matas
Perpetual Inventory, Rosalind E. Krauss
The Collected Poems of Emily Dickinson
§ ORDNER (FAKSIMILE-KOPIEN, ZEITUNGSAUSSCHNITTE, FRAGMENTE)
Die Ordnung der Klänge, R. Murray Schafer
Grafische Darstellung von Walgesängen (in Schafer)
Smithsonian Folkways Recordings World of Sound Catalog #1
»Uncanny Soundscapes: Towards an Inoperative Acoustic Community«, Iain Foreman, Organised Sound 16 (03)
»Voices from the Past: Compositional Approaches to Using Recorded Speech«, by Cathy Lane, Organised Sound 11 (01)
WEGE & WURZELN
Buscar las raíces no más que una forma
subterránea de andarse por las ramas.
(Die Suche nach den Wurzeln ist nur der latente Versuch, das eigentliche Thema zu umgehen.)
JOSÉ BERGAMÍN
Wenn du dich unterwegs verirrst
Läufst du ins Ungewisse
FRANK STANFORD
SARGASSOSEE