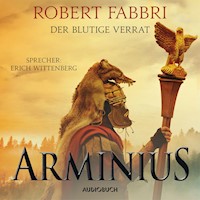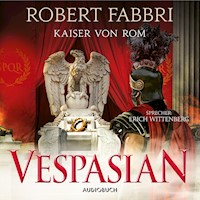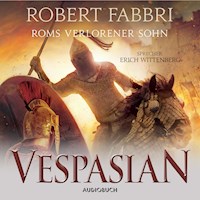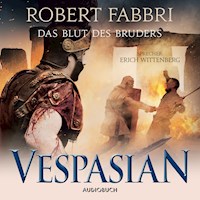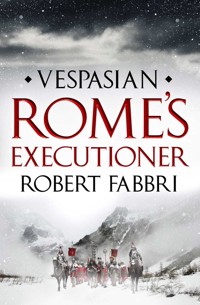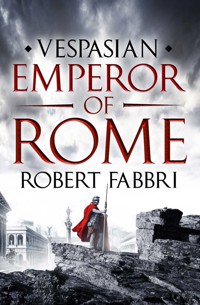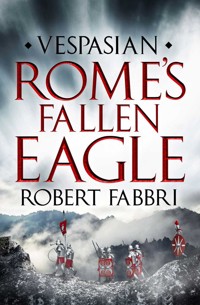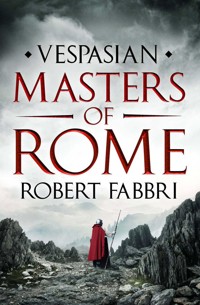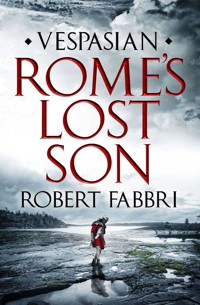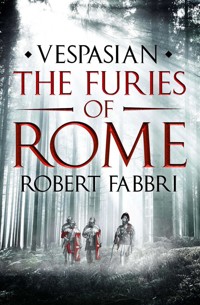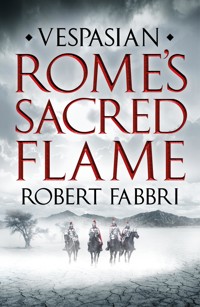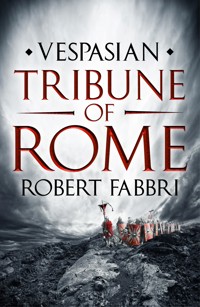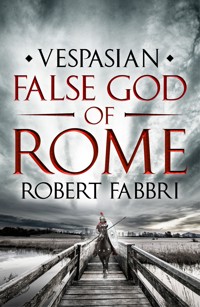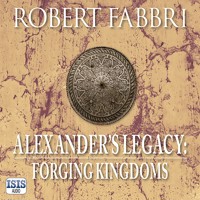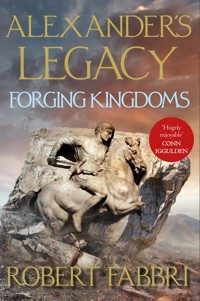9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Vespasian-Reihe
- Sprache: Deutsch
Der größte Sieg eines Mannes in Germania Magna. Und Roms größte Niederlage. Ein zeitlos faszinierendes Kapitel der Geschichte, spannend und klug erzählt. Geschickt verwoben mit der erfolgreichen «Vespasian»-Serie, für alle Fabbri-Fans und Cornwell-Süchtigen! A.D. 9: Wie konnten drei römische Legionsadler in den Wäldern Germaniens verlorengehen? Arminius, Sohn des Fürsten der Cherusker, führt ein Bündnis sechs germanischer Stämme an und bringt der römischen Armee mit der Vernichtung dreier Legionen in der Varusschlacht eine ihrer verheerendsten Niederlagen bei. Wie kam es dazu, dass Arminius, aufgewachsen als Römer, dem Römischen Reich den Rücken kehrte und einen Verrat beging – einen Verrat so gigantischen Ausmaßes, dass er bis heute widerhallt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 570
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Robert Fabbri
Arminius
Der blutige Verrat
Historischer Roman
Über dieses Buch
«Ein Roman über Mut, militärische Inkompetenz, politischen Neid, Stolz und eine Warnung, dass die Götter mitunter sehr nachtragend sind. Einmal angefangen, kann man kaum aufhören zu lesen!» Historical Novel Society
«Eine außerordentliche Geschichte, die wohl nie an Faszination verliert und hier mit großer Kunst erzählt wird. Wer auch immer sich für historische römische Kriegsromane interessiert, will sicher diese Darstellung der berüchtigtsten Schlacht der Epoche nicht verpassen.» For Winter Nights
«Wie der Autor diesen Band mit der ‹Vespasian›-Serie verlinkt, ist unterhaltsam und klug. (…) Dies ist wohl einer der beeindruckendsten Titel der Reihe, mit originellem Stil und erstaunlicher Sichtweite, unglaublich komplex und unterhaltsam.» Parmenionbooks
Vita
Robert Fabbri, geboren 1961, lebt in London und Berlin. Er arbeitete nach seinem Studium an der University of London 25 Jahre lang als Regieassistent und war an so unterschiedlichen Filmen beteiligt wie «Die Stunde der Patrioten», «Hellraiser», «Hornblower» und «Billy Elliot – I Will Dance». Aus Leidenschaft für antike Geschichte bemalte er 3500 mazedonische, thrakische, galatische, römische und viele andere Zinnsoldaten – und begann schließlich zu schreiben. Mit seiner epischen historischen Romanserie «Vespasian» über das Leben des römischen Kaisers wurde Robert Fabbri Bestsellerautor.
Mehr zum Autor und zu seinen Büchern: www.robertfabbri.com
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel «Arminius. The Limits of Empire» bei Corvus/Atlantik Books Ltd., London.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, August 2021
Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Arminius. The Limits of Empire» Copyright © 2017 by Robert Fabbri
Redaktion Tobias Schumacher-Hernández
Karte © Peter Palm, Berlin
Covergestaltung Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Coverabbildung Stephen Mulcahey/Trevillion Images; Hauptmann & Kompanie
ISBN 978-3-644-00945-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Leo und Jodi Fabbri – ich wünsche euch beiden ein langes und glückliches gemeinsames Leben. Willkommen in der Familie, Jodi – und natürlich der kleine Carl!
Prolog
Ravenna, A.D. 37
Gegen Synatos den Retiarius tritt nun an: der Secutor Licus von Germanien!»
Das Gebrüll der Menge übertönte die Stimme des Leiters der Spiele, doch für Thumelicaz drang es nur als dumpfes Dröhnen durch den Bronzehelm, der seinen Kopf umschloss. Er schritt in die Arena und reckte sein Kurzschwert in die Höhe. Die Leute schrien im Chor «Licus! Licus!», die Kurzform seines latinisierten Namens: Thumelicus. Er stieß im Rhythmus des Sprechchors sein Schwert in die Luft, seinen rechteckigen, halbzylindrischen Schild mit dem Keilerkopf vor sich haltend, und drehte sich nach allen Seiten, um die gesamte zehntausendköpfige Menge in dem ovalen Sandsteinbau zu grüßen.
In seinen fünf Jahren in der Arena hatte Thumelicaz von seinem Lanista Orosius, seinem Besitzer und Ausbilder, gelernt, die Gunst der Menge für sich zu gewinnen, ganz gleich, was er gegen diese Leute empfinden mochte: Ein beliebter Gladiator, der den Rückhalt der Massen genoss, war in jedem Kampf im Vorteil, und wenn er geschlagen wurde, konnte er auf ihre Gnade zählen. Orosius verfügte über einen reichen Erfahrungsschatz, nachdem er selbst vor fünfzehn Jahren nach dreiundfünfzig Kämpfen das hölzerne Schwert der Freiheit erlangt hatte. Heute würde Thumelicaz bis auf einen Kampf an diese Zahl heranreichen, was hauptsächlich den Lehren seines Lanista zu verdanken war. Thumelicaz hielt sein Schwert in die Richtung seines Mentors, der in der Menge saß. Orosius, den er einst gefürchtet und verabscheut hatte, inzwischen aber widerwillig respektierte, neigte dankend den Kopf.
Endlich grüßte Thumelicaz den Stifter der Spiele, der unter dem einzigen Baldachin saß, mit der vorgeschriebenen Formel eines Gladiators, welcher im Begriff war, auf Leben und Tod zu kämpfen. Mit huldvoller Geste signalisierte der Stifter, der neue Präfekt der kleinen Stadt Ravenna, seine Bereitschaft, das Blutvergießen anzusehen. Er richtete seine weiße Toga mit dem schmalen Purpurstreifen, dem Zeichen des Ritterstandes, und nahm den Jubel der Menge mit ausgestreckten Händen entgegen.
Schweiß lief unter der Filzkappe hervor, die Thumelicaz unter seinem Helm trug, und rann ihm übers Gesicht. Er blinzelte und drehte den Kopf, um durch die zwei kleinen Augenlöcher in dem glatten Gesichtsschutz nach Synatos zu suchen, dem helmlosen Retiarius mit Wurfnetz und Dreizack. Nachdem er seinen Widersacher gefunden hatte, behielt er ihn fest im Auge, denn er wusste, der leichter gerüstete, wendigere Kämpfer würde versuchen, flink aus seinem Blickfeld zu verschwinden. Er selbst war mit Helm, Schild und dem breiten Ledergürtel über seinem Lendenschurz beschwert. Außerdem trug er einen dicken Armschutz aus gefüttertem Leinen am rechten Arm, einen ebensolchen Schutz am rechten Unterschenkel und eine Schiene aus Leder am linken Bein. Somit war der Secutor vergleichsweise langsam, und Thumelicaz wusste aus Erfahrung, dass es entscheidend war, diesen Kampf rasch zu Ende zu bringen, ehe seine Kräfte ihn verließen.
Er griff nach dem Amulett in Form eines Hammers, das er um den Hals trug. «Donar, schärfe meine Klinge, führe meine Hand und gib mir Kraft, Großer Donnerer.»
Dann schnellte zwischen den beiden Kämpfern die Rudis herab, der hölzerne Stab des Schiedsrichters, des Summa Rudis. Die Menge verstummte. Das Geräusch von Thumelicaz’ schnellen, heftigen Atemzügen wurde durch den Helm verstärkt, die Atmosphäre darin war erstickend. Er stellte den linken Fuß vor und holte mit dem Schwertarm hoch aus, die Klinge schräg nach unten gerichtet, sodass die Spitze auf Höhe seiner Augen war. Den Schild vor sich haltend, starrte er Synatos über die Kante hinweg an. Der Retiarius erwiderte den Blick, die Augen gegen den aufgewirbelten Staub zusammengekniffen, der sich in seinen schwarzen Locken festsetzte. Geduckt stand er da, den muskulösen, geölten Körper seitlich gedreht, die linke Schulter vorn. Mit der rechten Hand schwang er sein mit Gewichten beschwertes Netz vor sich, mit dem Dreizack in der Linken führte er versuchsweise kleine Stöße. Der Arm war mit einem dicken Leinenschutz versehen, und ein Schulterschutz aus Kettenpanzer vervollständigte die spärliche Rüstung.
Noch immer war die Rudis zwischen ihnen. Thumelicaz blickte Synatos fest in die Augen und versuchte, seinen ersten Zug zu erraten. Sie hatten viele Male im Ludus, der Gladiatorenschule, miteinander gekämpft, sodass jeder mit dem Kampfstil des anderen gut vertraut war. Auch in der Arena waren sie bereits einmal gegeneinander angetreten. Es war vor fünf Monaten gewesen, und nach hartem Kampf hatte Thumelicaz schließlich gesiegt, hatte Synatos entwaffnet und ihm die Verletzung beigebracht, von der eine wulstige Narbe am rechten Unterarm zurückgeblieben war. Die Menge hatte die Leistung gewürdigt, indem sie dem Verlierer das Leben geschenkt hatte. Thumelicaz war erleichtert gewesen. Zwar schauten alle Gladiatoren, die mit dem Schwert kämpften, auf den Retiarius hinab, da er kein Gladiator im strengen Wortsinn war, doch für Thumelicaz war Synatos so etwas wie ein Freund, sofern er sich überhaupt gestattete, in der abgeschlossenen Welt des Ludus einen Freund zu haben, wo Männer dazu ausgebildet wurden, unterschiedslos Leben auszulöschen.
Er wird einen Sprung nach links machen und mit seinem Dreizack auf meinen ungeschützten rechten Oberschenkel zielen, dachte Thumelicaz, als er bemerkte, wie der Blick des Gegners kurz zu dieser Körperstelle huschte. Dann, wenn ich den Stich abzuwehren versuche, wird er das Netz nach meiner Hand auswerfen, um mir das Schwert zu entreißen.
Der Summa Rudis bellte das Kommando zum Kampf und hob seinen Stab. Die Menge brüllte vor Blutdurst. Synatos sprang nach links und stach blitzschnell mit seinem Dreizack nach Thumelicaz’ rechtem Schenkel. Thumelicaz, der mit diesem Angriff gerechnet hatte, stieß sein Schwert schräg abwärts zwischen zwei der mit Widerhaken versehenen Spitzen des Dreizacks. Funken sprühten, und der Dreizack glitt scharrend an seiner Klinge entlang, bis er mit einem metallischen Laut gegen den ovalen Handschutz prallte. Thumelicaz stieß seinen Schild nach vorn, um das Netz abzuwehren und zu verhindern, dass es sich an seiner rechten Hand verfing. Dann rückte er dem Gegner zu Leibe, denn der Retiarius hatte für den Nahkampf nichts als einen Pugio, einen kurzen Dolch. Synatos erkannte die Gefahr und machte einen Satz rückwärts. Das Netz ließ er wie einen runden Schatten vor sich auf dem Boden liegen, um Thumelicaz darin zu fangen, sollte dieser ihn verfolgen.
Ein Stoß mit dem Dreizack, auf seinen Hals gezielt, zwang Thumelicaz, den Schild zu heben, und er wich zurück, als die drei gefährlich scharfen Spitzen sich in das lederbezogene Holz bohrten. Durch die Wucht des Treffers schlug der Schild ihm mit der Kante gegen den Gesichtsschutz. Der Aufprall klang so laut in dem Helm wider, dass ihm die Ohren klingelten. Er riss seinen Schild zurück in der Hoffnung, dass der Dreizack feststeckte und er ihn Synatos’ Griff entreißen könnte, doch die Waffe löste sich. Im selben Moment fiel das Netz über seinen Kopf. Thumelicaz fühlte, wie es sich augenblicklich zuzog und ihn einzufangen drohte. Der Helm der Secutores war völlig glatt, ohne jegliche vorstehenden Ränder, Grate oder Kanten, die sich im Netz der Retiarii verfangen könnten. Thumelicaz zog den Kopf unter dem Netz heraus und hob sein Schwert, sodass die Klinge die Schnüre durchtrennte. Behände wich er weiter zurück, während er wiederholte Stöße mit dem Dreizack abwehrte, und schnitt das Netz entzwei, bis er die Zugschnur durchschnitt und die Waffe damit nahezu nutzlos machte.
Wieder bohrte sich der Dreizack mit Wucht in seinen Schild. Synatos warf nun das Netz von sich und packte den langen Schaft mit beiden Händen, um kräftiger zustoßen zu können. Dadurch wurde der Dreizack zu einer gefährlichen Angriffswaffe. Unter dem tosenden Beifall der Menge stach Synatos wieder und wieder nach Thumelicaz’ ungeschützten Füßen und zwang ihn so, beständig zu tänzeln und seinen Schild immer tiefer zu halten. Thumelicaz hieb mit seinem Schwert nach den Metallzinken und dem dicken Schaft, während er das Unvermeidliche erwartete.
Als es kam, war er bereit.
Die drei Spitzen schnellten plötzlich hoch, über den gesenkten Schild hinweg auf seine Halsgrube zu. Er duckte sich und hörte den Dreizack oben über seinen Helm schrammen, während er sich nach vorn warf und dem Gegner seinen Schild gegen die Brust schmetterte. Alle Luft wich aus Synatos’ Lunge; er taumelte, doch es gelang ihm, Thumelicaz den Schaft seiner Waffe krachend auf die Schultern zu schmettern. Der stieß seinerseits mit dem Schwert nach dem Herzen des Retiarius, doch durch die Wucht des Aufpralls verfehlte er sein Ziel. Die Spitze bohrte sich stattdessen in Synatos’ Schulterschutz, ohne ernsthaften Schaden anzurichten. Beide Gladiatoren stürzten heftig zu Boden, und sofort klebte Sand an ihren verschwitzten Leibern. Der Lärm der Zuschauer schwoll immer mehr an, denn nun begann der erbitterte Nahkampf auf Leben und Tod.
Wieder schmetterte Synatos mit beiden Händen den Schaft seines Dreizacks krachend auf Thumelicaz’ Schulterblätter. Stöhnend vor Schmerz schlug der mit der Faust, in der er das Schwert hielt, dem Retiarius seitlich gegen den ungeschützten Kopf, während der Gegner, noch immer unter dem Schild eingeklemmt, vergeblich nach Luft rang. Thumelicaz spürte, wie Synatos hinter seinem Rücken versuchte umzugreifen, den Dreizack zu drehen, um ihm die Spitzen in den Rücken zu bohren. Rittlings über dem liegenden Gegner kniend, richtete er sich mit einem Ruck auf und schlug ihm dabei die Waffe aus den bereits geschwächten Händen. Weiß glühender Schmerz raubte Thumelicaz für einen Moment die Sicht, da Synatos ihm sein Schienbein mit Wucht aufwärts zwischen die Beine rammte. Sein ganzer Körper wollte sich zusammenkrümmen, um diesen kostbaren Teil seiner Anatomie zu schützen, doch Thumelicaz widerstand dem Drang und warf sich stattdessen nach hinten, während der Schmerz in seinem Unterleib raste wie unzählige Messerstiche. Sein Magen hob sich, und aus seinem Mund ergoss sich Erbrochenes über die Innenseite seines Gesichtsschutzes.
Synatos zog flink seinen Pugio, kam gleichzeitig auf die Beine und stürzte sich auf Thumelicaz. Noch immer keuchend vor Schmerz, brachte der eben noch die Geistesgegenwart auf, seinen Schild hochzureißen, um erst die Klinge und dann den Körper des Gegners abzuwehren, der sie führte. Er wälzte sich nach links und kam mühsam auf die Knie hoch. Indessen stürzte Synatos auf den Sand, sprang jedoch mit der Schnelligkeit einer Eidechse wieder auf und wirbelte zu seinem Gegner herum. Thumelicaz stützte sich auf sein Schwert, um sich hochzustemmen. Er brachte nicht die Kraft auf, zu verhindern, dass Synatos seinen Dreizack wieder aufhob. Seine wichtigste Waffe in der rechten Hand, den Dolch in der linken, stand der Retiarius Thumelicaz frontal gegenüber. Das Gebrüll der Menge klang selbst durch den Bronzehelm hindurch ohrenbetäubend. Die Leute jubelten, da beide Gladiatoren wieder gleiche Chancen zu haben schienen und der Kampf weiterging. Dann erhob sich über den allgemeinen Lärm wieder der Sprechchor «Licus! Licus!».
Noch immer von Schmerzen gepeinigt und durch seine schwere Rüstung stärker eingeschränkt als sein Gegner, wusste Thumelicaz, dass er die Sache nun schnell zu Ende bringen musste. Bald würde er vor Erschöpfung zu keinem wirksamen Angriff mehr fähig sein. Er ließ seinen Schild ein wenig sinken, den Schwertarm herabhängen und tat, als drohte er, in die Knie zu gehen, so als wäre er bereits am Ende seiner Kräfte. Mit einem triumphierenden Fauchen machte der Retiarius einen Ausfall nach vorn und stieß mit seinem Dreizack in Brusthöhe zu. Mit einer schnellen, heftigen Bewegung seines Schildes lenkte Thumelicaz den Stoß ab, dann riss er sein Schwert hoch und traf den sogleich vorschnellenden Dolch. Mit metallischem Scheppern flog die Waffe hoch durch die Luft. Thumelicaz setzte die Bewegung fort und schmetterte seine rechte Faust, die noch immer das Schwert umklammerte, Synatos ins Gesicht. Knorpel knirschte, als die Nase brach. Der Retiarius wurde zurückgeschleudert, wobei er in der Luft eine Spur aus Blutstropfen hinter sich herzog, der Dreizack entglitt ihm, und mit einem heftigen Aufprall, der ihm den Atem raubte, landete er im Sand der Arena. Thumelicaz trat an seinen Gegner heran, der zu ihm aufsah und sofort den rechten Zeigefinger hob, das Zeichen, dass er sich ergab. Der Summa Rudis beendete den Kampf, indem er Thumelicaz seinen Stab quer vor die Brust hielt, um ihm Einhalt zu gebieten. Thumelicaz atmete tief und keuchend die nach Erbrochenem stinkende Luft ein. Schweiß brannte ihm in den Augen, während er auf den Mann hinunterschaute, der beinahe ein Freund für ihn war und nun geschlagen zu seinen Füßen lag.
Jetzt oblag es dem Stifter der Spiele, die Stimmung der Menge einzuschätzen und über Synatos’ Schicksal zu entscheiden.
«Licus! Licus!», erscholl noch immer der Sprechchor. Der Sieger hob sein Schwert, dem Stifter der Spiele zugewandt, und alle wussten, was diese Geste bedeutete: Leben oder Tod? Der Präfekt erhob sich langsam, die rechte Hand vor der Brust zur Faust geballt. Er schaute sich in dem Amphitheater um.
Der Ton der Masse wandelte sich. Langsam zunächst, aber unerbittlich änderte sich der Sprechchor, bis deutlich zu hören war: «Tod! Tod!» Die Leute hatten ein gutes Gedächtnis und waren nicht geneigt, einen Mann zu verschonen, der zweimal vom selben Gegner besiegt worden war.
Synatos hörte die Aufforderung, ihn kaltblütig zu töten, und er drehte langsam den Kopf, um den Präfekten anzuschauen. Ihre Blicke trafen sich. Eine kleine Weile sahen sie sich in die Augen, während die Menge verstummte, dann streckte der Präfekt von Ravenna den rechten Arm vor, den Daumen noch immer fest in der Faust wie ein Schwert, das in der Scheide steckte. Er hielt inne, um die dramatische Wirkung zu steigern, holte in der eintretenden Stille tief Luft und genoss die Macht über Leben und Tod. Dann schnellte sein Daumen plötzlich horizontal aus der Faust, das Zeichen für ein gezogenes Schwert: Tod.
Synatos schaute Thumelicaz an, rang sich ein ergebenes Lächeln ab und richtete sich auf ein Knie auf.
Die Zuschauer brüllten vor Begeisterung, viele, unter ihren Tuniken sichtbar erregt, spielten an sich selbst – manche fieberhaft, andere langsam und genüsslich – und warteten darauf, dass wieder einmal zu ihrem Ergötzen ein Leben ausgelöscht würde.
Thumelicaz drehte sich langsam auf der Stelle, das Schwert in die Höhe gereckt. Auf seinem Gesicht, das noch immer in dem Helm verborgen war, zeichnete sich Abscheu ab, während er einzelne Zuschauer ansah: Bäcker, Schreiber, kleine Magistrate, professionelle Schmeichler und Speichellecker, Ladenbesitzer, Lustknaben, Kaufleute und andere, alle ebenso unkriegerisch wie die Weiber, deren Furche sie pflügten. Der nutzlose Speck des Imperiums, dessen einzige Daseinsberechtigung darin bestand, dass er nun einmal geboren war, schrie nach dem Tod eines Mannes, der das elende Leben der meisten von ihnen in weniger als zehn Herzschlägen hätte auslöschen können. Hatten die Römer hierfür ihr Imperium erschaffen? Damit die Furchtsamen und Schlaffen ihre kämpferischen Phantasien stellvertretend ausleben konnten, ihren Samen verspritzen, während bessere Männer im Sand der Arena ihr Blut vergossen?
Thumelicaz nahm vor Synatos Aufstellung.
Der verurteilte Retiarius umklammerte seinen rechten Oberschenkel, hob den Kopf und blickte dem Mann, der ihn töten würde, fest in die Augen. «Tue es sauber, mein Freund.»
«Willst du keine Waffe in der Hand halten?»
«Nein, ich gehe einen anderen Weg als du. Meiner führt zum Fährmann, nicht nach Walhalla.»
Thumelicaz neigte den Kopf, dann hielt er sein Schwert senkrecht und setzte es zwischen Synatos’ Hals und dem Schlüsselbein an, dicht neben dem Schulterschutz. Mit beiden Händen, links über rechts, umklammerte er den Schwertgriff.
Der Lärm der Menge hatte sich schier ins Unmögliche gesteigert.
Synatos schluckte, schaute kurz in die Sonne, die von einem blauen, wolkenlosen Himmel brannte, und nickte.
Mit aller Kraft seiner Schultern stieß Thumelicaz die Klinge abwärts durch Haut, Fleisch und Lunge, bis die Spitze den Muskel des Organs durchdrang, das nun dreimal so schnell wie gewöhnlich pumpte. Synatos’ Augen weiteten sich vor Schmerz, seine Brust verkrampfte sich, und er stieß die Luft mit einem tiefen Stöhnen aus, das in einem Schwall Blut erstickte. Thumelicaz fühlte, wie der Griff des Sterbenden um seinen Schenkel sich verstärkte, die Fingernägel bohrten sich in die Haut, doch er achtete nicht weiter darauf – das geschah jedes Mal. Er drehte die Klinge nach links und rechts, um die Wunde zu vergrößern, dann packte er mit der rechten Hand Synatos’ Schulter und zog das Schwert mit einem schmatzenden Geräusch heraus.
Synatos blieb noch ein paar Augenblicke aufrecht auf den Knien, Blut quoll ihm aus Mund und Nase und lief in Strömen über das Kinn, die Augen waren leer, das Gesicht starr: tot. Die Menge stieß einen Seufzer bestialischer Befriedigung aus, und die Leiche kippte hintenüber in den Sand.
Thumelicaz reckte sein Schwert in die Höhe, um die zu grüßen, die er verachtete, und wünschte insgeheim jedem den Tod, der das Leben nicht verdiente, was in seinen Augen die meisten waren. Ohne einen weiteren Blick auf sein Opfer wandte er sich zu den Toren, die sich langsam öffneten. Acht Bogenschützen einer Auxiliartruppe marschierten herein, vier links und vier rechts, mit aufgelegten Pfeilen, die Bogen jedoch nicht ausgezogen.
Thumelicaz blieb stehen und warf sein Schwert auf den Boden.
Hinter den Bogenschützen erblickte er die Silhouetten zweier Personen, eine mit Toga.
Thumelicaz erkannte die muskelbepackte Gestalt seines Lanista Orosius. Mit einem raschen Blick zu dem Platz, wo der Stifter der Spiele gesessen hatte, vergewisserte er sich, wer der andere Mann sein musste. Der Präfekt von Ravenna schritt mit erhobenen Armen zur Mitte der Arena. Orosius blieb im Tor stehen und beobachtete die Szene.
Die Menge jubelte ihrem Präfekten zu, zurückhaltend, wie man einen Mann bejubelte, dessen Macht größer war als seine Beliebtheit. Falls der Präfekt das wahrnahm, so war es ihm nicht anzusehen. Er ging auf Thumelicaz zu und gebot mit Gesten Ruhe. Die Menge verstummte bereitwillig.
Thumelicaz war völlig überrascht, konnte sich aber denken, was gleich geschehen würde. Dennoch empfand er keine Begeisterung, keinen Stolz, keine Erleichterung, nachdem er fünf Jahre lang regelmäßig um sein Leben hatte kämpfen müssen. Sein einziger Gedanke galt seiner Heimat, die er nie gesehen, von der er nie geglaubt hatte, dass er sie einmal sehen würde. Diese Heimat kannte er nur aus den Erzählungen seiner Mutter, die an Rom ausgeliefert worden war, als sie ihn im Leib getragen hatte. Allzu wenig Zeit war ihr geblieben, ihm davon zu erzählen, ehe er ihr mit acht Jahren weggenommen wurde, um für ein Leben in der Arena ausgebildet zu werden. Und weil er der Sohn seines Vaters war, hatte er damit gerechnet, in der Arena zu sterben.
Der Präfekt sprach nun zur Menge, doch Thumelicaz nahm seine Worte kaum wahr. Vor seinem inneren Auge stand flammend das Bild des Vaters, den er nie kennengelernt hatte, und er stellte sich vor, wie er in das Land zurückkehrte, das dieser sechs Jahre vor Thumelicaz’ Geburt von der römischen Herrschaft befreit hatte: die Germania Magna. Binnen vier Tagen hatte sein Vater Erminaz, bei den Römern nur unter seinem latinisierten Namen Arminius bekannt, in einer Reihe von Schlachten im Teutoburger Wald die Armee von Publius Quinctilius Varus vernichtet, drei Legionen mitsamt Auxiliartruppen. Thumelicaz’ Mutter hatte ihm großartige Geschichten von dem Massaker erzählt. Drei Adler waren erbeutet worden, und Rom hatte sich daraufhin über den Rhenus zurückgezogen. Thumelicaz würde in ein freies Land zurückkehren, ein Land, in dem der Wert eines Mannes nach seiner Tapferkeit und Tüchtigkeit bemessen wurde und wo kleinherzige Menschen nicht zählten, ganz gleich, wie viel Silber sie besaßen.
Er fühlte, wie ihn jemand am Arm fasste, und mit einem Ruck kehrten seine Gedanken in die Gegenwart zurück. Der Präfekt redete in einem Ton, als wiederholte er sich. «Nimm deinen Helm ab, Licus von Germanien.»
Thumelicaz hakte die Daumen unter den Rand und schob den bronzenen Helm hoch. Sogleich fiel ihm das Atmen leichter. Die tiefliegenden blassblauen Augen unter den dicken schwarzen Brauen zusammengekniffen, schaute er auf den Präfekten hinunter, der zurückzuckte. Thumelicaz fuhr sich mit dem Handrücken über das glattrasierte Gesicht mit der langen, schmalen Nase, um es einigermaßen von dem halb eingetrockneten Erbrochenen zu befreien. Anschließend hielt er mit einem Finger erst ein Nasenloch zu, dann das andere und schnäuzte die saure Flüssigkeit aus.
Der Präfekt betrachtete ihn angewidert. Thumelicaz fragte sich, ob er es sich anders überlegen würde, doch dann wurde ihm klar: Der Präfekt würde das Gesicht verlieren, wenn er einem Gladiator nicht die Freiheit schenkte, nur weil er dessen Aussehen nach einem Kampf unappetitlich fand. Er zog die Nase hoch und spuckte blutigen Schleim in den Sand.
Der Präfekt griff in den Faltenbausch seiner Toga und förderte ein hölzernes Übungsschwert zutage. Mit einem solchen Schwert hatte Thumelicaz einst jahrelang Tag für Tag viele Stunden die vorgeschriebenen Bewegungen in jeder erdenklichen Kombination eingeübt, bis sie ihm so selbstverständlich geworden waren wie das Atmen.
Mit theatralischer Geste hielt der Präfekt das Holzschwert in die Höhe. «Ich, Marcus Vibius Vibianus, Präfekt der Stadt Ravenna, schenke dem Gladiator Licus von Germanien nach fünf Jahren in der Arena die Freiheit.» Er bot Thumelicaz das Schwert mit beiden Händen dar, und dieser nahm es ohne Dank entgegen.
Thumelicaz wusste, dass er es sich nicht leisten konnte, die Menge zu beleidigen. Also reckte er das Symbol für die Freilassung eines Gladiators in die Luft und drehte sich unter dem Beifall der Bürger von Ravenna einmal um sich selbst. Dabei hoffte er insgeheim, diesen Beifall zum letzten Mal zu hören.
«Du darfst mein Klient werden und meinen Namen annehmen», sagte Vibianus gönnerhaft.
Thumelicaz schaute den Präfekten an, als könne er nicht glauben, was er soeben gehört hatte. «Eher würde ich deine Hure werden und deine mickrigen Welpen gebären, Römer.» Damit ließ er den Präfekten stehen und marschierte entschlossenen Schrittes zum Tor. Im Gehen befreite er sich demonstrativ von der Rüstung, die ihn als Secutor kenntlich machte, und warf sie unter dem Jubel der Menge von sich. Er wusste, solange er das Volk auf seiner Seite hatte, konnte Vibianus nichts gegen ihn unternehmen.
In dem Versuch, das Beste aus der Situation zu machen, folgte ihm der Präfekt erhobenen Hauptes, das Inbild eines hochnäsigen Magistrats.
«Mir scheint, du und unser geschätzter Präfekt werdet künftig keine Tischgenossen», kommentierte Orosius und schloss sich Thumelicaz an, als der durch das Tor hinausging. Er gab ihm eine Papyrusrolle. «Das hier ist dein Freilassungsbrief.»
Thumelicaz nahm das Dokument entgegen, ohne es zu lesen. «Danke, Orosius. Wie ist es dazu gekommen? Ich dachte, ich sei dazu bestimmt, in der Arena zu sterben.»
«Das warst du auch, aber niemand hatte sich die Mühe gemacht, unserem neuen Präfekten vor seinem Amtsantritt diesen Umstand zur Kenntnis zu bringen. Und als er mir mitteilte, er wolle sich die Gunst der Plebs durch deine Freilassung erkaufen, wer wäre ich, ein bloßer Lanista, da gewesen, ihm zu widersprechen?»
Thumelicaz verlangsamte seinen Schritt. Sie gingen jetzt durch die von Fackelschein erhellten, verräucherten Eingeweide des Amphitheaters. Hier drängten sich verängstigte Gefangene in Ketten, die ihr Ende in den Fängen wilder Tiere erwarteten. Das Gebrüll der Bestien hallte von dem rauchfleckigen Ziegelgewölbe wider. Von der Decke tropfte Wasser in grüne, schleimige Pfützen auf dem abgenutzten Steinboden. «Warum hast du das für mich getan? Du schuldest mir nichts. Ganz im Gegenteil, ich verdanke dir alles, schließlich hast du mich persönlich ausgebildet.»
Orosius lächelte und schaute seinen vormaligen Schützling von der Seite an. «Würdest du mir glauben, wenn ich sage, ich wollte verhindern, dass du meine Erfolge in den Schatten stellst und der berühmteste Gladiator wirst, den Ravenna je hatte?»
«Blödsinn. Niemand schert sich einen Furz darum, in diesem Dreckloch irgendetwas zu gelten.»
«Da irrst du dich, der Präfekt schert sich durchaus darum. Er will die Gunst des neuen Kaisers Gaius Caligula erlangen, indem er dafür sorgt, dass mehr Steuern aus dieser Stadt in die kaiserliche Kasse fließen. Das beabsichtigt er zu erreichen, indem er sich zunächst das Wohlwollen der Bürger erkauft und dann Einsparungen vornimmt. Zu diesen zählt auch, wie viel er mir für meine Waren und Dienstleistungen zahlt – die Summe, die er mir als Entschädigung für deine Freilassung geboten hat, war lächerlich. Ich denke, wenn der Kaiser erfährt, dass Marcus Vibius Vibianus in seinem Bestreben, sich beliebt zu machen, Arminius’ Sohn freigelassen hat, wird er ihn nach Rom zurückrufen. Vibianus wird sich für diese neuartige Methode, unsere Feinde in Schach zu halten, erklären müssen. Selbst wenn er glimpflich davonkommt, wird er zumindest jegliche senatorischen Ambitionen vergessen können.»
«Und hier wird für dich alles wieder so werden wie früher?»
«Das ist alles, was ich will. Du solltest also lieber unverzüglich von hier verschwinden, ehe jemand den Präfekten darauf hinweist, dass er einen überaus törichten Fehler begangen hat.»
«Vorher habe ich noch etwas zu erledigen.»
«Nein, das hast du nicht, ich habe dein Preisgeld aus dem Ludus mitgebracht. Du bist ein reicher Mann, du könntest es dir beinahe leisten, dich selbst zu kaufen.»
«Behalte das Geld als Ausgleich dafür, dass deine Entschädigung so gering ausgefallen ist.»
«Dafür ist es mehr als genug.» Orosius gab den beiden Wachen am Tor zur Außenwelt ein Zeichen, es zu öffnen. «Was sonst ist so wichtig, dass es dich hindert, sofort die Stadt zu verlassen?»
Thumelicaz trat auf die Straße hinaus, zum ersten Mal frei zu gehen, wohin er wollte. Er wies mit einer Kopfbewegung auf das Schwert, das Orosius trug. «Darf ich?»
Orosius löste die Scheide von seinem Gürtel und gab sie Thumelicaz.
«Danke, Orosius. Ich muss meine Mutter holen, sie lebt als Sklavin im Haus meines Onkels.»
Thumelicaz hämmerte mit der Faust gegen die Tür eines herrschaftlichen Hauses an der breiten, belebten Straße, die Ravennas Forum mit der Festung der Stadt verband. Nach wenigen Augenblicken wurde ein Sehschlitz geöffnet, und ein dunkles Auge spähte forschend hindurch.
«Ich komme, um mit Tiberius Claudius Flavus zu sprechen.» Thumelicaz bemühte sich, die Anspannung in seiner Stimme zu unterdrücken.
«Wen darf ich ankündigen, Herr?»
«Sage ihm, der Sohn seines Bruders ist hier.»
Der Sehschlitz wurde abrupt wieder geschlossen.
Thumelicaz wartete in wachsender Ungeduld. Er fragte sich, ob sein Onkel Flavus, den er als Chlodochar kannte, es wagen würde, ihm nach so langer Abwesenheit die Tür zu öffnen.
Das Scharren eines Riegels und das Klappern eines Schlüssels beantworteten seine Frage.
Die Tür schwang nach innen.
Eine Hand am Heft seines Schwertes, schritt Thumelicaz durch die Vorhalle ins Atrium. Es war das erste Mal seit vierzehn Jahren, dass er das Haus seines Onkels betrat.
Das Atrium war das eines Römers, nicht eines germanischen Kriegers aus dem Stamm der Cherusker, dem sowohl Thumelicaz als auch sein Onkel angehörten. Ein kunstvoller Mosaikboden mit Szenen aus der Aeneis umgab das Impluvium in der Mitte des rechteckigen Raumes. Der Springbrunnen darin stellte Salacia, die Gefährtin Neptuns, in Gestalt einer Nymphe mit einem Kranz aus Seetang dar. An den Wänden hingen weder Waffen noch anderes Kriegsgerät, keine Hauer von Keilern, keine Geweihe, nichts, das die Wände im Langhaus eines Edelmannes zierte, wie Thumelicaz aus den Erzählungen seiner Mutter wusste. Es gab auch keine langen hölzernen Tische und Bänke, wo seine Gefolgsleute Gelage halten und singen konnten, nur niedrige Tischchen aus poliertem Marmor auf kunstvollen Beinen, und darauf standen Glasschalen und Bronzefiguren von römischen Gottheiten. Für Thumelicaz sah es aus wie irgendeines der römischen Häuser, in denen er gezwungen worden war, zum Ergötzen der Reichen von Ravenna bei ihren üppigen, verschwenderischen Gastmählern seine Künste im Schwertkampf zu zeigen. Er spuckte auf den Boden.
«Das ist genau das Benehmen, das ich von einem Sklaven und Gladiator erwartet hätte», ertönte vom anderen Ende des Raumes eine zutiefst verächtliche Stimme. «Warum bist du noch nicht tot, und wie kommt es, dass man dir erlaubt hat, mich zu besuchen?»
Thumelicaz blickte auf und sah einen hochgewachsenen, stattlichen Mann in der Toga des Ritterstandes ins Atrium kommen. Sein blondes, angegrautes Haar war kurz geschnitten, das feiste, gerötete Gesicht an der Stelle, wo sein rechtes Auge hätte sein sollen, von einer hässlichen Narbe entstellt.
Thumelicaz spuckte noch einmal aus, diesmal mehr aus Verachtung für den Mann, den er vor sich sah, als für die Kultur, mit der dieser sich umgab. «Ich bin nicht tot, weil ich den Schutz Donars genieße, eines Gottes der Krieger. Und ich bin hier, weil ich niemandes Erlaubnis brauche, um irgendwohin zu gehen, denn ich bin kein Sklave und kein Gladiator mehr, Onkel.»
Flavus blieb abrupt stehen, und sein eben noch höhnisch herablassendes Gesicht nahm einen Ausdruck der Bestürzung und Besorgnis an, kaum dass Thumelicaz die Worte ausgesprochen hatte. «Du lügst. Wachen!»
Thumelicaz zog das hölzerne Schwert aus seinem Gürtel und ging weiter in den Raum hinein, während vier große, kräftige Leibwächter mit gezogenen Schwertern hinter Flavus eintraten. Links neben dem Impluvium blieb Thumelicaz stehen.
Flavus hielt seine Männer mit einer Handbewegung zurück. «Wer hat dir das gegeben?»
«Dein Präfekt, vor nicht einmal einer Stunde.»
«Dann werde ich ihm sagen, er muss es dir wieder abnehmen.»
«Das könnte er nicht, selbst wenn er es versuchen würde. Meine Manumissio ist schriftlich bestätigt, ich bin ein freigelassener Bürger Roms. Ich könnte an den neuen Caesar appellieren, und er müsste mir recht geben.»
«Oder er könnte dich einfach töten lassen, wie Tiberius es schon vor Jahren hätte tun sollen.»
Nun war es an Thumelicaz, höhnisch zu grinsen. «Du weißt sehr wohl, warum Tiberius mich nicht töten ließ. Aus demselben Grund, aus dem er ablehnte, als Hadgan, der Fürst der Chatten, ihm anbot, meinen Vater zu vergiften: weil er Ehrgefühl besaß – etwas, das du schon vor Jahren vergessen hast. Nun gib mir meine Mutter heraus, dann lasse ich dich in Ruhe. Mögest du in den widerlichen Früchten deines Verrats verfaulen.»
«Ich kann sie nicht herausgeben, sie gehört Rom. Ich habe sie nur in meiner Obhut.»
«Sie ist die Frau deines Bruders. Da er tot ist, hast du das Recht, mit ihr zu verfahren, wie es dir beliebt. Überlasse sie mir, dann werde ich fortan eine etwas höhere Meinung von dir haben. Ich werde auf die Rache meines Vaters verzichten, die nun rechtmäßig die meine wäre, und du wirst nie wieder von mir hören.»
«Und wenn ich es vorziehe, das nicht zu tun?»
«Dann werde ich es vorziehen, sie mir zu holen und Rache für meinen Vater an dir zu üben, Rache für einen Mann, der von seinem Bruder ermordet wurde.»
Flavus lachte hohl und freudlos. Er wies mit dem Daumen über die Schulter. «Und du denkst, sie würden das zulassen?»
Thumelicaz betrachtete die Reihe der Leibwächter. Er nahm an, dass es Germanen aus einer Auxiliartruppe waren, die ihre Zeit abgeleistet hatten und danach weiter im Dienst ihres Befehlshabers geblieben waren. «Wenn ich mir Gedanken um sie machen müsste, dann würde ich sie mir einen nach dem anderen vornehmen.» Im Stillen bemerkte Thumelicaz besonders den dunkelhaarigen Mann ganz rechts und den älteren Mann mit blondem Vollbart daneben.
Etwas an dem beiläufigen Ton, in dem sein Neffe ihm antwortete, ließ Flavus einen Moment lang zögern, dann verhärtete sich der Blick seines verbliebenen Auges. Er trat zur Seite. «Tötet ihn!»
Die vier Leibwächter stürmten ohne Zögern vorwärts, zugleich, in einer Reihe nebeneinander. Thumelicaz wusste, dass sie damit einen schweren Fehler begingen. Er sprang nach rechts auf die Umrandung des Impluviums, als auch schon das Schwert des dunkelhaarigen Mannes niedersauste, wo er eben noch gestanden hatte. Thumelicaz zog sein Schwert aus der Scheide und setzte die Aufwärtsbewegung fort, sodass die Klinge den Kiefer des Mannes zerschmetterte. Gleichzeitig zielte der blonde Leibwächter mit einem waagerechten Schlag auf seinen Oberschenkel. Thumelicaz ließ mit der linken Hand das Übungsschwert hinabschnellen, sodass der Schlag durch das gehärtete Holz abgelenkt und gedämpft wurde und die Klinge nur noch mit geringer Kraft in seine Wade schnitt. Er verbiss den Schmerz und rammte dem blonden Mann den zersplitterten Stumpf des Holzschwerts ins Auge, sodass der mit einem gellenden Schrei rücklings stürzte. Thumelicaz zog seine Klinge mit einem Ruck aus seinem ersten Opfer, das röchelnd zusammenbrach, und richtete sie auf die zwei verbliebenen Wachen. Diese hielten inne, unsicher, wie sie einen Gegner angehen sollten, der soeben ihre beiden Kameraden in weniger als fünf Herzschlägen zur Strecke gebracht hatte. Thumelicaz ließ ihnen keine Zeit zum Pläneschmieden. Er wechselte die Waffe von der rechten in die linke Hand und schlug mit der Rückhand auf den Mann ein, der ihm am nächsten war. Die Klinge fuhr im Bogen durch die Luft, so schnell, dass die Bewegung nur verschwommen wahrnehmbar war, und ein dumpfer Laut war zu hören, als hätte das Beil eines Metzgers eine Schweinekeule zerteilt. Der Kopf des Mannes kippte auf die rechte Schulter, nur noch von ein paar Sehnen gehalten, und starrte voller Grauen auf den Kameraden an seiner Seite, während das Herz mit ein paar letzten mächtigen Schlägen eine Blutfontäne in die Luft pumpte. Dann fiel der Kopf nach vorn und zog den Körper mit. Indessen stach Thumelicaz’ Klinge bereits in den ungläubig aufgerissenen Mund des vierten Leibwächters, dass die Spitze im Nacken wieder austrat. Noch ehe das Opfer wusste, wie ihm geschah, wandte Thumelicaz sich ab und schaute sich im Raum um, doch sein Onkel war verschwunden.
Dann hallte der Schrei einer Frau durch das Atrium. Er kam aus dem Garten im hinteren Bereich des Hauses. Thumelicaz sah zu, wie sein letztes Opfer auf dem blutbesudelten Mosaikboden zusammenbrach und dabei seine Schwertklinge wieder freigab. Mit einem raschen Blick vergewisserte er sich, dass keine weiteren Bediensteten im Raum waren, die ihren Herrn verteidigen wollten, dann rannte Thumelicaz durch das Tablinum am hinteren Ende des Atriums hinaus in den Garten.
«Wirf dein Schwert weg, dann bleibt deine Mutter am Leben!» Flavus stand zwischen zwei Säulen der Kolonnade auf der anderen Seite des Gartens. Eine Frau in den Sechzigern, groß, mit wirrem grauem Haar und hängenden Brüsten unter einer dünnen, knielangen Tunika, wand sich in seinem Griff, ein Messer an der Kehle.
Ihre blauen Augen weiteten sich, als sie den Eindringling erkannte. «Thumelicaz!»
Thumelicaz hob eine Hand. «Bleib ruhig, Mutter.»
Hinter Flavus stand in einer offenen Tür eine weitere Frau in ähnlichem Alter, jedoch kleiner und stämmiger gebaut. In ihrer Hand blitzte ein Dolch, ihr Gesicht war vor Hass verzerrt. «Töte die Hündin doch einfach, Mann, und dann kümmern wir uns um ihren Welpen.»
«Schweig, Gunda! Thumelicus, lass deine Waffe fallen.»
«Und was, wenn ich es nicht tue?»
«Dann schneide ich Thusnelda die Kehle durch.»
Thumelicaz ging weiter, an einem großen Feigenbaum in der Mitte des Gartens vorbei. «Und was geschieht dann?»
«Dann bist du an der Reihe.»
Thumelicaz schnaubte verächtlich. «Du bist ein alter Mann, Onkel. Und wenn meiner Mutter ein Leid geschieht, wirst du nicht mehr einen Tag älter.» Zwei Schritt vor Flavus und Thusnelda blieb er stehen und senkte demonstrativ sein Schwert, behielt es jedoch fest im Griff. «Also, Onkel, was ziehst du vor – den Tod für euch beide oder das Leben?»
Flavus schaute seinen Neffen über Thusneldas Schulter hinweg an; in seinen Augen schienen Unsicherheit und Angst auf.
Thumelicaz hielt seinem Blick stand, und ein belustigter Ausdruck huschte über sein Gesicht. «Du hast schon immer zu sehr am Leben gehangen, Onkel. Deshalb hast du es auch der Ehre vorgezogen und meinen Vater ermordet.»
«Arminius hätte mich töten lassen. Nur einer von uns konnte überleben.»
«Mein Mann hat dich geliebt, Flavus!», stieß Thusnelda hervor. «Du warst sein kleiner Bruder. Er hätte dir verziehen, wenn du nach Germanien zurückgekehrt wärst und Rom abgeschworen hättest. Deshalb hat er sich in jener Nacht allein mit dir und meinem Vater getroffen – er glaubte deine Lüge, du wolltest zu ihm heimkehren und mich und meinen Sohn mitbringen. Aber du hast sein Vertrauen und die Blutsbande verraten, du Verräter hast ihn ermordet.»
«Ich habe getan, was das Beste für …»
Ein schriller Schrei, und Gunda stürzte mit wehendem Rock und Haar aus dem Schatten hervor, die Zähne gebleckt, den Dolch hoch erhoben, die Klinge über die Schulter ihres Mannes hinweg auf Thusneldas Hals gerichtet.
Flavus fuhr herum, wobei er Thusnelda mitriss, sodass nun ihr ganzer Körper dem Angriff ausgesetzt war, doch zugleich schnellte blankes Eisen wie ein Blitz von unten aufwärts; Thumelicaz’ Schwert trennte die Faust mit dem Dolch von Gundas rechtem Arm ab. Entsetzen zeichnete sich auf Flavus’ Gesicht ab, als er die blutige Hand seiner Frau durch die Luft fliegen sah, dann wich der Ausdruck dem von Schreck und Schmerz, da Thusneldas spitze Zähne sich in seinen Daumenballen gruben. Mit zwei heftigen Kopfbewegungen riss sie das Fleisch vom Knochen, sodass das Gelenk bloßlag. Zugleich rammte sie ihrem Schwager den Ellenbogen ins Zwerchfell. Der Dolch an ihrer Kehle fiel scheppernd zu Boden, doch das Geräusch wurde von Gundas schrillem Geschrei übertönt. Ihr Blick zuckte zwischen ihrer abgeschlagenen Hand am Boden und dem frischen Stumpf hin und her, den sie mit der Linken umklammert hielt. Blut sprudelte pulsierend heraus.
Thusnelda stieß Flavus’ Messer mit dem Fuß weg, während sie sich aus seiner Umklammerung befreite. Sie bückte sich noch rasch, um Gundas Hand vom Boden aufzuheben, dann war sie auch schon bei ihrem Sohn, der schützend den linken Arm um sie legte. Thusnelda drehte sich zu den zweien um, die sie in Gefangenschaft gehalten hatten und die nun beide auf die Knie gesunken waren. Ihr Kiefer arbeitete angestrengt, dann spuckte sie Flavus den halbzerkauten Fleischklumpen ins Gesicht. «Jetzt bin ich an der Reihe, Chlodochar; jetzt werdet du und deine Hündin von einer Frau sehen, wovon ich die letzten zweiundzwanzig Jahre geträumt habe.» Kalt lächelnd richtete sie den Blick auf Gunda, die wimmerte und ihren Unterarm fest umklammerte, um die Blutung zu stillen. «Und sei unbesorgt, meine Liebe, wenn du nicht mehr bist, wird man dich nicht so bald vergessen.» Sie hielt die abgetrennte Hand hoch. «Deine Fingerknochen werden einen reizenden Haarschmuck für mich abgeben.»
Thumelicaz zog an einem Strick und band ihn dann an einen der unteren Äste des Feigenbaums. Flavus hing an den Handgelenken, seine Füße berührten gerade eben nicht mehr den Boden.
Thusnelda hob den Kopf. «Donar, halte deine Hände über mich und meinen Sohn, wenn wir durch fremde Länder ziehen, und gib, dass wir nach Germanien zurückkehren. Nimm dieses Blutopfer, außer meinem eigenen Sohn die kostbarste Gabe, die ich dir darbringen könnte: das Blut einer Verwandten, die ein Kind geboren hat.» Thusnelda wandte den Blick vom Himmel ab zu Gunda, die an den Baumstamm gefesselt war. «Der Große Donnerer wird dich nehmen, Hündin. Du solltest mir dankbar sein, dass ich deinem elenden Dasein einen Wert gegeben habe.»
Gunda spuckte Thusnelda ins Gesicht. «Unser Sohn Italicus wird uns rächen.»
«Italicus! Was für ein Name ist das für einen Sohn Donars?» Thusnelda hob ihr Messer und setzte es Gunda an die Kehle. «Du hast alles verloren, womit du geboren wurdest, sogar die Fähigkeit, einen ehrenhaften Namen für einen Sohn auszusuchen.» Sie machte eine ruckartige Bewegung; geschärftes Eisen schnitt durch Fleisch.
Gundas Augen weiteten sich, aus ihrer Kehle drang ein gurgelndes Geräusch, und ihr Körper zuckte in den Fesseln.
Thumelicaz hob sein Schwert und trat an Flavus heran, der an dem Ast baumelnd voller Grauen die Todeszuckungen seiner Frau mit ansah. «Donar, führe uns heim und strecke mich mit Donner und Blitz nieder, wenn ich mich je wieder mit Rom oder seinem Volk einlasse. Ich will nichts von Rom, ich bin fertig mit Rom – achte, dass ich meinen Schwur halte.» Die Spitze seiner Klinge drang in Flavus’ Unterleib, und dem aufgehängten Mann entfuhr ein Stöhnen. Thumelicaz packte die Waffe nun mit beiden Händen und schnitt mit sägenden Bewegungen aufwärts. Muskeln und Eingeweide wurden durchtrennt, widerwärtige Gase und Flüssigkeiten entwichen, und Flavus schrie und schrie in seiner Qual. Als die Klinge den Brustkorb erreichte, zog Thumelicaz sie heraus und ging um seinen Onkel herum. Er fasste von hinten mit beiden Armen um den sich windenden Körper herum, griff mit den Händen in die Wunde und riss sie auf. Graue, dampfende Darmschlingen quollen heraus, streiften im Fallen Flavus’ Beine und häuften sich zu seinen Füßen auf dem Boden auf. Seine Schreie wärmten Thumelicaz und Thusnelda das Herz.
Sie schauten sich an und lächelten.
«Du hast mir gefehlt, mein Sohn.»
«Ich weiß, Mutter. Lass uns heimgehen.»
I
Germania Magna, Frühjahr A.D. 41
Thumelicaz beobachtete, wie drei Krieger zu Pferde sich von Westen näherten. Am anderen Rand des Tals, etwa eine halbe Meile entfernt, ritten sie den Hang hinunter. Sie suchten sich ihren Weg am Rand eines gepflügten und eingesäten Feldes, einer Rode, die frühere Generationen in schweißtreibender Arbeit aus dem umgebenden Wald geschlagen hatten. Im Tal angekommen, machten die Reiter einen Bogen um eine sumpfige Fläche am Ufer eines Flusses, der in einen schilfgesäumten See mündete. Eine sanfte Brise kräuselte die Oberfläche, die in der sinkenden Sonne silbern und golden funkelte – ein scharfer Kontrast zu den mit Koniferen bestandenen Bergen, die das Tal umgaben. In der warmen Luft lag der süßliche Geruch vom Harz all der Bäume, dem diese hohe Bergkette im Herzen der Germania Magna ihren Namen verdankte: In der Sprache des Stammes der Cherusker hieß sie Harzland – das Land des Harzes.
Dass bewaffnete Männer nahten, beunruhigte Thumelicaz und seine Leute nicht weiter, denn die Fremden hatten als Zeichen ihrer friedlichen Absichten Buchenzweige mit frischem Laub an ihren Speerspitzen befestigt. Dennoch hatten die zwölf Männer, die in der kleinen Siedlung lebten, ihre Waffen aus dem Langhaus in der Mitte geholt und sich auf dem Wehrgang der umgebenden Palisade postiert. Einzig Thumelicaz blieb unbewaffnet, er stand im offenen Tor. Doch er war nicht schutzlos: Zu beiden Seiten von ihm standen zwei riesenhafte, kurzhaarige, gestromte Jagdhunde. Sie knurrten grollend, als die drei Reiter näher kamen.
Thumelicaz klopfte beiden Hunden auf die Schnauze. «Beißer, Reißer, still!» Die Hunde verstummten augenblicklich und schauten zu ihrem Herrn auf. Sie warteten ab, wie er auf die Neuankömmlinge reagierte, um dann seinem Beispiel zu folgen.
Thumelicaz blinzelte mit tiefliegenden Augen in die sinkende Sonne. Er rieb sich den Bart, der nunmehr so üppig spross, dass er fast die hohen Wangenknochen erreichte. Dann strich er mit einem Finger über seine schmalen, blassen Lippen, während er die drei Krieger forschend musterte. Sie waren nur noch hundert Schritt entfernt. Stirnrunzelnd sah Thumelicaz zu dem Mann auf, der zu seiner Linken auf der Palisade stand. «Chatten?»
Der Mann knurrte, dann nickte er. «Ja, Herr, sie tragen eiserne Halsreife. Fußsoldaten, die in vorderster Front kämpfen – die tapfersten unter ihren Kriegern.»
«Wie lange ist es her, dass Chatten sich zuletzt auf unser Gebiet vorgewagt haben, Aldhard?»
«Fünf Jahre. Es war in dem Jahr, bevor du zurückkehrtest, Herr. Aber damals kamen sie mit gezogenen Schwertern und blanken Speerspitzen. Wir stellten uns ihnen entgegen, als sie versuchten, den Visurgis zu überqueren. Es war ein harter Kampf, und wir verloren an jenem Tag zahlreiche Männer. Das Blutgeld für sie ist noch nicht gezahlt.»
Thumelicaz nickte. Er kannte die Lieder über den letzten Einfall der Chatten in das Gebiet der Cherusker in dem Jahr, bevor er das hölzerne Schwert errungen hatte. Dem Jahr, bevor er und seine Mutter den strapaziösen Weg über die Berge angetreten hatten, um aus Italien nach Germanien zu fliehen.
Die drei Krieger legten das letzte Stück über offenes Gelände in leichtem Galopp zurück. Zwanzig Schritt vor Thumelicaz brachten sie ihre Pferde zum Stehen und hielten ihre mit Laub verzierten Speere hoch in die Luft, um unverkennbar ihre Absicht kundzutun.
Thumelicaz musterte die Männer. Alle hatten langes, flachsblondes Haar, das auf dem Kopf zu einem Knoten gebunden war, und ihre wallenden, gepflegten Bärte verdeckten teilweise die drei Finger breiten eisernen Halsreife. Zwei von ihnen waren in seinem Alter, Mitte zwanzig, doch der blonde Bart des mittleren Reiters wies silberne Strähnen auf, und um seine eisblauen Augen zeichneten sich deutliche Falten ab. Thumelicaz redete ihn an. «Was führt euch so weit von eurer Heimat fort?»
«Mein Name ist Warinhari, und ich komme aus der Halle von Hadgan, dem Fürsten der Chatten. Ich bin sein Sohn. Mein Vater sendet Thumelicaz, dem Sohn des Erminaz, seine Grüße – habe ich die Ehre, mit ihm zu sprechen?»
«Ich bin der, den du suchst.»
«Es ist ein Privileg, dem Sohn des größten Kriegers Germaniens zu begegnen. Im Herbst vor zweiunddreißig Jahren, als ich erst sechzehn Sommer zählte, kämpfte ich mit deinem Vater im Teutoburger Wald.»
Thumelicaz schmunzelte. Im Norden der Germania Magna gab es nicht einen Krieger über fünfundvierzig, der nicht von sich behauptet hätte, bei jener Schlacht dabei gewesen zu sein, die Roms Vormarsch nach Osten aufgehalten und dem Imperium seine Grenzen aufgezeigt hatte. «Wie ich hörte, haben die Chatten tapfer gekämpft – als sie sich denn einmal auf den Kampf einließen.»
Warinhari neigte den Kopf zu dem Kompliment, ohne auf den Seitenhieb einzugehen: Die Chatten hatten sich die ersten zwei Tage zurückgehalten und sich erst an den Kämpfen beteiligt, als der Ausgang schon so gut wie sicher war. «Die Chatten kämpfen immer tapfer.»
«Was hat Hadgan mir zu sagen? Als er zuletzt etwas von meiner Familie wollte, war es der Tod meines Vaters.»
«Das liegt eine Generation zurück. Er musste seinen Stand absichern, nachdem das Bündnis, das dein Vater geschmiedet hatte, zerbrochen war. Nun liegen die Dinge anders, und mein Vater möchte dir einen Vorschlag machen, der die Sicherheit aller germanischen Stämme betrifft. Es ist eine Angelegenheit, die am Herdfeuer erörtert gehört, nicht im Freien. Wir sollten die Sache zügig besprechen, denn bis morgen, zwei Tage vor dem Vollmond, muss eine Entscheidung gefallen sein.»
Thumelicaz sah zu Aldhard auf, der das Gespräch mit angehört hatte. Mit diskretem Kopfnicken signalisierte dieser seine Zustimmung. Thumelicaz wandte sich wieder an die Besucher. «Also schön, ich akzeptiere die Zeichen eurer friedlichen Absicht, ihr dürft hereinkommen. Tragt eure Waffen mit Ehre und tut drinnen niemandem ein Leid an.»
Obwohl es ein warmer Tag war, brannte in der runden Feuerstelle in der Mitte des Langhauses ein Feuer. Sein Rauch sammelte sich unter dem strohgedeckten Giebeldach, ehe er durch ein Loch im First abzog. An den Dachbalken hingen Schinken und Fische zum Räuchern. Abgesehen von ein paar Tischen und Bänken auf dem mit Binsen bedeckten Boden war das Langhaus leer. Thumelicaz führte Warinhari zu einem schlichten Holztisch beim Feuer und forderte ihn auf, sich auf einer Bank daran niederzulassen. Er selbst nahm dem Besucher gegenüber Platz und klatschte in die Hände, woraufhin durch einen Ledervorhang am hinteren Ende des Raumes ein alter Sklave eintrat. Sein dünnes graues Haar war nach römischer Sitte kurz geschnitten, sein Bart jedoch lang und zottig.
Der Sklave verbeugte sich. «Ja, Herr.»
«Bringe uns Bier, geräuchertes Fleisch und Brot, und jemand soll meiner Mutter Bescheid geben, damit sie sich uns anschließt.»
«Ja, Herr.» Der alte Sklave wandte sich zum Gehen, den Blick fest auf den Boden gerichtet.
«Und, Aius …»
Der Sklave hielt inne und drehte sich zu seinem Herrn um.
«Bringe den Gefährten dieses Mannes, die draußen warten, zu essen und zu trinken und sage Tiburtius, er soll die Pferde meiner Gäste abreiben.»
«Ja, Herr.»
Während Aius sich entfernte, wandte Thumelicaz sich an Warinhari. «Dieser Sklave und sein Kamerad Tiburtius haben schon meinem Vater gedient.»
«Römer?»
«Natürlich, aus Varus’ Armee, im Teutoburger Wald gefangen genommen.»
Warinhari runzelte fragend die Stirn.
«Sie haben bei all ihren Göttern geschworen, nie die Flucht zu versuchen, deshalb hat mein Vater sie vom Feuer unserer Götter verschont. Sie haben ihm selbst über den Tod hinaus treu gedient. Als ich zurückkam, fand ich sie noch immer im Langhaus meines Vaters vor, sie versorgten seine Pferde und Jagdhunde, polierten seine Waffen und seine Rüstung, erneuerten die Binsen auf dem Boden und hielten sein Herdfeuer in Gang. Ganz so, als wäre er nicht bereits seit fünfzehn Jahren tot.»
«Sie scheinen ihn geliebt zu haben.»
«Ihn geliebt? Das bezweifle ich. Du solltest wissen, dass mein Vater kein Mann war, der geliebt wurde. Aber alle, die ihn kannten, fürchteten ihn, denn es gab nichts, das er nicht gewagt hätte – keine Grenzen, die er nicht überschritten, keine Beschränkungen, über die er sich nicht hinweggesetzt hätte.»
Warinhari nickte mit abwesendem Blick. «Er war ein gefährlicher Mann, für seine Freunde ebenso wie für seine Feinde.»
«Und für seine Verwandten», sagte eine Frau, deren Silhouette eben in der Tür erschien. Ihr Haar hing wirr und war mit Knochen geschmückt, die klapperten, wenn sie sich bewegte.
Thumelicaz erhob sich. «Mutter, dieser Mann heißt Warinhari. Er kommt unter einem Friedenszweig, um mir einen Vorschlag von seinem Vater zu unterbreiten, dem Fürsten Hadgan. Ich möchte, dass du ihn gemeinsam mit mir anhörst.»
Thusnelda starrte Warinhari an, während dieser von der Bank aufstand und sich verbeugte. Ihre tiefblauen Augen verengten sich zu Schlitzen, und ihr vom Alter gefurchtes Gesicht verfinsterte sich. «Weshalb sollte ich den Boten des Mannes anhören, der dem Kaiser Tiberius angeboten hat, meinen Gemahl zu töten?»
«Weil wir in anderen Zeiten leben, Mutter. Außerdem hat Tiberius das Angebot ausgeschlagen.»
Thusnelda spuckte auf die Binsen. «Weil er, obwohl ein Römer, mehr Ehre besaß als dieses Wiesel von einem Chattenfürsten.»
«Mutter, das alles ist Vergangenheit. Hadgan hätte nicht seinen Sohn hierhergeschickt, wenn ihm nicht daran gelegen wäre, dass sein Vorschlag sehr ernst genommen wird. Wir sollten ihn anhören.»
Thusnelda steckte die Hand in einen ledernen Beutel an ihrem Gürtel und kramte darin herum; es schien sie zu beruhigen. «Also gut», gab sie nach, indes Aius mit einem Tablett wieder hereingeschlurft kam. «Aber ich warne dich, Thumelicaz, dieser Mann wird dich versuchen, einen Schwur zu brechen – die Knochen haben gesprochen.»
Thusnelda setzte sich neben ihren Sohn und funkelte den Besucher an, während Aius jedem ein Trinkhorn mit Bier füllte und sie allein ließ. Zwischen ihnen auf dem Tisch stand eine Platte mit Brot und kaltem Fleisch, daneben flackerte eine Talgkerze.
Thumelicaz trank einen tiefen Zug von seinem Bier und stellte das Horn ab. «Also, Warinhari, welchen Vorschlag hält dein Vater für so wichtig, dass er das Risiko eingeht, einen Sohn damit zu mir zu schicken?»
«Es hat etwas mit Rom zu tun.»
«Dann vergeudest du deine Zeit. Rom hat meine Familie auseinandergerissen.» Thumelicaz zog aus dem Ausschnitt seiner Tunika ein Amulett in Form eines Hammers, das um seinen Hals hing. «Ich habe Donar dem Donnerer geschworen, mich niemals wieder mit dem Imperium, dieser raffgierigen Bestie, einzulassen. Ich habe den Schwur besiegelt, indem ich meinen Onkel, den Verräter, und seine Frau opferte. Und dann, nachdem der Donnerer seinen Teil des Handels erfüllt und meine Mutter und mich heimgeführt hatte, bekräftigte ich meinen Schwur noch einmal mit drei römischen Kaufleuten, die in Weidenmännern verbrannt wurden, in demselben heiligen Hain, in dem einst mein Großvater Sigimer gezwungen wurde, dem römischen General Drusus seine beiden Söhne als Geiseln auszuliefern.»
«Die Geschichte ist wohlbekannt: Als dein Vater neun Jahre alt war, wurden er und sein jüngerer Bruder nach Rom gebracht.»
Thusnelda beugte sich vor und legte einen Arm um Thumelicaz. «Und auch ich wurde verschleppt, und Erminaz hat seinen Sohn nie kennengelernt. Mein treuloser Vater Segestes lieferte mich an Germanicus aus, als ich schwanger war. Ich wurde nach Rom gebracht und gebar dort mein Kind. Zwei Jahre später schaute mein Vater als geehrter Gast des Kaisers zu, wie ich und mein Sohn in Germanicus’ Triumphzug durch die Straßen geführt wurden. Seine Treue galt mehr den Reichtümern Roms und der Macht, die sie ihm einbringen konnten, als seinen eigenen Verwandten. Als letzten Beweis dafür beteiligte er sich an der Ermordung meines Mannes, zusammen mit dessen eigenem jüngerem Bruder. Wir wollen nie wieder etwas mit Rom zu tun haben. Und nun geh!»
Warinhari starrte über den Tisch hinweg Mutter und Sohn an, sah ihre verbissenen Gesichter; er leerte sein Trinkhorn. «Ich verstehe eure starken Gefühle, und glaubt mir, wenn ich sage, ich und mein Vater empfinden den gleichen Hass auf Rom. Nichtsdestoweniger ist Rom überall. Selbst hier in der Germania Magna fühlen wir seine Macht. Welcher Stamm zwischen den Flüssen Rhenus und Albis hätte nicht Verträge mit Rom, die ihn zwingen, junge Männer für die Hilfstruppen zu stellen und Tribut in die römischen Kassen zu zahlen? Jeder Stamm hat solche Verträge – die Chatten, die Friesen, die Chauken, die Angrivarier, alle, sogar ihr, die Cherusker.»
Thumelicaz schlug mit der flachen Hand auf den Tisch, sodass die Kerze flackerte und Talg verspritzte. «Das beweist nichts!»
«Es beweist, dass Rom einen langen Arm hat und die Stämme Germaniens zu schwach sind, um ihm zu widerstehen.»
«Aber wir sind immer noch frei, Warinhari, es gibt hier keinen römischen Statthalter. Die Siedlungen, die die Römer erbaut haben, ehe mein Vater sie besiegte, sind verfallen und wieder dem Wald einverleibt, und wir leben glücklich nach unseren eigenen Gesetzen. Wie viel mehr Freiheit können wir erhoffen?»
«Die Freiheit, die daraus erwächst, nicht jedes Jahr in Furcht vor einer neuen Invasion zu leben.»
«Roms Expansion nach Osten ist zum Stillstand gekommen, dafür hat mein Vater gesorgt.»
«Aber ist sie wirklich dauerhaft zum Stillstand gekommen oder doch nur zeitweilig ins Stocken geraten? Kannst du im Herzen sicher sein, dass Rom es nicht erneut versuchen wird?»
Thumelicaz rieb sich mit beiden Händen den Bart, die Ellenbogen auf den Tisch gestützt, und starrte auf das dünne Rauchfähnchen, das sich von der soeben erloschenen Kerze aufwärtskringelte. «Nein», sagte er nach kurzem Schweigen. «Nein, das kann ich nicht. Indem Rom expandiert, wächst auch die Zahl der Bürger, die in seinen Legionen dienen können. Solange nicht eine Seuche ausbricht, wird die römische Streitmacht immer größer werden. Bald werden die drei Legionen, die mein Vater vernichtet hat, ersetzt sein, und dann kann es sehr wohl geschehen, dass sie erneut einfallen.»
«So ist es. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass Rom anderswo zu beschäftigt ist, um uns wieder angreifen zu können.»
Thumelicaz hob den Blick und schaute Warinhari in die Augen. «Wie das?»
«Vor zwei Tagen kamen ein paar Römer zur Halle meines Vaters in Mattium. Sie waren auf der Suche nach dir. Sie haben ein Messer, das deinem Vater gehörte. Sie möchten es dir zurückgeben und hoffen, dass du im Gegenzug zu einem Treffen mit ihnen bereit bist.»
«Das Messer meines Vaters? Wie können sie gewiss sein, dass es seines war?»
«Auf der Klinge ist in Runen ‹Erminaz› eingraviert. Ich habe es selbst gesehen, es scheint echt zu sein.»
«Wie ist es in ihren Besitz gelangt?»
«Zwei von ihnen behaupten, die Söhne des Centurios zu sein, der deinen Vater als Geisel von seinem Volk zum Rhenus und weiter nach Rom eskortierte.»
«Erminaz hat dem Centurio wirklich sein Messer gegeben», bestätigte Thusnelda. «Er hat mir erzählt, er habe ihn gebeten, es seiner Mutter zu bringen, wenn er zurückkäme – das hat er nie getan, das unehrliche römische Schwein. Weshalb denkst du, den Söhnen eines Diebes könne man trauen?»
«Mein Vater Hadgan spricht stets die Wahrheit, deshalb erkennt er eine Lüge. Diese Männer sind aufrichtig.»
«Warum wollen sie sich mit mir treffen?», fragte Thumelicaz, griff nach dem Krug und füllte Warinharis Trinkhorn neu.
«Sie wollen wissen, wo der verlorene Adler der Siebzehnten Legion zu finden ist, den dein Vater im Teutoburger Wald erbeutet hat.»
Thumelicaz stellte den Krug so heftig wieder auf den Tisch, dass das Bier überschwappte, und brach in freudloses Gelächter aus. «Sie wollen ein Messer gegen einen Adler eintauschen? Nicht einmal Erminaz selbst hätte den Wert seiner Klinge so hoch geschätzt.»
Warinhari stimmte nicht in das Lachen ein. «Solange dieser Adler sich auf germanischem Boden befindet, wird Rom immer wieder herkommen und nach ihm suchen. Germanicus ist fünf Jahre nach der Schlacht im Teutoburger Wald zurückgekehrt und im folgenden Jahr noch einmal, und er hat deinen Vater dreimal geschlagen. Er ist nicht nur gekommen, um Rache zu üben, sondern auch, um die römische Ehre wiederherzustellen. Um die drei Adler zurückzuholen, die im Teutoburger Wald verloren gingen. Denkst du, er wäre wiedergekommen, wenn die Adler nicht gewesen wären? Wie dem auch sei, er hatte erst die beiden Adler der Achtzehnten und der Neunzehnten Legion gefunden, als Tiberius, eifersüchtig auf seine Erfolge und von Angst erfüllt, ihn nach Rom zurückrief.»
«Und seither ist niemand mehr gekommen.»
«Bis jetzt.»
«Ein paar Römer mit einem Messer?»
«Das ist nur der Anfang. Niemand anders als dein Vater wusste, welche der sechs Stämme, die an der Schlacht beteiligt waren, die Adler bekamen. Germanicus fand einen bei den Marsern und einen bei den Brukterern, und wir hatten das Steinbockemblem der Neunzehnten Legion bekommen. Somit bleiben noch dein Stamm, die Chauken und die Sugambrer. Weißt du, wo dieser Adler ist?»
Thumelicaz zögerte, dann nickte er. «Ja, ich weiß es.»
«Wirst du diesen Römern helfen, ihn zurückzuholen?»
Thumelicaz griff nach dem Amulett in Form eines Hammers an seinem Hals. «Wenn ich das täte, würde ich meinen Schwur brechen, und Donar würde mich von oben mit einem Blitz erschlagen.»
«Selbst wenn dein Handeln die Freiheit seines Volkes auf Generationen hinaus sichern würde?»
«Wie sollte die Rückgabe eines Adlers Rom daran hindern, je wieder seine Grenzen über den Rhenus ausdehnen zu wollen?»
Warinhari lächelte und beugte sich über den Tisch vor. «Rom hat einen neuen Kaiser, Claudius, einen sabbernden Schwachkopf, wie man sagt. Die Männer, die davon profitieren, dass er an der Macht ist, wollen ihn natürlich in seinem Amt halten. Dazu müssen sie erreichen, dass die Legionen Claudius lieben, damit sie einen so großen Sieg für ihn erringen, dass sein Volk hinter ihm steht und er sicher ist.»
«Und dieser Adler wird Claudius die Liebe seiner Armee einbringen?»
«Ja, Rom empfindet den Verlust noch immer als Schande. Wenn Claudius sich rühmen könnte, den Adler zurückgeholt zu haben, dann würden seine Legionen vielleicht tun, was sie für seinen Vorgänger Caligula nicht getan haben: sich einschiffen, um in Britannien einzumarschieren.»
Allmählich begriff Thumelicaz, und ein Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus. «Vier, vielleicht fünf Legionen mitsamt ihren Hilfstruppen.»
Warinhari nickte. «Ganz genau, und alle diese Legionen werden entweder von der Grenze am Rhenus oder von der am Danuvius südlich von uns abgezogen. Wenn so viele Truppen jenseits des nördlichen Meeres unabkömmlich sind, dann sind wir …»
«… auf Generationen hinaus vor einer Invasion sicher», beendete Thumelicaz den Satz.
«Ja, für hundert oder zweihundert Jahre sicher, und bis dahin sind wir vielleicht stärker als Rom und können seine westlichen Provinzen bedrohen.»
«Und das Imperium zurückschlagen, um eine germanische Zukunft für den Westen zu sichern.»
«Vielleicht.»
«Wo sind diese Römer?»
Thusnelda packte ihren Sohn am Arm. «Was ist mit deinem Schwur, mein Sohn?»
«Mutter, der Donnerer wird verstehen, weshalb ich das tue, und mir dieses eine Mal verzeihen. Ich werde diesen Römern den Adler zeigen und sein Volk vor Eroberung bewahren, damit es erstarken kann.»
«Du tust das Richtige, Thumelicaz», sagte Warinhari. «In drei Tagen, bei Vollmond, werden die Römer am Kalkriesen in den nördlichen Ausläufern des Teutoburger Waldes sein, dem Berg, in dessen Schatten Varus im Teutoburger Pass am vierten Tag der Schlacht sein letztes Gefecht schlug.»
Thumelicaz blickte Warinhari einige Momente lang schweigend in die Augen, während sein Entschluss sich