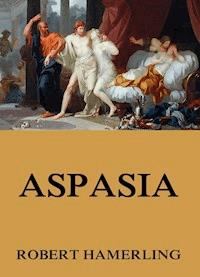1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Aspasia (Historischer Roman aus Alt-Hellas)" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Der historische Roman "Aspasia" hat als Hauptfigur die griechische Philosophin und Redner, die Lebensgefährtin des Perikles. Die Geschichte spielt im 5. Jh. v.u.Z. in Athen und entrollt ein farbiges Sittenbild der Zeit. Robert Hamerling (1830-1889) war ein österreichischer Dichter und Schriftsteller. Hamerling zählte zu seiner Zeit zu den meistgelesenen deutschsprachigen Autoren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Aspasia
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Wenn dieser Roman, einem vielcitierten kritischen Mahnworte unserer Zeit entsprechend, ein Volk – das alt-hellenische – »bei seiner Arbeit aufsucht«, die weltgeschichtliche Arbeit des Hellenenvolks aber eine Künstler-, eine Dichter- und Denkerarbeit war, wird dieser Art von Arbeit und ihrer Schilderung nicht etwas Gedankenhaftes, Lehrhaftes anzukleben scheinen? Wird sie an frischem Reize des Eindrucks nicht zurückstehen hinter den Bildern, welche aus dem Borne eines naiven, urwüchsigen, in der Tatkraft aufgehenden, poetisch vielleicht noch gar nicht ausgenützten Lebens geschöpft sind? Und mußte ein solcher Versuch, so gut wie auf den Reiz des Naiven, Naturwüchsigen, nicht andererseits auch wieder verzichten auf den Reiz des in modernem Sinne Geistreichen, des realistisch-Pikanten, auf die bunten, grellen Lichter der heutigen Dichtung? Durfte hellenisches Leben anders dargestellt werden als mit hellenischer Einfachheit? Und durfte der Darsteller nach anderem trachten, als nach einem Hauche hellenischen Geistes, hellenischer Anmut? –
Ist es nicht überhaupt bedenklich, untergegangenes Leben zu schildern? Detailmalerei des modernen Lebens wird als anziehender Realismus der Darstellung gepriesen; die des antiken wird auf viele den fröstelnden Eindruck der Gelehrsamkeit machen. In der Tat, wer dieses Werk nur flüchtig durchblättert, merkend, daß die einzelnen Abschnitte Ausblicke auf verschiedene Seiten hellenischen Lebens eröffnen, der wird rasch zur Hand sein mit dem Urteil, er wird ein loses Skizzenbuch vor sich zu haben glauben, im besten Falle einen »kulturhistorischen« Roman, was nach der Anschauung der meisten beiläufig soviel besagt als kein Roman. – Und doch – wenn der Roman als künstlerisches Werk von der Biographie, der Geschichte, der bloßen Erzählung durch innere und äußere Gliederung sich unterscheidet, wenn er nicht bloß der Ausdruck eines sinnvoll in sich abgeschlossenen Lebens und Schicksals ist, sondern auch eines Konfliktes in folgerechter Entwicklung und Lösung, so ist das, was ich hier erzähle, ein Roman. Denn nicht bloß lebt in bestimmter Gestaltung darin die schöne, geistverklärte Sinnlichkeit sich aus, in ihrer Entfaltung, ihrer Blüte, ihrem Niedergang; der Widerstreit zwischen dem ästhetischen Lebensideal und dem sittlichen entspinnt und entscheidet sich in einem Einzelgeschick und in einem Völkergeschick zugleich. Immer hat dieser Parallelismus von Einzel- und Völkergeschick, von individuellem und allgemeinem Leben mir als das Kunstgeheimnis der epischen Dichtung, als ihr oberstes Prinzip, als ihr eigenstes Schema vorgeschwebt. Nicht so jedoch, daß das Detail des erzählten Einzellebens und das des allgemeinen eben nur neben einander herlaufen, eines gleichsam die Episode des andern, sondern daß beide soviel als möglich an einem und demselben Detail sich abspinnen, daß sie, soviel als möglich, einem organischen Gebilde gleich, lebendig ineinander verwoben und verschlungen sind.
Nur mäßig durfte, um den reinen, gefälligen Eindruck des Bildes nicht zu stören, der Konflikt angedeutet sein: nur sachten Schrittes durfte er fortschreiten, und so scheint vielleicht an dünnem Faden die Handlung sich hinzuziehen. Aber was an Gesprächen und Schilderungen als Abschweifung erscheint, das alles ohne Ausnahme rückt zuletzt in sein rechtes, volles Licht, zeigt sich in seiner Notwendigkeit, in seinem Bezuge zum Ganzen, zur Idee.
Aber nicht zu einer Idee in abstraktem Sinne des Wortes. Laß dich nicht zu dem Gedanken verleiten, geneigter Leser, irgend einer »Tendenz« zuliebe sei der Verlauf dieser Geschichte gedreht, gewendet, gemodelt worden, was ich erzähle, ist die ungefälschte, parteilose Wahrheit. Ich schildere die Menschennatur und den Weltlauf. Ich gebe das Tun und Treiben, das Ringen und Streben der Menschen wieder, und die Worte, mit welchen sie es verteidigen. Ich habe keine Tendenz im Auge, als die des Lebens, keine Moral, als die der Notwendigkeit, keine Logik, als die der Tatsachen, welche aus Stoß und Gegenstoß besteht, so beständig und so gleichmäßig, wie das Hin- und Widerwogen eines Fichtenwipfels im Winde. Die Weisen behaupten wohl mit Recht, daß die Idee niemals rein aufgehe in der Wirklichkeit. Der Tendenzpoet verfolgt sie bis zu einem Höhepunkt ihrer Entwicklung, hält sie da auf einem Punkte, den sie doch eigentlich nur im Fluge berührt, gewaltsam fest, läßt sie farbig schimmern und schillern zur Freude der Sterblichen, und macht die Seifenblase zum Fixstern. Die reine, absichtslose Poesie aber begleitet die Idee auf dem Wege der Verwirklichung am liebsten bis zu jenem Punkte, wo sie, um in ihrer Reinheit sich wiederherzustellen, phönixgleich dem Flammentode sich selbst überliefert.
Graz, am 1. November 1875. R. H.
I. Der Schatz von Delos
Es war ein sonniger Tag der schwülen Zeit, als in der Stadt der Athenäer eine schlanke jugendliche Frauengestalt, begleitet von einer Sklavin, eiligen Schrittes ihren Weg über die Agora nahm. Die Erscheinung dieses Weibes hatte die sonderbare Wirkung, daß auf seinem ganzen Wege nicht ein einziger Mensch ihm begegnete, der nicht, nachdem er an ihm vorbeigekommen und in sein Antlitz geblickt, hinter ihm still gestanden wäre und eine geraume Weile wie festgebannt es mit seinen Blicken verfolgt hätte. Die Ursache davon lag nicht sowohl in dem Umstande, daß es schier eine Seltenheit, ein freigeborenes Athenerweib der vornehmeren Art öffentlich in den Straßen wandeln zu sehen, sondern vielmehr darin, daß diese Frauengestalt von einer wunderbaren und verblüffenden Schönheit war.
In den Gesichtern derjenigen, welche bei der Begegnung sie anstarrten oder hinter ihr in den Boden wurzelnd sie mit dem Auge verfolgten, malte das Erstaunen sich in allen möglichen Arten des Ausdrucks.
Einige lächelten mit Wohlbehagen, die Augen graubärtiger Greise funkelten, es gab welche, die den Blick eines Fauns nach dem schönen Weibe warfen, andere wieder, in deren Miene sich eine Art von Ehrfurcht spiegelte, als ob sie eine Göttin erblickten. Einige trugen eine ernste, befriedigte Kennermiene zur Schau, und andere blickten fast töricht, mit vor Verwunderung halbgeöffneten Lippen. Etliche wenige gab es freilich auch, die ein spöttisches Grinsen sehen ließen und einen bösen, stechenden Blick auf die Schöne richteten, als ob Schönheit ein Verbrechen wäre. – Männer, welche zu zweien gingen, oder in Gruppen standen, unterbrachen ihr Gespräch. Gesichter, auf welchen Langeweile gelagert war, erschienen auf einmal belebt; gerunzelte Stirnen glätteten sich. Es kam Bewegung in die Gemüter.
Die Erscheinung des Weibes war wie ein Sonnenstrahl, der in eine Rosenlaube fällt, und in welchem die Mücken in bacchantischem Wirbel zu tanzen beginnen.
Unter denjenigen, deren Aufmerksamkeit die verblüffende Frauengestalt auf sich zog, waren auch zwei Männer, welche schweigend neben einander hergingen. Ruhig, ernst, würdevoll und edel waren sie beide von Ansehen; jünger der eine, dunkel gelockt, stattlich, doch nicht ohne eine Spur von Weichheit in den Zügen; höher noch, fast ehrfurchtgebietend, ragte neben ihm des älteren Mannes Bildung: aber kahl wölbte sich sein mächtiges Vorhaupt über der tiefsinnigen Stirn. Es war, als sähe man neben dem feurigen Achill den völkergebietenden Agamemnon einherschreiten.
Der jüngere heftete einen Blick der Ueberraschung auf das bezaubernde Weib; ruhig blieb dagegen der ältere: es schien, als hätte er die Schöne nicht zum ersten Male gesehen, und so teilnahmlos, so tief versenkt in andere Gedanken erschien er, daß sein Begleiter eine Frage unterdrückte, die schon auf seinen Lippen schwebte.
Ein Sklave ging hinter den beiden Männern her. Sie schritten den langen, staubbedeckten Weg gegen den Piräus hinaus.
Auch diese Mauer erstreckte sich hinunter bis ans Meer, in weiter Krümmung dort sich auszubreiten und, wie oben die Stadt, so unten, mit der anderen vereinigt, den Hafen samt seinen Gebäuden mit schützendem Arm zu umfangen.
Auf diesem Mauerbau ruhte das Auge des jüngeren der beiden Männer prüfend und mit einer Art von Befriedigung, wenn es auf Augenblicke abglitt vom segelbeschwingten Ziel in der Ferne. Und mit Lächeln sprach er zuletzt, indes seine Blicke die endlose Linie festgefügter Quadern entlang glitten, zu seinem Gefährten gewendet:
»Wär' jedes drängende Wort, das ich um dieses Werkes willen zu den Athenäern sprach, zum Werkstein für dasselbe geworden, wahrlich, längst stünd' es uns fertig vor Augen. Aber auch so sehen wir es nun endlich der Vollendung nahe.«
»Und war sie in der Tat unentbehrlich, diese mittlere Mauer?« fragte, mit einem gleichgültigen Blicke das Werk streifend, der ältere.
»Sie war es!« versetzte jener. »Viel zu weit schweift die ältere linke Mauer ab gegen Phaleron. Eine große Strecke des Hafenstrands blieb offen. Jetzt erst ist die Aufgabe völlig gelöst. Aus der Brandasche des Perserkriegs verjüngt hervorgegangen, hat die Stadt der Pallas Athene, glänzend und mächtig, genährt vom Tribut der hellenischen Küsten und Inseln, diesen Quadergürtel um ihre Glieder geschlungen, stark genug fortan, den Neidern griechisch redender Zunge nicht minder als dem Anprall aller Barbaren des Morgenlandes zu trotzen.«
Der Mann, der so zu seinem Gefährten sprach, war des Xanthippos Sohn, der Alkmäonide Perikles, den sie den Olympier nannten. Sein Gefährte aber war ein gepriesener Erz- und Marmorbildner, Pheidias geheißen. Seiner Hände Werk war das riesige Standbild der »Vorkämpferin Athene«, das von der Höhe des Burgberges weit hinausleuchtete ins attische Land und in die Meeresferne sogar, wo annahende Schiffer die goldglänzende Lanzenspitze der Göttin freudig begrüßten, als erstes Wahrzeichen aus dem Banne des »veilchenbekränzten Athen«.
Einförmig fast erschienen die weithinlaufenden Quaderzüge, aber sie hatten, in das Licht des griechischen Himmels getaucht, nichts Düsteres. Ein bewegtes Getümmel wogte zwischen ihnen hin und her. Laut erschollen die spornenden Rufe der Maultiertreiber, und in langen Zügen gingen vom Hafen zur Stadt, von der Stadt zum Hafen die reich befrachteten Tiere den Weg entlang.
Hie und da trat ein Olivengehölz bis hart an die Straße heran, in dessen grünen Wipfeln von Zeit zu Zeit ein erfrischender Hauch, vom Golf herüberwehend, verzitterte.
Wenn solches geschah, zog der Erzbildner den breitrandigen Petasos vom Haupte und ließ seine hohe kahle Stirn von der Brise bestreichen. Der »Olympier« aber schritt nur immer mutiger aus, hielt nur immer fester sein Aug' auf die Triere gerichtet, die aus der Weite der Seebucht nun doch allmählich näher gegen den Hafen herankam.
Jetzt sind die beiden unfern dem Meere angelangt. Der Hafen ist erreicht. Auch hier schweift das Auge des Mannes, welchen sie den Olympier nennen, mit Befriedigung umher. Sein Werk ist zum großen Teile, was da dem Auge sich bietet, ein Neues dem Volke der Griechen in jener Zeit: breite, stattliche, gerade laufende Straßen. Hier prangt der große, von Säulenhallen umgebene Marktplatz, welcher den Namen nach seinem Erbauer Hippodamos, dem Milesier, erhielt. Staffelförmig erheben sich zur Linken, über den Säulenwald des Theaters hin, an den Abhängen des befestigten Hügels Munychia, die Häuserreihen, und auf der Höhe des Hügels ragt leuchtend das Marmorheiligtum der Artemis. Drunten aber in der Ebene dehnen sich bis ans Meer hin endlos die Hallen: hier die prächtige Stoa des Perikles, hier die ungeheuren Warenhäuser, wo ausgeschiffte Frachten bis zum Verkauf oder bis zur Weiterbeförderung lagern können, hier der riesige Bazar des Hafens, die Warenbörse, das »Deigma«, wo Schiffahrer und Händler ihre Waren Zur Schau stellen, wo sie ihre Verträge beraten.
In diesen Hallen, auf diesen Quaderterrassen steht der kluge Grieche wie auf dem Boden seiner Kraft, sich freuend, daß mit dem Gedeihen des Gemeinwohls auch sein persönliches wachse. Hier nimmt er aus den Händen des befreundeten Meergotts das Füllhorn aller Gaben der Fremde und sieht die letzten Wellenringe des Pontos, des Nils, des Indermeeres an seinem Gestade verschäumen.
Hier tummelt sich's, das Griechenvolk des Perikles: schöne, dunkelbraune Gestalten, malerisch sich abhebend vom Hintergrund der weißen Marmorhallen. Unbedeckt die Häupter der meisten, Sandalen zur Not an den Füßen, die karge, tuch- oder mantelartige, helle Gewandung lässig über die Schulter geworfen – dennoch in plastischer Schönheit, wie braune Erzbilder, stehen sie zwischen den Säulen. Nur daß sie lebensvoll sich gebärden, im bunten Stimmengewirre die Laute des klangreichen Hellenenidioms vernehmen lassend, energievoll in Reden und Gebärden und würdevoll zugleich wie Histrionen.
Seit der Athenäer nach glücklich geführten Kriegen die See beherrscht, hat er gelernt, hinauszugehen in die Hafenstadt des Piräus und sich zu bereichern. Er geht in den Piräus und sucht Reeder für überseeische Fahrten und Unternehmungen auf. Er geht zu den Geldmäklern, den Wechslern, legt Gelder bei ihnen nieder, oder erhebt welche, und wenn er keine zu erheben, keine zu hinterlegen hat, so entlehnt er welche. Denn Handel und Wandel blüht, und der Athenäer kennt die Gelegenheiten. Er weiß, wann es Zeit ist, Getreide vom Pontus zu holen, oder Holz aus Thrazien, oder Papyros aus Aegypten, oder Teppiche aus Milet, oder feines Schuhwerk aus Sikyon, oder Trauben von Rhodus. Er weiß auch, wo sein Olivenöl, sein Honig, seine Feigen, seine Metallarbeiten, seine Tongefäße gesucht und am besten bezahlt werden. Und der Mäkler, der Wechsler gibt das Geld ohne vieles Bedenken. Der Zinsfuß ist hoch, und für reiche Prozente kann man etwas wagen. So mancher Freigelassene, mancher Pasio, mancher Simo, mancher Phormio sitzt jetzt wohlgemut hinter seinem Wechslertisch im Piräus und gebärdet sich wie eine obrigkeitliche Person, denn man legt Kontrakte bei ihm nieder. Er gibt zwei Talente, ohne eine Miene zu verziehen, hin und empfängt ebenso gleichgültig zwei Talente, wenn man sie bei ihm hinterlegt. Er schreibt die Summe und den Namen dessen, der sie hinterlegt hat, in sein Buch, und die Sache ist abgetan. Man vertraut der Ehrlichkeit Pasios, und Pasio ist ehrlich, wenigstens so lang, als nicht der Vorteil einer Unehrlichkeit die Nachteile des gefährdeten Rufes seiner Ehrlichkeit aufwiegt.
Jene beiden erblicken jetzt das Meer, sanft gekräuselt und smaragdgrün anwogend an die Steinterrassen. Offen liegt vor den Blicken das tiefeingebuchtete Rund des piräischen Hafens. Als Wächter der Meerespforte hüten zwei mächtige Türme zur Rechten und zur Linken den Eingang. In Zeiten der Gefahr kann von einem Turme zum andern die eherne Riesenhemmkette geschlungen werden. Zahllos liegen in der Bucht die runden, bauchigen Handelsschiffe vor Anker; das Gestade zur Linken aber ist ganz bedeckt von den hochgebordeten Trieren der athenischen Flotte, nach Griechengebrauch ans Festland hinausgezogen, jedes in seinem besonderen Gehege, wie Ungeheuer in ihren Höhlen ruhend, gewaltige Meeresdrachen mit phantastischen Schnäbeln und befloßten, übermütig emporschnellenden Schwänzen; und drüben, auf der andern Seite der piräischen Halbinsel, in den Kriegshäfen von Zea und Munychia, lagern noch weit mehr dieser prächtigen Meeresungeheuer, und hinter ihnen dehnen sich die Seezeughäuser, wo das »hängende Zeug« der abgerüsteten Schiffe verwahrt wird, und weiterhin erstrecken sich Werften, wo unablässig neue Schiffshölzer abgeladen, rastlos neue Kiele gezimmert werden.
Nun läuft das Fahrzeug, welches der »Olympier« auf dem Wege zum Piräus so scharf ins Auge gefaßt hat, in den Hafen ein. Es ist das athenische Staatsschiff »Amphitrite«.
Die Massen des Volkes wogen gegen den Landungsplatz; in allen Hallen, auf allen Steinterrassen erschallt ein Gebrause von Stimmen.
»Die Amphitrite ist da – die Amphitrite mit dem Schatze von Delos! – Die Amphitrite mit der Bundeskasse! – So hat er es durchgesetzt, der Schlaukopf Perikles? – Was werden die Bundesgenossen dazu sagen? – Was sie mögen! wir stehen an ihrer Spitze, wir schützen sie, wir senden unsere Trieren an Ihre Küsten, wir führen ihre Kriege, dafür entrichten sie die Bundesgelder – was wir erübrigen, ist unser Eigentum.« Der Schall von Flöten erklingt vom Fahrzeug, wie es näher kommt.
Auf der »Amphitrite« wird, wie auf allen Staatsschiffen der Athener, der Ruderschlag durch Flötenschall gelenkt. Auch Gesang schallt von den Ruderbänken, und dazwischen tönt das Geplätscher der von unzähligen Rudern geschlagenen Meereswelle. Goldig leuchtet von der Spitze des Schiffsschnabels herab das Bild der Meeresgöttin, von welcher das Schiff den Namen trägt. Schön bemalt erglänzt der Rand des hohen Bordes im Sonnenschein. Gesang und Flötenschall und Meergeplätscher wird übertönt vom hellen Freudenruf des Volkes, den vom Schiffe her die wettergebräunten Seeleute kräftig erwidern.
Der Flötenschall verstummt, die Ruder regen sich nicht mehr, das Schiff steht, es beginnt ein Knarren von Tauen, ein Rasseln von Ketten, ein Hin- und Herlaufen an Bord, der Anker wird ausgeworfen, die Segel werden eingezogen, eine Treppe wird vom Ufer aus ans Schiff gelegt. Einige athenäische Würdenträger stehen ganz vorn am Rande des Uferdammes. Zu ihnen tritt Perikles, der Olympier, und spricht einige Worte. Der Laut seiner Stimme hat etwas Eigenartiges, wundersames. Die ihn noch nicht erkannt haben, erkennen ihn jetzt. Nicht alle Athener sahen genau die Züge seines Antlitzes in den Volksversammlungen auf der Pnyx. Aber alle hörten, alle kennen seine Stimme. Einige von den obrigkeitlichen Personen begeben sich über die Treppe an Bord des Schiffes.
Nach einiger Zeit werden aus der Tiefe des Schiffsbauchs ein paar ehern-beschlagene, wohlverwahrte Tonnen gehoben und ans Land gebracht, wo ein Maultiergespann die wuchtige Fracht erwartet. Der Trierarch kommt ans Land und spricht mit Perikles.
Es ist ein goldner Hort, was die »Amphitrite« unter den Augen des teilnahmvoll gespannten Athenervolks herantrug auf den blauen Meereswellen. Es ist der Schatz des athenäischen Bundes. Er kommt von Delos, dem »Stern des Meeres«, nach dem mächtigen Athen, auf des Perikles Betrieb, nicht mehr zu verwalten als Schatz des Bundes, in Empfang genommen als Tribut der Städte und Inseln.
Um goldene Horte webt ein Unheimliches, ein Dämmerschein, ein Hauch des Ungewissen, der bewußte Hoffnungen entflammt. unbewußte Beängstigung einflößt. Die Barre Goldes wird gemünzt, aber auch die Münze wird in der Hand des Eigners wieder umgeprägt. Sie verwandelt sich unter jedem Finger, der sie berührt. Dem einem wird sie Segen, dem andern Fluch. Und so dieser Schatz von Delos, auf welchen die Augen des Schwarmes der Athenäer erwartungsvoll gerichtet sind – wer weiß, ob mehr des Segens oder des Fluches daraus hervorgeht, ob mehr des Genusses oder der Reue damit erkauft wird, ob mehr des Dauernden oder des Vergänglichen damit geschaffen wird? Wer kennt die Winde, die aus diesem Aeolsschlauche wehen werden?
»Mit diesem Golde könnte man Athen zur unbezwinglichen Burg von Hellas machen!« dachten einige von den Amtspersonen, welche den Perikles umgaben.
»Mit diesem Golde könnte man die Seemacht Athens verstärken, Sizilien und Aegypten erobern, die Perser bekriegen, Sparta unterdrücken!« dachte der Trierarch.
»Von diesem Golde könnte man uns Fest- und Schauspielgelder zahlen!« dachte das Volk, das die Steinterrassen des Hafens füllte.
»Von diesem Golde könnte man die herrlichsten Tempel bauen, die glänzendsten Standbilder aufrichten!« dachte der sinnende Marmor- und Erzbildner an der Seite des Perikles.
Und Perikles, der Olympier, selbst? – In seinem Haupte, und in dem seinigen allein, waren alle diese Gedanken vereinigt ...
Der Maultierzug, welcher bestimmt war, die goldene Last vom Hafen in die Stadt zu schaffen, setzte sich in Bewegung. Mit ihm der Schwarm der Athener, und nachdem das Gedränge sich verlaufen hatte, traten auch Perikles und Pheidias den Heimweg an. Da des Volkes größerer Teil dem Schatze nachwogte, so war hinter ihm die Straße des Piräus ziemlich menschenleer und einzelne Erscheinungen konnten leicht für das Auge hervortreten.
Auf der Marmorplatte eines der Grabdenkmäler, welche zur Seite des Weges sich befanden, saßen zwei Männer in einem lebhaften Zwiegespräch begriffen. Das Antlitz des einen zeigte die heitere Würde des Weisen, düster waren die Züge des andern, und aus seinen glutenden Augen sprach ein fanatischer Eigenwille. Den vorübergehenden Perikles grüßte jener mit vertraulichem Lächeln, dieser Düstere aber warf ihm einen scharfen Blick aus feindlichen Augen zu.
Wieder waren die beiden Männer eine Strecke weiter gekommen, da sahen sie mitten auf dem Wege einen jüngeren Mann nachdenklich in sich versunken stehen. Er schien die Welt um sich her vergessen oder unter den Füßen verloren zu haben, und darüber nachzusinnen, wo er eine neue finden könnte. Er hatte eigentümliche, nicht eben anmutende Züge, und starrte mit unverwandten Augen gegen die Erde hinab.
»Einer von meinen Steinmetzen«, sagte der ernste Pheidias zu seinem Gefährten, indem er im Vorüberschreiten dem Nachdenklichen auf die Schulter klopfte, wie um ihn aufzurütteln; »ein braver, aber wunderlicher Bursch. Er arbeitet einen Tag lang mit Eifer in meiner Werkstätte, und den nächsten ist er verschwunden. So nachdenklich dazustehen ist seine Art.«
Unfern von dem Nachdenklichen kauerte ein lahmer, krüppelhafter Mann am Wege, ein Bettler mit wunderlich grinsendem Antlitz. Der gutherzige Perikles warf ihm ein Geldstück zu. Der krüppelhafte Bettler aber verzerrte sein grinsendes Angesicht noch mehr und schien etwas wie ein Schmähwort zwischen den Lippen zu murmeln.
Als die beiden etwa die Hälfte des Weges zurückgelegt hatten und aus einem Olivengehölz, welches den Weg eine Strecke lang säumte, hervortraten, tauchte die Akropole der Stadt vor ihnen auf und man sah das riesige Erzbild der »Vorkämpferin«, der »Athene Promachos«, im Scheine der Abendsonne leuchten. Man sah ihr behelmtes Haupt, man sah die gehobene Lanze und den großen Schild, auf den ihre Linke sich stützte. Auch funkelte vom Abhange des Berges augenblendend ein goldenes Gorgonenhaupt herüber, das ein begüterter Athener dorthin als Weihegeschenk gestiftet.
Von diesem Augenblicke an ging eine seltsame Veränderung in dem Wesen des Bildners vor. Er schien mit seinem Begleiter nun völlig die Rolle getauscht zu haben. So wie nämlich auf dem Wege von der Stadt zum Hafen dieser mit erregtem Gemüt und entflammtem Auge nach einem Ziel in der Ferne blickte, der Gefährte aber ernst, schweigsam, fast teilnahmlos neben ihm herging, so war jetzt umgekehrt auf dem Heimwege der Bildner mit beschleunigtem Schritte und befeuertem Blicke unverwandt der Akropolis zugekehrt, während sein Gefährte gelassen und schier ermüdet ihm zur Seite einherschritt. Es war, als ob den Bildner der Anblick seiner Göttin nach dem, was er im Piräus geschaut, eigentümlich erregte. Dort war ihm der Pomp des Nützlichen vor Augen getreten: des Hafens Getümmel, zankender Mäkler Geschrei, die gewaltigen, aber in ihrer Größe einförmigen Hallen, welche götterlosen Tempeln glichen, zuletzt der vom Dämmerhauch des »Ungewissen« umwobene Goldschatz: das alles hatte seine Bildnerseele beinahe verdüstert. Er mußte es gelten lassen, aber es störte ihm den Reigen unverwirklichter, idealer Glanzgebilde, von welchen sein Inneres erfüllt war. Jetzt, wo die Akropolis vor ihm auftauchte, schien er verwandelt und ließ so sinnend, so erwägungsvoll und gleichsam messend seinen unverwandten Blick über die leuchtende Höhe des Burgberges schweifen, daß Perikles ihn schon nach dem Grunde dieser nachdenklichen Aufmerksamkeit fragen wollte.
»Vater!« sagte in diesem Augenblicke ein Knäblein zu einem älteren Manne, in dessen Geleit es unmittelbar vor Perikles und Pheidias auf der Straße einherging, mit den dunklen Augen unablässig nach der Akropolis blickend: »Haben die Athenäer ganz allein die stadtschirmende Göttin Pallas auf ihrer Burg, oder wohnt sie auch bei anderen Menschen?«
»Auch die Rhodier«, antwortete der Mann mit dem Knäblein, »wollten sie bei sich auf ihrer Burg haben; ihnen aber gelang es nicht.«
»Hat ihnen Pallas Athene gezürnt?« fragte das Knäblein weiter.
»Die Athenäer auf dem Festland«, erwiderte der Mann, »und im Meere die Rhodier bewarben sich um die Göttin. Jene wie diese veranstalteten ein Opferfest auf ihrer Burg, um der Pallas Gunst zu gewinnen. Aber die Rhodier waren vergeßlich; sie gingen auf ihre Burg hinauf, und als sie das Opfer bringen wollten, da hatten sie kein Feuer. So brachten sie kein gehöriges, sondern ein kaltes Opfer, während bei den sinnigen Athenäern Feuer und Fettdampf lustig aufsprühte über den Felsen der Akropolis. Aus diesem Grunde gab Pallas Athene den Athenäern den Vorzug. Aber die Rhodier dauerten den Zeus, und um sie zu entschädigen, goß er vom Himmel einen goldenen Regen herunter, der ihre Gassen und Häuser anfüllte. Dess' freuten sich die Rhodier und trösteten sich damit, und stellten auf ihrer Burg den Gott des Reichtums, Plutos, auf.«
Diese Erzählung, welche der Mann dem Knäblein machte, traf das Ohr der beiden Männer, welche hinter ihnen schritten. Pheidias lächelte ein wenig, wendete sich nach einigen Augenblicken des Schweigens zu seinem Gefährten und sagte:
»Perikles, mich dünkt, die Zeiten haben sich geändert, und wir werden bald tun wie die Rhodier. Gedenkst du nicht auch den Plutos aufzustellen auf der Burg?«
»Fürchte nichts!« erwiderte Perikles lächelnd. »Solange das Meer den attischen Strand bespült, wird deiner Göttin Erzbild herrschend ragen aus der Hochstadt der Athenäer!«
»Aber unter Tempeltrümmern!« versetzte Pheidias. »Halbwüst liegt noch immer der Burgfels, wie ihn der sengende Perser gelassen. Laßt doch die Säulen und Trümmer herunterschaffen und baut eure Hafendämme und eure langen Mauern damit weiter; denn was der Perser oben zerstörte, das baut ihr doch nur im Piräus wieder auf!« –
Spähend blickte im Vorwärtsschreiten zuweilen der jüngere nach der blitzenden Fläche des saronischen Golfs hinüber. Sein Auge war scharf wie das Aug' eines Adlers. Er sah ein Schiff, das noch für keines anderen Menschen Blick erreichbar war. Er sah es auftauchen am Rande des Meerhorizonts. Des Fahrzeugs Weiterrücken war unmerklich in der weiten Entfernung. Der Adleräugige hatte das Ansehen eines Mannes, der sich zu fassen weiß; aber wenn er so nach dem fernen Fahrzeug hinübersah, da schien es doch bisweilen für einen Augenblick, als wolle er mit dem Odem seiner eigenen Brust das zögernde Segel beflügeln. Schweifte der Blick von dem Wege, welchen die beiden Männer gingen, zur Rechten ab, so stieß er in einiger Entfernung auf eine in der Sonne blinkende Mauer, die schier unabsehbar hinablief von der Stadt bis zum klippigen Meerstrand. Zur Linken sich wendend, sah man eine Mauer derselben Art, die soeben vor den Blicken des Beschauers emporzuwachsen schien. Die Bauleute türmten rechtwinklig behauene Werkstücke übereinander, und wo die Masse fertig stand, da scholl weithin der Hämmer Gedröhn, welche die verbindenden Erzklammern in die Quadern schlugen.
In diesem Augenblicke wendete sich der Mann, welcher das Knäblein führte, da er den Laut der Redenden hinter sich vernahm, und er erkannte den Perikles; dieser erwiderte freundlich seinen Gruß, denn er kannte ihn seit langer Zeit und war sein Gastfreund gewesen, als jener noch in Syrakus lebte.
»Dein und deines Söhnleins Lysias Gespräch, mein lieber Kephalos«, sagte er zu dem Manne, »hat unserm Pheidias hier soeben Anlaß gegeben, mir heiß zuzusetzen.«
»Wie das?« fragte Kephalos.
»Wir kommen aus dem Piräus«, fuhr der Olympier fort, »und schon dort war unser Freund, Pallas Athenes Liebling, fast verstimmt. Er möchte nur immer unter Göttergestalten wandeln. Er haßt die langen Mauern, die weiten Hallen, die Warenballen, die Säcke, die Tonnen, die geißledernen Schläuche; das Geschrei der Mäkler im Piräus hat sein Ohr zerrissen. Er wird, wenn er durchs Tor in die krummen, unansehnlichen Gassen der athenäischen Altstadt wieder eingetreten, mit erleichtertem Herzen den Staub des Weges zum Hafen von seinen Füßen schütteln.«
»Aber sage doch«, fuhr Perikles, zu dem Bildner gewendet, fort, »was starrst du so gedankenvoll und unverwandt nach der Höhe der Akropolis? Ist es der Anblick deiner Göttin, der dich erregt – deiner behelmten, lanzenschwingenden Vorkämpferin?«
»Wisse«, versetzte Pheidias, »die behelmte, lanzenschwingende Vorkämpferin ist seit geraumer Zeit in meiner Seele verdrängt durch eine Pallas Athene des Friedens; durch eine Pallas, welche nicht mehr kämpft mit rasselndem Erz, sondern geruhig und doch sieghaft mit leuchtendem Gorgoschild die Geburten der Nacht versteinert, wenn ich nun meinen Blick auf die Höhe der Akropolis richte, so wisse, daß ich dort dies in meinem Geiste gereifte Bild aufstelle, und daß ich ein herrlich prangendes Festhaus darüber wölbe: daß ich des Festhauses Giebel und Friese mit hundertfachem Bildwerk schmücke, und daß ich sogar auch weithin leuchtende Prachtvorhallen erbaue, von der Seite, auf welcher der Festzug der Panathenäen hinanwallt. Aber fürchte nicht, Perikles, daß ich mir Gold und Elfenbein für jene Pallas Athene des Friedens, und Marmor für jenes Festhaus von dir erbitte; nein, ich baue und bilde nur so in Gedanken – fürchte nichts!«
»So sind sie alle, diese Bildner und Poeten!« sagte Perikles, fast verletzt durch die spöttische Rede des Freundes. »Sie wissen nicht, daß das Schöne nur die Blüte des Nützlichen ist. Sie vergessen, daß vor allem das Gemeinwesen gesichert, das Volkswohl auf feste Grundlagen gestellt werden muß und daß die volle Blüte der Kunst sich nur in reichen, mächtigen Staaten entfaltet. Unser Pheidias grollt mir, weil ich ein paar Jahre lang an Getreidehallen im Piräus und an der mittleren langen Mauer gebaut habe, statt die Tempel der Akropolis wieder aufzurichten, und weil ich es nicht ganz allein der ragenden Lanze seiner erzbewehrten Göttin auf der Burg überlasse, uns wider jeden Feind, der zu Lande oder zur See androhen mag, zu beschützen« ...
Pheidias erhob das Haupt wie verletzt und warf einen Blick voll dunkler Glut auf Perikles. Dieser aber begegnete dem Blicke des Gekränkten mit versöhnendem Lächeln und fuhr fort, die Hand des Freundes ergreifend: »Kennst du mich so wenig, daß du mich ernstlich einen Feind und Bespötteler der göttlichen Bildkunst schelten dürftest? Bin ich nicht alles Schönen begeisterter Freund und Pfleger?« –
»Ich weiß es«, sagte Pheidias, nun seinerseits sarkastisch lächelnd. »Ich weiß, du bist des Schönen Freund. »Ein Blick in die Augen der schönen Chrysilla...«
»Nicht das allein!« sagte Perikles rasch und fuhr in ernstem Tone fort:
»Glaubt mir, Freunde, wenn die öffentlichen Sorgen mich belästigen, und neben den öffentlichen die eigenen, wenn manche Gegnerschaft mich drückt, mancher Widerspruch mich erbittert, wenn ich verstimmt heimkehre aus der Versammlung der Athenäer und nachdenklich, fast verstört durch die Gassen wandle, so ist oft ein kleines Säulenwerk, das mit schönen Verhältnissen meinem Auge begegnet, oder ein Bildwerk zur Seite des Weges, mit feinem Geist entworfen, im stande, mich anzuziehen und umzustimmen, und ich erinnere mich nicht, daß ich einmal ein Leid gehabt, welches mir nicht durch die Vorlesung eines Gesanges aus dem Homeros wenigstens erleichtert worden wäre.«
Die Freunde waren jetzt durchs Tor in die Stadt geschritten. Hier erschienen die Gassen enger, die Wohnhäuser weniger stattlich als im Piräus. Aber es war das echte Athen. Es war heiliger Boden.
Als Pheidias schon in die Nähe seines Hauses gekommen, sagte er zu Perikles und Kephalos: »Wenn ihr Lust und Muße hättet, bei mir noch ein wenig einzutreten, so werdet ihr einen nicht geringen Wettstreit in meiner Werkstätte durch euer Urteil entscheiden helfen.« – »Du stachelst unsere Neugier!« erwiderte Perikles.
»Ihr erinnert euch doch«, fuhr Pheidias fort, »des Marmorblocks, den das Perserheer übers Meer zu Schiff mit sich herüberschleppte, um nach unserer Unterwerfung ein persisches Siegesdenkmal aus persischem Gestein in Hellas aufzurichten, und der, als die Barbaren geschlagen entflohen, auf dem Schlachtfelde von Marathon in unseren Händen zurückblieb. Nach manchen Wanderungen wurde das schöne Gestein in meine Werkstätte geliefert, und wie dir bekannt ist, Perikles, wünschten die Athener ein Bild der kyprischen Göttin daraus gemeißelt, um den Bezirk der Gärten damit zu schmücken. Keinen meiner Schüler hielt ich für fähiger, als den Agorakritos von Paros, durch Vollendung solchen Bildwerks sich Ruhm zu erwerben; und so überließ ich ihm auf sein Verlangen den Marmorblock, aus welchem er nun ein treffliches Werk gefertigt hat. Aber ein anderer meiner besten Schüler, der ehrgeizige Alkamenes, neidete dem Agorakritos den Block und den Ruhm seiner Arbeit und vermaß sich, im Wettstreit mit dem Parier, meinem Liebling, wie er ihn nennt, ein Marmorbild derselben Göttin zu formen. Nun ist beider Jünglinge Gebild vollendet, und eine gute Anzahl von kunstliebenden Männern versammelt sich heute in meinem Hause. Wolltet ihr euch zu diesen gesellen, welcher Sporn wäre es für jene beiden! Kommt und seht, wie verschieden das schönste der Götterwesen in zweier Jünglinge Seelen sich gespiegelt hat!«
Nicht lange besannen sich Perikles und Kephalos. Sie nickten zustimmend und traten mit gespannter Erwartung in das Haus des Pheidias.
Sie fanden hier schon viele der kunstverständigen Männer versammelt. Es war da unter andern der Milesier Hippodamos, Antiphon, der Redner Ephialtes, der volksfreundliche Parteigenosse des Perikles, ferner Kallikrates, der Erbauer der mittleren langen Mauer, und Iktinos, ein Baumeister von vieler Gelehrsamkeit und großem Kunstverstande, dem Pheidias insbesondere befreundet.
Als diese Männer und die neuen Ankömmlinge sich begrüßt hatten, führte der Meister sie in einen der geräumigen Höfe seines Hauses.
Dort erhoben sich auf einem Sockel neben einander zwei hochragende verhüllte Marmormassen. Ein farbiges Linnen war zum Schutze des reinen, weiß leuchtenden Marmors gegen Staub und Besudelung darüber geworfen. Das Linnen zog jetzt ein Sklave auf den Wink des Pheidias hinweg. Da enthüllten sich die beiden glänzenden Werke in ihren gewaltigen, edel geformten Umrissen den Blicken der Beschauer, welche vor ihnen versammelt standen.
Die Männer blickten lange und ohne ein Wort zu sagen nach den beiden Bildern hin. In ihren Mienen war ein eigentümlicher Ausdruck von Betroffenheit zu lesen. Es war offenbar die merkwürdige Verschiedenheit der beiden Bildwerke, was sie in Verlegenheit setzte.
Das eine derselben zeigte eine weibliche Gestalt von erhabener Schönheit und übermenschlichem Adel. Sie war bekleidet, und ihr Gewand wallte in großen, edel geordneten Brüchen bis auf die Knöchel hinab. Nur eine der beiden Brüste war unverhüllt gelassen. Das Gebilde erschien durchaus fest und streng: nichts Weichliches war in den Zügen, nichts Ueppiges in den Gliedern, nichts Zärtliches in der Haltung. Und dennoch war es schön. Es war eine herbe, eine reife und doch jungfräuliche Schönheit. Es war Aphrodite ohne den Duft der Krokus- und Hyakinthosblüten, mit welchen die später geborenen Charitinnen und die Waldnymphen des Ida die Göttin bekränzten. Sie duftete noch nicht von Wohlgerüchen und sie lächelte noch nicht.
Solange die Betrachter auf dieses Bild allein hinblickten, vermißten sie nichts. Eine von allen Grazien und Liebesgöttern umflatterte Kypris war bis dahin im Hellenengeiste nicht gereift.
Wie sie da stand, die Schaumgeborene, von der Hand des Agorakritos gebildet, so war ihr Ideal von den Vätern ererbt.
Sobald indes der Beschauer von diesem Bilde weg auf das des Alkamenes eine Zeitlang sein Auge gerichtet hatte, so wurde er von einer Art von Unruhe ergriffen; und wenn er dann wieder zu jenem ersten Bilde zurückkehren wollte, so schien es ihm, als ob es ihm weniger als früher verständlich wäre, und als ob er inzwischen den Maßstab für die rechte Würdigung desselben verloren hätte. Es war ein Neues, was da den Blicken der Männer sich darbot. Noch konnten sie nicht sagen, ob ihnen dies Neue gefalle. Noch wußten sie nicht, ob es ein Recht habe, ihnen zu gefallen. Gewiß war nur, daß ihnen das Alte daneben jetzt weniger gefiel.
Je öfter aber der Blick von dem Bilde des Alkamenes zu dem des Agorakritos, von diesem zu jenem schweifte, desto länger blieb es auf jenem haften. – Was an demselben mit solchem heimlichen Zauber wirkte, war die Spur eines Reizes, einer Beseelung, einer Frische und Unmittelbarkeit der lebendigen Form, wie sie der Meißel des Griechen bisher nicht erreicht, nicht angestrebt hatte.
Von allen hing keiner so lange, keiner mit so glühenden Augen an den Formen, welche Alkamenes hier zur Schau gestellt, als Perikles.
»Dies Werk«, sagte er zuletzt, »will mich fast an das Standbild des Pygmalion erinnern; es scheint sich zu beseelen und eben auf dem Uebergange von der Starrheit des Marmors zu warmdurchpulster Leiblichkeit begriffen zu sein.«
»In der Tat«, rief Kephalos, »das Werk des Agorakritos ist voll vom Geiste des Meisters Pheidias, nur seinen Ernst noch überbietend. In das Gebilde des Alkamenes aber scheint mir ein Funke aus einer fremden Esse gefallen, der es mit einem seltsamen, eigentümlichen Leben durchglutet.«
»Ei, mein wackerer Alkamenes«, rief Perikles, »welcher neue Geist ist über dich gekommen, da man doch bisher deine Weise von der des Agorakritos kaum zu unterscheiden vermochte? Hast du etwa die Göttin im Traum gesehen? Weißt du, daß du mich in ein Entzücken versetzt hast, wie es noch kein Marmor in mir erregte?«
Alkamenes lächelte. Aber Pheidias blickte jetzt, wie von einem plötzlichen Gedanken durchzuckt, scharf nach dem Werke des Alkamenes und schien die Umrisse, die Formen einzelner Glieder unter dem Einflusse jenes Gedankens zu mustern.
»Nicht ein Traumbild«, sagte er zuletzt, »scheint mir in diesem Marmor verkörpert, sondern vieles Reizende aus sinnfälliger Wirklichkeit aufgenommen, um das Bild der Göttin damit auszuschmücken. Je länger ich die Schlankheit dieses ganzen Gebildes, das Zarte und doch Üppige dieses Busens und dieser Hüften, die eigentümliche Feinheit dieser spitz zulaufenden Finger und des anmutig gebogenen Handgelenks betrachte, um so stärker fühle ich mich an ein Weib erinnert, das wir in letzter Zeit ein paarmal in diesem Hause gesehen« –
»Es ist, wenn nicht das Angesicht, doch die Leibesgestalt der Milesierin!« rief ein anderer von den Schülern des Pheidias, herantretend; und alle Schüler, einer um den andern sich nähernd, erst das Bild und dann unter einander sich anblickend, riefen: »Kein Zweifel: es ist die Milesierin.«
»Wer ist diese Milesierin?« fragte Perikles hastig und gespannt.
»Wer sie ist?« sagte Pheidias lächelnd, »du hast sie schon einmal flüchtig gesehen – einen kurzen Augenblick hat der Strahl ihrer Schönheit dich getroffen. Im übrigen frage den Alkamenes« –
»Wer sie ist?« wiederholte nun der feurige Alkamenes. »Ein Sonnenstrahl ist sie, ein Tautropfen, ein schönes Weib, eine Rose, ein erfrischender Zephir, wer wird einen Sonnenstrahl nach Namen und Herkunft fragen? Vielleicht weiß Hipponikos anderes von ihr zu sagen, der sie als Gast in seinem Hause beherbergt.«
»Einmal kam sie mit Hipponikos herüber in diese Werkstätte«, sagte Pheidias.
»In welcher Absicht?« fragte Perikles.
»Um Dinge zu sprechen«, erwiderte Pheidias, »wie ich sie noch nicht aus eines Weibes Munde vernommen.«
»Bei Hipponikos also wohnt sie als Gast?« fragte Perikles.
»In einem kleineren Hause, das ihm gehört«, sagte Pheidias, »und das zwischen seinem Wohnhause und diesem da gelegen ist. Seit aber die Milesierin im Nebenhause weilt, ist mir ein wunderlicher Geist in diesen ganzen Schwarm da gefahren.«
»Wie das?« forschte Perikles.
»Seit jener Zeit«, erwiderte Pheidias, »ist der Duckmäuser, den du auf der Straße zum Hafen einsam stehen und vor sich hinstarren gesehen, noch weit nachdenklicher geworden, und was den Alkamenes anlangt, so gehört er zu denjenigen, welche ich am öftesten droben auf dem flachen Dache des Hauses betraf, von wo man in das Peristyl des Nebenhauses hinabsieht, und wohin sie von ihrer Arbeit weg sich schlichen, bald unter dem Vorwande, einen entkommenen Vogel oder Affen einzufangen, bald in der Abendkühle sitzend, um sich zu erholen, weil ihnen, wie sie sagten, das Blut so heftig gegen das Haupt ströme – in der Tat aber, um das Saitenspiel der Milesierin zu belauschen.«
»Und dieser Zauberin also«, sagte Perikles, »hat unser Alkamenes die Reize abgesehen, die uns auch hier im Marmor entzücken?«
»Wie es zuging, vermag ich nicht zu sagen!« versetzte Pheidias. »Vielleicht hat der Nachdenkliche den Kuppler gespielt; denn dieser scheint vertraut mit ihr zu sein. Dieser Wunderliche hat sich nämlich einen Eros zu meißeln vorgenommen, und hält es zu diesem Zwecke für nötig, sich zuvor über das Wesen dieses Gottes und seinen Begriff zu unterrichten. Denn so ist er nun einmal geartet: er strebt niemals nach den Dingen selber, sondern immer nach ihrem Begriffe, nach der Wahrheit und Weisheit, wie er sagt; weshalb wir ihn auch immer nur den Weisheitsfreund, den Wahrheitsucher nennen. Gegenwärtig nun jagt er dem reinen Begriffe der Liebe nach und will sich darüber von jener schönen Milesierin belehren lassen. Diese läßt, wie es scheint, den Sonderling gewähren, und ich habe sie einmal eine Stunde lang hier in diesem Hofe, auf einem Steinblock sitzend, sich mit ihm unterreden sehen. Hat nun wirklich nicht bloß dieser, sondern auch Alkamenes des geheimen Unterrichts der Milesierin genossen, so mag er auch fernerhin auf diesem Wege sein Heil versuchen. Mag er fortfahren, mehr von den schönen Weibern zu lernen, als von den Meistern seiner Kunst.«
»Was hier vor Augen steht«, rief Alkamenes aufwallend nach diesen spöttischen Worten des Pheidias, »ist meiner Hände Werk; den Tadel, der es trifft, nehm' ich auf mich, und das Lob, das man ihm zollt, brauch' ich mit keinem zu teilen!«
»Ei, doch!« rief Agorakritos finster; »mit der Milesierin hast du es zu teilen! Sie schlich heimlich zu dir!« ...
Ein heller Purpur schoß in die Wangen des Alkamenes. »Und du?« rief er, »wer schlich zu dir? Meinst du, wir merkten es nicht? Pheidias selber war es, der Meister, der des Nachts in deine Werkstätte schlich, um die letzte vollendende Hand an das Werk seines Lieblings zu legen« ...
Nun war es Pheidias, dessen Angesicht eine dunkle Röte unterlief – er warf einen zornigen Blick auf den verwegenen Schüler und wollte etwas erwidern.
Aber Perikles trat zwischen die beiden und sagte begütigend: »Keinen Zank, ihr Trefflichen! Es sei wie ihr sagt: zu Alkamenes ist die Milesierin, zu Agorakritos ist Pheidias geschlichen. Lerne jeder, wo und wie er es vermag, und neide keiner dem andern das Schöne, das ihm durch die Gunst der Musen, oder der Charitinnen, oder irgend welcher andern Göttin zu teil wird.«
»Ich habe nicht verschmäht, von Pheidias zu lernen«, sagte Alkamenes, welcher von den dreien zuerst seine heitre Ruhe wieder gewonnen hatte; »aber auch der lebendigen Wirklichkeit ihr Schönes abzulauschen, ist der verständigen Künstler Art; und daß ich es offen gestehe, mir scheint eine Milesierin, oder sonst eine Tochter der lebensfrohen ionischen Küsten weit besser geeignet, dem prüfenden Auge des Bildners die Geheimnisse der schönen Natur zu enthüllen, als die Frauen und Jungfrauen unseres heimischen attischen Landes. Es ist nicht gleichviel, wie der Bildner das Weib erblickt; ob es in blöder Verschämtheit dem Wurme ähnlich sieht, der sich in sich selber verkriechen zu wollen scheint, oder ob es die Blüte seiner Leiblichkeit in freier Anmut entfaltet. Unsere Athenerinnen bringen ihr Leben unter strenger Hut in der Zurückgezogenheit der Frauenwohnung hin. will man eines Weibes Anblick genießen, das es versteht, ohne Blödigkeit und ohne Frechheit das Auge mit seinem Reiz zu entzücken, so muß man sich an diese Ionierinnen, an diese Lyderinnen halten, die, von der jenseitigen Küste herüberkommend und gleichsam einen Hauch von der schönen Ungebundenheit ihrer heimischen Taumelfeste mit herüberbringend, das heitere Gesetz der Schönheit und der Sinnenfreude verkündigen.«
Viele von den Anwesenden stimmten dem Alkamenes bei und priesen ihn glücklich, daß er ein Weib wie diese Milesierin willfährig gefunden.
»Willfährig?« sagte Alkamenes. »Ich weiß nicht, was ihr meint; die Willfährigkeit dieses Weibes hat ihre Grenzen ... fragt nur den Nachdenklichen dort, den Wahrheitsucher, ihren Freund« –
So sprach Alkamenes und wies auf den jungen Steinmetz hin, der vorher auf der Straße zum Piräus sinnend gestanden und mittlerweile heimkehrend in den Raum des Hofes eingetreten war. Alle Umstehenden blickten bei den Worten des Alkamenes auf den Nachdenklichen und lächelten; denn sie fanden in seinem Wesen nichts, was ihn des Umgangs und der Freundschaft eines schönen Weibes hätte würdig erscheinen lassen. Er war stumpfnasig, und sein ganzes Ansehen war nicht das eines wohlgebildeten Griechen. Freilich, sein Mund lächelte trotz der wulstigen Lippen nicht unfein, und wenn seine Augen sich nicht im Nachdenken allzu starr auf einen Punkt hefteten, so blickten sie hell und Vertrauen erweckend.
»Wir kommen von unserem Gegenstande ab«, bemerkte jetzt Pheidias. »Alkamenes und Agorakritos stehen noch immer da und warten auf unsern Richterspruch. Vorläufig scheinen wir nur darüber einig, daß Agorakritos eine Göttin, Alkamenes ein schönes Weib gemeißelt.«
»Nun!« sagte Perikles, »ich glaube wahrlich, unser Alkamenes nicht bloß, sondern auch unser Agorakritos, so viel frömmer er sich auch bedünken mag, werden die Unsterblichen erzürnen, weil sie doch beide von ihrem Meister Pheidias gelernt haben, wenn sie ein Götterwesen darstellen wollen, der menschlichen Leibesbildung bis in ihr feinstes Geäder nachzugehen. Im Grunde seid ihr Bildner doch alle darin gleich, daß ihr Götter zu bilden vorgebt, in welchen wir in der Tat ein Göttliches zu erblicken und anzustaunen glauben: sehen wir aber genauer zu, so finden wir, daß dieses Göttliche doch nur die reinste Blüte und Ausgestaltung des Menschlichen, und daß auch der ätherische Götterleib nur eine Verbindung menschlicher Pulse, Sehnen, Muskeln, Gelenke und Faserbündel ist. Vernehmt doch auch einmal jenen zweiten Schüler der schönen Milesierin, euren Nachdenklichen dort! Auch er ist berufen, ein Urteil abzugeben.«
»Was meinst du«, rief Alkamenes dem Nachdenklichen zu, »ist die Natur des Menschen würdig, ein göttlich Wesen in sich darzustellen?«
»Was den Homeros und den Hesiodos betrifft und die andern Poeten«, sagte der Nachdenkliche, »so erinnere ich mich, daß sie das Meer und die Erde und alles mögliche göttlich nennen; es sollte mich daher wundern, wenn nicht auch die Menschennatur mit ihren Muskeln, Sehnen und Adern göttlich wäre. Pindaros scheint mir sogar noch weiter zu gehen, wenn er singt: »Eins ist von Anbeginn der Götter und der Sterblichen Geschlecht!« Und den weisen Anaxagoras erinnere ich mich gar kurzweg sagen gehört zu haben, daß alles, was ist, lebendig, und alles Lebendige göttlich ist. Wollt ihr aber diese Alten nicht hören, so fragt die schöne Milesierin« ...
,,Ich denke«, versetzte Perikles, »wir wären alle gar nicht abgeneigt, diesen Rat zu befolgen, wenn wir nur wüßten, wie wir es anzustellen haben, die Milesierin zur Entscheidung der Sache herbeizurufen. Kann uns etwa Pheidias diesen Dienst leisten, oder will uns Alkamenes das Geheimnis verraten, wie man sich Rat von dieser Schönen holt, oder sollen wir uns dem Nachdenklichen anvertrauen?«
»Dem Nachdenklichen!« rief Alkamenes lebhaft. »Seid gewiß, daß dieser, wenn er will, uns die Milesierin noch heute aus dem Hause des Hipponikos, wie ein Schlänglein aus seinem Versteck, durch Zaubermelodien und Besprechungen herüberlockt!«
»Wenn Alkamenes selber uns an diesen weist«, sagte Perikles, »so ist wohl der und kein anderer der rechte Mann für uns in dieser Sache. Was aber können wir dem Manne versprechen, damit er sich unser erbarmt und hingeht und uns die Milesierin herüberlockt?«
»Es dürfte nicht schwer sein«, versetzte der Nachdenkliche, »jemand zu bewegen, hier einzutreten, wenn er schon gleichsam wartend hinter der Tür steht.« »Die Milesierin ist also in der Nähe?« fragte Perikles.
»Als ich vordem«, erwiderte der Nachdenkliche, »von meinem Spaziergange auf dem Wege nach dem Piräus zurückkehrte und, von hinten her in das Haus tretend, hart an dem Gartengehege des Hipponikos vorüberkam, sah ich die Milesierin zwischen Blumenbeeten und blühenden Sträuchern stehen und einen Zweig von einem Lorbeerbusche pflücken. Ich fragte sie, welchen Helden oder Weisen oder kunstbegabten Mann sie mit diesem Lorbeer zu schmücken gedenke? Sie erwiderte, derselbe sei bestimmt für denjenigen der beiden trefflichen Schüler des Pheidias, welcher heute nach dem Urteile der Kunstverständigen als Sieger aus dem Wettstreite hervorgehen würde. »Du willst also das Glück des Siegers ins Unendliche steigern?« sagte ich; »suche doch auch den Unterliegenden einigermaßen zu trösten!« – »Gut«, erwiderte die Milesierin, »man muß sich auch des Unterliegenden erbarmen; ich will eine Rose für ihn pflücken!« – »Eine Rose?« versetzte ich, »ist das nicht etwa zu viel? Bist du sicher, daß dann nicht der Sieger den Unterliegenden gar noch beneidet?« – »So mag der Sieger wählen«, rief sie; »hier nimm den Lorbeer und hier die Rose, und überbringe sie.« – »Solltest du sie nicht selbst überreichen?« fragte ich. »Meinst du?« sagte sie. »Gewiß«, erwiderte ich. »Nunwohl!« gab sie zurück; »schicke mir den Sieger und den Besiegten hierher an die Gartenpforte, sobald die Kunstrichter das Urteil gesprochen und sich entfernt haben.« – »Wisset also«, schloß der Nachdenkliche seine Rede, »daß die Milesierin mit dem Lorbeerzweig und der Rose hinter dem Gartengehege des Hipponikos steht.«
»Gut«, sagte Pheidias, »so gehe und hole sie herüber!«
»Wie kann ich das?« versetzte jener. »Wie soll ich sie bewegen, herüber zu kommen in Gegenwart einer solchen Schar von Männern?«
»Gleichviel, wie du es anstellst«, sagte Pheidias, »das gehört zu deinen geheimen Kupplerkünsten, die brauchst du uns nicht zu verraten. Geh' nur und hole sie, da es Perikles so sehr wünscht.«
Der Nachdenkliche gehorchte. Er ging, und nach einigen Augenblicken kehrte er mit einem Weibe zurück, in dessen Gestalt die edelste Feinheit mit reizender Ueppigkeit der Bildung in wunderbarer Weise vereinigt waren. Perikles erkannte sogleich in ihr die Schöne, die er flüchtig gesehen, als er mit Pheidias sich anschickte, vom Markte aus nach dem Hafen zu gehen. Sie war schlank, und die Glieder dennoch von anmutigster Weichheit und Rundung. Ihr Gang war fest und reizvoll zugleich. Ihr krauses, weiches Haar schimmerte rötlich-braun, ihr Antlitz war von unvergleichlicher Schönheit. Das bezauberndste aber an ihr war ein feuchter Glanz, ein weicher, aphrodisischer Schimmer der wundervollen Augen. Ihr Gewand aus gelbem, weichem Byssos floß eng anschließend über die feinen, aber doch schön gerundeten Hüften zu den Knöcheln hinab. Nach oben war der Vorderteil des Gewebes an der Schulterhöhe mit dem Hinterteile durch zierliche Agraffen ineinander genestelt. Der Ueberschuß desselben aber fiel von den Schultern wieder als eine Art von Obergewand in schönen Falten hinab bis zur Mitte des Leibes. Unbedeckt ließ das ärmellose Gewand die edelgeformten Arme und verbarg nicht ganz den Umriß des jugendlich zarten und doch voll und fest entwickelten Busens. Es war der gewöhnliche Chiton der griechischen Frauen, welchen die Fremde trug, aber reich und bunt, wie man ihn bei ionischen und lydischen Frauen der asiatischen Küste sah. Die Farbe des Gewandes war glänzend gelb, die Säume mit bunten Stickereien reich geziert.
Das rötlich-braun schimmernde Haar wallte gekräuselt, wie es war, über den Nacken hinab; ein Purpurband, welches an der Stelle, wo es auf dem Vorhaupt ruhte, mit einer giebelartig gestalteten Metallplatte geziert war, hielt das reiche Gelock zusammen.
Als dies reizende Weib im Geleite des Nachdenklichen eintrat und einen so großen Kreis angesehener Männer, und darunter selbst den gewaltigen Perikles, erblickte, zögerte sie ein wenig. Aber Alkamenes trat ihr entgegen, faßte sie bei der Hand und sagte:
»Perikles, der Olympier, wünscht die schöne und weise Milesierin zu sehen.«
»Wie groß und gerecht auch das Verlangen gewesen sein mag, ein so hochgepriesenes Weib zu sehen«, sagte Perikles, »verschweigst du doch mit Unrecht, Alkamenes, daß wir zunächst durch die Verlegenheit, in welche die Entscheidung des Wettstreits zwischen dir und Agorakritos uns versetzte, auf den Rat des Wahrheitsuchers uns entschlossen, die Weisheit der schönen Milesierin zu Hilfe zu rufen. Es ist nämlich unter uns die Frage aufgeworfen worden, ob es erlaubt sei, eine Göttin unter dem Bilde eines schönen hellenischen Weibes darzustellen. In den Athenäern, fromm und den Göttern ergeben, wie sie sind, beginnt sich das Gewissen zu regen, ob sie denn nicht etwa die Sterblichen übermütig und die Götter neidisch machen, wenn sie das Göttliche allzu menschlich darstellen, und ob ihre Bildkunst überhaupt den Göttern wohlgefällig oder verhaßt sei?«
»Des griechischen Himmels Milde und Klarheit«, begann die Milesierin mit einer Stimme, deren Silberklang nicht weniger bezaubernd war, als der Strahl ihres Auges, »ist überall gepriesen, und die Leibesgestalt des Hellenen wird als die götterähnlichste selbst von Barbaren anerkannt. Die Götter von Hellas werden dem Athenäer nicht zürnen, wenn er ihnen Tempel baut, die so heiter-erhaben sind, wie der Aether, der sich über ihnen wölbt, und wenn er Bilder von ihnen aufrichtet, deren Wohlgestalt nicht hinter der Wohlgestalt derjenigen zurückbleibt, welche vor diesen Bildern Opfer bringen. Wie das Land, so der Tempel, wie der Mensch, so seine Götter! Beweisen nicht aber auch sonst die Olympischen, daß es ihr Wille und ihre Lust ist, sich zu spiegeln in der Seele des Athenäers? Haben sie nicht ihm vor allen den bildsamen Geist verliehen, und haben sie nicht der attischen Erde den besten Ton, das unvergleichlichste Gestein zum Bauen und zum Bilden anvertraut?«
»In der Tat!« fiel hier der feurige Alkamenes lebhaft ein, »alles besitzen wir; nur noch nicht das rechte, schrankenlose Feld der Betätigung! – Wahrhaftig, mir und uns allen«, fuhr er fort, auf seine Genossen weisend, »zuckt es längst in allen Fingerspitzen, und der Meißel in unseren Händen wird heiß vor Ungeduld« –
Ein Gemurmel der Zustimmung durchlief bei dieser plötzlichen Wendung des Gesprächs die ganze Werkstätte des Pheidias. »Sei nur getrost, Alkamenes«, sagte die Milesierin, mit Nachdruck die Worte betonend; »Athen ist reich geworden, übermäßig reich, und wohl nicht umsonst ist der goldene Schatz von Delos übers Meer zu euch herübergeschwommen« ...
Das schöne Weib blickte bei diesen Worten mit dem bezaubernden Auge auf Perikles. Dieser war, während sie sprach, mit seinen Blicken am Geringel ihrer hellbraunen, weichen und feinen Flechten gehangen und sagte nun zu sich im stillen: »Bei den Göttern, dieses Weibes Blondhaar selbst ist ein schimmernder Goldschatz von Delos, und mit jenem gemünzten wäre dieser ungemünzte zu teuer nicht erkauft ...«
Dann senkte er eine geraume Zeitlang nachdenklich das Haupt, während aller Blicke auf ihn gerichtet waren. Zuletzt begann er:
»Mit Recht erwartet ihr, Pfleger und Freunde der schönen Bildkunst, daß der delische Schatz nicht umsonst ans Gestade von Attika herübergeschwommen. Und hätt' ich nur nach des Herzens Belieben, nicht nach den Forderungen des Gemeinwesens zu fragen, wahrlich, ich hätte den Schatz am liebsten unmittelbar von Piräus hierher schaffen lassen in die Werkstätte des Pheidias. Aber hört, wie die Dings für denjenigen, welchem die Sorge für das Gemeinwohl obliegt, sich darstellen. Als der Perser mit seinen Scharen das Land verheerend überschwemmt und die gemeinsame Gefahr alle Hellenen vereinigt hatte, dann aber jener geschlagen abgezogen, und die große Lehre, die uns der Kampf gegeben, wieder vergessen, und der Sondergeist allenthalben wieder erwacht war, da hoffte ich dennoch, daß es möglich sein würde, das, was wir, von der Not des Krieges gedrängt, begonnen, auf friedlichem Wege fortzusetzen. Meinem Rate folgend, lud das Volk der Athenäer alle Hellenen ein, ihre Vertreter nach Athen zu senden, um über die gemeinsamen Angelegenheiten Griechenlands zu verhandeln. Ich wollte bewirken, daß mit gemeinsamen Mitteln alle von den Persern verbrannten Tempel und Heiligtümer wieder hergestellt würden. Ferner sollten die Hellenen von da an frei und sicher verkehren dürfen auf allen hellenischen Meeren, an allen hellenischen Küsten; Bürgschaften sollten geboten werden, daß unter dem Schutze eines ungetrübten Friedens das Gemeinwohl aller Hellenen ungetrübt erblühe. Zwanzig Männer wählten wir aus dem Volke, Männer, welche selbst mitgekämpft hatten in den großen Perserschlachten. Und welche Antworten brachten sie heim, diese Boten? Ausweichende von hier, unverhohlen ablehnende von dort. Vor allen aber bemühte sich Sparta den Samen des Mißtrauens gegen Athen bei den Stammverwandten reichlich auszustreuen. So scheiterte der Versuch, und Athen gewann die Erfahrung, daß es auf die Eintracht der Hellenen nicht rechnen dürfe, daß der Neid seiner Nebenbuhler nicht schlummere. Wäre mein wohlmeinender Plan gelungen, so hätte sich Athen und ganz Hellas rückhaltlos den Künsten des Friedens hingegeben, seine schönste und edelste Blüte unverweilt entfalten können. So aber ist es unsere erste Pflicht, nach immer größerer Macht, nach immer größerem Einfluß in Hellas zu trachten und immer so, wie jetzt, unangreifbar gerüstet dazustehen. Diese erste der Notwendigkeiten gebietet uns, hauszuhalten mit unsern Mitteln, so glänzend sie für den Augenblick auch sein mögen. Urteilt nun selbst, ihr Männer, ob wir die Rücksichten, welche uns die Behauptung unseres Vorranges in Hellas auferlegt, aus dem Auge verlieren und die goldenen Geschenke des Glücks schon jetzt an das Schöne und Angenehme verschwenden dürfen.«
So sprach Perikles, und da die Männer seine Rede schweigend, aber doch, wie er zu bemerken glaubte, nicht ohne heimliches Bedenken hörten, so fuhr er fort: »Erwäget die Sache, oder gebt sie dem Nachdenklichen hier, dem Wahrheitsfreunde, oder, wenn man Frauen auch in politischen Dingen hören darf, dieser Schönen aus Milet zu erwägen.«
»Wenn ich den Worten des Perikles mit meinem Verstande gefolgt bin«, hub der Nachdenkliche in seiner etwas umständlichen Art zu reden an, da alle im Kreise schwiegen, »so hat der große Staatsmann es als eine feststehende Tatsache hingestellt, daß Athen sich bemühen müsse, den Vorrang unter den griechischen Staaten zu behaupten. Auf welchem Wege aber diese Sicherung des Vorrangs erzielt werden könne, dies hat er uns noch zu erwägen anheim gestellt. Zwar hat er die bisherige allgemeine Ansicht, daß der Vorrang eines Gemeinwesens vor dem andern sich allein auf eine gewaltige Kriegsmacht stützen müsse, auch für die seinige ausgegeben. Aber weise wie er ist, unterscheidet er sich von allen früheren Staatsmännern dadurch, daß er noch andere Mittel für möglich zu halten scheint; denn wenn er solche nicht für möglich hielte, wie hätte er uns zu ihrer Erwägung aufgefordert?«
»Bist du es«, sagte Perikles, »der uns solche andere Mittel für den gleichen Zweck angeben kann, so sprich!«
»Man müßte«, versetzte der Nachdenkliche, »um diese Mittel zu erfahren, solche Personen fragen, welche erwiesenermaßen sich darauf verstehen, andern den Vorrang abzugewinnen und die Menschen ohne Anwendung von Gewalt aufs schönste und beste zu unterwerfen und zu beherrschen. Man müßte eben wieder die schöne Milesierin befragen.« Die Fremde warf lächelnd einen Blick auf den Nachdenklichen, und dieser fuhr in seiner gewohnten Redeweise, zu ihr gewendet, fort:
»Du hast gehört, daß wir erwägen, ob ein Gemeinwesen vor dem andern nur durch Kriegsgewalt und Schätze sich den Vorrang sichert, oder auch noch durch etwas anderes in der Welt, etwa durch die Pflege des Schönen und des Guten und jeder inneren Trefflichkeit. Du zählst nun zu denjenigen, welche sich darauf verstehen, andern den Vorrang abzulaufen und die Menschen ohne Gewalt aufs schönste und beste zu beherrschen. Willst du uns nicht sagen, wie du das anstellst?«
»Was uns Frauen betrifft«, versetzte die Milesierin lächelnd, »so kann ich nur sagen, daß es auf ein gewisses Maß von Wohlgestalt ankommt, und auf die Art sich zu kleiden, und auf die Kunst, anmutig zu tanzen oder bezaubernd die Zither zu spielen und was man sonst noch für Künste des Gefallens unterscheidet.«
»So weit es sich um Frauen handelt, wäre also die Frage gelöst!« sagte Perikles. »Wie aber? sollen auch wir Athenäer die Sparter und alle Inselbewohner und Asiaten durch Prunkgewänder und Wohlgestalt und anmutige Tänze und Zitherspiel zu unterwerfen und uns aufs schönste und beste zu beherrschen suchen?«
»Warum nicht?« versetzte die Milesierin. Dieses dreist hingeworfene Wort verblüffte die Männer. Das reizende Weib aber fuhr fort: »Jenes Gemeinwesen wird vor allen am meisten zu Macht und Ansehen gelangen, wo man am anmutigsten zu tanzen, am schönsten die Zither zu spielen, am besten zu bauen, zu meißeln und zu malen versteht, und wo die trefflichsten Poeten gedeihen!«
»Du scherzest!« sagten einige von den Männern.
»Durchaus nicht!« erwiderte lächelnd die Schöne.
»Wenn man näher zusieht«, sagte Hippodamos, »so scheint die schöne Milesierin mit ihrer kühnen Behauptung, die uns im ersten Augenblick lächeln machte, nicht völlig unrecht zu haben. In der Tat! Wenn die Schönheit nun einmal das Siegreiche in der Welt ist, warum sollte nicht auch ein Volk durch den Reiz des Schönen andern den Vorrang ablaufen, Ruhm, Bewunderung, Liebe, unberechenbaren Einfluß gewinnen, ganz wie eine schöne Frau?«
»Wenn nur die rückhaltlose Pflege des Schönen«, versetzte Perikles, »die Gemüter nicht weichlich und weibisch machte!« »Weichlich und weibisch?« rief die Milesierin; »ihr Athener seid es zu wenig. Gibt es nicht viele bei euch, welche euer Gemeinwesen ganz nach der düstern und rauhen Art der Sparter gestalten möchten? Es ist unrecht, zu sagen, daß das Schöne die Menschen verderbe. Das Schöne macht die Bürger heiter, zufrieden, fügsam, opferwillig, begeisterungsfähig. Was könnte beneidenswerter sein, als ein glücklich Volk, zu dessen Festen von nah' und fern die Menschen strömen? Laß den finstern, rauhen Sparter sich verhaßt machen: Athen wird salbenduftig und blumenbekränzt, wie eine Braut, sich die Herzen erobern!«
»Du meinst also«, sagte Perikles, »daß die Zeit schon gekommen, in welcher wir das Schwert aus der Hand legen dürfen, um uns dem Schönen und allen Künsten des Friedens hinzugeben?« –
»Gestattest du mir, es auszusprechen, o Perikles«, sagte die Fremde, »wann es nach meinem Bedünken Zeit ist, das Schöne zu schaffen?«
»Sprich!« versetzte Perikles.
»Die Zeit, Großes und Schönes zu schaffen«, sagte die Milesierin, »ist dann gekommen, meine ich, wenn die Männer da sind, welche berufen sind, es zu schaffen! – Jetzt habt ihr den Pheidias und die anderen Meister: wollt ihr mit der Ausführung ihrer Gedanken zögern, bis sie tatlos gealtert? Leicht findet ihr das Gold, um Schönes zu bezahlen, aber nicht immer die Männer, es auszuführen!«
Lauter und allgemeiner Beifall erscholl bei diesen Worten im ganzen Kreise.
Es gibt Blicke, es gibt Worte, die dem zündenden Blitze ähnlich in eine Menschenseele fallen. Des Perikles Seele war von einem solchen Blicke und einem solchen Worte zugleich getroffen worden.
Der zündende Blick war aus dem bezauberndsten Auge, das zündende Wort von der bezauberndsten Lippe gekommen. Der Macht des Wortes war Perikles sich bewußt; des Blickes Gewalt aber durchzuckte ihn mit einer süßen Flamme, aus deren Gluten er mehr, als er selbst es wußte, verwandelt hervorging.
Sein Auge begann Heller zu leuchten, und er wiederholte vor sich hin die Worte der Fremden:
»Die Zeit, Schönes zu schaffen, ist dann gekommen, wenn die Männer da sind, welche im stande sind, es zu schaffen!« – »Ich muß gestehen«, fuhr er fort, »dies Wort ist eines von den einleuchtenden und schlagenden. Einen besseren Anwalt konnte das, was uns allen am Herzen liegt, nicht finden. Ich glaube, du hast mich und alle, die hier sind, überzeugt. Indessen, es wäre dir nicht so leicht gefallen, schöne Fremde, wenn das, was du sagtest, nicht schon im Hintergrunde unserer Herzen geschlummert hätte. Aber willst du es mir vergönnen, daß ich mich nicht ganz und gar überwunden gebe? Willst du dich mit mir in einen gütlichen Vergleich einlassen? Ich denke, wir werden uns bemühen, unser Athen kriegstüchtig und mächtig, wie es ist, zu erhalten; aber du hast recht, wir dürfen auch nicht länger aus ängstlichen Rücksichten zögern, das zu tun, wofür die Zeit nun gekommen, weil, wie du uns zu bedenken gegeben, Männer da sind, die, wenn sie dahingegangen, niemals wiederkehren werden! – Dank' es dieser Schönen, Pheidias, wenn meine Bedenken geschwunden, und wenn ich dir und den Deinigen, welchen, wie uns Alkamenes zurief, der Meißel in den Händen brennt vor Ungeduld, die Schranken zu öffnen gelobe, damit ihr hingeht, wie ein begeistert Heer in die Schlacht, Zertrümmertes wieder aufzurichten und Schöneres, Herrlicheres, wovon ihr lange geträumt, neu zu begründen.