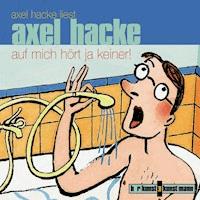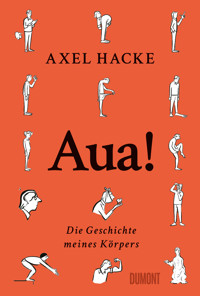
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie ist es, seit fünfzig Jahren mit einem Pfeifton im Ohr zu leben? Und: Woher kommt er überhaupt? Wie kann eine Einladung zum »Literarischen Quartett« zu einer Knieverletzung führen? Wie bricht man sich beim Meditieren einen Knochen? Axel Hacke weiß es und erzählt in diesem Buch die Geschichte und Geschichten seines eigenen Körpers, vom Standpunkt eines Mannes in der zweiten Hälfte der Sechziger aus gesehen: Es geht um die Gebrechen, aber auch um die Triumphe des Körpers und um das große, nie nachlassende Staunen über das Funktionieren desselben. Axel Hacke sucht nach Antworten auf einige alte Fragen – Habe ich einen Körper oder bin ich mein Körper? Und wem gehört dieser eigentlich? Dem, der drin wohnt? – und gewährt Einblicke in das Banale und das Geheimnisvolle, das Rührende und das Großartige, das Lustige und das Fürchterliche, das Schöne und das Abstoßende seines eigenen und letztlich unser aller Körper.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
»Wir haben vielleicht unterschiedliche Ansichten über Gendern oder Landwirtschaftssubventionen.
Aber verdauen tun wir alle.«
Jeder Körper hat seine eigenen Geschichten zu erzählen. Doch Axel Hacke zeigt, dass das Körperliche uns nicht trennt, sondern verbindet.
Und noch etwas haben wir gemeinsam: Wir denken über alles Mögliche nach, über den eigenen Körper jedoch oft erst im Notfall. Das ist schade, denn: Was wären wir ohne ihn? (Andererseits: Was wäre er ohne uns?)
© Matthias Ziegler
Axel Hacke lebt als Schriftsteller und Kolumnist des Süddeutsche Zeitung Magazins in München. Er gehört zu den bekanntesten Autoren Deutschlands, seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Für seine Arbeit wurde er mit vielen Preisen ausgezeichnet. Weitere Lebensläufe unter: www.axelhacke.de
Sein letztes Buch, ›Über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte‹, erreichte 2023 Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste.
Nishant Choksis
Axel Hacke
Aua!
Die Geschichte meines Körpers
Mit Illustrationen von Nishant Choksi
Von Axel Hacke ist bei DuMont außerdem erschienen:
Über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte
E-Book 2024© 2024 DuMont Buchverlag, KölnAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Illustrationen: © Nishant ChoksiSatz: Angelika Kudella, KölnE-Book Konvertierung: CPI books GmbH, LeckISBN E-Book 978-3-7558-1059-9
www.dumont-buchverlag.de
Für Ursula
Vorbemerkung
Ich betrachte ein Fotoalbum aus alten Zeiten.
Da liegt ein Baby mit vielen dunklen Haaren auf einem hellen Fell und schaut mit aufmerksam geöffneten Augen den Fotografen an.
Da sitzt ein Kleiner mit langen Locken in einer eisernen Wanne und hält ein Spielzeug in der Hand.
Da läuft ein zweieinhalbjähriges Kind unsicher und nur mit einem Hemdchen bekleidet über einen Rasen. Man sieht seinen Pillermann, so wurde in den 50er-Jahren das Geschlechtsteil von Buben genannt, jedenfalls in unserer Familie. Wir deklinieren: der Pillermann, des Pillermanns, dem Pillermann, den Pillermann.
Those were the days, my friend
We thought they’d never end
Der Kleine bin ich.
Der Kleine war ich.
Ich bin jetzt 68 Jahre alt. 1, 82 Meter groß, vor vierzig Jahren waren es noch 1, 84 Meter. Ich bin geschrumpft, das ist normal, die Bandscheiben werden dünner, wenn man altert. Ich wiege 86 Kilogramm. 84 wären mir lieber, vielleicht schaffe ich es noch, aber ich mache mich nicht verrückt. Der Body-Mass-Index-Rechner der Techniker Krankenkasse spuckt die Zahl 26, 0 aus und sagt: »Sie wiegen etwas zu viel.« Ich sollte maximal 82, 8 Kilogramm wiegen.
Unmöglich. So wenig habe ich noch nie gewogen. Oder vielleicht als Jugendlicher.
Lange, dunkle Locken habe ich nicht mehr, aber auch keine Glatze. Unten ohne laufe ich schon lange nicht mehr über Rasenflächen, ich bin ja nicht verrückt. Zum Pillermann sagen wir jetzt Penis. Oder Schwanz. Dazu später mehr.
Was ich sagen wollte: Mich fasziniert auf naive Art die Entwicklung meines Körpers, sein Wachsen und Sichausdehnen, dann wieder sein Schrumpfen, seine Kraft und die langsame Schwächung, der stetige Kampf dagegen. Seine Geschichte. Dass ich von einem kleinen Menschen zu einem kraftvollen Kerl werden konnte, nie einem großen Athleten, aber doch zu einem, dem sein Körper nicht in erster Linie Schwierigkeiten machte. Sondern große Freude.
Manche Menschen schreiben irgendwann ihre Memoiren, sie berichten von ihren geistigen Leistungen und ihrem Schaffen. Warum verfasst niemand eine Geschichte seines Körpers, berichtet von den Narben in seiner Haut und den damit verbundenen Ereignissen? Erzählt von den Schmerzen, den ausgefallenen Zähnen, den Beulen und Flecken, von Haarverlust und Knorpelschwund. Aber auch: von den Triumphen seiner Muskeln und den Möglichkeiten seiner Lunge. Vom Alltag seines Herzens. Meinetwegen auch von den Mühen seiner Leber. Und davon, wie sich seelische Lasten in körperliche Probleme verwandeln konnten.
Das Kind auf dem Fell, der Typ hier am Schreibtisch, eines Tages der Leichnam im Sarg – alles ich.
Wissen Sie, was mich beschäftigt?
Ich habe mein ganzes Leben mit diesem Körper verbracht. Ohne ihn ginge es ja nicht. Und dennoch weiß ich erstaunlich wenig über ihn. Fragte mich jemand, wo meine Leber sitzt, ich müsste raten. Hätte ich die Funktion meiner Galle zu erklären, ich könnte es nicht. Sollte ich etwas über den Grund sagen, aus dem meine Finger eines Tages aufgehört haben zu wachsen – ich hätte keinen Schimmer.
Robert Gernhardt schrieb in seinem Gedicht Das Dunkel:
Ob im Mann, ob im Weib,
Dunkel herrscht in jedem Leib.
Das wirft ein Licht auf die Tatsache, dass manche von uns mehr über den Weltraum oder neueste Entwicklungen in der Fußballnationalmannschaft wissen als über das Innere des eigenen Körpers.
Wir leben in und mit etwas zum großen Teil Unbekanntem, und das, obwohl wir von nichts anderem so abhängig sind und manche von uns ihre Körper mit Leidenschaft modellieren, kleiden, tätowieren, ernähren und in manchen Fällen und zu gewissen Zeiten: zeigen.
Während wiederum andere ihre Leiber vernachlässigen, als hätten sie nichts mit ihnen zu tun.
Ist es nicht übrigens das, was uns seinerzeit an Gunther von Hagens’ Körperwelten-Ausstellung so fasziniert hat: dass man hier von außen das Innere von Körpern sehen konnte? Also in die Menschen hineinblickte, ins Dunkel fremder Leiber?
Genau dieses Unbekannte jedenfalls spiegelt sich in den Erlebnissen des Verfassers, der einerseits nie eine Vorsorgeuntersuchung versäumt, andererseits trotzdem nicht wirklich erklären kann, woher genau seine wiederkehrenden Schmerzen im linken Unterkörper etwa auf der Höhe des Beckenrandes kommen. Irgendwas mit den Muskeln dort, Hüftbeuger heißt die Muskelgruppe, und sie ist stressempfindlich, seltsam. Alle Spezialisten haben versichert, es sei nichts Bedrohliches.
Andererseits: Weiß man’s?
Trifft man nicht jeden zweiten Tag jemanden, der vom schlimmen Schicksal eines anderen erzählt, von einem, der es mit irrenden Ärzten zu tun gehabt hatte?
Mein Onkel Wolfgang, der ein einfacher Mann war und dem im frühen Alter nach und nach ein Organ nach dem anderen den Dienst versagte, antwortete jedenfalls auf die Frage, welche Krankheit er eigentlich habe, stets nur: »Das habe ich auch nicht so richtig verstanden.«
Wir wissen viel, wir denken über alles Mögliche nach, über den Körper jedoch oft erst im Notfall. Dabei ist er ungeheuer interessant.
Wir haben es im Folgenden nun mit einem männlichen Körper zu tun, der zweifelsohne seine besten Jahre hinter sich hat. Aber ehrlich gesagt, so sicher bin ich mir da auch wieder nicht. Denn bisweilen habe ich das Gefühl: Wann war es je besser als jetzt, so ausgeruht und reflektiert, nicht mehr getrieben von unnachsichtigen Hormonen, umsichtig auf die physischen Bedürfnisse bedacht und noch ordentlich bei Kräften?
Jedenfalls gibt es, gerade weil dieser Körper nicht mehr der allerjüngste ist, allerhand über ihn zu berichten. Kein besonderer Körper, nebenbei gesagt, besonders im Sinne von herausragend schön oder großartig geformt oder andererseits unfassbar dick oder irgendwie durch Krankheit eingeschränkt.
Aber das ist es ja. Das vereint uns alle: Jede und jeder hat einen Körper und muss mit ihm zurechtkommen. Es geht also um das Verhältnis zum eigenen Körper im Lauf des Lebens und das Verhältnis dieses Körpers zur Welt und damit um einige Leib-Seele-Probleme am konkreten Beispiel. Dies übrigens in Zeiten, in denen der Mensch sich dem Körper bisweilen mit religiös anmutender Hingabe widmet, vom Essen bis zum einer Pilgerfahrt ähnelnden Wellness-Wochenende. In denen der Körper manchmal ein Statussymbol ist.
Es geht um die Zeit, die sich in unseren Körpern abbildet, die vergehende Zeit des Lebens und die Zeit, in der wir leben. Davon hat jede und jeder von uns seine Geschichten zu erzählen, gute und schlimme. Ich erinnere mich, es als Kind ganz normal gefunden zu haben, dass erwachsenen Männern Arme fehlten oder Beine oder dass sie blind waren. Wir waren umgeben von Versehrten, mein Vater gehörte zu ihnen. Es war die Zeit des Krieges, die sie verstümmelt hatte.
Man könnte auch sagen: Hier versucht jemand, die Welt und sich selbst anhand des eigenen Körpers zu verstehen, denn es gibt letztlich kaum ein persönliches Erlebnis, das sich nicht irgendwie dem Körper eingeschrieben hat, Narben, Falten, Flecke, Schründe, Macken, Brüche.
Nur muss man eben auch bedenken: Wenn wir uns auf eine solche Reise begeben, die unterhaltsam sein soll wie jede schöne Reise, dann berühren wir nicht nur die Grenzen dessen, was wir »intim« oder »persönlich« zu nennen uns angewöhnt haben. Wir überschreiten sie sogar. Oder zucken zurück. Entscheiden uns für ein Geheimnis, das eines bleiben soll. In jedem Fall sollten wir uns darüber klar sein, dass es hier an der einen oder anderen Stelle um jene Gefühle gehen wird, die für Menschen am schwersten auszuhalten und deshalb auch nicht leicht einzugestehen sind: Scham und Angst.
Warum dann überhaupt aufbrechen?
Vielleicht aus dem ältesten aller Gründe für Aufbrüche überhaupt?
Aus Neugier?
Also: Es gibt Risiken, es mag Nebenwirkungen geben. Aber wen könnte man deshalb fragen? Vermutlich diesmal keinen Arzt und keine Apothekerin.
Aber sich selbst, oder?
Scham und Angst. Dazu wäre zu sagen, dass ich versuche, meine Angst immer erst zu prüfen, bevor ich entscheide, ihr nachzugeben oder nicht. Ist mir die Angst nützlich? Oder steht sie meinem Leben nur im Weg? Und was die Scham angeht: Ich habe in den Jahrzehnten, in denen ich schreibe, immer mehr das Gefühl bekommen, dass uns die Scham sehr oft nutzlos in die Quere kommt, weil man sich nämlich aus manchem Alleinsein nur retten kann, wenn man begreift, dass andere sich für die gleichen Dinge schämen und mit denselben Gefühlen allein sind. Und dass man dies nur überwinden kann, wenn man sich mitteilt. Vielleicht sind Bücher auch in meinem Leben als Autor und als Leser immer eine Rettung vor der Einsamkeit gewesen.
Also – das Thema kann uns weit tragen, wird aber immer zu dem einen Körper und seiner Geschichte zurückführen, zum Rührenden und zum Großartigen an ihm und damit an allen Körpern, zum Banalen und Geheimnisvollen, Lustigen und Fürchterlichen, Schönen und Abstoßenden, Peinlichen, Entblößten und Verhüllten, all das eben am Beispiel der Geschichte meines Körpers, jener einzigen und letzten Bastion, die mich vom Tode trennt.
Was wäre ich ohne ihn?
Andererseits: Was wäre er ohne mich?
Haut
Ich betrachte die Haut meiner Hände. Sie sitzt nicht mehr so straff wie früher, auch sehe ich Flecken. Ist nichts Schlimmes, sagt der Hautprofessor zu mir. Wenn ich ihn frage, ob das Hautkrebs sei: Kann ich Ihnen wegmachen. Aber das Wegmachen verschieben wir auf den Herbst. Komischerweise gehe ich zum jährlichen Routinebesuch immer im Frühjahr. Bis zum Herbst habe ich mich mit den Flecken abgefunden. So bleibt meine Handhaut fleckig wie ein Tarnanzug.
Der Hautprofessor ist seit Jahrzehnten mein Stamm-Dermatologe. Ich schätze ihn über die Maßen, er redet nicht lange herum, weiß immer alles und sofort. Manchmal beantwortet er Fragen, bevor ich sie gestellt habe.
Sie haben eine gute Haut, sagt der Hochgeschwindigkeits-Hautarzt, und das macht mich stolz. So hoffe ich, dass meine gute Haut in Zusammenarbeit mit dem Arzt mich vor allem Malignen bewahren wird.
Ich habe auch eine Haut, die leicht braun wird. Ein Tag in der Sonne und ich sehe aus wie andere Leute nach drei Wochen im Süden.
Vielleicht sollte ich erwähnen, dass ich zu wenig Sonnencreme benutze. Der Arzt sagt, ich müsse mir, was die malignen Scheußlichkeiten angehe, wahrscheinlich nie Sorgen machen. Bei seinem Zusatz, wenn Sie eine 50er-Creme benutzen, bin ich gedanklich schon an der frischen Luft.
Wenn ich also mit meiner Frau am Meer bin oder an einem See, salbe ich mit Hingabe ihren Rücken. Das ist übrigens etwas, das ich im Leben erst lernen musste: mich mit Hingabe einem anderen Körper zu widmen, also vom eigenen Körper abzusehen und mich auf einen anderen Körper zu konzentrieren, den meiner Frau, wie gesagt.
Aber ich war ein guter Schüler. Ich befolgte alle Anweisungen, mehr auf die Schultern, heißt es ja immer. Ich lernte, keine Anweisungen mehr zu benötigen, und schließlich lernte ich, von mir selbst zu lernen, meinem eigenen Gefühl.
Aber bevor ich die Sonnencreme selbst benutzen könnte, habe ich schon was anderes zu tun. Sonnencreme langweilt mich, was meine eigene Haut angeht.
Warum?
Als Kinder wurden wir mütterlicherseits gemahnt, uns einzucremen. (Jedoch keineswegs so dringlich, wie Mütter das heute tun.) Wir taten es nie. Ein Sonnenbrand galt nicht als Todesbote, man hielt ihn für unvermeidlich. Ohne Sonnenbrand wirst du nicht braun, wurde gesagt. Fuhren wir an die Nordsee, galt entzündete Epidermis als unerlässliches Durchgangsstadium auf dem Weg zu Erholung und Bräune, was für identisch gehalten wurde. Wir wälzten uns nachts voller Schmerzen, die Haut ließ sich in Streifen vom Körper ziehen, rohes Fleisch wurde sichtbar. Das hörte nach Tagen auf.
Wenn wir uns eincremten, dann in der Regel erst, wenn wir einen Sonnenbrand hatten. Einmal las ich, die Haut merke sich jeden Sonnenbrand jahrzehntelang, und manchmal entstehe Hautkrebs als Folge solcher Schäden erst viel später. Das hat mich fürchterlich erschreckt. Aber nur kurz. Ich kann es eh nicht mehr ändern.
Ist die Haut nicht unser größtes Organ? Ja! Ich sollte sie besser behandeln.
Vielleicht muss ich erwähnen, dass ich Sonnenbaden hasse. Wenn andere sich im Schein der Strahlen aalen, eingehüllt in Ambre Solaire, Nivea, Tiroler Nussöl, Eucerin, Cetaphil und wie sie alle heißen, sitze ich mit Hemd im Schatten, mag die Hitze nicht und auch nicht das Herumliegen in einer sülzigen Panade aus Creme, Öl, Schweiß, Sand und Salz. Der Schatten ist mein Revier. Nasensonnenbrand habe ich trotzdem in jedem Frühsommer.
In den Niederlanden gibt es in vielen Gemeinden Gratis-Sonnenmilchspender, zonnebrandcrème, wie der Niederländer sagt, tegen de schadelijke gevolgen van de uv-straling. Auch bei der Fußballeuropameisterschaft 2024 standen Spender mit kostenloser Sonnenmilch in vielen deutschen Städten. Geht das weiter, werden bald unsere Offiziellen, die sich einst zu Beginn der Pandemie 2020 im Video langwierig ihre Hände wuschen, gefilmt, wie sie sich sorgfältig mit Sonnenmilch eincremen.
Jedenfalls ist es interessant, wie aus Vater im Verlauf meines Lebens Mutter Staat wurde, nicht wahr? Überall dieses um unsere Körper Besorgte. Kaum hat der April begonnen, warnt man uns vor den Gefahren des Sommers. Es scheint nichts mehr zu geben, das ungefährlich wäre, auch beim Licht sehen wir vor allem den Schatten. Juli und August sind voller Schrecken. Dann naht der triste Winter, ohne Sonne. Noch schlimmer als Sonne ist ja nur die Abwesenheit von Sonne.
Manchmal denke ich, was aus meiner Sonnenmilch-Aversion geworden wäre, hätte meine Mutter vor jedem Strandbesuch gerufen: Sonnenmilch gibt’s nicht! Wehe, du cremst dich ein! Wahrscheinlich würde ich mich heute einölen wie eine Dosensardine. Man entkommt seiner Kindheit nicht. Für meine Haut wäre es am besten, wenn an jeder Ecke staatliche Schilder vor Sonnenschutz warnten. Aber das kann man nicht verlangen.
Ich betrachte mich im Spiegel.
Da sind Falten, natürlich, sie stören mich nicht, von einigen am Hals mal abgesehen. Wissen Sie, was ich toll fände? Wenn ab und zu mal das Gesicht des jungen Mannes, der ich war, neben mir im Spiegel erschiene. Nur zum Vergleich. Es würde mich nicht traurig machen. Ich hadere nicht mit dem Älterwerden, wozu denn? Bedenke ich die Alternative, bin ich sogar froh.
Da sind auch Narben.
Die Naht rechts oben an der Stirn, die von einem Unfall herrührt, als ich vier Jahre alt war. Ein Motorroller hatte mich angefahren und die Haut aufgerissen.
In der Nähe des rechten Handgelenks ein schmaler Strich, der aussieht wie die Folge eines fehlgeschlagenen Suizidversuchs. Wir verbrachten als 17-, 18-, 19-Jährige ein Wochenende im Landhaus der Eltern eines Kameraden und waren dorthin unter anderem mit einem VW-Käfer gefahren. Am Nachmittag rasten wir mit dem Wagen durch den Wald, es gab Leute, die vorne auf der Kofferraumhaube saßen, ich stand auf der hinteren Stoßstange. Es war Wahnsinn, aber wir bejubelten unsere Freiheit. Der Fahrer war betrunken und ohnehin etwas irre, er donnerte im Rausch über die schmalen Waldwege. Ich konnte mich an einer Bodenwelle nicht mehr festhalten, rutschte langsam vom fahrenden Wagen ab und riss mir am Metall die Haut auf, gefährlich nahe an der Schlagader.
Über der Nase die Spur einer – wie soll ich sagen? Friedensverletzung? (Ich habe als Soldat keinen Krieg erlebt, also habe ich auch keine Kriegsverletzung.) Ich hatte mir jedenfalls als Richtschütze tief unten in einem Bundeswehrpanzer während eines Manövers im Gelände am Zielfernrohr den Schädel aufgeschlagen.
Am Ringfinger rechts ein Strich, auch aus Bundeswehrzeiten. Damals wollte ich eine Dose, in der sich ein Gasmaskenfilter befand, mit der Hand aufbiegen, als der Dosenöffner abgerissen war. Es blutete höllisch, ein Arzt musste ran.
Ich erinnere mich, dass an einer Wunde einmal überschießendes Gewebe entstanden war, eine dunkelrote Wucherung, die dann wieder verschwand. Wildes Fleisch nannte der Arzt das, ein Ausdruck, den ich nie mehr vergessen habe, weil er wie der Titel eines Pornos klingt.
Heiße Körper, wildes Fleisch.
Die Haut sei der Reisesack des Lebens, hat Robert Musil im Mann ohne Eigenschaften geschrieben, als er einen Mann auf dem Totenbett beschrieb. Ja, nun: Sack? Das klingt, als wären wir hineingefüllt in diese Haut wie Kohlen oder Mehl. Aber das stimmt nicht, wir sitzen bestens strukturiert in unseren Häuten.
Manchmal stelle ich mir vor, meine Haut wäre mir zu groß wie ein Pullover Größe 56. Ich würde sie nicht ausfüllen und müsste sie zurechtzupfen.
Ich habe eine gute, schon etwas ältere weiße Haut. Vor mehr als sechzig Jahren wäre nie jemand auf die Idee gekommen, diese Tatsache als eine zu betrachten, die mir im Leben Privilegien verschafft hätte. Heute ist das anders. Es ist noch dazu eine Männerhaut. Ich halte nichts davon, beleidigt zu sein, wenn man mich als alten weißen Mann bezeichnet. Es stimmt ja (wobei, na ja, alt …), auch wenn sich die Leute mal eine weniger abgegriffene Formulierung überlegen könnten. Hätte ich mein Leben mit einer dunklen Frauenhaut verbracht, wäre alles schwieriger gewesen. Aber dann wäre es auch nicht mein Leben gewesen.
Was soll ich machen? Ich versuche, mich als meiner Haut halbwegs würdig zu erweisen.
Haut ist (und war immer) von kaum zu überschätzender Relevanz für unser Leben. Sie wird gelesen und interpretiert, mit neuen Bedeutungen versehen. Ihre Farbe ist seltsamerweise wichtig, obwohl wir lernen sollten, sie als unwichtig zu sehen. Blässe galt im 19. Jahrhundert als Zeichen derer, die sich der Mühsal körperlicher Arbeit nicht unterziehen mussten, später wiederum als etwas Ungesundes. Man schminkt sich und definiert die eigene Person über Tattoos. Ist Haut ein Text, der gelesen wird? Oder ist sie ein Bild, das jeder von sich selbst entwirft oder das die Natur von ihm entworfen hat? Und ist sie gerade deshalb in unserem Zeitalter der Bilder von größter Bedeutung?
Auf Youtube sah ich einen kleinen Film mit dem Moderator Ralph Caspers zum Thema Quantenphysik: Wo endet mein Körper? Anders gesagt: Wo genau ist die Grenze zwischen mir und allem anderen?
Interessanterweise ist die Frage nicht leicht zu beantworten.
Rückt man der Haut auf die Pelle, unserer Grenze zur Welt, sieht man, dass sie mit ihrer äußersten Schicht endet, der Hornschicht, und zwar bei deren äußersten Zellen, und zwar bei den Aminosäuren, aus denen diese Zellen bestehen, und zwar bei den Molekülen, aus denen wiederum diese Aminosäuren bestehen, und zwar bei den Ketten von Kohlenstoffatomen, aus denen wiederum die Moleküle bestehen.
Es sei offensichtlich, sagt Caspers: Ich höre da auf, wo das letzte Atom meiner äußeren Hautschicht ist.
Nun ist es aber so, dass Atome aus einem winzigen Kern bestehen, der von punktförmigen Elektronen umkreist wird. Sie sind so klein, dass sie kein Volumen haben, keine Größe. Diese Elektronen haben keine festen Umlaufbahnen. Sie schwirren sozusagen in unscharfen Wolken herum. Man kann nie sagen, wo ganz, ganz, ganz genau gerade unser Körper aufhört, weil man niemals ganz, ganz, ganz genau zu bestimmen vermag, wo gerade das äußerste Elektron ist.
Die Körpergrenze ist unscharf, nimmt man es ganz, ganz, ganz genau.
Ich liebe diesen Gedanken. Wenn wir an unser Äußerstes gehen, verschwimmen wir ein ganz klein wenig mit dem Universum, so wie die Grenzen unseres Globus, vom Weltall aus betrachtet, auch ein ganz klein wenig unscharf sind. Und ich liebe auch den Gedanken, dass, wenn ich mit den Fingern und ihren Spitzen, mit den Händen und ihren Flächen über die Haut meiner Frau streiche, dass dann also Hunderttausende unserer äußersten Elektronen sich berühren, voneinander abprallen, sich wieder aufeinander zubewegen, ping pong pang ging gong gang bing bong bang, sich vertauschen, austauschen, ineinander verhaken und wie unsere Körper dann in quantenphysischem Taumeln versinken.
Auf der Haut, die jeden von uns einhüllt, leben mehr Bakterien, als es Menschen auf der Welt gibt. »Sie sind eine Wolke aus Lebewesen, ein wandelndes Ökosystem«, schreibt Jörg Blech an die Leserinnen und Leser seines Buchs Leben auf dem Menschen gerichtet. »In Ihrem Körper gibt es 100 Billionen Zellen. Rund 90 Prozent von ihnen sind aber nicht menschlichen Ursprungs, sondern gehören zu jenen Kreaturen, denen die Evolution den Menschen zugewiesen hat: als Nahrungsquelle und Schlafplatz, als Hochzeitsmarkt und Futterstelle, als Raststätte und Kreißsaal.«
Ein Beispiel: Auf unser aller Häuten leben zwei winzige Arten von Spinnentieren, Demodex folliculorum und Demodex brevis, wobei Demodex Schmalzbohrwurm bedeutet, weil man diese Wesen zum ersten Mal im Ohrkanal entdeckte. Es handelt sich um in der Regel harmlose Haarbalgmilben, die sich vom Sekret unserer Talgdrüsen ernähren.
Spinnenphobikerinnen und Spinnenphobiker, seid ihr noch da?
Sie sind fast durchsichtig. Männchen erreichen durchschnittlich eine Länge von 280 Mikrometern. Bei Babys sind sie noch nicht vorhanden, bei Erwachsenen über siebzig zu hundert Prozent. Ich persönlich nähere mich der Vollbesiedelung durch Demodex. Die Tiere leben hauptsächlich im Gesicht, manchmal auch auf Knien, Brüsten, Zungen und Vorhäuten, wobei drei oder mehr Tiere einen Haarfollikel bewohnen. Ihre Köpfe stecken dabei in der Haut, ihre Hintern schauen an die frische Luft, und manchmal tauchen sie ganz ab.
Wir sind schon lustig. Und eklig, in vielerlei Hinsicht. Teilweise. Teilweise aber auch nicht. Wir sind alles Mögliche.
Aber da ist dieses Wolkenhafte, Unscharfe, nur oberflächlich betrachtet exakt Begrenzte unserer Existenz.
Vor etlichen Jahren stellte der New Yorker Literaturagent John Brockman einmal führenden Wissenschaftlern und Denkern die Frage: Zu welchem Thema haben Sie Ihre Meinung geändert und warum?
Der dänische Wissenschaftsautor Tor Nørretranders antwortete, er habe früher gedacht, der Körper sei eine Art Hardware, auf der sich sozusagen die Software abspiele, unser Geist also. Heute denke er anders. Unser Körper sei selbst die Software.
Es handele sich bei ihm nämlich keineswegs um etwas Stabiles wie einen Tisch oder einen Stuhl. Er gleiche vielmehr einem Fluss. 98 Prozent der Atome, aus denen unser Körper besteht, werden jedes Jahr ersetzt. Wassermoleküle bleiben maximal zwei Wochen, jene in den Knochen einige Monate. »Aber fast kein einziges Atom harrt in Ihrem Körper von der Geburt bis zum Tod aus«, lese ich in Nørretranders’ Antwort, die in Deutschland der Tagesspiegel 2008 veröffentlichte.
Und weiter: »Das, was konstant an Ihnen ist, ist nicht materiell. Ein Mensch verleibt sich jedes Jahr durchschnittlich 1, 5 Tonnen Materie ein, in Form von Essen, Trinken und Sauerstoff. Diese Materie begreift, was es heißt, Sie zu sein. Jedes Jahr wieder. Neue Atome müssen lernen, sich an Ihre Kindheit zu erinnern.« Als diese Erkenntnis zum ersten Mal auftauchte, sagte der Physiker Richard Feynman: »Die Kartoffeln von letzter Woche! Sie können sich jetzt daran erinnern, was in Ihrem Kopf vor einem Jahr vor sich ging.«
Wir reden also von ständiger Wiedergeburt. Das hat natürlich nicht nur mit unserer Haut zu tun, aber auch, weil es hier eben um unsere Grenze einerseits und die ständige Verbindung mit unserer Umwelt geht – aber noch einmal ganz anders.
Nørretranders vergleicht das mit der Musik seiner Teenagerzeit, sie war anfangs auf Vinylplatten zu finden, dann auf Kassetten, schließlich auf CDs und heute im Internet. So ist das mit meinem wiederkehrenden Appetit auf Bratwurst: Er lagert heute auf anderen Atomen als in meiner Kindheit. Aber er bleibt da, solange es Atome gibt.
Ist das nicht irre? Dass wir unseren Körper als etwas Festes, materiell stabil Konstituiertes verstehen, dass er aber in Wahrheit eine Transitstation für Atome ist?
Und das ist nicht alles.