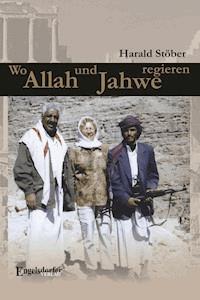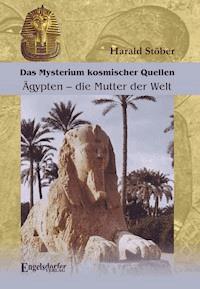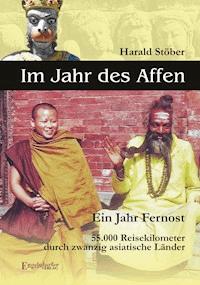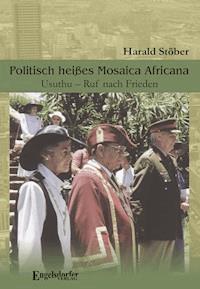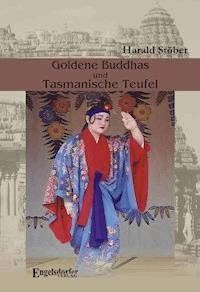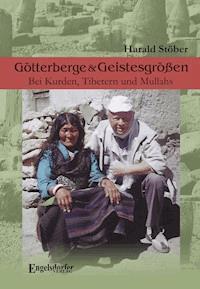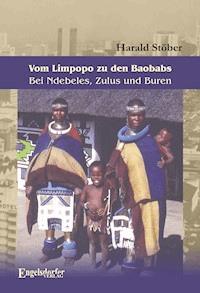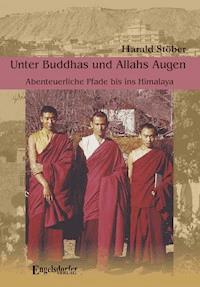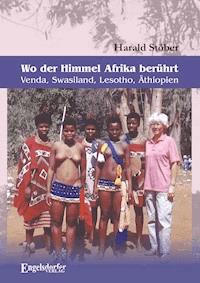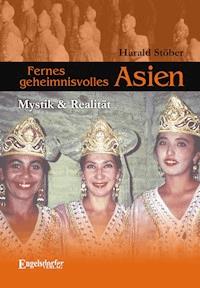6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Als Solist den real existierenden Ostblock und den bürgerkriegsgeschüttelten Balkan zu bereisen, setzte einen gewissen »Mut zum Mut« voraus, der für unser Reiseehepaar seit vielen Jahren die Richtschnur zur Durchführung ausgefallener Aktivitäten ist. Bereits seit den Sechziger Jahren erkunden die Stöbers mit »Herz und Verstand« nicht nur Osteuropa, sondern die ganze Welt, ohne je aus den Augen verloren zu haben, Fakten und Eindrücke schnörkellos und wahrheitsgemäß zu Papier zu bringen. Das heißt also nicht, dass der Autor auf Emotionales gänzlich verzichtet hätte! Dieses Buch spiegelt aus engagiert kritischer Sicht eine Erfahrungswelt wider, die sich auf zwölf Touren durch alle ost- und südosteuropäischen Länder gebildet hat. Dabei wurden gut 61.000 Reisekilometer bewältigt sowie 170 Städte und Dörfer besucht, deren facettenhafte Eigenheiten dem Leser unter die Haut gehen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Harald Stöber
Auf heiklen Wegen in Europa
Bei Völkern bis zum Schwarzen Meer
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Copyright (2012) Engelsdorfer Verlag
Alle Rechte beim Autor
Titelfoto:
Ein Liraspieler in Kaniv hoch über dem Dnjepr
Coverrückseite:
Der Katharinenpalast in Puschkin bei Moskau
www.engelsdorfer-verlag.de
eISBN: 978-3-86268-786-2
Man sollte die
Welt so nehmen
wie sie ist, aber
nicht so lassen.
Anonymus
Gewidmet meiner
lieben Familie und
allen guten Freunden.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Europa ist nicht nur heile Welt
1. Kapitel
Unter Roten Sternen
Deutsche Demokratische Republik
Tschechoslowakei (ČSSR)
Ungarn
Rumänien
Bulgarien
Jugoslawien
2. Kapitel
Jenseits von Oder und Neiße
3. Kapitel
Bis hinauf nach Estland
Tschechien
Polen
Ukraine
Belarus
Litauen
Lettland
Estland
4. Kapitel
In Moskau und St. Petersburg
Moskau
Sagorsk/Sergijew Possad
St. Petersburg
Puschkin
5. Kapitel
Bei Skipetaren und Helenen
Kroatien
Montenegro
Albanien
Mazedonien
Griechenland
6. Kapitel
Als Pilger nach Mount Áthos
7. Kapitel
Ostpreußen war einmal
8. Kapitel
Potjomkin und Jalta
9. Kapitel
Das Orakel schweigt
10. Kapitel
Unter hellster Sonne
11. Kapitel
Von Fremdmächten attackiert
Bulgarien
Mazedonien
Kosovo
Serbien
12. Kapitel
Bei Mönchen und Antiken Göttern
Vorwort
Europa ist nicht nur heile Welt
Es bedurfte seit jeher, insbesondere in den Siebziger Jahren, einer willensstarken Courage, als Individualreisender gen Ost und Südost aufzubrechen, um fernab offizieller Darstellungen die dortigen Wirklichkeiten kennenzulernen. Das war zu Zeiten, als sich in Europa noch zwei feindlich gesinnte Blöcke gegenüberstanden, besonders heikel, da man stets das Gefühl hatte, nicht nur von Spitzeln professionell beobachtet zu werden, sondern auch von unzähligen Augenpaaren misstrauischer »Leute auf der Straße«.
Bei näherem Hinschauen und Hinhören entdeckte ich jedoch selbst im sogenannten Ostblock von Land zu Land gravierende Unterschiede, die sicher nicht immer im Sinne Moskaus lagen – die den Begriff »Ostblock« oft auch ad absurdum führten. So spürte ich in der DDR unablässig einem gestrengen Regime ausgeliefert zu sein und stets als potentieller Spion beäugt zu werden, was in der UdSSR (Ukraine) und in Rumänien zum Alltag gehörte, aber im kommunistischen Polen und sozialistischen Jugoslawien durften sich Westbesucher schon damals frei bewegen und brauchten keine besondere Zurückhaltung üben, wenn es beispielsweise um politische Meinungsäußerungen ging.
Als ab 1989 beziehungsweise ab Gorbatschow die sogenannte Wende eingeläutet wurde, veränderte sich nicht nur Osteuropa tiefgehend, sondern praktisch die ganze politische Welt. Fast von heute auf morgen standen plötzlich alle Türen offen, so dass ich als wissensdurstiger Reisender endlich zu meinem Recht kam, nämlich als Individualist Mensch und Kultur in Osteuropa sowie auch auf dem Balkan angstfrei zu verinnerlichen. Dabei entdeckte ich einen wahren Ozean an Fremdartigkeiten, was mich bis ans Lebensende beschäftigen könnte, so dass die Gefahr besteht, dabei die übrige Welt sträflich zu vernachlässigen.
Dieses Buch spiegelt Jahrzehnte intensiver ost- und südosteuropäische Reisejahre wider, die ich gewohnt schnörkellos und offen zu Papier gebracht habe, wobei sich Subjektivität und Objektivität möglichst die Waage halten, und dennoch ist der berühmte Rote Faden kritisch. Großen Wert legte ich zwar auf Historisch-Kulturelles, aber auch der Mensch als Individuum kommt an vielen Stellen zu seinem Recht, egal, ob als Bürgerkriegsgeschädigter oder Kuttenträger auf dem Balkan, als Bierkonsument in Russland oder als Chorsänger in orthodoxen Gotteshäusern. Um einen möglichst umfassenden Eindruck vom östlichen und südöstlichen »heiklen Europa« aus der Sicht eines politisch und kulturell interessierten Reiseindividualisten zu bekommen, unternahm ich zusammen mit meiner Frau zwölf Touren beziehungsweise reiste 61.000 Kilometer weit. Dabei sammelten wir wertvolle Erfahrungen in nicht weniger als 170 Städten und Dörfern, die es wert sind, an »Interessenten mit Herz und Verstand« weitergereicht zu werden.
1. Kapitel
Unter Roten Sternen
Der Leser wird gespürt haben, dass wir die beiden ersten Autoreisen nach Ungarn und in die ČSSR mit großem Interesse und echter Freude unternommen hatten, auch wenn so manches Erlebnis und Gesehene alles andere als ausgesprochen angenehm war. Was uns ziemlich deprimierte, war die nicht zu übersehende Ärmlichkeit, die uns vor allem in den sehr vernachlässigten Stadtrandgebieten begegnete, ein Zustand, den wir aber andernorts bald als gegeben hinnahmen, denn daran ändert ja weder viel Meckerei noch gar Zorn etwas. Aber wir hatten auch gelernt, dass die Städte, insbesondere die als Aushängeschilder dienenden Metropolen, viel zu bieten haben, was man als Europäer gesehen haben sollte.
Aus diesen Erfahrungen heraus entwickelte sich schließlich ein Vorhaben, das mit zu den größten und interessantesten werden sollte, die wir bisher erlebt haben: Wir planten eine Autoreise durch nicht weniger als sieben Ostblockstaaten, ein Mammutunternehmen, das nicht nur dem neuen Wagen – einem zitronengelben Ford 1300 – viel abverlangte, sondern natürlich auch uns. Ich maß auf Landkarten gut 7.000 Kilometer, doch am Ende kamen tatsächlich rund 9.000 gefahrene Kilometer heraus – leider aber nicht ganz schadlos!
Die von uns vorgesehene Route, die wir unterwegs vor allem wegen der strikten Einhaltung der UdSSR-Reisedaten unter keinen Umständen wesentlich verändern durften, hatte im Wesentlichen folgenden Verlauf: Dresden, Pressburg, Pécs, Debrecen, Cluj, Sibiu, Moldauklöster, Odessa, Constanţa, Bukarest, Varna, Sofia, Skopje, Dubrovnik, Mostar, Sarajewo.
Auf diese wochenlange Reise – sozusagen »Rote Sterne total« – bereitete ich mich als der verantwortliche Tourenplaner besonders gründlich vor, war ich mir doch im Klaren darüber, dass unterwegs hinsichtlich Devisen, Visa und insbesondere in »Sachen Auto« nichts passieren durfte. So sammelte ich notwendige Informationen in Form von Prospekten, Karten sowie allgemeiner Autoreiseunterlagen und stellte mit diesem Material für jedes Land eine eigene Leitz-Mappe zusammen. Außerdem arbeitete ich einen genauen Tourenplan aus, der alle infrage kommenden Daten, wie Ein- und Ausreisetage, Zahl der Übernachtungen an welchen Orten, zu fahrende Kilometer und nicht zuletzt touristische Stichpunkte enthielt. An dieser Art der Rundreiseplanung hat sich im Prinzip bis heute nichts geändert.
Nicht ganz einfach war naturgemäß die Beschaffung der verschiedenen Visa, denn das musste wegen der schnellen Verfallstermine rasch vonstatten gehen. Die längste Zeit nahm die Visabeschaffung für die UdSSR in Anspruch, denn auch das für Reisen in die UdSSR spezialisierte Münchener Büro Lindex sah keine Möglichkeit für eine Beschleunigung. Die Antragstellung mittels langer Fragebögen und das Bezahlen der Hotel- und Visakosten ging über das genannte Büro leider sehr schleppend über die Bühne, denn erst nach 4 Wochen gelangten wir endlich wieder in den Besitz unserer Reisepässe mit separaten, kyrillisch getippten Visa; in die Pässe gestempelt wurde also nicht. Die Visa Nummer K-2 394485 für mich und Nummer K-2 394484 für Hilde enthielten mit allen wichtigen Daten und Lichtbild versehene Ein- und Ausreisekarten und besagten, dass wir uns vom 22. bis 24. August 1973 als Autoreisende in Odessa aufhalten durften. Gebucht und bezahlt hatten wir – in West-Devisen versteht sich – das Hotel Chorne More.
Die Visa für die DDR wollten wir uns über das selbe Büro beschaffen, doch da lagen die Bedingungen etwas anders. Wir konnten zwar bei Lindex das Interhotel Königstein in Dresden buchen, erhielten die Buchungsbestätigung nebst Rechnung aber direkt von der Generaldirektion des DDR-Reisebüros in Ostberlin, Alexanderplatz. Bestätigt wurde uns unter der Nummer 108-8488/73 im genannten Hotel ein Doppelzimmer vom 4. bis 6. August 1973 zum Preis von 66 DM pro Tag zuzüglich 5 DM für je ein Frühstück. Obwohl wir über diese Priese ziemlich schockiert waren, mussten wir nun auch B sagen und zahlen.
Während wir laut Auskunft des zuständigen Reisebüros Vay Kiepert in München für Bulgarien nur ein an der Grenze auszustellendes Transitvisum benötigen würden, ging die Beschaffung der Visa für Ungarn (8 Tage Aufenthalt), für Rumänien (1Woche Aufenthalt) und für die ČSSR (3 Tage Aufenthalt) problemlos über die Bühne. Das ungarische Visum wurde uns gebührenpflichtig unter der Nummer 55-350-9342-1/2 ausgestellt, das rumänische ebenfalls gebührenpflichtig unter der Nummer 10.843 und das ČSSR-Visum ohne Nummer, aber ebenfalls gebührenpflichtig. Für Jugoslawien war schon seinerzeit der Visumzwang für Deutsche abgeschafft worden.
Wie man sieht, bedurfte es der Überwindung einer ganzen Reihe formalistischer Hürden, die wir letztlich aber alle nehmen konnten, doch ein befreiendes Gefühl war damit leider nicht verbunden, zeigten doch die zu erfüllenden Voraussetzungen ganz klar die Absicht, dass dem Individualtouristen von vornherein vorhandener Übermut beschnitten werden sollte. Und so war’s dann auch, denn in lockere Urlaubsstimmung sollten wir nicht kommen. Dass später noch weitere Hürden hinzukamen – Zwangsumtausch, Straßenbenutzungsgebühren, Beobachtungsängste und oftmals zermürbende Hotelsuchereien – sei vorausgeschickt.
Nach vielen Vorbereitungsarbeiten, von denen ich oben nur die wesentlichsten beschrieben habe, kam dann endlich der Tag der Abreise, es war der 3. August 1973. Wir hatten gottseidank die Möglichkeit, unsere beiden jetzt 12-jährigen Söhne für die Dauer dieser großen Ostreise bei den Schwiegereltern in Holland zu lassen, so dass wir beruhigt die abenteuerliche Reise antreten konnten.
Die zirka 700 Kilometer lange Fahrt über beste Autobahnen bis nach Holland war problemlos in acht bis neun Stunden erledigt, so dass ich hinsichtlich der Leistungsfähigkeit unseres neuen Vehikels zufrieden sein konnte. Mit einem Westauto durfte im Osten möglichst nichts passieren, denn Ersatzteile gibt es, wenn überhaupt, in der Regel nur in den Hauptstädten oder müssen auf dem Luftweg auf eigene Kosten eingeflogen werden. Ich möchte nicht wissen, wie kompliziert das wegen der tausend Bestimmungen hierfür wäre und wie lange man auf sein fehlendes Teilchen warten müsste. Kurzum, ich nahm mir vor, mich äußerst vorsichtig im dortigen Straßenverkehr zu bewegen, es durfte einfach nichts passieren.
Deutsche Demokratische Republik
Am frühen Morgen des 4. August endlich Start gen Osten. Dass ich den kommenden paar Tagen mit besonderer Spannung entgegenfieberte, kann jeder verstehen, der selbst einmal vor vielen Jahren seine Heimatstadt zum letzten Mal mit eigenen Augen gesehen hatte. Ziemlich genau vor einem Vierteljahrhundert, im September 1948, mussten wir bei Nacht und Nebel Dresden verlassen und über West-Berlin per leerem »Kartoffelbomber« in den Westen flüchten. Ich hatte mir für Dresden, unserer ersten Station auf dieser Ostreise, natürlich viel vorgenommen, denn niemand von uns wusste, ob sich noch einmal eine solche Möglichkeit ergeben würde.
Wir durchfuhren nonstop auf gewohnt guten Straßen das gesamte Ruhrgebiet und erreichten bereits gegen Mittag den Grenzkontrollpunkt Herleshausen/Schmilka. Während auf westdeutscher Seite lediglich eine Personalausweiskontrolle stattfand, wurde es auf der anderen Seite erwartungsgemäß komplizierter. Da mussten sich die in die DDR Einreisenden zunächst einmal im Slalomfahren (Straßenhindernisse zur Verhinderung von Fluchtversuchen) und Schlangestehen üben. Als wir nach zirka einer halben Stunde an der Reihe waren, wurden beide Reispässe, die Buchungsbestätigung und 30 DM für 2 Visa verlangt. Das alles verschwand in einer geheimnisvollen Röhre, doch die Abfertigung als solche ging weiter. Wir mussten Zollerklärungen ausfüllen (Angabe von Devisen, Filmen, Wertgegenständen und so weiter) und bei einem weiteren Posten nochmals 30 DM berappen: »Straßenbenutzungsgebühr für eine einmalige Reise in die Deutsche Demokratische Republik bis 300 Kilometer (Stufe II) und zurück nach den geltenden Rechtsvorschriften der Deutschen Demokratischen Republik – Gebührenbescheinigung Nummer A 299799«, so der offizielle Text. Das waren pro 10 Kilometer immerhin eine DM. Etwas später wurden uns die abgestempelten Reisepässe mit Aufenthaltsbescheinigung, Ein- und Ausreisvisum nebst Quittung für Visagebühren ausgehändigt und angenehmer Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen Republik gewünscht. Die offizielle Staatsbezeichnung »Deutsche Demokratische Republik« hörten und lasen wir während des Einreisemanövers sicherlich 50-mal!
Nun wollte ich bescheidene 50 DM gegen Ostmark umtauschen, doch das zuständige Staatsorgan schüttelte heftig seinen Kopf, als es hörte, dass wir für zwei bis drei Tage nur diesen mickrigen Betrag tauschen wollten, zusammen 100 DM sei das Mindeste! Also tauschte ich brav 100 DM und erhielt hierfür nur lächerlich 100 Ostmark. Bei jeder Bank im Westen hätte ich offiziell mindestens 400 Ostmark bekommen!
Wer mich sparsamen Bundesbürger kennt wird ahnen, dass ich angesichts horrender Visa- und Straßenbenutzungsgebühren, hoher Hotelkosten und politisch erzwungenem Umtausch »zum falschen Kurs« ziemlich sauer war. Doch was will man machen, wenn die DDR mit Dresden auf der Reiseroute lag!
Nun hatten wir’s also endgültig unter die Haut bekommen: Wir befanden uns in der »Friedliebenden Deutschen Demokratischen Republik, dem ersten Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem Boden«. Wir wurden auf überdimensionalen Schildern vom »Volk der Deutschen Demokratischen« herzlich willkommen geheißen und brauchten jetzt nur noch brav den nicht zu übersehenden Autobahnschildern »Transit« zu folgen. Ein Abweichen hiervon, auch das wurde uns am Übergang mehr als einmal eingetrichtert, ist nach den »geltenden Rechtsvorschriften der Deutschen Demokratischen Republik« strafbar.
Aber all diese nervenden Dinge schluckten wir, wenn auch nicht ohne Murren. Wir waren vom Übergangszeremoniell derart »beeindruckt«, dass wir die »Grenzorgane« beinahe um einen Staublappen gebeten hätten, um uns vor dem Betreten der »sauberen Deutschen Demokratischen Republik« schnell noch einmal die Schuhe abzuwischen.
Die Transitstrecke nach Dresden führte vorbei an Erfurt, Gera und Karl-Marx-Stadt (Chemnitz), eine Autobahn in nur sehr mäßigem Zustand – absolut nicht vergleichbar mit den unseren. Es fehlten Leitplanken, die Beschilderung war bis auf »Transit« äußerst dürftig und die Fahrbahn an unzähligen Stellen defekt. Wir waren uns sicher, dass hier seit Hitlers Zeiten so gut wie nichts repariert worden war. Wofür dann eigentlich die hohen Straßenbenutzungsgebühren in West-Mark?
Je näher wir an Dresden herankamen, desto häufiger lasen wir Schilder mit »brüderlichen Willkommensgrüßen an die Adresse der Jugend der Welt«, die sich, was wir zuvor gar nicht gewusst hatten, zurzeit in Dresden zu einem propagandistisch groß aufgemachten Meeting traf. Wir konnten also erwarten, in Dresden auf jede Menge junges Volk zu stoßen, das fröhlich und dankbar dem unerschütterlichen Friedenswillen der Deutschen Demokratischen Republik huldigt.
Ich gebe zu ein bisschen Herzklopfen gehabt zu haben, als ich das gelbe Stadtschild »Dresden« hinter mir hatte und mich nun zum ersten Mal nach 25 Jahren wieder in meiner alten Heimatstadt befand. Aber auch hier, wie schon in der ČSSR und in Ungarn, wurde ich zunächst einmal tief getroffen von den verwahrlosten, völlig überalterten Zuständen in den Stadtrandgebieten; wir mussten lange suchen, um ein halbwegs intaktes Gebäude zu entdecken. In einem ähnlich schlechten Zustand waren vor allem auch die Straßen. Selbst stark befahrene Ausfallstraßen hatten noch holpriges Kopfsteinpflaster, aus dessen Seitenschlitzen Gras wuchs.
Angenehm fiel mir als Autofahrer die Straßendisziplin auf, denn nicht ein einziges Mal sah ich ein riskantes Manöver, musste ich mich über zu hohe Geschwindigkeiten oder zu dichtes Auffahren ärgern. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand: Jeder Unfall hat strengste öffentliche Folgen, Ersatzteile sind äußerst schwer zu bekommen und nicht zuletzt sind die Uniformen der zuständigen Organe allgegenwärtig.
Als ich in der Gegend des Neustädter Bahnhofes die ersten mir noch in Erinnerung gebliebenen Häuser sah, dann den Albert-Platz (heute »Platz der Einheit« – welcher Einheit?) und wenig später die Augustus-Brücke und das gegenüberliegende wohlbekannte Altstädter Panorama, musste ich ein wenig mit den Tränen kämpfen, denn immerhin verbrachte ich hier einen Großteil meiner Kindheit, die ersten Schuljahre und erlebte hier von A bis Z den mörderischen alliierten Bombenhagel am 13. und 14. Februar 1945, von dem mir noch bis auf den heutigen Tag jede Phase gegenwärtig ist.
Wir querten die Augustus-Brücke und gelangten – am Zwinger, dem Postplatz und Altmarkt vorbeifahrend – zum Hauptbahnhof und zum Interhotel »Königstein«, an dessen Rückseite ich unser gelbes Auto unter den neugierigen Blicken gelangweilter alter Rentner parkte. Einer sprach uns sofort ohne Umschweife an und gab in unverkennbar sächsischem Tonfall zu verstehen, dass er sich jedes Mal freue, wenn Westler zu Besuch kämen. Wir sollten jedoch, meinte er mahnend, sehr darauf achten, dass unser Auto stets gut verschlossen sei und außen keine abschraubbaren oder leicht abzumontierenden Gegenstände aufweise, denn hier könne man alles gebrauchen und verwerten!
Wir betraten das Interhotel »Königstein« – einen modernen Hochbau im oberen Drittel der völlig zerstört gewesenen Prager Straße – vom Parkplatz aus durch den Hintereingang und wurden sogleich von einem netten Rezeptionsmädchen freundlich begrüßt. Nachdem wir die üblichen Formalitäten erfüllt und zum Zweck der polizeilichen Anmeldung unsere Pässe abgegeben hatten, wurde uns das Zimmer 418 zugewiesen. An der selben Rezeption bekamen wir zufällig mit, wie sich zwei offensichtlich ahnungslose junge DDR-Leute – wahrscheinlich Jugendtreffbesucher – nach dem Zimmerpreis erkundigten: zirka 350 Mark pro Person und Nacht ohne Frühstück! Ich hörte nur noch, wie einer der beiden murmelte, dass er dafür ja drei Wochen lang schuften müsse.
Sowjetfahnen zum Zeichen »brüderlicher Verbundenheit« in Dresdens Altstadt 1973.
Auf dem Zimmer, einem einfach eingerichteten Raum im 4. Stock mit Blick in Richtung Hauptbahnhof, studierte ich an der Rezeption gegriffenes Informationsmaterial und lernte, dass der »Ruhm Dresdens nur auf die großen Leistungen der Werktätigen zurückgehe und darüber hinaus es ausschließlich der Führung der Kommunistischen Partei und dem großen sowjetischen Brudervolk zu verdanken sei, dass es dieses Stück geheiligter deutscher Friedenserde überhaupt gebe«. Als ich den vor Floskeln dieser und ähnlicher Art nur so strotzenden offiziellen Propagandatext gelesen hatte, war mir endgültig klar, dass ich in eine mir völlig unbekannte fremde Welt geraten war, eine Welt, die ich als Heimat, so sehr mich dieser Gedanke auch schmerzte, nicht mehr bezeichnen konnte, jedenfalls nicht zum damaligen Zeitpunkt.
Dresden nur aus touristischer Sicht zu beschreiben ist mir als Dresdner, der zutiefst an dieser Stadt hängt, nicht möglich. Selbst, wenn ich mich ausschließlich auf’s Touristische mit geschichtlichen Hintergrunddaten beschränken würde, müsste ich hierüber hundert Seiten zu Papier bringen, so ergiebig ist Dresden! Doch darauf muss ich verzichten und mich weitgehend auf das beschränken, was ich unmittelbar erlebte, sah und empfand. Im Folgenden deshalb nur ein paar kurze Stichworte zur Geschichte und Gegenwart.
Dresden (slawisch »Die Sumpfwaldleute«) ist aus zwei slawischen Fischerdörfern und einer 1206 erstmals erwähnten markgräflichen Burg entstanden, an die sich eine deutsche Stadt anschloss. 1485 wurde Dresden dauernder Regierungssitz der Landesherren von Meißen-Sachsen. Im 17. bis 18. Jahrhundert war Dresden von einem besonders prunkvollen Hofleben geprägt.
Den Ruhm Dresdens als einer der schönsten deutschen Städte, auch Elbflorenz genannt, begründeten in erster Linie die Bauten der wettinischen Landesherren. Dem Umbau des Schlosses im 16. Jahrhundert und dem Großen Garten (1676 bis 1680) folgten die Bauwerke des Japanischen Palais’ (1715), der Frauenkirche (1726 bis 1743), der Katholischen Hofkirche und des Alten Rathauses (1741 bis 1745). Späteren Zeiten gehören die Gemäldegalerie (1847 bis 1856), das Opernhaus (1871 bis 1878) und das Neue Rathaus (1905 bis 1910) an. Der Gemäldegalerie, einer Sammlung von Weltruf, wurden 1955 siebenhundertfünfzig Gemälde von der Sowjetunion zurückgegeben.
Bis 1952 war Dresden Hauptstadt des Landes Sachsen mit rund 490.000 Einwohnern (1939: 630.000 Einwohner!). Dresden liegt beiderseits der hier 130 Meter breiten Elbe, 106 Meter über dem Meeresspiegel in geschützter Beckenlage inmitten der langgestreckten Elbtalweitung. Es ist heute Behördensitz, hat Technische Hochschule, Militärakademie, Hochschulen für Musik, Theater, Akademie der Bildenden Künste, Medizinische Akademie, ein Zentralinstitut für Kernforschung, Museen und große Parks.
Nun drängte es mich verständlicherweise hinaus in die Stadt, in die Wirklichkeit Dresdens von 1973, suchend nach Dingen, die ich noch in Erinnerung hatte.
Unser erster Weg führte zum nahegelegenen Hauptbahnhof, der als eines der ganz wenigen Bauwerke der Altstadt nach dem Krieg in alter Form wieder aufgebaut wurde, obwohl er sehr stark zerstört worden war. Selbst die vielen bunten Fahnen, die auf dem Bahnhofsvorplatz anlässlich des internationalen Jugend-Meetings im Wind flatterten, vermochten in mir nicht jene grausamen Bilder zu tilgen, die mir hier sogar noch verstärkt wieder ins Bewusstsein rückten: ein paar Tausend von Bomben, Granaten und Phosphor zerfetzte und entstellte Flüchtlinge, die hier auf ihren Weitertransport gewartet hatten und von tieffliegenden Aufklärern angeblich als Truppenansammlung erkannt worden waren. Hier und in der Prager Straße war ich damals zusammen mit meiner Mutter über riesige Leichenhaufen gestiegen, immer hoffend, irgendwo noch ein Lebenszeichen unserer Verwandtschaft zu entdecken – vergeblich.
Hilde, die wohl spürte, was in diesen Augenblicken in mir vorging, ging mit hinein, sah sich das massive Innere nicht weniger interessiert an und entschloss sich erst nach einigem Zögern, auch noch hoch zu den Bahnsteigen zu gehen. Wahrhaftig – alles wie früher: Dampfloks, Reklameschilder, Schalter, Fenster, Bedachung, Uhren, Endpuffer, Reisende – so, als hätte es die apokalyptischen Tage im Februar 1945 überhaupt nicht gegeben. Dank an die Stadt Dresden, dass sie wenigstens diesen altehrwürdigen Bahnhof wieder hergestellt hat!
Doch was nun folgte – der Gang durch die Prager Straße, durch die modernen Wohnviertel (Gegend Gürtzstraße, Fučikplatz) bis hinunter zur Elbe war für mich leider wenig erfreulich, denn erstens empfand ich die Neubauten als ausgesprochen seelenlos, und zweitens waren fast 30 Jahre nach der Zerstörung vor allem im historischen Teil der Altstadt immer noch riesige Ruinen zu sehen, die selbst durch die mittlerweile fast ausgewachsenen Bäume dazwischen nicht schöner geworden waren.
Rechts und links der oberen Hälfte der Prager Straße hat man viel zu groß geratene eintönige Wohn-, Geschäfts- und Hotelbauten hochgezogen, die heute das einst weltberühmte Bild dieser wichtigsten Straße Dresdens bestimmen. An dieser traurigen Tatsache vermögen auch nicht die bunten Propagandastreifen »Der Sozialismus siegt« oder »Es lebe die unverbrüchliche Freundschaft zum sowjetischen Brudervolk« vorbeizumogeln. Als gewisse Auflockerung empfanden wir lediglich ein paar »Sputnik-Brunnen«, die vielen roten Fahnen und flanierendes Jung- und Altvolk.
Als wir das neue Kino – das ist ein modern konzipierter Rundbau – passiert hatten, kamen wir zur Kreuzkirche, die sich rechtsseitig zur Elbe hin blickend befindet. Hier wurden kurzerhand ganze Häuserzeilen beseitigt, die allerdings völlig zerstört waren. Die Kirche, eine der berühmtesten der Stadt, wurde gottseidank wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt, obwohl sie sehr stark beschädigt war. Wir konnten uns im Innern ungehindert umsehen und feststellen, dass noch heute schwarze Brandspuren »als Mahnung« zu erkennen sind. In Eingangsnähe erinnern eindringlich zahlreiche Fotos daran, in welch hoffnungslosem Zustand sich diese nicht nur durch den Dresdner Kreuzchor so berühmte Kirche kurz nach dem Angriff befunden hatte.
Unweit der Kreuzkirche befindet sich das Dresdner Rathaus, ein sehenswerter Bau, der dem Bombenhagel nur knapp entkam, jedenfalls nicht total zerstört wurde. Auch dieses Gebäude wurde dankenswerterweise wieder instandgesetzt und kann von Besuchern besichtigt werden. Wir nahmen uns leider nicht die Zeit, gegen ein bescheidenes Eintrittsgeld den Rathausturm zu besteigen, um uns die heutige Innenstadt Dresdens aus der Vogelperspektive zu betrachten. Der Blick reicht bis hoch zum Hauptbahnhof und bis hinunter zum eigentlichen Stadtkern, dem Schloss- und Zwinger-Viertel – das nächste Mal!
Im gemütlichen Rathauskeller, der, soweit ich erkennen konnte, ebenfalls noch oder wieder im alten Zustand war, nahmen wir mangels anderer Angebote ein denkbar einfaches Krautessen zu uns und beobachteten zum ersten Mal, wie vorsichtig und leise sich hier zusammensitzende junge Leute unterhalten. Niemals hörten wir eine laute Unterhaltung oder auch nur Bruchstücke davon, denn – das wurde uns von Stunde zu Stunde bewusster – man achtet hier sehr darauf, dass die »Ohren der Organe« keine Privatgespräche mitbekommen.
Insbesondere scheint die hiesige Polizei auf Jugendliche einen Kieker zu haben, sahen wir doch während unseres nur zwei Tage dauernden Aufenthalts immer wieder beflissene strenge »Staatsorgane«, die alle möglichen Papierchen kontrollierten. Wer wirklich das Bedürfnis haben sollte, einen richtigen Polizeistaat kennenzulernen, dem können wir diesen friedliebenden Arbeiter- und Bauernstaat empfehlen, denn auf so viele Uniformen und »auffällig Unauffällige« wie hier trifft man nirgendwo!
Nun stand der Stadtkern und das Wichtigste der Neustadt auf unserem Programm; den Zwinger, den Weißen Hirsch und andere sehenswerte Dinge nahmen wir uns für morgen vor. Wir passierten den äußerlich nichtssagenden neuen Kulturpalast und sahen uns die umliegenden Straßen an, die zum Teil noch erhalten waren beziehungsweise wieder hergestellt wurden. Hierbei handelt es sich um jenes untere Stück der Prager Straße, in dem ich 1936 in der Prager Straße Nummer 7 das Licht dieser Welt erblickte. Aber mein Geburtshaus, das wusste ich schon vorher, und alle umliegenden Häuser waren seinerzeit vollkommen zerstört worden. Lediglich das der Kreuzkirche gegenüberliegende große Kaufhaus am Altmarkt konnte trotz fast totaler innerer Vernichtung wieder hergestellt werden.
Nur wenige Gehminuten von hier entfernt kamen wir zum Komplex des Königlichen Schlosses, das heute allerdings weitgehend Ruine ist. Lediglich der Turmdurchgang, das Georgentor, wurde wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt, und es waren an den Durchgangssäulen noch jene mir bekannten Puttenfigürchen zu sehen, die zum historischen Stadtbild Dresdens gehören.
Als wir das Georgentor hinter uns hatten, gelangten wir zum Schloßplatz mit der Brühlschen Terrasse, der Hofkirche und dem Alten Finanzministerium. Ich spürte, wie wohl mir hier das Kopfsteinpflaster unter den Füßen tat, denn als Kind war ich unzählige Male in dieser Gegend, lag sie doch auf dem direkten Weg zur Prager Straße Nummer 7, wo meine Großeltern, Tanten, Onkel und Cousinen wohnten. Ich kannte jede Straßenlaterne, jede Putte, jede Figur, jeden Turm!
Von einer Bank der Brühlschen Terrasse aus sahen wir über diesen Schloßplatz hinüber zur Hofkirche, deren Äußeres mir heute noch so vertraut ist, wie damals. Nur die teils zugemauerten Fenster störten mich, sie erinnerten daran, dass auch diese berühmte Kirche dem Brand zum Opfer gefallen war. Des Weiteren erkannten wir die Vorderfront des Königlichen Hoftheaters und natür-lich auch die vom Schloßplatz aus-gehende Augustus-Brücke, sowie die teilweise noch bestehenden Ge-bäude früherer Ministerien (Finanz-, Kriegs- und Justizministerium). Mein Gott, wie oft hatte ich im Sommer barfuß die Augustus-Brücke überquert und für 20 Pfennige im Winter die zugefrorene Elbe passiert!
Das Dresdner Schloss (ab 16. Jahrhundert) war 1973 immer noch Ruine – wie auchdie Semper-Oper.
Wir gingen hinüber zum Theaterplatz, bewunderten die vordere Fassade und den herrlichen Eingang zum Zwinger, die Vorderfront des Hoftheaters (Semper-Oper) und besahen uns das Italienische Schlösschen, ein heute wieder funktionierendes altes Café. Vom Hoftheater war jedoch nur noch die genannte Vorderfront vorhanden. Auf den Ruinen der Seitenfassaden wucherten Bäumchen und Büsche, und im Innern rostete ein schweres Baugerät schon seit Jahren vor sich hin. – Wie ich 1982, also 37 Jahre nach Kriegsende, erfuhr, soll dieses weltberühmte Theater jetzt endlich wieder aufgebaut werden! In den Jahrzehnten vor dem Krieg, das weiß ich von meinen Eltern und anderen Dresdnern, war dieses Viertel der Treffpunkt der Kunstwelt, hier wurden später berühmt gewordene Opern uraufgeführt, hier trafen sich die Großen der Gesellschaft und flanierten kostbar gekleidete Damen hinüber zum Italienischen Schlösschen, um dort die Stunden nach der festlichen Aufführung zu verbringen. Der Platz soll so blank gewesen sein, dass keine der Damen um die Sauberkeit ihres langen Abendkleides zu fürchten brauchte!
Und heute? Alles voller Touristenbusse und das in einer Umgebung, die leider nur zum Teil wirklich sehenswert ist, denn überall ragen immer noch wie mahnende Todesfinger die ausgebrannten Turmruinen des Königlichen Schlosses, des Prinzen-Palais und der Sophienkirche in den Himmel, wachsen grüne Bäume und Gräser zwischen gespenstischen Ruinen und spürt man angesichts dieser letzten Zeugen einer wahnsinnigen Bombennacht allenthalben eine gedrückte Stimmung. Einer wie ich, der vom gegenüberliegenden Elbufer diese berühmte Kulisse hat lichterloh brennen sehen und darüber auch heute noch Schmerz empfindet, bekommt zwangsläufig bleierne Füße, wenn er sich nach so langer Zeit wieder einmal hier umsieht! Der nächste Tag war abermals der Stadt gewidmet, sollte es doch schon morgen früh in Richtung ČSSR weitergehen. Deshalb machten wir uns zeitig auf, um keine Stunde unseres ohnehin viel zu kurzen Aufenthalts zu vergeuden. Nach dem Frühstück im Hotel ohne Bohnenkaffee oder Tee (leider war gerade alles ausgegangen!) gingen wir abermals durch die Prager Straße, hielten uns nach dem Rathaus rechts, um zum Neumarkt zu kommen, wo das Standbild Martin Luthers gen Westen gerichtet vor dem Trümmerhaufen der einst weltberühmten Frauenkirche steht und mahnend seinen Zeigefinger hebt. Wie deutlich habe ich noch diesen herrlichen Platz und diese wuchtige, architektonisch einmalige Kirche vor Augen! Aber von all dem war bis auf den erwähnten Steinhaufen und dem Standbild Luthers absolut nichts mehr zu sehen.
Wir gelangten, an tristen neuen Wohnblocks billigster Bauweise vorbeigehend, wieder zur Brühlschen Terrasse, querten abermals den Schloß- und Theaterplatz und strebten endlich dem Dresdner Zwinger zu, jenem monumentalen Prachtgebilde, das heute ein touristischer Anziehungspunkt von allerhöchstem Rang ist. – Es wird immer wieder behauptet, dass der Zwinger nach der totalen Zerstörung wieder aufgebaut wurde, doch ist das leider oder gottseidank nur die halbe Wahrheit. Tatsache ist – das habe ich mit eigenen Augen gesehen –, dass der Zwinger glücklicherweise nur zu einem Teil in Mitleidenschaft gezogen wurde und schon wenige Monate nach dem Bombenangriff wieder besucht werden konnte. Wäre der Zwinger wirklich total zerstört worden, würde es ihn heute auch nicht mehr geben, wie beispielsweise die Frauenkirche, oder das Schloss. – Als ich diese Zeilen zu Papier brachte, schrieben wir das Jahr 1973!
Der Zwinger ist ein 1711 bis 1722 errichtetes Prachtensemble, dessen sieben durch eine einstöckige Galerie miteinander verbundene Pavillons einen 117 Meter langen und 107 Meter breiten Innenraum umschließen, den wir ehrfurchtsvoll betraten. Dieser ganze Komplex sollte nach den Plänen Pöppelmanns den Vorhof zu einem noch großartigeren Schloss bilden! Daraus geworden ist schließlich von Rokokodetails abgesehen die glänzendste und anmutigste Verkörperung des Barock, ein Bauwerk, das schon so manch weichherziges Gemüt zu Tränen gerührt hat.
Das Kronentor des barocken Zwingers (Anfang 18. Jahrhundert) erstrahlt nach derZerstörung 1945 wieder in neuem Glanz.
Wir hielten uns lange hier auf, umwanderten immer wieder die herrlichen Brunnen, bewunderten die alten würdevollen Lampen, Innenfassaden, Treppen, Figuren, Fenstergalerien und nicht zuletzt das anmutige Kronentor an der dem Eingangstor gegenüberliegenden Seite. Doch hier gab es auch Schmerzhaftes zu sehen, nämlich jene schon genannten »Todesfinger«, die man vom Innenraum des Zwingers aus ständig vor Augen hatte.
Natürlich besuchten wir auch die heute wieder weltberühmte Dresdner Gemäldegalerie, die im Seitenflügel zum Theaterplatz hin untergebracht ist und eine fast nicht mehr zu verkraftende Menge großartiger Kunstwerke aus alten Zeiten aufweist. Absoluter Höhepunkt ist das Monumentalbild »Madonna di San Sisto« oder »Die Sixtinische Madonna«, das Raffael (Santi) wahrscheinlich 1515 für die Klosterkirche der Benediktiner in Piacenza gemalt hatte. Der Sächsische Hof kaufte dieses Bild 1753 für 60.000 Taler, dessen Hauptmotiv noch heute als »die höchste Verklärung der Jungfrau als Himmelskönigin und als unaussprechliche Schönheit und Hoheit« gelten. Es zeigt Maria das Jesuskind im Arm haltend und auf Wolken schwebend den Heiligen Sixtus und die Heilige Barbara, sowie zwei reizende kleine Engelchen am unteren Rand.
Tief beeindruckt vom Zwinger machten wir uns auf die Neustadt zu »ergründen«, wenn es dort besonders Sehenswertes auch nicht mehr gibt. Dafür verbindet mich umso mehr mit diesem Teil Dresdens, denn hier in der Neustadt verbrachte ich meine frühe Kindheit, ging ich zur Schule und wohnte ich in der Bautzener Straße.
Wir querten die geschichtsträchtige Augustus-Brücke, die schon im 13. Jahrhundert bestanden hatte, 1813 von Franzosen teilweise und im Mai 1945 von Deutschen gesprengt wurde. Wie liebten wir als Kinder doch diese Brücke! Vorbei am Goldenen Reiter, der frisch restauriert worden war, kamen wir zum Albertplatz, früher einmal das pulsierende Herz zwischen Neustadt und Altstadt. Der heutige »Platz der Einheit« lässt jedoch kaum mehr ahnen, welche Bedeutung er vor dem Krieg einmal gehabt hat. Das alte Hochhaus ist schon mehr schwarz als grau (hier hatte ein englisches Kampfflugzeug dieses Gebäude gerammt und war abgestürzt), das einst gern besuchte, 1871/73 von Schreiber erbaute Albert-Theater ist ausgebrannt und 1973 noch eine traurige Ruine, und die alten Geschäfte um den Albertplatz existieren nicht mehr. Diese Trostlosigkeit konnten auch die vielen Partei- und Jubelfahnen anlässlich des Jugend-Meetings nicht verdecken.
Wir wandten uns dann linker Hand dem Neustädter Bahnhof zu, der während des Bombenhagels im Februar 1945 erstaunlicherweise kaum gelitten hatte und besichtigten auch dessen Innenleben. Wie damals! Nun querten wir abermals den Albert-Platz – »Platz der Einheit« will mir einfach nicht aus der Feder gehen! – und kamen in die Bautzener Straße, die mir natürlich noch am lebendigsten in Erinnerung war. Als ich nach 25 Jahren mein altes Zuhause wiedersah, musste ich erst ein paar Mal schlucken, denn wie gern hatte ich hier als Kind doch gelebt! Das Haus Nummer 49, immer noch kirchliches Eigentum, machte außen einen erbärmlichen Eindruck. Es ist seit dem Krieg nie mehr gestrichen beziehungsweise instandgesetzt worden, doch innen hatte man es restauriert und es war wie damals peinlich sauber. Ich konnte es nicht lassen und musste die breiten Treppen bis hoch zum 4. Stock und aus den Fenstern in den Hof und hinüber zu den jetzt freien Grünflächen schauen, wo früher ebenfalls 4-stöckige Häuser standen. Als wir vor unserer alten Wohnungstür standen, hätte ich beinahe geklingelt, doch daran hinderte mich die nüchterne Hilde. Im Haus so gut wie keine Veränderung, selbst etliche der mir noch bekannten Namensschilder waren noch vorhanden. Auch in den alten Keller musste ich gehen, in welchem wir die fürchterlichste aller Bombennächte verbracht hatten und die schrecklichen Detonationen der Brückensprengungen kurz vor dem Einmarsch der Russen im Mai 1945 miterlebten. Wie gegenwärtig mir doch in diesem Haus die Vergangenheit war, ich glaubte, sogar die ersten Schreie meiner jüngsten Schwester wieder zu hören, die hier 1943 geboren wurde.
Als wir das Haus wieder verließen ohne irgendjemand gesprochen zu haben, fiel mir sofort der gegenüberliegende freie Platz – eine heute baumbestandene Fläche – ins Auge, an dessen Stelle früher ein schönes großes Eckhaus mit Terrassen-Café gestanden hatte, das von einer Luftmine vollständig weggerissen wurde. Diese grauenhafte Detonation genau gegenüber unseres Hauses spüre und höre ich noch heute! Wie tief war ich doch schockiert, als wir nach vielen angstvollen Stunden unseren Keller verließen und ich durch die glühende Flugasche hindurch dort drüben nur noch einen brennenden Steinhaufen sah!
Wir wandten uns nun dem Elbufer, dem Kindergarten, dem Rosengarten und der alten Schule zu, jenen Punkten also, die für mich als Kind außerhalb des Wohnhauses eine große Rolle gespielt haben. Während die Schule, der ich nach dem Angriff monatelang zugeordnet war, schon längst keine mehr war, funktionierte erstaunlicherweise noch immer der Kindergarten der Diakonissenanstalt, der wie damals von weißbehüteten Schwestern betreut wird. Hier lernte ich die ersten Lieder und Reigen, hier begann mein Basteltalent erste bescheidene Früchte zu tragen, hier schloss ich erste Kinderfreundschaften. Jahrelang war ich täglich bei diesen gütigen Schwestern.
Entlang des Elbufers, wo mir fast auf einmal sämtliche Erlebnisse von damals einfielen (Fahrten auf Eisschollen, Eisübergänge, Uferwellen, Drachensteigen, Reisigbuden, Feuerchen, Beinbruch, verbrannte und zerfetzte Angriffsopfer, lodernde Altstadt, Menschenfackeln), kamen wir zum Rosengarten, einem ruhigen und duftenden Fleckchen, wo ich mich früher unzählige Male und zu jeder Jahreszeit aufgehalten hatte. Traurig die Tatsache, dass das Garten-Café ungenutzt daliegt und allmählich verkommt.
Wir querten auf unserem Rückweg abermals die Bautzener Straße und gingen zur Martin-Luther-Kirche, jener schönen alten, innen wie außen noch sehr vertrauten Kirche, die ich vor und auch noch nach dem Krieg im Zuge des Religionsunterrichts zigmal besucht hatte. So gut diese Kirche auch noch erhalten ist – lebt sie doch immer noch –, so deprimierend empfanden wir den baulichen Zustand der schönen alten unzerstört gebliebenen Stadthäuser rund um den Martin-Luther-Platz.
Auf dem Weg hoch zum Alaunplatz erreichten wir jene Schule, in die ich im Herbst 1942 eingeführt worden war. »Schule für Knaben« ist in Stein gemeißelt über dem Eingang zu lesen. Noch heute sehe ich meinen mit einer riesigen Zuckertüte belasteten alten Opa, ich sehe mich immer noch auf dem Schulflur in Reih und Glied stehen und lernen, welche Seite die rechte beziehungsweise linke ist, und ich kritzle im Geiste die ersten Striche mit einem viel zu weichen Griffel auf meine Schiefertafel.
Wir passierten den Eingang zur Schule, gingen durch den erwähnten Flur und sahen in ein paar Klassenzimmer hinein, die gerade frisch gestrichen wurden. Es waren jene, die ich noch in Erinnerung hatte, auch das alte Mobiliar, die Tafeln und die großen Fenster – alles unverändert! Als ich mit Hilde im Schulhof stand und uns ein paar Kinder von oben zuwinkten, die uns wohl als Westler erkannt haben dürften, glaubte ich einen Moment lang, dass eben nicht schon 35 Jahre seit meiner hiesigen Schulzeit vergangen waren.
Zum Alaunplatz gehend passierten wir – einen Umweg machend – die völlig unverändert gebliebene Pfunds-Molkerei, die noch immer die gleiche Funktion hat und in der wir wenige Tage nach dem »Mord an Dresden« das erste saubere Trinkwasser erhielten. Der Alaunplatz, der früher Exerzier- und Paradeplatz war, hatte sich völlig verändert, denn heute ist er ein riesiger Park mit inzwischen großen fast ausgewachsenen Bäumen, blühenden Sträuchern und weiten Rasenflächen. Hätte es damals schon diese Anlage gegeben, wäre ich dort nicht auf den Schotter gefallen, wäre mein Knie nicht angeschwollen und hätte ein Arzt mich nicht operieren müssen. Aber dann wäre auch kein Zirkus gekommen und hätten hier keine waghalsigen Drahtseilfahrer mit ihren überschweren Motorrädern ihre kitzligen Kunststückchen gezeigt! Ich sah, dass einer sogar abstürzte!
Nun kamen wir ins Kasernengebiet, das ich ebenfalls noch in Erinnerung hatte, denn hier oben war ich zu Hitlers Zeiten stolzer Pimpf, durfte mit Platzpatronen schießen und mich aus der Gulaschkanone sattessen. In welcher Kaserne sich das abspielte – ob in der Schützen-, Infanterie- oder Pionierkaserne –, vermag ich jedoch nicht mehr zu sagen. Ich erinnere mich lediglich, dass ich meinen Vater nach dessen Absturz mit dem Fallschirm (er hatte sich dabei beide Beine gebrochen) ein paar Mal im Garnison-Lazarett besucht habe. Da mein Vater ein überzeugter Uniformträger und dennoch kein Nazi war, verstehe ich, dass er seinerzeit in der Garnison-Kirche heiratete, in einer ungewöhnlich schönen massiven Kirche, die wir traurigerweise jedoch als Lagerschuppen für das Stadtbauamt antrafen, vor deren schweren Holztüren viel Gras wucherte. Die Kasernen selbst, das sahen wir durch hohe Zäune hindurch, werden heute ausschließlich von Russen benutzt. Das war 1973.
Ebenso lebendig ist mir auch noch die Gegend Weißer Hirsch, Loschwitz und Blasewitz in Erinnerung, denn in diese Richtung elbaufwärts fuhren oder gingen wir als Kinder unzählige Male, wenn es galt, die Dresdner Heide unsicher zu machen. Wir benutzten die Straßenbahn der Linie 11, und wieder kamen Erinnerungen auf, denn wie oft bin ich damals die Strecke mit dem geliebten »Hechtwagen« gefahren, der heute leider ausgedient hat und im Verkehrsmuseum von Interessenten besichtigt werden kann. Und wie schmerzhaft waren doch die gemeinen Fußtritte russischer Offiziersweiber, wenn sie uns Kinder beim Durchwühlen ihrer Mülleimer in dieser Gegend erwischten, weil wir Hunger hatten und nach erbärmlichen Resten suchten!
Manchmal hatte ich während dieses Besuches sogar das Gefühl, als sei es falsch gewesen hierherzukommen, denn die vielen bösen Erinnerungen mussten ja auch alle wieder aufleben, wobei ich in diesem Bericht aus Zeitgründen natürlich beileibe nicht alles erwähnen kann.
Am »Weißen Hirsch« angekommen, ließen wir uns erst einmal im dortigen Restaurant, dem Luisenhof, nieder, genossen von hier oben einen herrlichen Ausblick auf Loschwitzer Hanghäuser sowie auf die Elbe und hatten unsere Freude am alten Stehgeiger, der den Eindruck erweckte, als wenn er schon seit Jahrzehnten zum Mobiliar dieses Cafés gehören würde. Hier oben lernten wir eine freundliche Dresdnerin kennen, mit der wir uns angenehm unterhielten und lockeren Briefkontakt pflegen, der allerdings bald einschlief.
Nun drängte es uns zur Standseilbahn, die Besucher seit eh und je runter zur Elbe beziehungsweise zum »Blauen Wunder« – einer mächtigen Stahlbrücke – und wieder zurück bringt. Über dem Eingangstor hing ein unübersehbares Propagandaschild, das uns wieder in die Wirklichkeit von heute zurückholte: »Alles für das Wohl der Arbeiterklasse und aller Werktätigen in unserem Staat!« Wir fragten uns immer wieder, was dieser Unsinn eigentlich soll, denn außer der brüderlichen Sowjetunion und Bulgarien können mittlerweile alle anderen Staaten unter Roten Sternen auf diese hohlen Sprüche verzichten. Nur eine Handvoll wirklich Überzeugter glaubt hier noch an diese abertausendmal wiederholten längst verbrauchten Floskeln, zumal die jahrzehntelange Wirklichkeit ganz andere Gesichter hat.
Für ein paar Groschen ließen auch wir uns hinabfahren, sahen dabei Häuser und Hangstraßen, die einen verdammt vernachlässigten Eindruck machten und gelangten zum »Blauen Wunder«, das wir zu Fuß überquerten. Auch das hatte ich als Kind im Sommer unzählige Male getan. Drüben setzten wir uns ins Freie des Schiller-Cafés und beobachteten ruhesuchende Dresdner, die am Kiosk etwas Gutes zu kaufen versuchten, aber außer rosaroter Wasser-Limonade und nachkriegsdick belegter Brote war nichts zu haben.
Per Straßenbahn, in der wir hier draußen sofort als Westler erkannt wurden – das spürt man –, tuckelten wir zurück zur Innenstadt, wo wir noch die letzte Öffnungsstunde nutzten und uns das Verkehrsmuseum anschauten. Im Mittelpunkt stehen hier natürlich Dresdens Straßenbahnen und ein paar alte Loks, wobei mir beim Anblick der Straßenbahnen so manches wieder vor Augen kam: meine Hechtwagen! Wie sehr liebte ich sie und war stolz auf diese »Wunderwerke der Straßenbahnkunst«. Ein verunglückter Hechtwagen war wochenlanges Gesprächsthema! Wie sehr unsere Familie tatsächlich an Dresdens Straßenbahnen hing, wird glaubhaft, wenn ich verrate, dass Tante und Onkel ein langes Leben lang Bahnen durch Dresden gekurbelt haben. Und wem wundert’s dann noch, dass deren Tochter sich im festlich geschmückten Sonderwagen zur Kirche fahren ließ, um dort den Heiratssegen zu empfangen.
Gegenüber dem Zwinger liegt das neu erbaute, wahrscheinlich beste Restaurant der Stadt: das »Restaurant am Zwinger«, in welchem wir für erstaunlich wenig Geld ein prima Essen bekamen, das wir uns in München vermutlich nicht leisten würden. Das Restaurant war blitzsauber, mit freundlichem Personal bestückt und beileibe nicht nur von zahlungskräftigen Westlern besucht. Hier wurden wir mit vielen Dingen, die uns so gar nicht gefallen wollten, halbwegs wieder versöhnt.
Abends spazierten wir etwas im »Dresden bei Nacht« umher, stellten aber bald fest, dass man außerhalb des oberen Drittels der Prager Straße fast nur im Dunkeln tappen muss. – Jeder wird verstehen, dass ich nach dem Zubettgehen noch stundenlang wachgelegen habe, um über die vielen tiefen Eindrücke und wieder hochgekommenen Erinnerungen nachzudenken. Irgendwann, das war mir in den letzten Tagen klar geworden, würde ich mich mit Dresden als meiner Heimatstadt weiter beschäftigen, aber auf welche Art und Weise sei der Zukunft überlassen.
Tschechoslowakei (ČSSR)
Am zeitigen Morgen des 6. August hieß es Abschied nehmen von Dresden, einer Stadt, die mir wie keine andere auf der Welt tief drinnen erhalten bleiben wird. Nach dem Frühstück im Hotel »Königstein«, und zwar abermals ohne Bohnenkaffee, packten wir unsere Sachen, nahmen unseren Wagen, ohne dass etwas abmontiert worden wäre, wieder in Besitz und fuhren gen Süden.
Die Straße Richtung Pirna auf der linken Elbuferseite war schmal und in schlechtem Zustand. Man merkte deutlich, dass diese Strecke keine für Westler gedachte Transitstrecke war, denn die wäre von Dresden wohl direkt nach Aussig gegangen. Aber ich wollte unbedingt noch einmal die liebliche Berg- und Flusslandschaft des Elbsandsteingebirges sehen, in der ich vor Jahrzehnten so gern allein oder mit Klassenkameraden gewandert war. Wie oft war ich damals an Wochenenden mit einem der heute noch zwischen Pirna und Dresden verkehrenden Raddampfer gen Süden gefahren, die wir alle liebten, und wie überglücklich waren wir, dass selbst der furchtbare Angriff diesen Elbschiffen nichts anhaben konnte, weil sie ausgelagert wurden. Die Tatsache, dass diese malerischen, seit vielen Jahrzehnten zum Stadtbild Dresdens gehörenden Personenschiffe immer noch verkehren, ist mit Sicherheit nicht darauf zurückzuführen, dass wegen Geldmangel keine neuen Schiffe angeschafft werden können, sondern den Dresdnern würde man ein Stück echter Heimatstadt wegnehmen, und das ist ihnen nach dem Todeshagel vom Februar 1945 nicht mehr zuzumuten.
Da wir auf der Fahrt zur Grenze kein einziges Westauto sahen und nicht wussten, ob der ins Auge gefasste Übergang für uns überhaupt zugelassen war, kamen mir zwar Bedenken, doch die nahm ich angesichts der Bilderbuchlandschaft in Kauf; denn notfalls konnten wir ja wieder umkehren. Am Kontrollpunkt angekommen, entdeckte ich auch dort keine Spur eines Westlers. Ich stellte mich brav und ganz selbstverständlich an, doch kaum war unser auffälliger gelber Wagen in Reih und Glied, hatte man uns auch schon entdeckt.
Volkspolizisten winkten uns aus der Reihe heraus und gaben uns zu verstehen, an der Warteschlange vorbei bis vor zum Schlagbaum zu fahren. Dort angekommen, wurden wir von einer auffallend freundlichen Grenzpolizistin zügig und problemlos abgefertigt. Sie besorgte das Abstempeln der Pässe im Häuschen selbst, fragte nach mitgebrachten Waren, schaute nur kurz in den Kofferraum und ließ uns schon nach wenigen Minuten mit guten Wünschen für die Reise weiterfahren. Plötzlich verstanden wir die kommunistische Welt nicht mehr!
Der tschechoslowakische Zoll war im Prinzip genauso zügig und komplikationslos, denn das Visum hatten wir ja schon im Pass. Wir brauchten nur noch die Anzahl der gewünschten Aufenthaltstage angeben und pro Tag á 7 US-Dollar gegen tschechische Kronen eintauschen. Obwohl wir nur Deutsche Mark bei uns hatten, rechnete man entsprechend um und war sogar in der Lage, uns zuviel entrichtete DM zurückzuzahlen. Das alles ging ohne jede Komplikation über die Bühne, so dass wir bereits binnen einer halben Stunde unsere Fahrt in Richtung Aussig fortsetzen konnten.
Die Strecke führte über Dečin und war von Dresden aus gerechnet keine 100 Kilometer lang. Und da zudem der Straßenverkehr gleich null war, dürfte es erst gegen 9 Uhr vormittags gewesen sein, als wir Aussig, das heutige Ústi nad Labem, erreichten, eine ehemals sudetendeutsche Stadt.
Heute ist Aussig tschechisch, und so wird mancher folgende Zeilen aus einem alten Lexikon mit etwas Wehmut lesen:
… liegt an der Linie der Österreichischen Nordwestbahn, Sitz eines Bezirksgerichts, Zoll- und Steueramtes, hat (1890) 23.646 meist deutsche Einwohner, Rathaus, Stadtkirche (angeblich von 826) mit schönem Madonnenbilde von Carlo Dolce, ein Geschenk des Israel Mengs, dem hier 1728 sein Sohn Rafael geboren war …
Aussig, eine der königlichen Städte Böhmens, wurde unter Ottokar II. zuerst erwähnt. Die Stadt geriet 1282 vorübergehend in den Pfandbesitz des Markgrafen Otto von Brandenburg, wurde 1426 von den Hussiten zerstört, blühte aber bald wieder auf. Im Jahr 1639 nahmen die Schweden unter Banér Aussig ein. 1778 wurde die Stadt im Bayerischen Erbfolgekrieg eine Zeitlang von Preußen besetzt.
Die Bevölkerung in den Randgebieten der Tschechoslowakei (Sudetenländer) und einiger Sprachinseln im Innern des Landes setzte sich seit dem Mittelalter bis zur zwangsweisen Aussiedlung nach 1945 vorwiegend aus Deutschen zusammen.
Wir hatten nicht die Absicht länger zu bleiben, denn unser Tagesziel war Pressburg, doch wollten wir uns natürlich einen Eindruck verschaffen, handelt es sich doch um eine der ehemaligen wichtigen Städte des Sudetenlandes.
Aussig hat mehrere Plätze, so dass es zunächst gar nicht so einfach war ohne Straßenplan herauszufinden, welcher Platz nun das eigentliche Stadtzentrum ist. Der erste Platz mit dem schön restaurierten Theater, einem hässlichen nicht zum Stadtbild passenden stählernen Denkmal und bunten Blumenbeeten war nicht das historische Zentrum, sondern jener Platz mit dem weiß gestrichenen Rathaus, dessen gedrungener Turm für dieses Gebäude wohl etwas zu klein geraten war.
Die umliegenden Stadthäuser gefielen uns zwar, doch war zu erkennen, dass man diese schönen Häuser bereits seit Kriegsende nicht mehr renoviert hatte. An einer der vier Ecken des Zentrums befindet sich die wohl schon tausend Jahre alte Stadtkirche, deren gotische Fenster uns besonders gut gefielen. Der überschlanke, mit zusätzlichen kleinen Türmchen besetzte Kirchturm wollte genauso wenig zum Komplex passen, wie der Rathausturm zum Rathaus. Wir hatten den Eindruck, als hätte man zu einem späteren Zeitpunkt diese beiden Türme einfach drauf gesetzt.
Auf einem weiteren Platz, der jedoch auch für den fremden Besucher kaum als Stadtzentrum angesehen werden kann – aber er war’s! – erfreuten wir uns der vielen tausend bunten Blumen, die von derben Landfrauen im Schatten einer wuchtigen klobigen Kirche mit gedrungenen Doppeltürmen feilgeboten wurden.
Der Rundgang führte uns noch am modernen Parteigebäude vorbei, dessen einfallslose Fassade ein Schandfleck im Stadtbild Aussigs ist, und endete wieder am Rathausplatz. – Insgesamt gesehen und im Vergleich beispielsweise zu Komotau war für uns auffallend, dass Aussig lebendiger und farbenfroher ist. Außerdem machte diese Stadt nicht den Eindruck, als ob hier die Entwicklung 1945 stehengeblieben wäre, wenn auch noch sehr viel hauptsächlich in Sachen Denkmalschutz zu tun ist. Bemerkenswert, dass der Rathausplatz voller Pkw stand, ein zwar hässliches Bild, doch lässt diese Tatsache den Schluss zu, dass die Bewohner in relativem Wohlstand leben.
Auf der langen Fahrt ins fast 300 Kilometer entfernte Brünn (Brno), die uns an Prag vorbeiführte, wo wir aus Zeitgründen keine Pause einlegten, wurden wir zweimal angehalten: einmal auf freier Strecke von einem Polizisten zu Fuß, der ohne zu zögern behauptete, ich sei zu schnell gefahren und hierfür 50 Kronen kassierte, und ein zweites Mal von zwei jungen Trampern, deren Augen zu strahlen begannen, als sie unser gelbes West-Vehikel besteigen durften.
Nach anfänglichem Schweigen – man betastete erst einmal ehrfurchtsvoll die neuen Polster, Scheiben und Läufer – tauten die beiden Jungs auf und ließen dann ihren Gedanken freien Lauf. So erfuhren wir, ohne dass wir danach gefragt hätten, dass sie aus der DDR kommend mit einer Jugend-Tramper-Genehmigung unterwegs seien und sich zunächst einmal Brünn zum Ziel gesetzt hätten. Des Weiteren plauderten sie über die miserablen wirtschaftlichen Zustände und über die politischen Zwänge, denen hauptsächlich die jungen Leute drüben ausgesetzt seien. Der eine war Facharbeiter und verdiente 2,50 Mark in der Stunde, der andere war Student ohne eigenes Einkommen. Beide gaben offen zu erkennen, bei sich bietender Gelegenheit in den Westen gehen zu wollen, denn – auch das wurde uns in allen Einzelheiten erläutert – wenn sogar Tramper in der DDR auf jeden Kilometer, den sie per Anhalter unterwegs sind, staatlich kontrolliert werden, gebe es keinen Freiheitsraum mehr, der das Dasein lebenswert machen würde.
Bald hatten wir Brünn erreicht, die mit etwa 400.000 Einwohnern zweitgrößte Stadt des Landes, wo sich die beiden jungen Freunde mit tausend Dank verabschiedeten.
Brünn liegt am Zusammenfluss von Schwarzawa und Zwittawa in 220 Metern Höhe. Überragt wird diese Stadt vom Spielberg mit der alten Festung. In der Altstadt befinden sich barocke Paläste, Kirchen und das Rathaus aus dem Jahr 1511. Außerdem hat Brünn vier Hochschulen, mehrere Fach- und Mittelschulen, Museen und zwei Theater. Wichtigster Industriezweig ist der Maschinenbau. Ferner ist hier die Textil-, Leder-, Chemie-, Papier- und Holzindustrie von größerer Bedeutung.
Brünn erhielt 1243 das Stadtrecht verliehen. Es verteidigte sich im Jahr 1428 erfolgreich gegen die Hussiten und 1645 gegen die Schweden. Der Spielberg war in den Jahren 1349 bis 1411 Sitz der Markgrafen von Mähren und von 1740 bis 1855 österreichisches Staatsgefängnis. Bis 1918 hatte Brünn, die ehemalige Hauptstadt Mährens, eine Bevölkerung, die zu zwei Dritteln aus Deutschen bestand, aber im Jahr 1930 war der deutsche Bevölkerungsanteil auf etwa 20 Prozent zusammengeschrumpft. Die deutsche Technische Hochschule und die Handelsschule bestanden bis 1945.
Nun wurden wir mit genau dem Gegenteil bisher kennengelernter Städte in der ČSSR bekannt, denn Brünn ist nicht nur dem Namen nach eine der bekanntesten Städte unter Rotem Stern, im Gegenteil, jeder Besucher kann sich mit eigenen Augen davon überzeugen, dass Brünn es zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht jederzeit selbst mit Prag aufnimmt. Das mag zunächst überraschen, aber auch wir hatten hiervon vor unserem Besuch keine Ahnung.
Die Leser erinnern sich des gewaltsamen Endes des »Prager Frühlings«, der erst zirka 4 Jahre zuvor stattgefunden hatte. Dieses Ende bedeutete für die Slowakei, die seit eh und je mit der Tschechei in Fehde liegt, einen gewissen Neubeginn, denn dieser Landesteil erhielt im Zuge der politischen Neuordnung, die während des »Prager Frühlings« eingesetzt hatte, weitgehende Autonomie, vor allem auf wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet.
In der Praxis bedeutet das für die Slowaken zunächst ein weit über die Landesgrenzen hinaus hörbares Aufatmen. Ferner hatte man ab sofort die Möglichkeit, mit westlichen Partnern ungehindert Handel zu treiben und endlich konnte man der diskriminierten Slowakischen Sprache wieder mehr Rechte verschaffen.
Wie fast immer, so erreichten wir auch in Brünn schnell das Stadtzentrum und begannen von hier aus unseren Rundgang, der uns bis hinauf auf den Spielberg führte. Aber zunächst durchmaßen wir mehrere saubere Fußgängerzonen mit hochwertigen Auslagen in den Geschäften, mit bunten Reklameschildern und guten Cafés – alles Dinge, von denen man nicht nur in der DDR allenfalls bloß träumt. Wir trauten kaum unseren Augen, aber es entspricht schlicht den Tatsachen, dass hier vom AEG-Staubsauger, Braun-Rasierer bis zum Farbfernsehgerät von Phillips und exotischem Obst alles frei zu haben ist. Insofern wird diese Messestadt ihrer eigenen Bevölkerung gegenüber gerecht, was man von Leipzig zum Beispiel noch nicht sagen konnte. Dass die Preise aber auch dem westlichen Niveau entsprechen, steht auf einem anderen Blatt, doch ist leicht zu beobachten, dass all diese westlichen Luxusartikel tatsächlich auch fleißig gekauft werden. Jeder DDR-Bürger wäre glücklich, wenn auch er diese geradezu traumhaften Einkaufsmöglichkeiten hätte! Aber auch die Tschechen im eigenen Land, deren Geschäfte absolut nichts Westliches anzubieten haben, also weder Bananen, Lippenstifte oder Elektrogeräte, blicken neidvoll nach Brünn und Pressburg. Sollten diese Spannungen anhalten beziehungsweise nicht irgendwie abgebaut werden, dürften die nächsten innenpolitischen Schwierigkeiten vorprogrammiert sein.
Wir schlenderten zum Bahnhof, einem bestens unterhaltenen riesigen Bau aus der Zeit um die Jahrhundertwende, und sahen hier wie auch an rot-gelb gestrichenen Straßenbahnen, Geschäften und auf Plakaten zweisprachige Beschriftungen – tschechisch und slowakisch, obwohl die sprachlichen Unterschiede oft nur minimal sind.
Auffallend, dass wir hier kaum ein äußerlich vernachlässigtes Wohn-, Geschäfts- oder Verwaltungsgebäude sahen. Auch die Kirchen, wovon es in Brünn weißgott nicht wenige gibt, waren ausnahmslos in gutem Zustand. Und beinahe selbstverständlich für die Brünner sind frische Farben, saubere kleine Parks und solide ordentliche Kleidung. Wir hatten den Eindruck, als ob sich der Rote Stern über Brünn schon fast aufgelöst hätte. Wo war nur die DDR geblieben!?
Abschließend gingen wir hoch zum Spielberg, der bekanntlich große geschichtliche Bedeutung hat. Von diesem direkt am Stadtrand gelegenen fast hundert Meter hohen Berg hatten wir eine großartige Aussicht auf ganz Brünn, dessen Randgebiete erkennbar unter großen Umweltbelastungen leiden: qualmende Industrie! Unser Versuch, die große Bergkirche mit ihrem schlanken Turm und die übrigen mittelalterlichen Gebäude auch von innen zu sehen, war leider vergeblich, denn alles war aus Gründen, die wir nicht erkennen konnten, verschlossen.
Nachdem wir uns ein paar Stunden in Brünn aufgehalten und einen recht guten Überblick gewonnen hatten, setzten wir die Fahrt nach Pressburg im Süden des Landes dicht an der Grenze zu Österreich fort. Kaum hatten wir den Stadtbereich hinter uns, trafen wir überraschenderweise wieder auf unsere beiden jungen Tramper aus der DDR, die uns ungeniert abermals anhielten und glücklich waren, auf diese komfortable Art und Weise heute sogar noch bis Pressburg zu kommen.
Nach problemloser Fahrt erreichten wir abends die Hauptstadt der Slowakei, die sich heute Bratislava nennt. Sie liegt am Fuße der Kleinen Karpaten und überwiegend am linken Donauufer, zählt rund 250.000 Einwohner und ist Sitz mehrerer Verwaltungsbehörden, der Slowakischen Universität und Technischen Hochschule, hat außerdem eine Hochschule für musische Kunst, wissenschaftliche Akademien, Museen, Theater und einige höhere Schulen. Pressburg hat nach Komorn den wichtigsten Flusshafen der ČSSR, ist die größte Weinbaugemeinde des Landes und ein bedeutender Industriestandort.
Pressburg wird zuerst als Burg des großmährischen Herzogs Wlatislaw im Jahr 907 erwähnt. Um die Wende zum 13. Jahrhundert entstand die damals rein deutsche Stadt (1880 noch 63 Prozent, 1921 achtundzwanzig Prozent). Die Stadt war in den Jahren 1526 bis 1784 unter dem Namen Pozsony ungarische Landeshauptstadt. Als 1784 Ofen (Budapest) wieder zur ungarischen Hauptstadt wurde, blieb indessen Pressburg bis 1848 Sitz des Landtages. Nach der Schlacht und dem Waffenstillstand zu Austerlitz zwischen Napoleon I. und Kaiser Franz II musste letzterer bedeutende territoriale und politische Zugeständnisse machen. Diesen »Frieden zu Pressburg« nannte man später die »nächste Veranlassung zur Auflösung des Deutschen Reiches«.
Als wir unser Auto mitten in der Stadt abgestellt hatten und uns auf Hotelsuche begaben, spürten wir die Anstrengung dieses sehr langen Tages, denn immerhin hatten wir heute Morgen noch in Dresden gefrühstückt und die beiden Städte Aussig und Brünn touristisch hinter uns gebracht. Wie sich herausstellte, sollte es hier Probleme mit der Hotelsuche geben, waren doch die ersten Anfragen glatt eine Pleite. Schließlich erkannte ein uns wohlgesonnener junger Mann die Situation und bot seine uneigennützigen Dienste an. Er führte uns zum Interhotel Krym, sprach zur Rezeptionsdame ein paar uns unverständliche Sätze und schon hatten wir die Zusage zwei Nächte bleiben zu können. Uns wurde ein Zimmer für insgesamt 442 Kronen zugewiesen, pro Nacht also etwa 20 DM.
Der nächste Tag musste für uns anstrengend werden, denn wir hatten erkannt, dass man Pressburg als Besucher nicht einfach abhaken durfte, da mussten wir also genauer hinschauen, denn der Sehenswürdigkeiten gibt es hier überraschend viele. Auch hinsichtlich der Größe macht Pressburg einen respektablen Eindruck. Diese Stadt wird in vielerlei Hinsicht den Erwartungen, die man in eine Hauptstadt setzt, gerecht.
Unser erster Weg führte über die neue Donaubrücke, die mit ihrer schräg gestellten mächtigen Stütze und den riesigen Halteseilen als technisches Meisterwerk gilt. Diese Brücke ist heute ebenso ein Wahrzeichen Pressburgs, wie die seit altersher auf dem 90 Meter hohen Hügel des Heiligen Mesto liegende gewaltige Burg mit ihren vier gedrungenen Ecktürmen. Vom gegenüberliegenden Donauufer aus hatten wir die Möglichkeit, dieses prächtige Bauwerk, dessen Anfänge bis ins 13. Jahrhundert zurückreichen, über der Stadt liegen zu sehen – ein Postkartenblick!
Zurück benutzten wir die Fähre und strebten dann auf direktem Weg der Burg zu, die ursprünglich einmal ein befestigter Vorposten der größten römischen Stadt an der Donau Carnuntum war. Der Bau datiert aus dem Jahr 1287, doch der Hauptteil wurde erst in den Jahren 1423 bis 1500 errichtet; 150 Jahre später wurde im frühbarocken Stil umgebaut, dann brannte sie im Jahr 1811 nieder und wurde erst jetzt unter Rotem Stern wieder instandgesetzt beziehungsweise vollständig restauriert.
Dass den dafür Verantwortlichen höchstes Lob gebührt, muss man unumwunden zugeben, wobei ich natürlich mit Wehmut daran denke, dass in dieser Hinsicht die Verantwortlichen in Dresden offensichtlich immer noch nicht begriffen haben, welches Kulturverbrechen es wäre, würden sie die historische Altstadt nicht wieder vollständig in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen. Übrigens sind auch die Polen in dieser Hinsicht erstaunliche Wege gegangen, haben sie doch zum Beispiel die völlig zerstört gewesene riesige Warschauer Altstadt wieder detailgetreu aufgebaut!
Solche Gedanken und Vergleiche drängen sich natürlich einem Dresdner auf, der – wenn auch als Kind – das noch unzerstörte »Elbflorenz« kennengelernt hatte. Auch hier in Pressburg, und zwar auf dem Weg hoch zur Burg, wird jedem Besucher vor Augen geführt, das kulturhistorisch wertvolle Bauten hier nicht für immer verloren sind, auch wenn sie noch so baufällig sein mögen. Wir durchwanderten mehrere kleine romantische Straßen mit nur ebenerdigen, maximal eingeschossigen jahrhundertealten Häusern, deren baufälliger Zustand zurzeit aber von Grund auf behoben wird. Keines dieser bilderbuchhaften Häuschen ist bewohnt, so dass die Restaurateure ungehindert ihrer wichtigen Arbeit nachgehen können. Ich bin mir sicher, dass dieser vermutlich schon wieder bewohnte historische Teil Pressburgs heute eine touristische Sehenswürdigkeit von Rang ist.
Die sich diesem ältesten Stadtteil Pressburgs anschließende Burg war bereits zu 100 Prozent wieder hergestellt, und zwar – sogar für den Denkmalschutzlaien erkennbar – historisch getreu. Fenster, Türen, Arkadenbögen, Bedachung, Bemalung, Hofbepflasterung – alles tipp-topp in Ordnung, sauber und übersichtlich. Wir waren überrascht, zumal wir ja wussten, dass der ganze Komplex über 150 Jahre lang nach der Brandkatastrophe völlig brach gelegen hatte. Hut ab und Dresdner, nehmt euch ein Beispiel an den Tschechoslowaken und an den Polen!
Nachdem wir uns mit Begeisterung das prachtvolle Bauwerk mit seinem herrlichen Arkaden-Innenhof und das interessante Museum mit unzähligen historischen Relikten angeschaut hatten, gönnten wir uns von hier oben einen weiten Blick über die Altstadt mit ihrem überschlanken goldblinkenden Kirchturm bis hinunter zur Donau, wo Last- und Passagierschiffe ankerten und wo der gottseidank nur mäßige Straßenverkehr über die moderne Brücke floss. Die Brücke von hier oben zu betrachten, zählt ebenfalls zu den interessanten Aspekten Pressburgs.
Das Zentrum der Stadt ist der »Platz des 4. April« (Befreiungstag durch die Russen), um den herum sich die sehenswerten Gebäude gruppieren – unser nächstes Ziel. Allgemein kann man sagen, dass ein Spaziergang durch Alt-Pressburg mit seinen schönen gotischen, barocken, seinen Rokokobauten und prächtigen klassizistischen Palästen, zahlreichen Kirchen, Brunnen und sehenswerten Straßenzügen mit zu den erlebnisreichsten Unternehmungen zählt, die man in der ČSSR machen kann. Die wenigen Häuser, die für unsere Begriffe noch der Renovierung bedürfen, konnten wir getrost übersehen, war doch überall zu erkennen, dass es vorwärts geht – auch ohne dümmliche Parteiparolen!
Auf dem Weg zur Innenstadt gelangten wir zunächst zum Michaelistor am Hubavnovo-Platz, das als einziges von vier Stadttoren der Befestigungsanlagen aus dem 15. und 16. Jahrhundert erhalten blieb. Dann folgte als Nächstes am »Platz des 4. April« das Alte Rathaus, dessen Stil teils gotisch, teils barock ist (13. bis 16. Jahrhundert). Hier gefiel uns besonders der schöne Turm aus dem Jahr 1572 – eine Augenweide für uns Liebhaber schöner historischer Bauten!
Nur wenige Gehminuten von diesem Zentrum entfernt stießen wir auf einen weiteren Platz, wo sich das ebenfalls in bestem Zustand präsentierende slowakische Nationaltheater befindet. Auf dem großzügigen Platz davor steht ein großer Springbrunnen, der zwar nicht historisch ist, aber dennoch gut zur Umgebung passt. Die sich anschließende breite Allee ist mit alten Bäumen und riesigen Blumentöpfen bestanden und wertet somit die ohnehin schon prachtvollen Häuserkulissen noch weiter auf.
Wir gingen in Richtung Donau, passierten das ansehnliche alte Hotel »Carlton«, das sicher sehr teuer ist sowie das weniger schöne Hotel »Devin« und erreichten kurz darauf die Uferstraße, wo wir die slowakische Nationalgalerie sowie das slowakische Nationalmuseum sahen – beides prachtvolle bestens unterhaltene alte Gebäude, die aber aus uns nicht bekannten Gründen geschlossen waren.
Nicht weit vom Nationalmuseum entfernt befindet sich die Komensky-Universität, ein zwar recht unscheinbares Gebäude, jedoch mit einem interessanten erkerähnlichen und doppelgeschossigen Vorbau. Uns eine sozialistische Universität einmal von innen anzusehen, war schon lange unser Wunsch, weshalb wir ungeniert hineingingen und uns dort tatsächlich hemmungslos umsehen konnten. Auffallend die angenehme Ruhe, die vorbildliche Sauberkeit, die Übersichtlichkeit trotz alter Gemäuer und die alles andere als aufmüpfig gekleideten Studenten, von denen wir allerdings nur ein paar zu Gesicht bekamen, alle anderen saßen brav in ihren Hörsälen.
Da wir also bemerkten, dass diese Universität voll in Aktion war, verzichteten wir darauf, bis zu einem der Hörsäle vorzudringen, doch war uns ohnehin bereits klar, dass sich diese Uni ausgesprochen wohltuend von vergleichbaren Lehranstalten bei uns abhob. Man ist fast geneigt zu sagen, dass selbst das Vorzeichen stimmt, denn nirgendwo in Pressburg und auch nicht in dieser Uni waren selbst noch so bescheidene kommunistische äußere Anzeichen zu entdecken.
Während Hilde verständlicherweise erschöpft war und es deshalb vorzog, sich aufs Hotelzimmer zurückzuziehen, ging ich nochmals über die »Wunderbrücke« hinüber zum Park »Sad Janka Krála«, wo ich auf eine große Boxveranstaltung stieß, die unter lebhafter Zuschaueranteilnahme unter freiem Himmel stattfand. Es standen sich Mannschaften aus der DDR und aus Pressburg gegenüber, die sich gegenseitig mit äußerster Verbissenheit verprügelten.
Gegen Abend unternahmen wir nochmals einen ausgiebigen Spaziergang durch diese bemerkenswerte Stadt, der uns bis hoch zum Gottwald-Haus führte, einem Jungpionier-Palast respektvoller Ausmaße. Auf das noch weiter oben liegende Lenin-Museum sowie auf das Befreiungsdenkmal, dem »Slavin«, verzichteten wir und wussten warum.