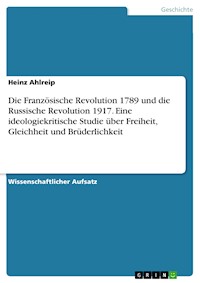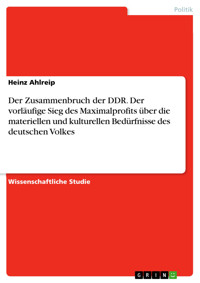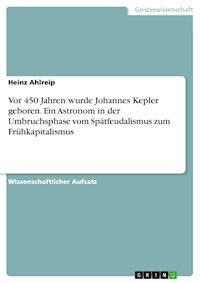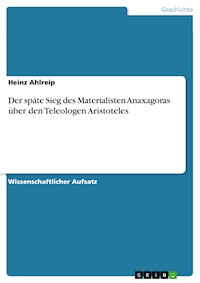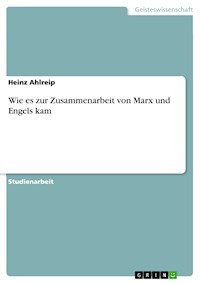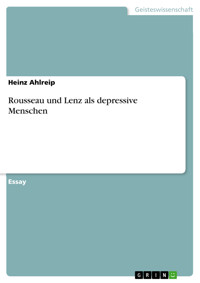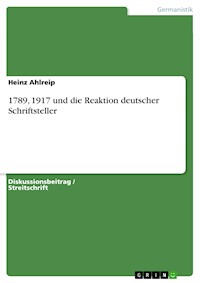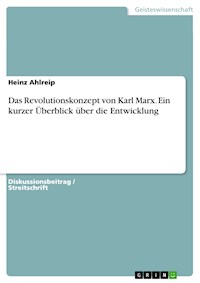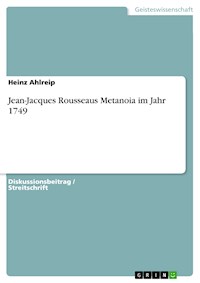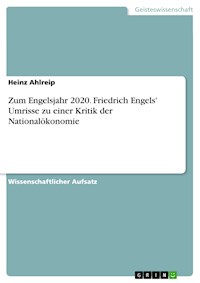29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Fachbuch aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Philosophie - Epochenübergreifende Abhandlungen, , Sprache: Deutsch, Abstract: Im Urteil Diderots war Voltaire auf jedem Gebiet der Zweite, ein „touche à tout“. Als ein tiefsinniger Philosoph des Widerspruchs ist Voltaire nicht in die Geschichte der Philosophie eingegangen, Hegel widmet ihm in der seinigen kein Kapitel, wohl aber seinem Gegenspieler Rousseau. Kant schwimmt mit seiner Nebulartheorie, in der er den sicheren Untergang unseres Sonnensystems vorhersagt, nicht nur gegen den Fortschrittsoptimismus der Aufklärung, sondern ist sich auch des paradoxen Charakters der Weltgeschichte bewußt. Bis in die Wortwahl wird Kant von diesem verfolgt: die Aufklärung sei allmählich, mit unterlaufendem Wahne und Grillen, als ein großes Gut entsprungen. Die Aufklärung entspringt allmählich --- korrekt muß es natürlich heißen: die Aufklärung entsteht allmählich. Der Sprung folgt dem plötzlichen Abbruch einer allmählichen Entwicklung. Erst durch die Allgewalt der Hegelschen Dialektik wird die Menschheit in ihre eigene Geschichte gebannt als abgeschlossene. Der Linkshegelianismus, der gegen diese Identität von Weltvernunft und Weltgeschichte rebellierte, kulminierte in Feuerbachs Fundamentalangriff auf die idealistische Wurzel des Hegelianismus: es gab eine Natur vor der Philosophie Hegels, die Feuerbach als theologischen Mystizismus zu entlarven versuchte. Die Theorie von Marx und Engels kann als eine Synthese von Hegelscher Dialektik und Feuerbachschen Materialismus dargestellt werden, ohne aber zu unterstellen, diese beiden Elementarien unkritisch übernommen zu haben. Der Marxismus stellt in seinem Kern etwas völlig Neues dar, seine materialistische Dialektik ist eine Waffe im finalen Klassenkampf, in dem auch Lenin die völlige Vernichtung der Bourgeoisie forderte. Die vorliegende Studie unternimmt den Versuch, durch ein Ineinanderspiegeln nicht der Marxschen, sondern bereits der Hegelschen Widerspruchstheorie mit der maoistischen den Nachweis zu führen, dass aus der fehlerhaften Widerspruchstheorie Mao Tse tungs politische Fehler resultieren, aus denen die Finsternis aufstieg, die heute die rote Sonne China verdunkelt. Es wird der Nachweis geführt, dass schon der Vergleich mit Hegel hinreichend ist, die Defizite der Theorie Maos aufzuzeigen, zugleich wird die These, der maoistische Marxismus habe Wurzeln in der altchinesischen Mythologie, sei eine asiatische Variante des Marxismus, zurückgewiesen. Mao stand auf der Höhe der philosophischen Diskussion des XX. Jahrhunderts.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Die Aufklärung als ideologische Strömung läßt sich geografisch auf Europa, historisch auf die Übergangszeit von der Epoche des Feudalismus zum Kapitalismus eingrenzen. Wenn lateinamerikanische Philosophen im Geiste der Aufklärung Gedanken entwickelten, so war das eine Folge der Ausstrahlung der spanischen. Als ideologische Waffe der aufstrebenden Bourgeoisie gegen den Feudalabsolutismus wurde in ihr deutlich, dass diese sowohl weltlich (konstitutionelle Monarchie) als auch religiös (Deismus) Kompromissen zugeneigt war. John Locke tischte eine Lehre der doppelten Wahrheit auf, es gäbe eine mit der menschlichen Vernunft zu erfassende und eine der göttlichen Offenbarung. Montesquieu, hundert Jahre vor dem Ausbruch der französischen Revolution geboren, versuchte wie auch Holbach die Lösung der gesellschaftlichen Widersprüche des Feudalabsolutismus durch eine Stärkung der Parlamente zu erreichen. Voltaire, im Frühjahr 1726 zum zweieinhalbjähriges Exil in England gezwungen, wird zeitlebens das Kompromisstalent der englischen Bourgeoisie bewundern, das eine „weise Regierungsform zustande gebracht hat, in welcher der Regent mächtig ist, Gutes zu tun, und im Gegenteil gebundene Hände hat, wenn er Böses tun wollte“. 1. In sozialer Hinsicht stellt er den englischen Bauern als Vorbild für den französischen hin, der englische „ißt Weißbrot, ist sauber gekleidet“. 2. Einen Klassenkonflikt in Genf will er bei einem Abendessen mit den Hauptrepräsentanten der Konfliktgegner durch überzeugende Argumente lösen. „Voltaire glaubte an die lange Wirkung der kleinen Taten“. 3. Der katholische Klerus, den Voltaire innig hasst, er spricht von „Orden heiliger Nichtstuer“ 4., muss herhalten, um vom entscheidenden antagonistischen Widerspruch zwischen dem leibeigenen Bauernknecht und dem Feudalherren abzulenken. Der Antagonismus war bekannt, 1774 forderte Condorcet die Aufhebung der schwersten Frondienste, damit der versteckte Krieg zwischen diesen beiden Klassen aufhöre, ein subkutaner Krieg, der sich jederzeit zu einem offenen Bürgerkrieg entzünden könne. 5. Voltaire, dem im Alter klar war, dass eine Revolution unvermeidlich sei, er sie aber nicht mehr miterleben werde, unterbreitete den Vorschlag, dass alle Franzosen gute Bücher lesen sollten zum Wohle eines konfliktfreien Fortschritts der ganzen Nation und dass man Klöster in Krankenhäuser und Schulen umzubauen hätte. Besserung der Menschen durch sehr gute Aufklärungsbücher, das war die Erwartung, die er Diderot mitteilte: „Sehr gute Bücher erscheinen Schlag auf Schlag. Das Licht breitet sich sichtlich allenthalben aus“. 6. Wird der Widerspruch bei Voltaire minimalisiert, so wird er in Hegels Geistbegriff radikalisiert: „ … weil der Geist um so größer ist, aus je grösserem Gegensatze er in sich zurück kehrt“. 7. Schon beim jungen Hegel finden wir um 1799 / 1800 die Formulierung „Der immer sich vergrößernde Widerspruch“. Und Hegel sollte Recht behalten, der Widerspruch mildert sich nicht, er wird radikaler. Wenn Marx und Engels im Manifest schrieben, dass vor dem Jahrhundert der Bourgeoisie kein früheres ahnen konnte, welche Produktionskräfte im Schoß der gesellschaftlichen Arbeit schlummerten, so konnten sie noch nicht ahnen, dass als Gegenreflex zur immer stärker werdenden sozialdemokratischen Arbeiterbewegung eine nationale, sozialistische und deutsche Arbeiterpartei ebenfalls eine Frucht aus diesem Schoße sein wird und die die Verfolgung zumindest der reichen Juden als ein Fertigwerden mit der eigenen Bourgeoisie ausgeben konnte. Der Faschismus offenbarte, wie falsch eine ungebrochene Fortschrittsannahme der Aufklärung war und dass selbst im Land der klassischen bürgerlichen Revolution die Bourgeoisie ihm die Hand reichte. Ganz überraschend konnte das nicht kommen, wenn man sich an die Pariser Kommune erinnert. Die heutige Wirklichkeit nur im Licht der bürgerlichen Aufklärung und des technischen Fortschritts zu sehen verzerrt diese. Insbesondere weist die heutige spätbürgerliche Gesellschaft einen unterschwelligen Faschismus auf, der die ganze Gesellschaft in eine Inhumanität stürzen könnte, die in der Weltgeschichte beispiellos wäre. Das Verbot der KPD im Jahr 1956 durch das Bundesverfassungsgericht hat die Inhumanität in der Bundesrepublik einen Schritt nach vorn gebracht. Die Sonne der Aufklärung ist verdunkelt und von ihrem Ideal weit entfernt. Obwohl bereits in der bürgerlichen Aufklärung volksfeindliche Tendenzen leicht zu eruieren sind, die verhinderten, dass die in der Aufklärung keimende Intention einer anarchistischen Gesellschaft von Atheisten, die Bayle für möglich hielt, nicht konsequent zu Ende gedacht wurde, ist sie nach ihrer inhaltlichen Intention unabgeschlossen im Sinne einer lebenslangen Lernbereitschaft, so dass der Vorwurf Hegels, die Aufklärung sei über sich selbst nicht aufgeklärt, zu relativieren ist, die Aufklärung kann über sich selbst nie ganz aufgeklärt sein, da sie ihre Grenze nicht erreicht, um sich an ihr aufzuopfern. In ihrem Begriff schon liegt die ständige Erhellung der Finsternis der Unwissenheit, sie selbst schloß eine Art sokratischer Weisheit in sich ein, die in der Philosophie ein finales Denken für dogmatisch hielt. Gerade in Deutschland ließ im philosophischen Denken vor der Berliner Diktatur Hegels der kantische Kritizismus die fundamentalen Fragen über Gott und die Welt völlig offen und hatte für Hegel dem Nichtwissen nur ein gutes Gewissen gemacht. Es bleibt nach Kant, nach seinem Studium, nach seinem Tod nur ein subjektives Dafürhalten, die Fragen nach dem Ich und nach Gott sind der wissenschaftlichen Forschung entzogen. Die Vernunft des Menschen als einem intellektuellen Bewohner der Sinnenwelt ist für Kant so, dass sie Gott nicht als existenten zu demonstrieren vermag, der Glaube ist zugelassen, aus ihm wird aber durch keine Vernunftanstrengung Wissen. Das Programm der kritischen theoretischen Philosophie hat im Prospekt, alle Schwärmerei mit der Wurzel auszurotten und die Dialektik auf immer zu vertilgen. Man kann sich also von Gott nur einen negativen, die Erkenntnis nicht erweiternden Begriff machen, mit dem positiven beginnt das Vernünfteln ins Blaue hinein. Nur der radikale Flügel der französischen Aufklärung strebte zu ihrer Zeit „schwärmerisch“ eine gerechte Gesellschaft der Égalité an und gab durch deren Anvisierung der Weltgeschichte einen finalen Sinn. Gerade er schöpfte aus der offenen Kampfstellung gegen den Katholizismus kreative Denkkraft, unterlag aber durch diese militante Stellung zugleich einer unterschwelligen Gefahr, in Erstarrung zu geraten. Die Kunst des ideologischen Klassenkämpfers besteht darin, diese zu vermeiden. Lange vor Adorno, lange vor Horkheimer ließ Lessing Minna von Barnhelm fragen, wie vernünftig die Vernunft der Aufklärung sei ? Lange vor Adorno, lange vor Horkheimer klagte Schiller: „Das Zeitalter ist aufgeklärt … Woran liegt es, daß wir noch immer Barbaren sind ?“ 8. Hatte nicht Rousseau schon 1758 in einem Brief an d' Alembert geklagt, dass vor lauter Wissenschaftsgläubigkeit die Tugend unter die Räder gekommen sei? Aber trotz aller Wissenschaftsgläubigkeit bekämpfte die Aufklärung bis auf wenige Ausnahmen (zum Beispiel Holbach) den Atheismus, indem sie das Universum als Gotteswerk deutete. „Staunend bewunderte ich die Weite des Raumes, die Bahnen der Sterne und das wunderbare Zusammenwirken im Weltgefüge, Dinge, für die das Volk kein Auge hat. Noch tiefer war meine Bewunderung für den Geist, der über diesen ungeheuren Kräften waltet“. 9. Aber nicht nur im Universum, auch in der Gattungsgeschichte sahen sie noch einen übergeordneten Gedanken (Gott war im Exil, aber es gab ihn noch), obwohl diese ausschließlich das Werk des Aufeinanderwirkens der Menschen selbst war, was man seit Vico wusste, ganz nüchtern basiert für d' Alembert die Gesellschaft auf die reziproke Nützlichkeit der Menschen untereinander. Durch die Verbannung Gottes aus der Geschichte war diese nun kein Heilsgeschehen mehr, das zu machende Glück fiel in die Hände jedes einzelnen. Der junge Friedrich Engels bemerkte einmal, dass die Revolutionen des 18. Jahrhunderts im Gegensatz steckengebliebene waren 10., dass die Aufklärung nicht der letzte, nur der vorletzte Schritt zur Selbsterkenntnis und Selbstbefreiung der Menschheit war. 11. Bei aller Kritik an der Tradition lag in der Aufklärung eine durch die Renaissance vermittelte positive Rückbesinnung auf den antiken Republikanismus vor. Die römische Republik war für Rousseau „le meilleur gouvernement qui ait jamais existé“. Auch bereits Machiavelli hatte sich in seiner politischen Theorie an römischen Vorbildern orientiert. Für Voltaire hatte die griechischen Klassiker auf den Gebieten der Metaphysik und der Moral bereits alles gesagt. In der Geschichte des dialektischen Denkens nimmt die Renaissance, in der sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf faszinierende Weise verbinden, insofern eine Schlüsselstellung ein, als durch sie das dialektische Denken der antiken Philosophie, insbesondere das zur Zeit des Perikles, entmarginalisiert wird, sie sich aber nicht nur in der Rückbesinnung erschöpft, sondern auf Neues, auf ein neues Menschen- und Weltbild hinweist, ohne die es keine europäische Aufklärung in dem uns heute bekannten klassischen Sinn gegeben hätte. Die Zukunft rückte immer mehr in den Mittelpunkt. In ihrer Favorisierung des in der Tradition Bacons stehenden experimentellen und analytischen Denkens, dieses Stabes, „den die Natur den Blinden gegeben hat“ (Voltaire), gegenüber dem spekulativen und synthetischen wendete sie sich zugleich gegen die in der Tradition des Mittelalters stehenden religiös fundierten Dogmatik. Diese galt es aus den Wissenschaften zu vertreiben. Die raumübergreifenden, globale Dimensionen annehmenden Entdeckungen der „christlichen“ Seefahrt, die eine Horizonterweiterung in wahrsten Sinne des Wortes brachten, die Kenntnis von überseeischen Völkern mit anderen Mentalitäten, technische Erfindungen, die unsere Einsichten in die Materie vertieften, zugleich eine auf einen Erfahrungsbeleg geeichte Philosophie, eine als autonom begriffene, von Gott unabhängige Natur und eine Kritik der Vorurteile, mit der Gassendi begonnen hatte, wurden zu Elementarien, aus denen sich der neuzeitliche Fortschrittsbegriff zusammensetzte. Autoritäten konnten sich nicht länger allein auf ihr Alter berufen. Des Weiteren hatte die Aufklärung wie schon die Renaissance einen lebens- ja lustbejahenden Grundzug, der sich gegen den christlichen Asketismus richtete. Es war ein Zeitalter, in dem der autonome und kreative Mensch die Sinnlichkeit gegen die platonisch-christliche Leibfeindlichkeit rehabilitierte. Wir können in der Geschichte der Aufklärung schon in allen wissenschaftlichen Disziplinen Mikrorevolutionen verfolgen, etwa im Verhältnis von Theorie und Praxis, Trieb und Vernunft, Glauben und Wissen … in denen alles auf den Kopf gestellt wurde und die in alle Disziplinen hineinwirkten, so dass sich die große soziale Umwälzung in den Eigentumsverhältnissen zwar nicht, wie man zunächst annehmen könnte, als Summe theoretischer Mikrorevolutionen ergab, im Gegenteil, dass sie anzeigt, dass das Bewußtsein der Menschen hinter der Objektivität ihrer Lebensproduktion in Ausbeutergesellschaften vielmehr zurückbleibt. Es war nicht im Bewußtsein der Jakobiner, dass Klassen aus dem Bestreben heraus, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, in ihre Revolution hineingejagt worden waren. Soweit waren die Sozialwissenschaften im 18. Jahrhundert nocht nicht, erst Saint-Simon stellte in seinen „Genfer Briefen“ 1802, also drei Jahre nach dem Machtantritt Napoleons fest, dass die französische Revolution ein Klassenkampf zwischen Adel, Bürgertum und Besitzlosen gewesen war. Jede seriöse Philosophie enthielt durch die Geschichte hindurch sowohl Elemente der Aufklärung als auch Konturen dialektischen Denkens. Aber durch das Krisenbewußtsein des 18. Jahrhunderts, das Rousseau 1762 im „Emile“ prägnant erfasste, kam es zur Ballung dieser Elemente und ab dem 19. Jahrhundert stehen wir ganz im Banne der Dialektik. In der französischen Revolution wird die bis in unsere Tage und darüber hinaus wirkende Widerspruchsdialektik der Aufklärung virulent. Der Artikel aus der „Enzyklopädie“ über die „Politische Autorität“ bleibt bis heute tagein tagaus aktuell: „Kein Mensch hat von der Natur das Recht erhalten, über andere zu gebieten“. Macht gleich welcher Art im zwischenmenschlichen Lebens- und Kommunikationsraum kann nur Mißbrauch der Macht sein. In den Worten St. Justs, einem Schüler Rousseaus wie Robespierre: Niemand kann regieren und unschuldig bleiben. Ihr Lehrer hatte geschrieben, dass ein Mensch, der anderen Menschen Befehle geben will, krank sein muss. „Macht ist für den hypokritischen Aufklärer immer Mißbrauch der Macht“. 12. Bezeichnend für die deutsche Misere ist, dass Kant noch 1795 im philosophischen Entwurf zum ewigen Frieden der gesetzgebenden Autorität eines Staates „natürlicherweise“ die größte Weisheit beilegt.
Voltaire war ein Repräsentant der gemäßigten Aufklärung, der den bewaffneten Aufstand der Volksmassen fürchtete. Er war kein Atheist, sondern ein Deist, der 1768 die unter englischem Freidenkereinfluß stehende "Profession de foi des théistes". (Glaubensbekenntnis der Deisten) publizierte. Einen wichtigen Einfluss auf die Freidenkerbewegung hatte John Toland mit seiner 1696 erschienen Schrift „Christianity not Mysterious“ ausgeübt. Voltaires Credo lautete: Man brauche einen Gott, müsse ihn notfalls sogar erfinden („Si Dieu n' existait pas, il faudrait l' inventer“), um den Pöbel im Zaum zu halten. „Kein noch so kleines Nest läßt sich ohne Religion regieren“. 13. Der Pöbel bestand für ihn aus "Ochsen", nicht diese, monarchistische Kreise müsse man aufklären. Er vertrat eine widerwärtige Aufklärung für die "Oberen Zehntausend", und nur diese konnten damals lesen und schreiben, und er fühlte sich zeitlebens zur verfaulten Aristokratie hingezogen. "Ce n' est pas pour les tailleurs et les bottiers". ( Das ist nichts für Schneider und Schuster, die für ihn Pack waren, die Formulierung „ ... wie der Pack sich ausdrückt …“ läßt sich bei ihm finden). Dieses Pack verstehe ohnehin nichts von Philosophie. 14. Deshalb können die Herrschenden die Philosophen auch ruhig in ihrer Religionskritik gewähren lassen, das Volk wird immer im Glauben dahindämmern, die Aufklärung wird nicht in die dumpfe Masse einsickern. 15. Alexis de Tocqueville erkannte diesen Irrtum der Aufklärer, sie hatten etwas losgerissen, was sie nicht mehr steuern konnten. 16. Wieland hatte sich immerhin noch gegen Voltaire gewandt und Schneider und Schuster für berechtigt erklärt, die Menschheit aufzuklären 17., für den großen Jakobiner Marat bildeten die Arbeiter den gesündesten Teil des Volkes, obwohl selbst dieser große Jakobiner und radikale Feind der Aristokratie sehr oft noch von einer steten unabänderlichen politischen Unwissenheit des Volkes ausging. Von der Tafel Friedrichs des Großen weiß Voltaire in einer autobiografischen Skizze zu berichten: "Gott selbst wurde nicht angetastet. Aber allen denjenigen, die in seinem Namen die Menschen betrogen hatten, ließ man keine Schonung widerfahren". 18. Gott selbst wurde nicht angetastet, aber Gott war an dieser Tafel nur noch ein leerer Name, ein Gott der Vergangenheit, ohne Gegenwart und Zukunft. Gott war entrückt, er durchflutete nicht mehr wie für Spinoza das All, war nicht mehr allpräsent-allwissend. Aber reaktionär war der Pantheismus Spinozas keineswegs, ein entrückter Gott entfernt Herr und Knecht voneinander und läßt sie bestehen, was Voltaire erkannte, in einer Allgottheit erweist sich eine Herr-Knecht-Konstellation zwischen Menschen als Sünde per se. Gott mißhandelt sich nicht selbst. Kant begründet einen Gegengott zum spinozistischen, also im Bereich des Intelligiblen angesiedelten, aus der Moral. Für den Rechtsgelehrten Hugo Grotius galt das Recht zwischen Menschen auch ohne Gott. Mögen der deistische und der pantheistische Gottesbegriff auch diametral entgegengesetzt sein, der Deismus und der Pantheismus treffen sich auch wieder. Der Deismus macht den Raum frei für eine eigenständige Aktivität des Menschen, der aber unter der Ägide der Religion kein Prometheus werden kann, im Pantheismus liegt die Aufforderung, die unfertige Welt gottgemäß, zu seinem Ebenbild zu gestalten. Für die Deisten, konsequente Fortführer der Sozianer, war die Religion nicht die Schlange, die der Kopf zertreten werden musste, für Voltaire war in der Tradition Bayles der Aberglaube die Schlange. „Man muß ihr den Kopf zertreten, ohne die Religion, die von ihr vergiftet und zerfleischt wird, zu verletzen“. 19. Die Philosophie wurde mit dem Licht assoziiert, der Aberglaube, nicht die Religion, mit der Dunkelheit. In der religiösen Tradition war das Licht durch Christus in die Welt gekommen, die Aufklärung enteignete diese. Unser Jahrhundert wird von Tag zu Tag lichter, dachten die Aufklärer, und, so Bayle, vor ihm werden alle anderen Jahrhunderte Finsternis. Die Unwissenheit galt als Mutter des Aberglaubens. Insbesondere der Jude, nach Voltaire der Überträger des Aberglaubens, wird für ihn peripher, gleichwohl die Aufklärung seine Gleichstellung im Prospekt hatte. Wenn die Wissen verbreitende Vernunft den Aberglauben bezwingt, öffnet sich das Tor zum Glück der Menschheit. Der alte Fritz war da skeptischer, für ihn gab es immer Aberglauben und wird es ihn immer geben. Nach der Aufklärung wuchs die Güte des Menschen mit seiner Bildung. So dachte Voltaire, aber nicht Rousseau, nicht Hegel, der gegen den Begriff „Bildung“ eine regelrechte Aversion hatte. Bildung macht nicht besser, zwischen gutem Wissen und gutem Willen besteht leider kein Automatismus. Von den Teilnehmern an der Wannseekonferenz zur Endlösung der Judenfrage hatten alle Teilnehmer bis auf den Konferenzvorsitzenden SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich den Doktorgrad einer deutschen Universität, wobei man sich über die Notwendigkeit der Liquidierung der Juden schnell einig wurde, die Konferenz zog sich wegen der „Behandlung“ der Halb- und Vierteljuden in die Länge. Nietzsche sollte auf perverse Art Recht bekommen: er sah in der übermässigen Wissensgier und im ständigen Bildungseifer eine Frucht der Aufklärung, dass die Menschen heute nur noch als Enzyklopädien, als „historische Bildungsgebilde“ durch die Gegend laufen. Überall werde Halbwissen aufgeschnappt und der intellektuell kreative Mensch verkomme zum Kompilator, der nichts sein eigen nennen kann. Die Frucht der Aufklärung ist gewiss nicht nur eine süsse: der Mensch hat ein Bedürfnis nach einer Weltanschauung aus einem Guss, gerade die Zeit, die der Aufklärung und der Revolution, die den Zerfall mittelalterlicher Fundamentalismen bewirkten, folgte, war eine Zeit des hastigen Suchens und Findens neuer pluraler Fundamentalismen. Die Zeit der Ismen war angebrochen. Seit 1789 ist fast alle intellektuelle Produktion lediglich Reaktion auf die Atomisierung, die dem Sturm auf die Bastille explosionsartig folgte. Auch die Explosionen und gesellschaftlichen Eruptionen nach der Oktoberrevolution warfen Fragen über eine sinnvolle Gestaltung des Lebens der Individuen auf, Stalins Studie „Über dialektischen und historischen Materialismus“ lieferte dafür eine Weltanschauung aus einem Guss.