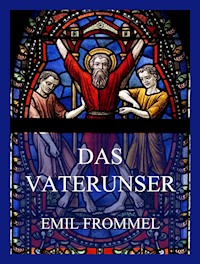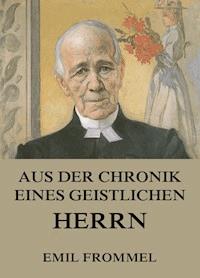
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Emil Wilhelm Frommel, ältester Sohn von Karl Ludwig Frommel und der Pfarrerstochter Jeanne Henriette Gambs, studierte in Halle, Erlangen und Heidelberg Theologie. 1848 nahm er als Burschenschafter an den revolutionären Unruhen teil, distanzierte sich aber später davon. Außer zahlreichen Predigten und dem Beitrag zur Kirchengeschichte Badens Aus dem Leben des Dr. A. Henhöfer (Barmen 1865) sowie der Schrift Von der Kunst im täglichen Leben (Barmen 1867) hat er eine Reihe von Volksschriften veröffentlicht, die ihn wegen ihrer Frömmigkeit, Sprache und ihres Humors bekannt machten. In diesem autobiographischen Roman bietet er viele Anekdoten aus seinem Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aus der Chronik eines geistlichen Herrn
Emil Wilhelm Frommel
Inhalt:
Emil Frommel – Biografie und Bibliografie
Aus der Chronik eines geistlichen Herrn
Etliches von Familienchroniken
Aus dem untersten Stockwerk
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel
Eine Hundstags-Wanderung im Achteck und Dreieck
Aus der Familienchronik
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel.
Achtes Kapitel.
Neuntes Kapitel
Zum Schluß noch etwas »vom Grüßen«
Aus vergangenen Tagen
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Zum Schluß
Aus der Chronik eines geistlichen Herrn, E. Frommel
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849615086
www.jazzybee-verlag.de
Emil Frommel – Biografie und Bibliografie
Theologe und Volksschriftsteller, Sohn des Malers Karl Ludwig Frommel, geb. 5. Jan. 1828 in Karlsruhe, gest. 9. Nov. 1896 in Plön, studierte in Halle, Erlangen und Heidelberg Theologie, bekleidete in der Folge Pfarrämter in Altlußheim bei Heidelberg, Karlsruhe und Barmen und wurde 1869 als Garnisonpfarrer nach Berlin berufen, wo er 1872 zum Hofprediger ernannt wurde. An dem Kriege 1870/71 nahm er als Feldprediger unter General v. Werder teil. Volkstümliches Denken und ein tiefes gläubiges Gemüt bewährte F. in seinen »Erzählungen«, Bd. 1: »Aus der Chronik eines geistlichen Herrn« (5. Aufl., Stuttg. 1901), Bd. 2: »Nach des Tages Last und Hitze. Wanderungen durch Werkstatt, Schlachtfeld und Pfarrhaus« (4. Aufl. 1900), Bd. 3: »O du Heimatflur!« (2. Aufl. 1899, darin der bemerkenswerte Beitrag zur Kirchengeschichte Badens: »Aus dem Leben des D. A. Henhöfer«). Ihnen stehen zur Seite die Erzählungen und Skizzen: »Beim Lichtspan«, »In des Königs Rock«, »Allerlei Sang und Klang«, »Aus der Sommerfrische« u. a. Ferner gab er die Anthologie »In drei Stufen« heraus und war Mitbegründer der »Neuen Christoterpe«. In dem »Frommel-Gedenkwerk«, herausgegeben von der Familie (Berl. 1900 bis 1904, 7 Bde.), enthalten Bd. 1–2 eine Biographie Frommels von Otto Frommel, Bd. 3: Briefe, Bd. 4 u. 5: Reden, Bd. 6: Briefe und Denksprüche, Bd. 7: ausgewählte Predigten. Frommels Leben beschrieben Schöttler (3. Aufl., Barm. 1897), Kayser (3. Aufl., Karlsr. 1898) und Kappstein (Leipz. 1903). Vgl. auch G. Mayer, Emil F. als christlicher Volksschriftsteller (Brem. 1898).
Aus der Chronik eines geistlichen Herrn
Etliches von Familienchroniken
Was der Verfasser sonst in den drei Büchlein erscheinen ließ: »Aus dem untersten Stockwerk,« »Aus der Familienchronik eines geistlichen Herrn« und »Aus vergangenen Tagen,« will jetzt den geneigten Leser in einem Büchlein grüßen. Gehören die drei doch zusammen. Es sind wohl zehn Jahre her, daß das erste Büchlein seinen Lauf begann »Aus der Familienchronik eines geistlichen Herrn.« Es war nicht ein Gedanke von gestern und heute, solch ein Büchlein hinaus in die Welt fliegen zu lassen. Als ich noch ein Büblein war und wie alle Büblein mit dem Ranzen auf dem Rücken in die Schule ging, in welchem viel gelehrtes und ungelehrtes Zeug sich aufhielt, hörte ich an einem Schulfest eine Rede vom alten Herrn Rektor. Die Rede war aber kurz und gut und gefiel mir über die Maßen. Der liebe alte Herr, Gott hab ihn selig, sprach nämlich von einem Trieb, den die Knaben hätten, einem absonderlichen vor allen andern, und der hieß: der Sammeltrieb. Und das ist wahr. Der eine klettert wie eine Katze auf die Bäume und holt sich die Vogeleier in seine Sammlung und kauft sich noch ein Straußen- oder Kolibriei dazu, weil sie heuer im deutschen Wald nicht mehr geraten; der andre springt den Schmetterlingen nach, bis er sie alle in den Kasten gesperrt hat und läßt sich keine Mühe dabei verdrießen. Denn es geht ihm dabei oft fatal und um kein Haar besser als den Fischern; wie die an der Angel statt eines Fischleins nach langem Harren ein Stück Holz oder ein Pfund Schlamm herausziehen, so fangen oft die Schmetterlingsförster gelben Ginster und roten Fingerhut im Netz, aber der Herr Schmetterling wirbelt in der Luft und lacht den Ginsterfänger aus. Und wieder ein anderer sammelt Steine und klopft an alle Berge und sogar auch an den Consol mit der Marmorplatte in der Staatsstube, um seine Sammlung zu vervollständigen, und legt zugleich die Ohrfeige, die er dafür bekommt, zu der bereits angelegten Sammlung dieser zarten Südfrüchte; und wieder ein andrer legt sich auf Raritäten und Altertümer, und gäbe das Butterbrot vom Munde weg, wenn ihm einer die Zähne des Kalifen von Bagdad verschaffte, die Hüon, der tapfere Ritter, ihm seiner Zeit aus dem Munde schlug. Da meinte denn der alte würdige Herr, es lohne sich der Mühe, etwas Besseres und Bleibenderes zu sammeln als Vogeleier und Schmetterlinge, hinter die das Ungeziefer kommt, – das sei die Geschichte von Vater und Mutter, Großvater und Großmutter väterlicher- und mütterlicherseits, so weit's hinaufgeht in der Kunde und das Gedächtnis samt dem Papier reicht.
Und darin hatte er wieder recht. Denn da wächst das Männlein unversehens hinein in die Geschichte seiner Familie nicht bloß, sondern auch seines Volkes, wie die Dorfkonfirmanden in den großen Konfirmationsrock, der unten noch zwei Handbreit eingeschlagen ist. Da sieht man durch die Familiengeschichte in die große Volks- und Weltgeschichte wie durch ein kleines Guckfensterlein hinein, und es wird einem die Geschichte beigebracht man weiß nicht wie, aber ohne Arrest und Thränen jedenfalls. Und sie wird lebendig, wenn man hört, wie der Urgroßvater unterm alten Fritz gedient und an seiner Tafel gesessen, und wie der Großvater mütterlicherseits die Bastille hat stürmen und die Guillotine hat aufschlagen sehen; wie der Großvater väterlicherseits von den Franzosen übel traktiert worden ist, und wie die Großmutter von der Frau Seite anno 13 die Kinder versteckte von wegen der Kalmücken und Don'schen Kosaken.
Seit jener Rede habe ich eine Sammlung angelegt von Geschichten aus der Familie, und paßte wie ein Hechelmacher auf, wenn der Vater oder die Großmutter von der Frau Seite erzählte von dem Vorfahr und den guten und bösen Zeiten. Denn es gilt noch immerhin, was in den Sprüchen steht: »Bei den Großvätern ist die Weisheit und der Verstand bei den Alten.« Nun giebt's freilich Familiengeschichten, die man nicht in die Druckerei geben kann, und unter Schloß und Riegel gehören; denn nicht alles was man weiß, kann und soll man an die große Glocke hängen; das will ich auch nicht, sondern nur zeigen, wie Gott mit unsern Vätern gewandelt und sie mit ihm, und wie ihnen und uns nichts fehlen wird an Heil und an allem Guten, wenn wir seine Wege wandeln.
Als ich nun das Büchlein hatte hinausfliegen lassen, dachte ich in meiner angeborenen Bescheidenheit nicht im mindesten daran, daß mir aus verschiedenen Gauen Brieflein zukommen würden mit viel freundlichen Dankworten. Der eine frug: »Ob denn das alles wahr wäre, was da drin stünde« – als ob man etwas drucken lassen könnte, was nicht wahr wäre und dazu noch ein »geistlicher Herr« solches thun würde, das wäre doch etwas stark; abgesehen davon, daß der Herr Steinkopf sein Papier nicht zum Lügen hat. Der andere bat um gefällige Auskunft, wie man denn zu einer solchen Familienchronik kommen könnte. Er habe auch nicht umsonst in der Welt gelebt und wisse auch ein Stücklein daraus zu erzählen, allein er könne die Sache nicht klein kriegen. Darauf habe ich ihm gesagt: er solle nur einmal anfangen zu schreiben und was er geschrieben, den Seinen des Abends nach dem Nachtessen vorlesen und einmal zuschauen, was das für einen Eindruck mache. Er werde bald sehen, wo die Geschichte zu breit oder zu lang sei und solle dann die Schere nicht sparen. Schreiben lerne man durch Schreiben, wie man Schwimmen nur durch Schwimmen lerne. Er könne das Geschreibsel ja, nach des quintus Flaccus Horatius gutem Rat, noch neun Jahre liegen lassen, ehe er's zum Druck befördere; in neun Jahren ließe sich bei redlichem Fleiße immer noch etwas an Gescheitheit zulegen. Der dritte wollte wissen, wie ich denn meine Familienchronik eingerichtet hätte, was denn da alles drin sei. Dem habe ich erzählt, daß ich zunächst einmal einen Stammbaum verfertigt hatte, väterlicherseits, mütterlicherseits und von der Frau Seite. Da müsse eben jeder sehen, wie er sich helfen könne, wie man den Leuten allen auf die Spur komme. Das koste heuer, seit dem deutschen Reich, nicht mehr viel; mit ein paar Groschenmarken und einem Brief an das »Wohlehrwürdige Pfarramt da und da,« mit der Bitte um einen gefälligen Auszug aus dem Familienregister, und drunter: »unter Postnachnahme zu senden« und wenn man besonders wohlgezogen ist, noch dazu mit einem: »Sich damit« oder »Zu Gegendiensten stets bereit« – komme man weit. Sei das in Ordnung und der Stammbaum so weit hergestellt, daß mit einiger Sicherheit auf Adam und Eva als Urahnen zu schließen sei, dann könne man sich beruhigen. Sodann hätte ich eine Hauschronik vom Anfang der Ehe angelegt, dabei die Hochzeitspredigt und Gedichte nebst der Hochzeitsreise und was sich zugetragen bis zur Geburt des ersten Kindleins. Letzteres bekomme dann seine besondere Chronik, mit Taufschein, Taufrede, Patenbriefen nebst allem was sich auf seine Geburt, Leben, Thaten und Meinungen bezieht. Der erste Zahn wird notiert, die andern nicht mehr. So werde jedem Kindlein die Chronik zusammengeheftet; die Hauptsache sei dabei ein guter Aktenstecher und – daß das Männlein oder Fräulein (oder gar wie dem Verfasser am 13. Novembris des Jahres 1862 in der Morgenstunde passierte das Männlein und Fräulein) – etwas erlebt. Die Hauschronik gehe aber trotz alledem weiter, nebenher aber die Familienchronik. Alles was sich von Wissenswürdigem aus alter und neuer Zeit im Jahr sammelt, kommt zusammen in eine blaue Schachtel, die an Sylvester umgestürzt wird, und woraus sich dann die Nachträge und weitere Geschichten spinnen. Am Familientage, an welchem aus Ost und West die Kinder und Geschwisterkinder väterlicher- und mütterlicherseits zusammenkommen, wird der Stammbaum ergänzt, ein alter Fund mitgeteilt und in seiner Echtheit nachgewiesen oder als Familiensage in einen rosenroten Kasten gelegt. Daneben halte ich auch ein besonder Fach mit Schwarz überzogen, drin seien die Erinnerungen an die Heimgegangenen, Leichenreden und Andenken, getrocknete Blätter und letzte Briefe. Bei diesem Fach kämen dem Verfasser freilich manchmal die Thränen in die Augen, nebst einem Ergrimmen im Geist. Aber das »Memento mori« auf dem Deckel thue allezeit Dienste. Bei diesen Aufzeichnungen solle aber der Herr Briefsteller nicht zu scrupulös sein und meinen, es müßten immer große gewaltige Geschichten sein, die er verzeichnen müsse. Auch die kleinen Sachen sind interessant für den, der sich dafür interessiert; und nicht die großen, sondern die kleinen Züge machen oft das Porträt erst ähnlich; selbst Sommersprossen und Leberflecken, wie auch der schüchterne Schnurrbart, der sich zu ihrem Leidwesen bei der Tante allmählich eingestellt, dürften nicht fehlen.
So mache es der Verfasser; wenn der Herr Briefsteller es aber anders machen wolle, so sei dagegen nichts einzuwenden.
So ließ ich das zweite Bändchen »Aus vergangenen Tagen« erscheinen. Und auch das brachte mir manch lieben Gruß zurück, und die Bitte, ob ich nicht im Zusammenhang etwas aus meinen Leben schreiben wollte. Da bin ich freilich schwer dran gegangen. Denn wer bin ich, daß ich von mir erzählen sollte? Aber ich dachte: du erzählst ja nicht von dir, sondern vom lieben Vaterhause, von deinen lieben, seligen Eltern und erinnerst etliche Leute an die Zeit ihrer eignen Jugend. So schrieb ich das letzte Büchlein »Aus dem untersten Stockwerk.« Das haben mir zwar etliche Leute sehr übel vermerkt und gemeint, ein königlicher Hofprediger habe doch heutzutage etwas anderes zu thun, als »Aus dem untersten Stockwerk« zu schreiben. Aber es reut mich nicht. Mögen andere, die das Zeug dazu haben, über Kirchenpolitik schreiben und die Tagesfragen beleuchten, jeder arbeite an seinem Stücklein Erde im Weinberg und es kommt doch dem Ganzen zu gut. Wenn ich schreibe, so schreibe ich mir zur Erholung in den wenig stillen, freien Stunden, die mein Amt mir läßt. Was ich in Jahren gedacht und in mir innerlich reif geworden, das fällt dann in einer stillen Mitternachtstunde fröhlich ab. Wem's nicht gefällt, der braucht's ja nicht zu kaufen. Was aber mir in der brausenden Welt, in der sauren Tagesarbeit, im wechselnden Heute mit seinen kommenden und gehenden Bildern Erholung ist: das stille, traute Heim, das Wandeln mitten unter den Kinderaugen und Kinderherzen, das Zurückgehen auf die Tage der Vergangenheit in der unvergeßlichen Heimat; das Kramen unter alten, vergilbten Papieren, das treue Hangen an denen, die mir noch geblieben sind nach so vielem Scheiden – das, dachte ich, wird vielleicht auch anderen eine solche Erholung und Erquickung sein.
Es geht heutzutage so vieles aus dem Leime, aber wenn das Beste aus dem Leime ginge: der Sinn fürs Haus und die Familie, diesem Schaden würde auch das gelehrteste Buch nicht aufhelfen. Ich möchte im kleinsten Punkte an unserem Volksleben mitbauen durch dies Buch und tröste mich dabei des großen und schönen Wortes eines großen Mannes:
»Aus der Kinderstube wird die Welt regiert.«
Aus dem untersten Stockwerk
Erstes Kapitel
Dem geneigten Leser zum Gruß. Unser Haus.
Als der Verfasser seinen vierzigsten Geburtstag feierte (an welchem bekanntlich die Schwaben ihren richtigen Verstand kriegen und gescheit werden, denn sonst bleiben sie eben so dumm wie die andern Bewohner des heiligen deutschen Reichs), sollte er abends zum Danke für all die schönen Sträuße und Glückwünsche ein Stück aus seinem Leben erzählen. Nun giebt's aber kein wonnevolleres Stück darin, als den Morgen, zumal wenn's bei Einem stark auf den Abend geht. Da war alles so frisch und duftig, so voll Tau und Sonnenschein, da und dort auch ein Stücklein Nebel und Wolken dazwischen; Wahrheit und Dichtung, Selbsterlebtes und Gehörtes geht da bunt durcheinander. Denn manchmal ruft der Bruder beim Erzählen: »halt, das bist nicht du, sondern ich gewesen,« aber 's ist Einem doch, als hätte man's selbst erlebt. So nahm ich denn den Morgen vor zum Erzählen oder auch das unterste Stockwerk, die Zeit vom ersten bis zum zehnten Jahr. Denn dann zieht man hinauf in den nächsten zehn Jahren in den Zwischenstock; darnach in die Beletage, die die Zwanziger und Dreißiger umfaßt, dann geht's schon in den vierten Stock, und so immer höher hinauf in den fünften, sechsten und siebenten, und je höher hinauf, desto beschwerlicher das Treppensteigen, aber auch immer näher und höher dem Himmel zu. Und von oben herunter sieht man auf das Treiben der Menschen herab; die kommen Einem, je höher hinauf man gezogen, desto kleiner da drunten vor in ihrem Rennen und Treiben. Man gedenkt aber daran, wie man sich selber einst auch da herumgetrieben zwischen Menschen, Pferden und Wagen durch; den Ball gespielt und unbesorgt seinen Tanzknopf den Spaziergängern zwischen die Beine gejagt, und kann sich auch wieder freuen an all dem bunten Treiben und ist nur froh, daß man's nicht noch einmal durchzumachen hat. Denn zweimal lebt kein Mensch sein Leben gerade so durch, und mit dem »Andersmachenwollen das nächste Mal« ist's auch eine bedenkliche Sache. Zuletzt geht's aber mit dem Geiste aus dem obersten Stockwerke hinauf zur lichten Wohnung, und der Leib zieht wieder ins wahrhaftige Parterre, davon er genommen ist.
Als ich aber so erzählte, baten sie alle, ich möchte es doch 'mal aufschreiben für meine Kinder und für andere auch, als einen Eingang zur »Familienchronik« und zu den »vergangenen Tagen«, die beim Herrn Steinkopf in Stuttgart auf Lager liegen und die er gerne hergiebt. Zugleich sollte das Büchlein auch andern Vätern im deutschen Reich Lust und Liebe machen, von ihrem Leben, ihrer Jugendzeit für ihre Kinder etwas aufzuschreiben als ein liebes Vermächtnis. Und das bei Zeiten, und nicht denken: »du kommst einmal dran, wenn du dich zurückgezogen hast oder zurückgezogen worden bist (was auch vorkommt) – denn da kommt so mancherlei, was es nicht mehr leiden will, als da sind: das Zipperlein am Finger, oder das Zittern an der Hand, oder es kommt der Tod und nimmt die Feder weg. Sie brauchen's ja nicht drucken zu lassen und können's wegschließen, daß es niemand sonst liest. So kam der Verfasser dazu und hat's lange Jahre liegen lassen. Denn man besinnt sich eben doch, ehe man solch ein Stück Eigentum und Heiligtum allen Leuten weggiebt. Aber andere haben ihn ermutigt und vielleicht denkt Eins oder das Andere dabei an seine Jugend zurück. Und wenn in ein altes Auge ein Strahl der Freude käme, oder ein anderer sagte: »So war's bei uns zu Haus auch« und er noch dankbar seiner lieben Eltern gedächte und all des Guten, was ihm sein Gott in der Jugend beschert: und wenn ein anderer zufrieden würde mit seinen alten Tagen und mit den mancherlei Bresthaftigkeiten, die dran hängen, weil er's doch einmal licht gehabt in seinem Leben, so würde es ja das Büchlein schon wert sein.
O du Heimatflur, o du Heimatflur, Laß zu deinem heil'gen Raum Mich noch einmal nur, mich noch einmal nur Entfliehn im Traum!
Als ich Abschied nahm, als ich Abschied nahm, War die Welt mir voll so sehr; Als ich wiederkam, als ich wiederkam, War alles leer!
So singt's freilich jetzt im Verfasser, wenn er wieder einmal in die alte Heimat kommt und in seine Geburtsstadt Karlsruhe. Wohl steht sie noch auf demselben Fleck, aber sie ist größer und schöner geworden; die Häuser sind's zum Teil auch noch, alte Bekannte, aber andere Gesichter schauen heraus. Wie anders als damals, wo man auf dem Schulweg des Morgens früh um sieben oder um acht Uhr jeden Hausbewohner kannte in seinem Morgenkostüm! Da schaute im Schlafrock, uns gerade gegenüber, der Herr Kanzleirat zum untern Stock, auf rotes Polster gelehnt, seine Pfeife rauchend heraus und mit ihm im Morgenhäubchen seine Frau. Man zog ehrerbietig seine Kappe herunter und stereotyp klang der Gruß: »Gutemorge Büble, kann'sch dein' Sach?« Ja, das waren manchmal »Gewissenssachen« mit dem Können, und oftmals stieg der Neid auf in dem Gedanken: »Ach, wenn du's so gut hättest, wie der Herr Kanzleirat Strohmeyer, der sein Sach' schon längst kann und nichts mehr zu lernen braucht.« – Dann ging's vorbei beim Flügeladjutanten des Großherzogs, einem alten General, und seinem Bruder, dem Forstmeister; ein Blick in die Stube, ob die Geweihe und Sechzehnender noch alle lebten und am Platz waren, und langsam vorüber an dem weißen Hühnerhund, der's nicht leiden konnte, wenn die Buben sprangen und einen dann für eine Schnepfe ansah und ihnen die Hosen zerriß; am Waldhornwirt vorbei, dem Herrn Hartweg, der unter der Thür stand. Da roch's zu gut nach saftigem Braten und nach kaltem Tabaksrauch aus dem Saal der Stammgäste, in welchem die Pfeifen der Reihe nach hingen wie das Prinzipalregister in der Orgel. Dann bog's um die Ecke in die Lammgasse; da wohnten zwei Nachbarn einander gegenüber. Der eine im Tuchladen, der Herr Nathan Levis im großblumigten Kaftan und rotem Fesch, gelb wie eine Quitte und mit gewaltiger Adler- oder Hobnase, die sich im verjüngten Maßstabe bei seinen Kindern wiederfand. Seine lange türkische Pfeife mit großer Bernsteinspitze rauchend, unterhielt er sich mit dem Nachbar, dem Bäckermeister Vorholz, dem Karlsruher Meistersänger und Freunde Justinus Kerner's, über die Straße herüber. Dann ging's vorbei an dem großen Bogenfenster eines alten Kaufmannshauses, in welchem ein kleiner freundlicher Herr des Morgens, zwischen elf und zwölf Uhr Audienz gab. Er war das Börsenorakel der Stadt, dieselben Herren machten zur selben Stunde ihr »Ständerlein« bei ihm – bis man endlich richtig das Lyceum erblickte.
Jetzt lebt keiner mehr von allen und keiner fragt die hochwichtige Frage mehr: »Büble, kann'sch dein' Sach?«
Vornehmlich hat sich's aber dort geändert, wo der Verfasser das Licht der Welt erblickte, am Spitalplatz. Der lag am Anfang des Stadtteils, den man kurzweg »das Dörfle« nannte; in gebildeter Sprache auch der »Pfannenstiel« genannt, der älteste und auch der ärmste Teil der Stadt. Denn bei meiner Vaterstadt ging's, wie's in der großen Welt geht: die Kultur drängte von Osten nach Westen: das »Dörfle« aber lag im Osten. – Aber auch im »Osten beginnt's zu tagen,« die einstöckigen kleinen Häuser aus Lehm beginnen zu schwinden und da und dort entsteht im Dörfle ein ansehnlicher Baustil. Der einzige Fluß, an dem die Stadt lag, ist ein Nebenfluß des Rheins, nämlich der Landgraben, dessen Quellen sehr im Verborgenen liegen. In alter und auch zu meiner Zeit zog er noch ziemlich unverblümt durch die Stadt und wälzte seine schwarzen Wogen offenkundig. Nachgerade aber wurde der alte Geselle bedeutet, daß er, da ihm jeglicher Sinn für Aufklärung abginge, überbrückt werden müsse – und so ist er denn größtenteils den Augen entschwunden und führt ein unterirdisches Dasein. Zu meiner Zeit aber lag er offen, quer über den Platz, wohl überwölbt, aber man konnte hinabsteigen und – Schiff fahren, was bei dem pestilenzartigen Fluidum für eine Bubennase noch immerhin ein Genuß war.
Das Haus, in welchem wir in den ersten Jahren meines Lebens wohnten, steht heute noch. Später ging ich freilich nie an demselben ohne ein gewisses Gruseln vorüber. An einem Abend – nach Jahren, als wir herangewachsen waren – erzählte auf vieles Bitten der Vater davon. Im untern Stock wohnte nämlich ein städtischer Beamter mit seiner Frau. Die Leute hatten keine Kinder, keine Sorgen, aber auch keinen Frieden, sondern viel Streit miteinander, und oft mußte der Vater herunterkommen und schlichtend zwischen die beiden treten. So ging's Jahre lang. Der Mann hatte etwas Finsteres, Verstecktes an sich, und niemand traute ihm. Er brauchte viel Geld für sich und daher vielleicht auch so mancher Streit. Da, an einem Winterabende, während es draußen stürmte und tobte, war unten wieder Streit. Der Eltern Schlafzimmer lag gerade über dem Schlafzimmer der Leute unten und man konnte fast die Worte hören. Es wurde Mitternacht. Da ertönte ein gellender Schrei und dann wurde es plötzlich totenstill. Die Mutter wachte und rief: »Um Gotteswillen, was für ein Schrei, da ist gewiß ein Unglück geschehen!« Der Vater beruhigte sie, es werde eben wieder wie gewöhnlich Streit sein. »Nein,« meinte die Mutter, »solch einen Schrei habe ich in meinem ganzen Leben nicht gehört, der ging durch Mark und Bein.«
Die Eltern hatten noch nicht ausgeredet, als es draußen vor der Thür leise klopfte. Der Vater stand auf und machte Licht. Draußen stand die hagere, rothaarige Magd der Leute im untern Stock im Nachtkleid, das Entsetzen auf dem Angesicht und sagte: »Ach, Herr Professor, kommen Sie – unsere Frau!«
Der Vater stand auf, weckte noch einige von den Atelier-Herren, seinen Kunstschülern, die oben unter dem Dache schliefen und ging mit ihnen hinunter. In der Wohnstube am Ofen saß der Mann und stierte die Eintretenden an. »Wo ist Ihre Frau?« rief der Vater laut und stark, daß der Mutter oben das Herz bebte.
»Drinnen in der Stube liegt sie, sie hat sich selbst entleibt, nachdem sie mich hat umbringen wollen.« Dabei deutete er auf Wunden an seinen Händen.
»Das ist nicht wahr. Sie haben sie umgebracht!« rief der Vater; damit nahm er das Licht, schloß die Thüre nach dem Gange ab und befahl den drei handfestesten unter seinen Atelierherren, den Mann festzuhalten, der Miene machte, aus der Stube zu gehen. Der Vater ging in die Schlafkammer, das Bild, das sich ihm darbot, war entsetzlich. Da lag die Frau schwimmend im Blute, ein großes Messer in die Brust gebohrt, die Hände durchschnitten. Sie hatte sich offenbar gewehrt, als er das Messer gegen sie führte. – Nachdem der Vater sich von dem eingetretenen Tode überzeugt, schloß er die Kammer ab und schickte zwei Herren nach der Polizei. Gensdarmen kamen, legten dem Manne die Handschellen an und führten ihn ab. Damals war noch andere Gerichtspflege, und der Mann leugnete hartnäckig und behauptete, von seiner Frau angefallen worden zu sein, die sich dann, als sie gemerkt, daß sie ihn nicht töten könne, selbst umgebracht habe. Das war sehr unwahrscheinlich, aber dennoch wäre er fast freigesprochen worden. Da wurde auch die Mutter zum Zeugnis aufgerufen, und sie erzählte von dem gellenden Schrei, den sie gehört. Von dem aber hatte der Mann nichts gesagt, sondern im Gegenteil, sie habe das alles ganz still vollbracht. Als die Mutter ihm aber gegenüberstand, ihm die Stunde sagte, zu welcher es geschehen, da erblaßte er und gestand. Er sollte eben weggeführt werden zum Zuchthause, um gerichtet zu werden, da – auf dem Karren – bohrte er sich einen kleinen Löffel, den er im Gefängnis scharf geschliffen hatte, in die Herzgrube und starb sogleich. Seit jener Zeit war es graulich in dem Hause. Der Mutter ging noch bis in ihr hohes Alter jener Schrei in den Ohren nach. – –
Aber der Platz war auch von Erinnerungen besserer Art durchzogen, denn dort hatte der Vater seine Jugend wenigstens vom zehnten Jahre an zugebracht, und so wurde uns auch jedes Haus lebendig, als ob wir drinnen gelebt hätten. Es war allemal ein Festtag, wenn der Vater aus seiner Jugend erzählte. Einiges steht auch schon in der »Familien-Chronik eines geistlichen Herrn« zu lesen. Aber ich hole hier noch etliches nach. – Der Vater war auf Schloß Birkenfeld geboren auf dem Hunsrücken, der, damals zur sponheimischen Grafschaft gehörig, badischen Gebiets war. Der Großvater, der dort markgräflicher Baumeister war, wurde im Jahre 1799 nach Karlsruhe versetzt und zog mit seiner Familie dahin. Da war allerdings die schönste Zeit für den Vater vorbei. Denn auf Schloß Birkenfeld war Freiheit, Wald und Feld ringsum; zwischen Pferden, Kühen und Schafen und Hühnern trieben sich die »Buben« des Landbaumeisters mit denen des Forstmeisters und Gerichtsaktuars herum, dort zogen die Franzosenscharen unter General Ney durch – und da gab's immer was zu sehen (wenn auch manche Angst dabei war), was einen Buben interessierte. Nun auf einmal herunter in die enge, gradlinige Residenz, damals eine Stadt mit 12000 Einwohnern, wo jeder den andern kannte. Statt des Hauslehrers, der den gerade nicht gelehrten Namen »Ochs« führte, mit dem sich allenfalls noch über die Stunden reden ließ, ging es in die Schule, in das damalige »Lyceum illustre« was nicht weit vom Spitalplatz war. Da gab's gleich die ersten Thränen bei den gestrengen Lehrern und bei den Mitschülern die ersten Kämpfe. Denn es war in Karlsruhe nicht anders als wie in andern Schulen: man mußte sich den Einlaß erkämpfen. Es geht dem Büblein wie dem Hahn oder Meister Gockler, der auf einen fremden Hof oder Dunghaufen kommt und sich in manchem ritterlichen Strauß erst das Hausrecht erobern muß. Ein Umstand aber verschlimmerte die Sache gewaltig. Der Großvater, der seiner Zeit lange in England gewesen, hatte eine besondere Vorliebe für jenes Land und seine Sitten. So kleidete er auch seine Buben englisch. Ein blaues, feines Wämschen über der Brust, den Hals offen und den weißen Hemdkragen breit über das Wams gelegt, weiße Pantalons und Schuhe; auf dem Kopfe aber nur kurz geschnittene Haare und sonst nichts darauf, kein Hut und keine Mütze: so zogen zum Schrecken der Karlsruher Lyceisten die englisierten Hunsrücker auf. Denn die Karlsruher »Herren Buben« trugen große lange Überröcke mit gelben Aufschlägen am Kragen und an allen Ecken des Rockes, welcher bis über die Kniee ging; gelblederne Beinkleider, die über dem Knie zugeknöpft waren, große Stulpenstiefeln und schwarze hohe Halsbinden, aus denen der Kopf mit Mühe herausschaute. Oben auf dem Kopfe pomadisierte und gebrannte Locken und – lange Zöpfe, die bis auf den Boden reichten, wenn sie das höchste Maß der Schönheit hatten, auf dem Kopf ein dreieckiger Hut im Sommer, und im Winter eine dicke Pelzkappe mit langem, oben überliegendem Fuchsschwanz – so stiegen die Eingeborenen daher. So kam's denn bald zu Schlägereien, und die Zöpfe der Schulfüchse mußten gehörig dran glauben, bis endlich Friede ward. Um zehn Uhr erhielten die Reicheren ein Frühstück, bestehend in einem Glas Wein und einem Stück warmem Braten, das die Bedienten im Schulhofe servierten. Oft erzählte uns der Vater, wie die andern minder Reichen um zehn Uhr zu einem Bäcker wanderten, der in der Nähe des Luceums wohnte. Der backte »Salzwecke« und »Hörnle« so duftig, und ums Neujahr herum die »Dambedei« Männlein und Fräulein in Bretzelteig. Da passierte es ihm einmal, daß er über dem Backen einschlief und die ganze »Backet« von Dambedei rein schwarz wurde. Die Frau schlug die Hände über dem Kopf zusammen, als sie den Schaden besah und rief: »Mann, 's isch alles hin.« – Er aber besann sich und sagte: »Mutter, geh hinaus und rupf' dem Gockler seine schönsten Federn aus.« Kopfschüttelnd Hing die Frau hinaus, und bald hörte man das Gewinsel des Hahns. Sie brachte die Federn. Der Bäckermeister nahm sie, setzte eine um die andere auf das Haupt seiner schwarzen Legion und wartete, bis er den ersten »Buben« zur Schule, gehen sah. Den rief er herein und gab ihm eins von den Prachtexemplaren zum Präsent und sagte: »Büble, heut ist Dreikönigstag, da hat's lauter Mohrenköpf gegeben, da hast du einen; sag's nur den andern.« Das Büblein bewunderte den schwarzen Mohren und zeigte ihn zum hohen Ergötzen in der Schule. Um zehn Uhr aber stürmte die Jugend die Bäckerei; alle wollten »Mohrenköpfe« haben. In wenig Minuten war der ganze Vorrat aufgeräumt. Schmunzelnd sagte aber der Bäcker: »Siehst du, Mutter, es kommt halt nur auf den Namen an, den man einer Sache giebt« – womit derselbe eine große und zwar nicht bloß eine »Bäckerwahrheit«»ausgesprochen. – So trocken und philisterhaft die damalige Stadtjugend aussah, so spukte doch in den pomadisierten, zopfbehafteten Köpfen allerhand Bubenmutwillen. In der Residenz war auch ein Theater und da hineinzugehen eine Hauptfreude. Aber woher das Geld nehmen und doch nicht stehlen? Da gab's nur ein Mittel, das war: selbst mitspielen. Freilich stand keiner von den Buben auf dem Theaterzettel, sondern sie kamen unter die Rubrik: »Volk etc.« Unter anderem war ein beliebtes Stück: »Die Donauweibchen,« in welchem tanzende Säcke vorkommen. Schnell waren die Hunsrücker Jungen bei der Hand, einen solchen mit Empfindung zu spielen. Also hinein in den Sack und dafür das nächstemal ein Freiplatz auf dem »Juchhe« im Theater. Aber der verschmitzte Sack war nicht festgenäht und platzte mitten in der Vorstellung beim Tanzen. Der Onkel, der Bruder des Vaters purzelte aus dem betreffenden Sacke heraus vor die zuschauende Menge, die ihn sofort erkannte und aus einem Munde erstaunt rief: »Das ist ja Frommels Edeward!« Das gab zu Hause eine Scene und die Bretter wurden für lange Zeit verboten. – Aber das Theaterspielen war doch zu verlockend. Schillers »Räuber« waren dazumal ein höchst beliebtes Stück, und vornehmlich das Räuberleben ein Ideal der Schulbuben. Mit »hoher obrigkeitlicher Bewilligung« wurden denn auch auf einem Liebhabertheater in der damaligen »Affengasse« von Schülern die Räuber aufgeführt. Die Hauptschwierigkeit bestand allerdings darin, die einzige weibliche Person, die in dem Stücke spielt, zu engagieren, sich unter die Räuber zu wagen. Endlich unter vielen Versprechungen verstand sich auch die Cousine eines Räubers dazu, die Rolle der »Amalia« zu übernehmen. Die Zettel wurden ausgegeben, ein mäßiges Eintrittsgeld festgesetzt, das Haus war ausverkauft und die Vorstellung begann. Im dritten Akte aber wäre fast gar das Stück zu Falle gekommen. Als die Räuber ihren großen Gewinn überschlugen, wollten sie sich dafür Würste und Schinken und Bier als »räuberwürdiges« Mahl kaufen, Amalia aber wollte für sich Torten und Eingemachtes haben, und als die Jungen das nicht wollten, lief sie hinüber auf den Hof und setzte sich auf eine Holzbeuge, weinte und sagte: »Ich spiel nimmer mit.« Es bedurfte des ganzen Aufwands der Beredsamkeit Karl Moors (meines Onkels), um sie zu bewegen wieder zu kommen; sie sollte »ihr Sach' apart haben.« Das Stück ging dann zu Ende. – Aber das Ende war noch nicht da. Bei der großen Mehrzahl hatten die Räuber festen Fuß gefaßt. Die Flinten und Säbel, die Schlapphüte waren ja schon vorhanden, Geld auch, das Räuberlied einstudiert – was fehlte da noch? Nichts, als daß man die wohlgelungene Sache auch einmal im Ernst ausführte. Etwa fünf Stunden von Karlsruhe lag die alte verfallene Burg Ebersteinburg, damals im dichtesten Wald liegend, ein herrlicher Schlupfwinkel für Räuber. – Die Kleider wurden in ein einsames Wirtshaus vor dem Stadtthor gebracht; damit der Thorwart nichts merke, zog man zu verschiedenen Stadtthoren einzeln hinaus und sammelte sich in jenem Wirtshause. Dort wurden die Kleider angezogen, in der Nachtstille durch die Ortschaften marschiert und in der Mitternacht langte die Bande oben auf Ebersteinburg an. Am frühen Morgen, nach den Schauern in dem alten Verließ, wurde die Burg in Verteidigungszustand gesetzt, der Eingang mit großen Steinen verrammelt und Wachen ausgestellt. Dann wurde ein Feuer angezündet, Eier gesotten und Kaffee gekocht und die Würste von der Vorstellung her vollends verzehrt. Am folgenden Tage wurde ein nächtlicher Ausfall auf das Dorf Ebersteinburg beschlossen, um dort einiger Gänse habhaft zu werden und diese dann kunstgerecht zu braten. Der Überfall wurde mit großer Schlauheit ausgeführt und gelang. Droben auf der Burg wirbelte der Rauch über der ermordeten Gans in die Luft und die Bauern wurden aufmerksam. Die beraubte Bäuerin erhob ein Wehegeschrei bei dem Vogt. Einer von den Bauern wollte sich hinauf zur Burg machen, wurde aber von der Wache mit einem blinden Schuß empfangen. Die Räuber stürzten gleich alle hervor und im Todesschrecken lief der Mann zum Vogt und schrie: »Es sind Räuber da oben, wahrhaftige Mordbrenner!" Der Vogt ließ Sturm läuten und holte den Gensdarmen, der bereits von der Residenz aus avisiert war, »ob man keine Buben gefunden hätte.« Langsam zog die Schar mit Dreschflegeln und Mistgabeln und alten Nachtwächterspießen unter Anführung des Gensdarmen hinauf zur Burg. Den »Räubern,« die vom Wartturm aus zusahen, wurde doch bänglich zu Mute. Nach kurzem Kriegsrate beschloß man, sich aus dem Staube zu machen. Aber der kriegskundige Gensdarm hatte wie ein kluger General den Bergkegel umstellen lassen, damit ihm keiner der Vögel entwische. So fielen denn die meisten den Bauern in die Hände, ihrer Sechse aber, und darunter mein Onkel, entwischten, indem sie von den hohen Tannen hinabkletterten und unten übel zerschunden ankamen. Dann liefen sie Karlsruhe zu. Kurz vor dem Thore trafen sie mit den andern Malefikanten zusammen, die per Schub gefahren wurden und ihnen zuriefen: »Mir hen doch noch fahren dürfen!« – Was es daheim absetzte, kann sich der geneigte Leser selber denken, nebst der Standrede in der Schule. Einer aber kam am schlechtesten dabei weg, der doch gar nicht dabei gewesen: das war der Dichter Friedrich von Schiller, der den jungen Leuten die Köpfe verrückt gemacht haben sollte. Mein Vater ist nicht mit dabei gewesen wegen eines kranken Fußes, und segnete sich, daß er am Fuße gepackt worden war. Von diesen Geschichten war uns die ganze Umgegend, in der wir wohnten, wie von einem lebendigen Sagenkreise umhüllt. Freilich fand sich vieles nicht mehr vor zu unserer Zeit, was damals noch existierte. Daß auf dem Marktplatz, wo jetzt die geheimnisvolle Pyramide steht, und drin das Herz des Erbauers der Stadt, um die nur trotz des Verbots so oft nach der Schule »Fangerles« spielten, die Stadtkirche stand und ein großer Kirchhof war, wollte uns nicht in den Sinn, noch daß der Wald ganze heutige Straßen einst bedeckte.
Dort am Spitalplatze wohnte der ehrwürdige Meister Haldenwang, der berühmte Kupferstecher und Lehrer des Vaters, und hinten dran lag der Zimmerplatz des Ratszimmermeisters, Herrn Küntzle, auf dem der Vater oft gespielt; in der nächsten Straße das Haus der einen Großmutter. Denn was nicht jedem passiert: ich hatte ihrer drei – während sonst jeder andere deutsche Mensch nur zwei hat. Wie das kam, erfährt der Leser im nächsten Kapitel. Nur so viel will ich noch sagen zu diesem ersten: als ich nach dreißig Jahren in meiner Vaterstadt angestellt wurde und die Stadt in besondere kirchliche Distrikte eingeteilt wurde, da fiel mir, als dem Jüngsten, dieses Stück Jugendland zu: »das Dörfle«, und es gereichte mir zur absonderlichen Freude und ist's bis zum heutigen Tage noch, daß ich einen Teil der Liebesschuld meiner lieben Vaterstadt abtragen konnte und der »Dörflespfarrer« geheißen wurde.
Zweites Kapitel
Etliches vom Großvater und Großmüttern, Paten und andern
Der hundertundsiebenundzwanzigste Psalm, in welchem geschrieben steht: »Wo der Herr das Haus nicht bauet, arbeiten umsonst, die daran bauen,« gilt nicht sowohl dem Hause, das der Zimmermann mitsamt dem Maurer baut, als vielmehr dem, das aus lebendigen Bausteinen, alten und jungen, aus Großvätern, Vätern und Enkeln besteht (wiewohl es allwege eine gute Sitte bei den Zimmerleuten ist, den Hut zu lüften und den großen Baumeister der Welt zu bitten, beim Aufschlagen des Hauses gegenwärtig zu sein). In das Haus der Familie wächst aber das Kind hinein und weiß nicht wie, aber gut ist's, wenn es hinterher sich drum kümmert und von der Familie zu sagen weiß.
Zu Frankfurt am Main residierte noch zu Anfang dieses Jahrhunderts eine Großtante des Vaters, die sich dorthin verheiratet hatte. Als sie deshalb aus dem Badischen verzog, stellten ihr des »durchlauchtigsten Herrn Markgrafen zu Baden und Hochberg, hochfürstlichen Oberamts Durlach gnädigst verordnete Oberbeamte« auf kunstvoll geschriebenem Pergament den Geleit- und Empfehlungsbrief aus, »dem hochwohlweisen, hochedelgeboren, »hochstrengen Rat der freien Stadt Frankfurt kund zu »wissen gethan, daß die Juliane Margarete Frommel »ein rechtmäßig Kind sei. und in heiliger Taufe der »lutherischen Kirche einverleibt, mithin von uns allen »als ein wahres, rechtes Ehekind gehalten worden ist »und noch jetzt gehalten wird. Sie ist auch weder diesseitiger »höchster Landesherrschaft noch sonsten jemand »mit einiger Leibeigenschaft anverwandt und zugethan, »sondern derselben vollkommen frei, los und ledig, daß »sie also Bürgerrecht suchen und annehmen kann, wenn »und wo ihr gefällig. Was übrigens ihre Aufführung »betrifft, so ist uns davon nichts Widriges, sondern »alles Gutes bekannt, daher wir auch dieselbe der hoch»löblichen p.p. Obrigkeit zu Frankfurt am Main zu »geneigtester Aufnahme bestens rekommandieren.« So war sie ausgewandert mit ihrem Manne, dem Herrn Cornelius Pilgram, und hatte ihre Hochzeitreise in Begleitung des Friseurs Mack gemacht, der von Frankfurt entgegengereiset kam, um das Landmädchen mit reglementsmäßigen Toupées zu versehen, damit sie würdig in Frankfurt einziehe in das Haus »zum trierischen Eck.« Herr Pilgram aber trug »bei solcher Gelegenheit einen himmelblauen Frack, knappe Beinkleider und seidene Strümpfe,« laut der Hochzeitschronik.
Diese besagte Großtante Pilgram war das Familienorakel in Betreff der Verwandtschaft. Wehe, wenn einer der Familie unter dem Heer von Onkeln, Tanten und Vettern sich nicht zurecht zu finden wußte! Das war zehnmal schlimmer, als wenn ein Büblein in der Schule aus Angst die deutschen Kaiser unter einander schmeißt. Der Vater hatte einst bei einem Besuche in Frankfurt von der Tante eine saftige Ohrfeige empfangen, weil er im Familien-Stammbaum nicht Bescheid wußte, er warnte im Andenken daran vor Schaden und weihte uns möglichst in die Stammtafel der Familie ein. Mit Ehrfurcht sahen wir daher in Durlach an dem Marktplatze an dem Markgrafen mit der roten Tasche hinauf, (der weiland dort auf dem Brunnen stand und leider vor etlichen Jahren auswandern mußte) – denn mit diesem Markgrafen sollte auch unser Familienbaum und erste sichere Kunde über das Haupt der Familie beginnen. Über den hinaus aber ging eine dunkle, graue Sage. Die einen behaupteten: aus Italien sei der erste des Namens gekommen, natürlich ein tapferer Ritter und Edelmann; die andern aber, aus Schweden sei er her. Bis zum heutigen Tage ist der Streit noch nicht geschlichtet. Fußend aber auf einer dunkeln Mär, daß früher auf den Kornsäcken der Söllinger Urväter des Geschlechts sich der Name »Frommheld« befunden, wurde das Wappen acceptiert: Kreuz und Schwert, im blauen und roten Felde. Tante Pilgram aber wußte das alles genau und hielt darauf, daß andere es auch wußten und jeder den gehörigen Respekt vor der Familie habe. Das kommt einem nun heutzutag freilich ziemlich altmodisch vor, wo man kaum noch das Geschwisterkind als »Verwandtes« gelten läßt und man durch das leidige Herumwandern in der Welt einander kaum mehr kennt, so daß es leicht passieren kann, daß sich zwei Vettern im Eisenbahncoupé die schönsten Grobheiten sagen, und schließlich mit »einiger Befriedigung« merken, daß sie denselben Großvater hatten, der sich gewiß wenig über die Enkel gefreut hätte. Damals spannte man aber den Zirkel weiter und hieß in den Familienkreis noch viele kommen, wenn sie auch kaum mehr einen Tropfen Familienblut in sich hatten. Waren sie auch Nach-Nach-Nachgeschwisterkind und angeheiratet dazu, so hießen sie doch immer noch »Herr Vetter« oder »Jungfer Nase,« und man »vetterte und baste« sich leichter durch die Welt, als wenn man heutigen Tages so wildfremd an die Häuser klopft. Dem heurigen Geschlecht thut aber ein wenig mehr Familienachtung und Liebe not, wenn es nicht ganz zerfahren soll. 'S ist eben doch was andres, wenn man weiß, auf welchem Ast des Familienbaumes man als Blättlein festsitzt, als wenn man so geschichtelos vom Winde verweht wird.
Darum horchten mir auch hoch auf, wenn der Vater von dem alten, ehrwürdigen »Schulz« von Söllingen sprach, von welchem ich in einer badischen Chronik vor kurzem zu meiner Freude unter dem Titel:
»Von einigen besonders verdienten Einheimischen und wenigen Fremden bezüglich auf die Zeit Karl Friedrichs,« folgendes fand: »Frommel, Schultheiß zu »Söllingen, ein denkender Kopf, nicht nur mit ausgezeichneter Anwendung seiner praktischen Kenntnisse in »der Landwirtschaft, sondern auch mit Sinn für alle »bürgerliche Ordnung. Der Markgraf ehrte ihn mit »öftern Unterhaltungen. Frommel war voll Anhänglichkeit »zu seinen Fürsten, hielt übrigens fest an seiner »einfachen Lebensweise des Landmanns. Starb in den »1750 er Jahren« – das war aber der Vater der gefürchteten Tante Pilgram zu Frankfurt und der Urgroßvater meines Vaters.
Alle Jahre wurde drum eine Fahrt nach Söllingen gemacht zum alten Stammhause, das ich noch lebendig vor mir sehe, mit seinem breiten, handfesten Hofthor, dem weiten Hof und den großen Scheunen. Wohl war's schon in fremdem Besitz, aber die Namenszüge der Familie, die einst drin gewohnt, standen noch über dem Thor.
Einen richtigen Buben interessiert freilich die lebendige Gegenwart mehr als die Vergangenheit, und erst später konnte ich mich freuen, von den Alten zu hören. Zunächst aber ragte die Gestalt des Großvaters ehrwürdig und mild herein ins junge Leben.
'S ist ein wunderbar Ding um solch einen Großvater und seinen Enkel. Sie haben beide einen eigenen Zug zu einander. Das Kind fühlt sich da so sicher und gut aufgehaben, nicht so rasch und derb angefaßt und aus seinem Spiel gerissen, wie manchmal der Herr Vater thut, der eben von der Arbeit kommt und nun auch »seine Freude« an dem Buben haben will. Bei beiden liegt die Röte über dem Lebenshimmel, bei dem Großvater die Abendröte und beim Enkel die Morgenröte. Beide haben einander nichts vorzuwerfen. Hat der Großvater seine Haare verloren, so hat sie der Enkel noch nicht bekommen und die zwei Kahlköpfe schauen einander vertraulich an; fehlt dem Großvater so mancher liebe Zahn – so weist der Enkel das zahnlose Mündchen. Der eine hat Schmerzen beim Kommen, der andere beim Gehen der weißen Müller. Der eine hat nicht weit vom Himmel, denn in des Enkels Auge glänzt so was von oben her, und der Großvater nicht weit zum Himmel, und solch ein Auge leuchtet auch – kurz die vier Augen schauen sich verständnisvoll an, und wenn der Großvater den Enkel auf dem Schoße hat, und dieser mit seinen Ärmchen hinaufgreift, ist's nicht anders, als wenn der junge, grüne Epheu sich um einen alten Stamm oder Gemäuer schlingt, und als wollten die beiden sagen:
Mein Herz und auch das deine Verstehen sich gar gut!
Oder hat der Großvater oder die Großmutter nicht so ein verborgenes Schublädlein im Schreibtisch, wo »Gutzele« drin sind? Und haben sie nicht ein blankes Gröschlein oder Kreuzerlein, das ihnen in den Weg kam, arretiert und aufgehoben, dem Enkel bei einer feierlichen Gelegenheit zu überreichen? Zumeist giebt's auch dort keine Schläge und keine Rüben noch Bohnen zu Mittag und das Kind braucht nicht zu singen, wie wir so manchmal zu Hause:
Rüben, Rüben, Rüben! Die haben mich vertrieben; Hätt' meine Mutter Fleisch gekocht, War' ich länger blieben! Bohnen, Bohnen, Bohnen Sind meines Herzens Kronen!
So ist denn das Großelternhaus allewege ein vom Kinde gesegnetes. –
Der Großvater väterlicherseits, meines Vaters Vater, steht mir noch lebendig vor der Seele. Sein Zimmer lag nach dem Garten hinaus, freundlich und heiter wie er selbst. Der Großvater war von imposanter Figur; das volle silberweiße Haar deckte den männlich schönen Kopf des hohen Siebzigers; unter den dichten Augenbraunen schauten zwei kluge, sinnende Augen voll Milde und Freundlichkeit hervor; um den Mund spielte ein schalkhafter Humor, mit größtem Wohlwollen gepaart. Ich sah ihn nie anders, als im langen Rocke und weißer hoher Halsbinde und stehender Weste, die lange Pfeife rauchend. Auf seinem Schreibtisch stand das für mich so geheimnisvolle Ding, eine Zündmaschine. Nicht oft genug konnte er mir das Experiment machen, daß der Platinaschwamm glühte und der Fidibus brannte, nachdem der kleine Knall vor sich gegangen. Auf dem Ofen stand die Kaffeemaschine; den ganzen Tag rauchte er und trank langsam den selbstbereiteten Kaffee. Wie oft mußte später, als die Mutter behauptete, das Rauchen verkürze die Lebenszeit, als Beweismittel dienen, daß man beim Rauchen siebenundsiebzig Jahre alt werden könne, wie der Großvater selig! Der Mutter fiel freilich nicht jener durchschlagende Beweis einer Tante ein, die ihrem Neffen auch das Schädliche des Rauchens vorhielt, indem es das Leben verkürze. »Aber,« sagte der Neffe, »der Großonkel raucht doch auch immer noch und ist schon achtzig Jahre alt.« »Ach,« entgegnete die Tante, »dummes Zeug! der wäre schon neunzig, wenn er nicht rauchen thäte!« Womit also das Rauchen, als ein abscheuliches Laster, gebrandmarkt sein soll. Aber das Schnupfen ist noch viel abscheulicher, meint der Verfasser, der leider an dem ersten leidet.
Der Großvater hatte ein Angesicht wie eine schöne Abendlandschaft, die im Sonnenstrahl nach einem Gewitter vor einem liegt. Denn gewettert hatte es ja freilich in diesem Leben, und über der schönen Stirne hin lagen noch so ein paar Wölklein stille gelagert. – Droben im Oberlande geboren, ein munterer Pfarrersbub, wanderte er ins Gymnasium zu Lörrach. Da geschah's in seinem vierzehnten Jahre, daß der Markgraf Karl Friedrich, der seinen zwei Augen und Ohren mehr traute als denen andrer Leute, selbst das Gymnasium visitierte und Examen abhielt. War's doch die Jugend, auf die er hoffte, um sein Volk zu einem wahrhaft »christlichen, glücklichen und opulenten« zu machen. Da traf er denn auch den Pfarrersbuben an und fühlte ihm auf den Zahn. Als der klug und geschickt antwortete und in mathematicis und physicis ordentlich Bescheid wußte, notierte sich ihn der selige Markgraf, und bald kam ein Brief aus der geheimen Kanzlei an den Pfarrer zu Bettberg, des Inhalts: Ob er Willens sei, seinen Wilhelm herzugeben, dann wolle der Herr Markgraf ihn nach England senden, damit er dort die Rechenkunst und Sternseherei gründlich lerne. – Der Pfarrer von Bettberg dachte aber: »Das kommt nicht von ungefähr sondern von dem Herrn, der der Menschen Herzen lenkt wie Wasserbäche.« Hatte er doch acht Kinder, die alle etwas werden wollten und dem Vater bis dahin noch die Füße unter den Tisch streckten und alle Mittag nach ihrem Löffel griffen, ohne zu fragen, wie teuer der Malter Weizen und das Pfündlein Butter auf dem Lörracher Markt stehe. – So schrieb er denn einen Dankbrief nach Karlsruhe, und der kaum fünfzehnjährige Knabe ging aufs Schiff nach England und verblieb dort etliche Jahre. Das war aber für sein ganzes Leben von Segen. Er sah, daß die Welt noch größer sei, als die obere Markgrafschaft, und es noch andere Leute in der Welt gebe, als den Herrn Obervogt von Lörrach. Das eben aber wollte der selige Markgraf, der selbst weit gereist war und einen großen, freien Blick hatte für alles Gute, was in andern Ländern sich fand. – Dann war er heimgekommen und sollte auf der Sternwarte in Mannheim nach den Sternen schauen, ob sie alle in der Ordnung seien und keiner die Kreuz und die Quer laufe. Aber das sagte ihm doch auf die Länge nicht zu und sein Sinn stand zur Baumeistern. So ward er denn Baumeister und zog als markgräflicher Beamter hinauf nach Birkenfeld, wo wir ihn im vorigen Kapitel trafen. Nachdem er fast alle Habe im Kriege verloren, kam er wieder ins Land nach Karlsruhe und wurde zuletzt Oberbaurat. Dort verlor er seine Frau, die mit ihm treulich alle Not geteilt. In der Blockade von Straßburg stürzte sein jüngster Sohn mit dem Pferde und sank nach langen Leiden im blühenden Alter ins Grab, nachdem er ahnungsvoll in einem Gedicht sein eigenes Begräbnis, Wochen zuvor, aufs genaueste beschrieben. Dort in Baden-Baden auf dem Kirchhofe in der Seufzerallee liegt er zu Füßen des schönen Kruzifixes begraben. Dieser Tod war ihm nahe zu Herzen gegangen. In dies Dunkel hinein blickte aber wie ein lichter Sonnenstrahl unser Vater, der im innigsten Freundschaftsverhältnis zu seinem Vater stand. Gegen die Sitte der damaligen Zeit, da man die Eltern aus Ehrfurcht »Sie« nannte, hatten die beiden das trauliche »Du« behalten. Jeden Tag ging Vater zum Großvater, Jahr aus Jahr ein. Der Großvater war des Vaters bester Freund. Wenn ich die beiden sah und später meinen Vater davon reden hörte, war's mein innigster Wunsch, ich möchte doch auch meines Vaters Freund so werden, wie es beim Großvater war. Und es ist gottlob auch so geworden, und die Liebe nimmt dabei nicht ab noch die Ehrerbietung; und wenn man gleich selber alt wird und sein eignes Haus und Kinder hat, so ist's doch was Besonderes von Güte Gottes, solch einen betagten Vater und Mutter noch zu haben, die einen von Jugend auf kennen und daher vieles an den Augen schon abmerken, ohne daß man ein Wörtlein zu ihnen sagt. Aber wenn solch zwei alte, treue Augen, die uns von Jugend an angeschaut und geleitet, brechen, da bricht eben vieles mit und man fühlt dann erst recht, daß man in dieser Welt keine Heimat hat. –
Des Großvaters Lebensabend neigte sich. Noch erinnere ich mich dunkel des Ehrentages, den er als letzten Sonnenblick erlebte, seines fünfzigjährigen Dienstjubiläums. Wir wurden festlich gekleidet und mit Blumensträußen bewaffnet, und kamen des Morgens in der Frühe zur Akademiestraße, wo der Großvater wohnte. Der Großvater sah so feierlich und so friedlich aus und dankte jedem so herzlich für alle Liebe. Den tiefsten Eindruck machte mir aber, daß der selige Großherzog Leopold ihm den Zähringer Löwenorden verliehen, der im roten Kästchen auf dem Tische lag. So wußte ich in der Jugend schon, was das zu bedeuten hatte: »der Zähringer Löwe,« und kam nicht in die Verlegenheit, in die einst eine gute Landsmännin geriet, als ihr Mann freudestrahlend nach Hause kam und rief: »Mutter, ich hab' den Zähringer Löw' bekommen!« »Ach,« sagte sie höchst aufgeregt: »ach Vater, wie