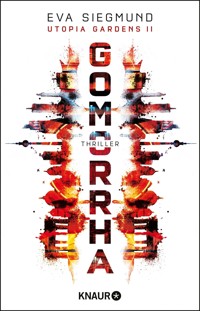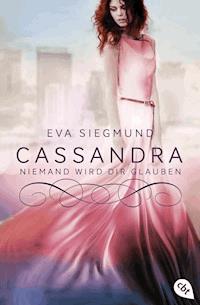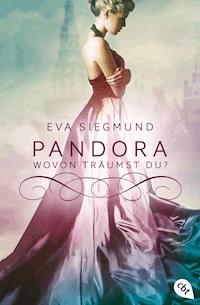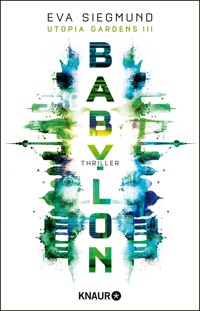
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Hannah Peters
- Sprache: Deutsch
Berlin versinkt in Düsternis: Teil 3 der faszinierenden Near-Future-Thrillerreihe Berlin in einer nahen Zukunft: Seitdem ihr Chef, der Cop Birol, spurlos verschwunden ist, sind die Polizeischülerin Laura und die zum Strafdienst verurteilte Raven auf sich allein gestellt. Auch sie werden verfolgt, dennoch suchen sie nicht nur fieberhaft nach Birol, sondern auch nach dem verschwundenen Milliardärssohn Sky. Während im und um den riesigen Club »Utopia Gardens« immer mehr Menschen sterben, ahnen Raven und Laura nicht, wie mächtig die Leute sind, mit denen sie sich angelegt haben. Das »Babylon Berlin« von morgen - für alle Fans von Veit Etzold und Marc Elsberg »Bedrohlich, abgründig und packend – sowohl der Plot, als auch die Charaktere. Mit "Utopia Gardens" hat Eva Siegmund ein atmosphärisches Thriller-Highlight geschaffen.« Anne Freytag »Babylon« ist der dritte Band der Thriller-Reihe »Utopia Gardens«. Die Techno-Thriller erscheinen in folgender Reihenfolge: - Sodom - Gomorrha - Babylon
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Eva Siegmund
Babylon
Utopia Gardens III
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Berlin in einer nahen Zukunft: Seitdem ihr Chef, der Cop Birol, spurlos verschwunden ist, sind die Polizeischülerin Laura und die zum Strafdienst verurteilte Raven auf sich allein gestellt. Auch sie werden verfolgt, dennoch suchen sie nicht nur fieberhaft nach Birol, sondern auch nach dem verschwundenen Milliardärssohn Sky. Während im und um den riesigen Club »Utopia Gardens« immer mehr Menschen sterben, ahnen Raven und Laura nicht, wie mächtig die Leute sind, mit denen sie sich angelegt haben.
Inhaltsübersicht
Prolog
Sky
Raven
Ronny
Ophelia
Othello
Silbermann
Laura
Birol
Silbermann
Raven
Ophelia
Sky
Raven
Silbermann
Sky
Laura
Mikael
Birol
Silbermann
Ophelia
Raven
Cristobal
Othello
Raven
Eugene
Ronny
Ophelia
Laura
Birol
Sky
Ronny
Laura
Hinnerk
Raven
Birol
Sky
Laura
Ronny
Othello
Raven
Eugene
Laura
Birol
Othello
Laura
Raven
Mikael
Eugene
Ronny
Silbermann
Ophelia
Raven
Othello
Laura
Othello
Raven
Ronny
Laura
Ronny
Othello
Cristobal
Ophelia
Raven
Othello
Laura
Birol
Professor Lorenz
Othello
Laura
Er erwachte mit einem schrecklichen Gefühl. Dieser Gewissheit, dass nichts in Ordnung war und alles durcheinander. Alles einfach nur falsch. Außerdem spürte er instinktiv, dass er sehr lange geschlafen hatte. Länger, als normal war. Vielleicht sogar Tage. Seine Zunge war ein trockener, pelziger Klumpen, der ganze Mund fühlte sich schrecklich an.
Um Birol herum war es stockfinster und roch fremd. Ein bisschen nach feuchter Erde, ein bisschen nach Desinfektionsmitteln und stark nach neuem Auto. Dank seiner Cousins kannte er diesen Geruch ganz genau. Alle kriminellen Celiks investierten ihre Gewinne in PS und hielten Vorträge über die Unvergleichlichkeit des Geruchs eines Autos, das gerade vom Band gerollt war. Lag er etwa in einem Kofferraum? Seine Nackenhaare stellten sich kerzengerade auf, und er bekam eine Gänsehaut. Wo war er? Was war passiert?
Vorsichtig setzte er sich auf und stellte erleichtert fest, dass sein Kopf nirgendwo gegen stieß. Kein Kofferraum also. Birol blinzelte in die Dunkelheit, versuchte, irgendetwas zu finden, woran er sich orientieren konnte, doch da war nichts. Nicht der kleinste Lichtstrahl. Keine grauen Flecken in all dem Schwarz. Die Finsternis war undurchdringlich und überall.
Er saß auf einer Art Bett oder Pritsche und konnte seine Arme und Beine frei bewegen. Die nackten Füße baumelten in der Luft. Warum zur Hölle hatte er keine Schuhe an?
»Hallo?«, fragte Birol mit rauer Stimme, deren Klang beinahe sofort verschluckt wurde. Viel Platz hatte er jedenfalls nicht.
Vorsichtig ließ er sich nach unten gleiten, und schon nach kurzer Zeit fanden seine Füße den Boden. Er fühlte sich weich und glatt an. Seine Hände fanden eine Wand, die ebenso weich und glatt war. Nachgiebig. Abwaschbar. Mit Schaumstoff bespannt und mit festem Gummi überzogen.
Ihm wurde schlecht, und er musste sich setzen.
Der junge Polizist kannte solche Räume aus dem Käfig und aus Erzählungen seines Vaters Can. Sie wurden »Kriseninterventionsräume« genannt, waren aber besser als »Gummizellen« bekannt. Meist wurden sie benutzt, um randalierende, um sich schlagende Betrunkene vor der Befragung auszunüchtern. Was zur Hölle?
Er zermarterte sein Gehirn, konnte sich aber nicht erinnern, wie er hierhergeraten war. War er etwa ausgerastet? Hatte er versucht, sich was anzutun?
Das Letzte, was er wusste, war, dass jemand in seine Zelle gekommen war, aber er hatte keine Ahnung, wie es dann weiterging.
»Hallo??« Er schrie noch einmal, diesmal lauter. Obwohl er genau wusste, dass der dicke Schaumstoff auch den Schall isolierte. Mehr als einmal hatte er Hinnerk Blume, seinen Boss bei der Kriminalpolizei, mit der Gummizelle drohen hören, wenn einer zu viel herumkrakeelte.
Das erklärte jedoch alles noch nicht, warum es so finster war. Was sollte das?
Birol versuchte, nicht die Nerven zu verlieren, logisch zu denken und ganz tief in den Bauch zu atmen.
In seiner Zelle in Moabit hatte er bereits nach wenigen Tagen jeden Winkel, jede Kerbe, jede abgescheuerte Ecke gekannt. Der Tagesablauf war immer gleich gewesen, das Personal hatte kaum gewechselt. Birol hatte sich das erste Mal seit Langem wieder sicher gefühlt. Ruhig. Als hätte alles seine Ordnung und würde nun seinen geregelten Gang gehen.
Was für ein Trugschluss.
Er wusste genau, dass er hier und jetzt nicht in Sicherheit war.
Plötzlich sprang das Licht über ihm an, und er stieß einen Schrei aus, so sehr brannten seine Augen. Er hatte direkt in die hellen Lampen geschaut. Birol prallte zurück und taumelte gegen die Pritsche.
Schwer atmend stützte er sich auf der Liegefläche ab und versuchte, blinzelnd die Augen wieder zu öffnen, doch es machte keinen Unterschied. Die großen, dunklen Punkte, die durch sein Sichtfeld tanzten, machten es ihm unmöglich, klar zu sehen.
»Guten Abend, Herr Celik«, hörte er eine weibliche Stimme sagen. Sie klang kalt und laut und kam von überallher.
Birol erstarrte. Er hatte sie schon einmal gehört, da war er ganz sicher. Es rührte sich etwas in ihm. Weniger als eine Erinnerung, aber definitiv mehr als nichts.
»Wer sind Sie?«, fragte er in keine bestimmte Richtung. »Was wollen Sie von mir?«
»Sie sind nicht derjenige, der hier die Fragen stellt«, entgegnete die Frau schroff. »Wenn Sie noch einmal sprechen, ohne aufgefordert zu werden, dann werden Sie es bitter bereuen.«
Birol schluckte. Seine Nasenflügel bebten, und es kostete ihn enorme Anstrengung, so tief wie möglich zu atmen. Er wollte nicht, dass man seine Angst sah. Und ohnmächtig werden wollte er auch nicht. Allmählich klärte sich seine Sicht, und er konnte den Raum in Augenschein nehmen. Viel gab es hier allerdings nicht zu sehen.
Er stand in einer pechschwarzen, fensterlosen Zelle. Vielleicht zwei mal zwei Meter groß. Es gab eine Pritsche, eine Toilette und ein Waschbecken. Und mehr nicht.
Nicht einmal eine Tür. Er fühlte Panik in sich hochsteigen. Wie zur Hölle sollte er hier wieder herauskommen, wenn es keine gottverdammte Tür gab? Die Frau sprach erneut. »Das sind die Regeln: Sie sprechen nur nach Aufforderung. Sie beantworten jede Frage. Sie lügen mich nicht an. Wenn Sie essen sollen, dann essen Sie. Wenn wir Ihnen Medikamente geben, dann nehmen Sie diese ein. Verstanden?«
Medikamente? War er doch in einer Anstalt gelandet? Aber warum konnte er die Frau dann nicht sehen? Warum gab es keine Tür?
Er nickte.
»Gut. Mich interessiert eigentlich nur eine Sache. Wenn Sie mir hier weiterhelfen können, dann haben Sie vielleicht eine Chance. Wenn nicht …«
Sie ließ den Satz mit voller Absicht in der Luft hängen, das konnte Birol hören. Ihre Stimme war aufgeladen, fast so, als würde sie lächeln. Er hasste es, dass sich jemand an seiner Angst ergötzte, doch es war ihm unmöglich, sie zu verbergen. Seine Stirn klebte, die Augäpfel flitzten hektisch hin und her, und er bekam seinen Atem einfach nicht unter Kontrolle. Birol war fieberhaft auf der Suche nach einem Ausweg, den es nicht gab. Die sich langsam einstellende Gewissheit, ausgeliefert zu sein, brachte ihn fast um den Verstand. Wie konnte es sein, dass er keine Möglichkeit hatte, sich zu wehren?
»Haben Sie verstanden, was ich Ihnen gesagt habe? Antworten Sie.«
»Ja. Ich habe verstanden.«
»Gut. Hören Sie zu, ich habe eigentlich nur eine einzige Frage: Woher hatte Ihr Vater den Prototypen?«
»Was für einen Prototypen?«, entfuhr es Birol unwillkürlich, und er bereute es sofort.
Das Licht ging aus, und die Stimme der Frau erklang erneut.
»Sie sprechen nur nach Aufforderung, Celik. Betrachten Sie das als Warnung.«
Noch bevor Birol einen klaren Gedanken fassen konnte, schoss eiskaltes Wasser von allen Seiten auf ihn zu. Binnen einer Sekunde war er tropfnass. Die Düsen, die es in den Raum drückten, hatten extrem viel Power, er musste sein Gesicht mit den Händen schützen, um überhaupt atmen zu können.
Konnte dieser Raum komplett volllaufen?, fragte er sich panisch. Gab es deshalb keine Tür?
Die Attacke endete so schnell, wie sie gekommen war, und Birol rollte sich triefnass und zitternd im Dunkeln auf seiner Liege zusammen.
»Was für ein Prototyp?«, flüsterte er leise. »Was für ein verdammter Prototyp?«
Sky
Er wurde noch wahnsinnig. Die verrückte alte Schachtel ließ ihn nicht eine Sekunde aus den Augen. Entweder sie textete ihn zu oder er landete ausgeschaltet in einer Schublade. Nie hatte er einen Moment für sich; so hatte er keine Gelegenheit, Raven zu antworten. Die nach ihm rief. Immer und immer wieder. Mal klang sie verzweifelt, mal müde. Doch sie versuchte es immer wieder. Ihre Stimme war das Einzige, das Sky aufrecht hielt. Sie lebte, sie war okay. Und sie hatte versprochen, nach ihm zu suchen. Zum Glück konnte nur er und nicht Ophelia Raven hören. Es war, als wohnte sie in seinem Kopf.
Er hatte versucht, ihr telepathisch eine Nachricht zukommen zu lassen, doch das hatte nicht funktioniert. Sky musste seine Stimme nutzen, um ihr zu antworten. Doch das konnte er nicht riskieren. Raven schwebte auch so schon in höchster Gefahr, er wollte es nicht noch schlimmer machen. Dass er nicht für sie da sein, sie nicht beschützen konnte, war fast das Schlimmste an seiner Situation. Was, wenn ihr etwas zustieß, während er zwischen den Beinen dieser Hexe klemmte?
Sky verfluchte den Tag, an dem er betrunken auf einer Party gedacht hatte, Ophelia Sander in die Damentoilette zu folgen, wäre eine Bombenidee. Seine Jungs hatten ihn angefeuert, und er selbst war auch neugierig auf diese berühmte Frau gewesen. Warum auch nicht? Konnte schließlich nicht schaden. Haha. Idiot.
»Woran denkst du?«, hörte er sie fragen und wollte am liebsten die Augen schließen. Doch er konnte nicht. Es war wie bei einem Autounfall, den man anstarrte, obwohl man wusste, dass es falsch war. Ophelia lag nackt neben ihm auf dem Bett und streichelte das Gehäuse seines digitalen Gefängnisses. Als würde er irgendwas fühlen. In dem Fall musste man allerdings sagen: zum Glück nicht.
Es war nicht so, dass Ophelia hässlich war, im Gegenteil. Sie war groß und schlank, blond gelockt mit geraden Zähnen und einem breiten Mund, der sich für ihn sogar manchmal zu einem wirklich schönen Lächeln verzog. Dank ihres Reichtums war ihr Alter zweitrangig. Sie konnte es sich leisten, faltenfrei herumzulaufen. Objektiv betrachtet, war sie makellos.
Und doch war sie der hässlichste Mensch, der ihm jemals im Leben untergekommen war. Wo andere Leute eine schöne Frau sahen, sah er nur noch eine böse Fratze. Die ihn die ganze Zeit anstarrte. Aus toten, kalten Augen.
»Sky? Liebling?« Sie drehte sich auf den Bauch und klimperte ihn an.
»Ja?« Sky konnte nicht anders. Egal, wie oft er sich vornahm, einfach nicht mehr mit ihr zu sprechen – irgendwann knickte er immer ein. Er war einfach zu einsam, um nicht mit ihr zu reden. Und er hatte zu viel Schiss, dass sie ihm eines Tages einfach nicht mehr antworten würde. Galt das schon als Stockholm-Syndrom?
»Woran denkst du? Du wirkst so abwesend.«
Er seufzte und schaute auf seine Hände. Wie gerne würde er diese Finger jetzt um ihren Hals legen und zudrücken, bis sie Ruhe gab. Amok laufen, die teure Einrichtung zu Kleinholz schlagen. Irgendwas. Stattdessen war er noch hilfloser als ein kleines Baby. Die konnten wenigstens am Daumen lutschen. Es war ein widerliches Gefühl.
»Ich vermisse meinen Körper«, antwortete er wahrheitsgemäß. »Es ist Folter, ohne zu leben.«
Er sah sie an. »Du sagst immer, dass du mich liebst. Aber wenn das wahr ist, warum hast du mir das dann angetan?«
Ophelia setzte sich auf und nahm einen Schluck Rotwein. In letzter Zeit trank sie ziemlich viel und zu beinahe jeder Tageszeit. Sky ermutigte sie, weil er hoffte, dass sie irgendwann einfach umkippen und einschlafen würde. Doch das war noch nie passiert. Sie vertrug mehr als ein Hamburger Hafenarbeiter. Trotzdem war sie erträglicher, wenn sie trank. Dann war sie wenigstens nicht ganz so triebgesteuert.
»Warum ich dir das angetan habe?« Sie sah ihn unter schweren Lidern an. »Weil ich nicht riskieren konnte, dich zu verlieren.«
Und ehrlicher.
»Hast du noch niemals gehört, dass man ziehen lassen muss, was man wirklich liebt?«
Ophelia schnaubte. »Also bitte.«
»Dir ist wirklich nie der Gedanke gekommen, dass unser Zusammensein weniger wertvoll sein könnte, wenn du mich dazu zwingen musst?«, hakte Sky nach.
Ophelia sah ihn aufrichtig überrascht an. Sie schien eine Weile zu überlegen.
»Nein«, antwortete sie schließlich. »Solange ich bekomme, was ich will, ist mir egal, wie es anderen Menschen damit geht.«
Sky zog die Brauen hoch. Das war wahrscheinlich das Aufrichtigste, das er jemals aus ihrem Mund gehört hatte.
»Und das findest du nicht … unmoralisch?«
Ophelia starrte ihn ein paar Sekunden mit weit aufgerissenen Augen an, dann brach sie in schallendes Gelächter aus.
»Du bist wirklich zu süß, mein Schatz«, gurrte sie, und Sky drehte sich der inexistente Magen um.
Ophelia streckte sich wieder auf dem Bett aus und stellte Sky auf ihren Bauch. Er hasste es, wenn sie das tat. Dann musste er zwischen ihren falschen Brüsten hindurchschauen. Wie durch einen Canyon. Wahrscheinlich dachte sie, das wäre anziehend. Sie strich mit ihren Fingern wieder um den Rahmen des Geräts.
»Es war allerdings nie der Plan, dass dein Körper draufgeht, weißt du? Das Verfahren ist noch fehleranfällig, aber wir werden besser. Mit jeder Übertragung, die gelingt, wird das Verfahren sicherer. Du wirst sehen, bald können wir dir einen neuen Körper schenken.« Sie lächelte. »Natürlich müsste er dir ähnlich sehen.« Nachdenklich legte sie einen Finger an die Lippen. »Andererseits haben wir deinen Körper noch in der Kryonik. Vielleicht gibt es in der Zukunft eine Möglichkeit, ihn wiederherzustellen. Es wäre schon schöner, wirklich mit dir zu schlafen. Und ich kann warten.«
Beinahe hätte Sky laut aufgelacht. Seit wann gehörte Geduld zu ihren Stärken? Na ja. Alkohol verstärkte ihren Hang zur Selbstüberschätzung.
Ophelia tippte leicht gegen das Gerät und kicherte, als es umfiel und Sky für einen gnädigen Moment an die Decke starren durfte.
»Natürlich müssten wir Vorkehrungen treffen, damit du mir nicht wegläufst«, hörte sie ihn sagen. »Aber ich sehne mich nach deinen Händen auf meiner Haut. Und in mir …«
Sky unterdrückte ein Würgen. Lieber wäre er tot. Und das war für ihn eine erstaunliche Aussage. Sky von Bülow war ziemlich gern am Leben. Selbst jetzt noch.
Er versuchte einzuordnen, was er gerade gehört hatte. Was gar nicht so einfach war, da alles vollkommen wahnsinnig klang. Trotzdem war er hier. Eingesperrt in ein gottverdammtes Tablet. Und sein Körper lag irgendwo eingefroren rum. Wie ein gottverdammtes Suppenhuhn. Sky traute sich nicht zu fragen, was genau mit seinem Körper passiert war.
»Das heißt, es gibt noch andere?«, fragte er nach einer Weile, da das die Frage war, die ihn neben seinem Schicksal am meisten beschäftigte.
Ophelia nahm ihn wieder auf, stellte ihn auf den Nachttisch und begann, sich anzuziehen. Gut.
»Natürlich gibt es die. Leider mussten wir auf dem Weg ziemlich viele Verluste verzeichnen, aber mittlerweile stehen wir kurz vor der Marktreife.«
Sie lächelte. »Du wirst wie ein Held gefeiert werden, glaub mir. Wenn wir erst veröffentlichen, dass du der Pionier von SanderConnect bist, der mutige Vorreiter auf dem Weg zu ewigem Leben, wirst du noch berühmter sein, als du es je zuvor warst. Natürlich müssten wir vorher noch heiraten, aber das ist sowieso selbstverständlich.« Ihr Grinsen verrutschte in Richtung Wahnsinn. »Sonst glaubt uns ja niemand, dass du dieses Opfer freiwillig gebracht hast.«
Okay, vielleicht verlor er jetzt doch die Nerven. Sky wusste, dass es klüger wäre, den Mund zu halten, doch wenn es eines gab, das seine Lage an Positivem mit sich brachte, dann die Tatsache, dass es kaum noch etwas gab, mit dem man ihn verletzen konnte. Solange Ophelia nichts von Raven wusste, hatte er nichts mehr zu verlieren.
»Ein schöner Plan«, sagte er mit eisiger Stimme.
»Ja, nicht wahr?«
»Er hat nur einen Haken.«
Ophelias sehnige Hände, die er so sehr hasste, knöpften eine schwarze Bluse zu, während sie beinahe gelangweilt fragte: »Der da wäre?«
»Ich liebe dich nicht«, antwortete Sky und sah ihr dabei fest in die Augen.
Ophelia kam ganz nah an ihn heran und beugte sich so tief, dass sie ihm direkt ins Gesicht sehen konnte. Da war keine Wut, keine Verletzung. Nur kalte Berechnung.
»Dann schlage ich vor, dass du es lernst.«
Sie hob die Hand und schaltete The Ark ab.
Raven
Raven hatte keine Ahnung, wo sie anfangen sollten. Was sie als Erstes tun sollten oder welche Möglichkeiten sie überhaupt hatten. Den ganzen Tag hatten sie Pläne geschmiedet und wieder verworfen, alle Informationen, die ihnen vorlagen, zusammengetragen und waren doch kein Stück weitergekommen. Nach allem, was sie wussten, war Sky bei Ophelia Sander, und diese war wiederum vor rund einer Woche aus ihrer Konzernzentrale verschwunden. Das hatte eine kurze Recherche in den internen Firmenforen von SanderSolutions hervorgebracht. Für eine Softwarefirma war es berückend leicht gewesen, an Nutzernamen und Passwort zu kommen. Sie wussten also, bei wem Sky sich befand, aber nicht, wo. Sie rief ständig nach ihm, doch bekam sie keine Antwort. Wenn sie sich in die Verbindung loggte, konnte sie sehen, dass er immer wieder online war. Also lebte er. Damit musste sie sich vorerst zufriedengeben. Sie verfluchte sich dafür, dass sie keinen Versuch unternommen hatte, Sky auf einer Festplatte oder in einer Cloud zu speichern. Wahrscheinlich hätte sie die erforderliche Menge Speicher gar nicht bezahlen können, und es hätte sich auch irgendwie merkwürdig angefühlt, aber … wenigstens wäre er so irgendwie noch in Sicherheit. Dennoch: So viel konnte einer virtuellen Existenz ja nicht passieren.
Ganz im Gegensatz zu Birol. Er war ein Mensch aus Fleisch und Blut, und irgendjemand hatte ihn entführt. Aus dem Gefängnis. Die Berichterstattung hatte über den Tag verteilt immer mehr ans Licht gebracht. So waren auch ein Justizvollzugsbeamter getötet und die Überwachungskameras manipuliert worden. Das alles machte nicht viel Hoffnung. Doch so zerstört und verheult, wie Laura gerade vor ihr saß, war klar, dass Raven nichts anderes übrig blieb, als einen kühlen Kopf und den letzten Rest Hoffnung für sie beide zu bewahren. Ihrer Freundin würde es wohl kaum gelingen.
Raven schob Laura einen Kaffeebecher über den Tisch, den diese anstarrte, als wäre er voll mit grünem Schleim.
»Trink«, befahl Raven. »Wenn wir Birol helfen wollen, brauchen wir deinen Kopf. Funktionsfähig.«
Laura schniefte und griff nach der Tasse. »Gott, Raven, was machen wir denn jetzt?«
Raven zuckte die Schultern. »Was Menschen immer tun, wenn sie etwas verloren haben. Wir machen uns auf die Suche.«
Sie war längst nicht so beherrscht und abgeklärt, wie sie gerade klang. Im Gegenteil. Birols Verschwinden nagte auch an ihr. Sie waren nie wirklich gut miteinander ausgekommen, aber Raven betrachtete ihn als Teil ihres Teams. Er stand in ihrer Ringecke. Und sie in seiner.
Raven zupfte an ihrer Unterlippe.
Laura und sie hatten zwei Probleme. Zwei Menschen, die sie suchen, und zwei Wege, die sie hierfür beschreiten mussten.
Sie selbst musste zu Nina gehen. Es blieb ihr überhaupt nichts anderes übrig. Ihre Freundin hatte Zugang zu Othello Sander, und der wusste vielleicht, wie man an seine Schwester herankam. Zwar war es ein offenes Geheimnis, dass die Geschwister seit Jahren zerstritten waren, doch das musste ja nicht heißen, dass sie einander nicht im Auge behielten. Jede Information über Ophelia, die Nina besorgen konnte, könnte hilfreich sein.
»Pass auf«, sagte sie irgendwann, als sie es nicht mehr aushielt, untätig auf ihrem Stuhl zu sitzen.
»Wir müssen uns aufteilen. Du gehst in den Käfig, um herauszufinden, was über Birols Verschwinden im Intranet steht. Ob geredet wird und was.«
Laura verzog das Gesicht. »Raven, das ist gefährlich. Ich werde gesucht.«
Raven zog die Brauen hoch. »Hast du auch nur ansatzweise eine Ahnung, von wie vielen Leuten ich so gesucht werde? Du musst dich nur in die Uniform werfen und als Martha in den Käfig spazieren. Du hast einen Ausweis, und außerdem ist dabei bisher auch nichts passiert.«
»Aber glaubst du wirklich, dass im Intranet irgendwas steht, das wir noch nicht wissen?«
»Es wäre eine Möglichkeit. Außerdem müsste man vielleicht wissen, woran er neben unseren Fällen zuletzt so gearbeitet hat. Wenn du kannst, lass seinen Laptop mitgehen. Falls er überhaupt noch da ist.«
»Und was machst du?«
»Ich muss ins Gardens. Mit ein paar Leuten reden.«
Laura riss die Augen auf und setzte sich kerzengerade hin. »Das kannst du nicht machen!«
»Warum nicht?«
»Weil ich dich gerade erst in ziemlich ramponiertem Zustand dort abgeholt habe. Jemand hat versucht, dich zu töten, Raven! Du kannst doch nicht einfach dahin zurück!«
»Ich muss aber. Es ist die einzige Möglichkeit, an mehr Informationen zu kommen. Damit kommen wir jedenfalls nicht weiter.« Sie zeigte auf ihr Tablet. »Außerdem ist es nicht das erste Mal, dass jemand versucht hat, mich umzubringen.« Sie lächelte schief. »Ich bin eine Katze. Sieben Leben, Baby.«
Raven fing Lauras Blick auf, der etwas Prüfendes hatte.
»Was ist?«
Laura schüttelte den Kopf. »Ich will dich nicht allein in den Club gehen lassen, Raven. Auch wenn das jetzt dramatisch klingt: Du bist alles, was ich in Berlin noch habe.« Sie lächelte leicht. »Außerdem habe ich mich irgendwie an dich gewöhnt. Ich will nicht, dass dir was passiert.«
Raven wurde bei diesen Worten ganz plötzlich sehr warm. Ihr ganzes Leben lang war sie herumgeschubst worden, Liebe und Glück waren Dinge gewesen, die es für sie schlicht nicht gab. Spencer hatte zwar immer gesagt, dass er sie liebte, doch das hatte ihr nichts bedeutet. Kaum etwas hatte ihr in den letzten Jahren neben ihrer Arbeit viel bedeutet. Ihre Freunde natürlich. Aber das Leben von Nina, Lin und Cristobal war zu hart, um sich Sentimentalitäten zu erlauben. Sie hielten einander den Rücken frei. Aber ihre Geheimnisse teilten sie nicht. Was dazu führte, dass sie einander kaum kannten. Was am Ende des Tages auch besser so war. Sicherer. Geheimnisse machten verwundbar, und deshalb behielt man sie für sich. Es war eines der ungeschriebenen Gesetze des Clubs. Wenn man es brach oder schlicht nicht kannte, dann konnte es einen das Leben kosten.
Deshalb drangen Lauras Worte ja auch so tief in Raven vor. Sie brachten etwas in ihr zum Schwingen und ihren Mund zum Lächeln.
»Ich will auch nicht, dass dir etwas passiert«, erwiderte sie wahrheitsgemäß. »Du nervst zwar ziemlich, aber du bist ’ne badass Braut und …«, Raven zuckte die Schultern. »Du bist in Ordnung.«
Laura schnaubte. »War das jetzt so was wie ein Kompliment?«
»Ich schätze schon. Zu mehr bin ich nicht imstande.« Raven seufzte und nahm einen Schluck Kaffee. »Und was schlägst du jetzt vor? Wenn wir gar nichts tun, weil wir zu viel Angst umeinander haben, dann was? Wir können Sky und Birol schließlich nicht im Stich lassen.«
Lauras schöne braune Augen füllten sich mit Tränen. »Nein. Das können wir nicht.« Sie schniefte, dann lächelte sie wieder. »Dein Sky ist mir ja egal, aber Fenne würde mir den Hals umdrehen, wenn sie wüsste, dass ich ihn hängen lasse. Und Birol …«, sie schluckte. »Ich liebe Birol.«
»Was ich nicht verstehen muss«, sagte Raven und hob die Hände.
»Sagt die Frau, die in ein Tablet verliebt ist.«
»Sky ist kein Tablet. Er ist eine Persönlichkeit. Das Tablet ist nur sein … Medium.« Sie stutzte. »Außerdem bin ich nicht in ihn verliebt.«
»Du bist eine lausige Lügnerin«, sagte Laura, »das bist du.«
»Hey!«, empörte sich Raven halbherzig, während sie versuchte, für sich einzuordnen, ob an Lauras Einschätzung etwas dran war. Konnte sie überhaupt in eine virtuelle Präsenz verliebt sein?
Laura atmete tief durch und setzte sich gerade hin. Der Kaffee hatte offenbar ein wenig geholfen.
»Okay«, sagte sie. »Uns bleibt nichts anderes übrig, als aktiv zu werden. Aber wir können nicht einfach so drauflosrennen. Wir müssen uns vorbereiten. Professionell da rangehen.«
»Und an welche Art der Vorbereitung hattest du gedacht?«, fragte Raven skeptisch.
Laura zupfte nachdenklich an ihrer Unterlippe, während sie Raven betrachtete. »Hast du schon mal versucht, deine Haare zu färben?«
Raven fühlte, wie ihr Gesicht heiß wurde. Sie sprach einfach nicht gern über ihre Haare. Oder ihre Haut.
»Natürlich hab ich das«, gab sie patzig zurück. »Was denkst du denn? Dass ich freiwillig so aussehe?«
»Okay, okay. Entschuldige.«
»Nein.« Raven seufzte. »Ich entschuldige mich. Du kannst es ja nicht wissen. Meine Haare nehmen keine Pigmente auf. Das kann man vergessen. Sie sind auch nicht weiß, sondern eher durchsichtig, und wirken nur in der Masse weiß. Wie ein Haufen Salz.«
»Dann brauchen wir eben eine gute Perücke.« Laura grinste. »Und ich weiß auch schon, wo wir eine herbekommen.«
»Ach ja?«
»Ja. Sowieso glaube ich, wir sollten Papageno einen Besuch abstatten.«
Raven schnalzte mit der Zunge. Das war also ihr Plan? »Wenn wir zu Papageno gehen, können wir auch gleich nackt in den Club latschen. Das wäre nicht sehr professionell.«
»Hm. Also ich mag ihn«, gab Laura zurück.
»Ich mag ihn auch. Sehr sogar. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich seine Schwächen ignorieren kann. Er liebt es zu zeigen, dass er genau weiß, was im Club abgeht, obwohl er ihn nur selten betritt. Delikate Informationen sind bei ihm schlicht nicht gut aufgehoben. Er kokst auch zu viel, um diskret zu sein.«
Sie überlegte eine Weile, zupfte an ihrer Unterlippe herum und wälzte Ideen hin und her.
»Tu mir einen Gefallen: Wenn es ums Gardens geht, dann lässt du mich denken und sprechen. Du bist eher für die Polizeisachen zuständig.« Raven lächelte. »Von uns beiden bist du das brave Mädchen.«
Lauras Brauen schossen in die Höhe. »Ich habe schon mehr Gesetze gebrochen, als ich zählen kann.«
»Das spielt keine Rolle. Du hast es getan, um jemanden zu rächen, den du liebst. In Film und Literatur ist das nicht umsonst das Heldenmotiv schlechthin. Du bist keine Verbrecherin. Deine Umstände zwingen dich dazu, für ein höheres Ziel zu illegalen Maßnahmen zu greifen. Das ist was völlig anderes.«
»Du hattest auch keine Wahl«, bemerkte Laura leise, und Raven seufzte.
»Das stimmt, aber es ist trotzdem was anderes.«
Raven stand auf und sah Laura auffordernd an.
»Okay. Planänderung. Wir gehen in den Club. Zusammen. Und danach gehen wir zusammen in den Käfig. Deal?«
»Deal.« Lauras Stirn kräuselte sich. »Warum hast du deine Meinung geändert?«
Raven grinste. »Weil ich dich als menschlichen Schutzschild brauche. Na los!«
Ronny
Nichts an dieser Situation war gut. Wenn es um Ophelia ging, hatte er schon vor langer Zeit gelernt, die Zeichen zu deuten. Und gerade, wenn sie äußerlich besonders ruhig wirkte, war sie am gefährlichsten. Schon in dem Moment, in dem er den offenen Wohnbereich der Berliner Villa betreten hatte, wusste Ronny, dass etwas anders war. Die Bedrohung lag in der Luft wie ein nahendes Gewitter. Beinahe konnte er die Funken hören, die von seiner Chefin ausgingen und die Atmosphäre im Raum aufluden. Und er hatte keine Ahnung, warum.
»Ich hätte Silvie und die Mädchen anrufen sollen«, schoss es ihm durch den Kopf, als er bemerkte, dass der kleine, altmodisch wirkende Revolver der Sanderin vor ihr auf dem Küchentresen lag.
Ronny Könighaus fühlte, wie ihm der Schweiß ausbrach. Die Flüssigkeit sammelte sich in seinen Nackenfalten. In dem Moment, in dem die Sanderin ihren Blick hob und ihn damit durchbohrte wie mit einem Eispickel, löste sich ein Tropfen und rann seine Wirbelsäule hinab. Sie brauchte kein einziges Wort zu sagen, um ihm klarzumachen, dass er ein Problem hatte.
Doch er riss sich zusammen. Besser, seine Angst nicht zu zeigen.
»Was gibt’s denn?«, fragte er und zeigte lächelnd auf die Waffe. »Und wozu haben Sie die hier oben? Es ist keine so gute Idee, eine illegale Waffe offen herumliegen zu lassen.«
Gott, was faselte er denn da? Außer Ophelia und ihm selbst hatte niemand Zugang zu diesem verfluchten Haus.
Die Sanderin ging weder auf seinen Gruß noch auf seine Frage ein, sondern hielt ein kleines, braunes Päckchen in die Höhe. »Das hier kam heute Morgen per Kurier.«
»Sie sollen doch niemandem die Tür öffnen«, tadelte er, noch bevor er es sich anders überlegen konnte. Über zehn Jahre in diesem Job hatten ihn zu einer Art Sander-Sicherheitsautomaten verkommen lassen. Mit einem Mal war ihm sein Körper zu groß. Überall Haut und Schweiß und Fett. Er wollte im Erdboden verschwinden. Sich ganz klein machen und durch irgendeine Ritze nach draußen kriechen. Jetzt.
»Halten Sie die Klappe, Könighaus«, fuhr sie ihn an, und er zuckte zusammen. Schweigend sah er zu, wie Ophelia den Deckel der kleinen Pappschachtel anhob, auf der das Logo des Utopia Gardens schimmerte.
Ihm wurde schwarz vor Augen. Ronny ahnte, was sich im Inneren dieser Schachtel befand: sein Todesurteil. Dabei war es vollkommen egal, in welcher Form es daherkam.
Zu seiner Überraschung war es ein Mikrochip.
»Eugene Metzger hat uns ein kleines Präsent zugeschickt. Mit den besten Wünschen. Ist das nicht nett?« Sie zog eine kleine weiße Karte aus dem Karton und klappte sie auf.
»Meine Liebe, wie schön, Sie wieder in der Stadt zu wissen«, las sie vor.
»Das ist wirklich sehr nett«, sagte Ronny, und seine Stimme brach bei dem Wort »nett«.
Er hätte gedacht, dass er Ophelia Sander gut genug kannte, um mit ihr in jeder Situation fertigzuwerden. Doch jetzt hatte er keine Ahnung, was er tun sollte.
»Sind Sie wirklich so einfältig?«, fragte Ophelia scharf, und Ronny zuckte die Schultern. Mehr fiel ihm nicht ein. Etwas tief in ihm drinnen sagte ihm, dass er schon verloren hatte.
Ophelia schob den Mikrochip in den seitlich angebrachten Chipleser ihres Laptops und drehte diesen so, dass Ronny ihn sehen konnte.
Der Bildschirm war kurz schwarz, dann erschien eine spärlich beleuchtete Treppe, die ihm nur allzu bekannt vorkam. Aufzeichnungen einer Überwachungskamera im Utopia Gardens. Unwillkürlich schloss er die Augen.
»Schauen Sie gefälligst hin!«, blaffte Ophelia, und Ronny riss sich zusammen und die Augen auf.
Man sah nicht alles, aber man sah genug. Wie er den Sicherheitsmann über den Haufen schoss und ihn in das Atelier zog. Wie die junge Frau durch die Tür trat. Und wie er kurz darauf mit einem Laptop in der Hand und Knopf im Ohr wieder herauskam.
Ronny schluckte. »Ich verstehe das nicht«, murmelte er, mehr zu sich selbst. »Jeder weiß, dass es im Utopia Gardens keine Videokameras gibt!«
Ophelia schnaubte. »Jetzt machen Sie sich doch nicht lächerlich. Würden Sie auf Videoüberwachung verzichten, wenn Sie die Metzgers wären?« Sie tippte sich an die Schläfe. »Kein Mensch bei Verstand würde das. Und kein Mensch bei Verstand würde so was ernsthaft annehmen – und sich dann auch noch Sicherheitschef schimpfen.«
Er nickte. Natürlich war es naiv von ihm gewesen anzunehmen, der gesamte Club sei tatsächlich kamerafrei. So, wie die Metzgers ihr Regime aufgebaut hatten, ging es ja gar nicht ohne Überwachung. Wie hatte er nur so blöd sein können? Die Sanderin verschränkte die Arme. »Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie Sky nicht, wie Sie behauptet haben, aus einer Asservatenkammer der Polizei, sondern aus dem Utopia Gardens entwendet haben?«
»Ja.« Ronny wollte es nicht, aber er konnte nicht anders und schlug die Augen nieder. Diesen abschätzigen Blick ertrug er einfach nicht. Zu sehr erinnerte er ihn daran, wie seine Lehrer ihn immer angeschaut hatten, wenn er keine Hausaufgaben dabeihatte. Oder der Zuhälter seiner Mutter, wenn er kam, um seinen Anteil zu holen. Mit einer Mischung aus Abscheu und Mitleid. Aber eher die Art Mitleid, die man auch mit einer Kakerlake hatte, auf die man gerade trat.
»Wer hatte das Gerät?«, fragte Ophelia schneidend, und Ronny fällte eine Entscheidung.
»Der Junge, der mich begleitet hat.«
»Aha. Und woher hatte er es?« Ronny zuckte die Schultern. »Ich weiß es nicht. Er war stumm.«
»Stumm?«
Ronny nickte. »Nicht von Natur aus. Ihm war gerade erst der Kehlkopf entfernt worden. Wahrscheinlich eine Strafaktion der Metzgers.«
Ronny konnte sehen, dass Ophelia ihm diese Erklärung abnahm, da sich ihre Stirn minimal glättete.
»Und das Mädchen?«
Er zuckte die Schultern, so unbeteiligt wie möglich. Und dankte sich selbst dafür, dass er noch am Tag zuvor den Laptop des Mädchens in die Spree geworfen hatte.
»Zur falschen Zeit am falschen Ort.«
»Sie ist also tot?«, hakte Ophelia nach, und Ronny nickte. »Es ging leider nicht anders.«
»Was heißt hier leider?« Ophelia begann, vor der Fensterfront auf und ab zu gehen. Wie er das hasste. Dieses Geräusch, das ihre Schuhe auf dem Parkettboden machten. Ihr Gesicht im Profil. Ihr Atem, der schwerer ging, wenn sie sich über etwas aufregte.
Seine Chefin drehte sich abrupt um und richtete die Waffe auf ihn.
»Warten Sie doch. Ich kann alles erklären!«, stammelte er und war sich bewusst darüber, wie dämlich er klingen musste.
»Nicht nötig«, gab Ophelia kühl zurück. »Ich brauche keine Erklärungen, sondern Loyalität. Und Sie, König, sind nicht mehr loyal.«
Ihre Blicke trafen sich, und für einen kurzen Moment hatte Ronny das Gefühl, Ophelia habe Tränen in den Augen. Vielleicht waren es aber auch nur diese komischen Deckenspots, die einem immer ins Gesicht leuchteten, egal, wo man stand.
In dem Moment fühlte Ronny, wie etwas mit der Stärke von zehn Elefanten gegen seine Brust prallte. Kurz darauf hörte er den Schuss.
»Schneller als der Schall«, dachte er, während er zu Boden ging. Dann nichts mehr.
Ophelia
Könighaus fiel zu Boden, und sie selbst stolperte auf ihren hohen Absätzen in Richtung Fensterfront und verlor dabei fast das Gleichgewicht. Den Rückstoß hatte sie definitiv unterschätzt – sie konnte sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal getaumelt war.
Als sie sich wieder gefangen und Atem geschöpft hatte, durchfuhr die Erkenntnis sie wie ein Blitz. Ophelia Sander unterdrückte einen Schrei und presste sich die freie Hand so fest sie konnte auf den Mund. Dabei hatte sie das Gefühl, der Schrei müsste aus allen anderen Körperöffnungen dringen, so stark war das Gefühl, das sie gerade ausfüllte.
Sie hatte es wirklich getan. Sie hatte eigenhändig einen Menschen getötet. Hatte ein Leben genommen, eine Existenz ausgelöscht. Nicht aus Versehen und nicht nur mittelbar. Nein. Bewusst. Sie hatte den Abzug betätigt, und nun lag Könighaus tot auf dem Rücken. Wusste nichts mehr, fühlte nichts mehr, dachte an nichts mehr.
Nun wusste sie, dass sie es tatsächlich fertigbrachte. Sie war in der Lage, es selbst zu tun.
Es war ein gutes Gefühl. Mächtig und unkontrollierbar und … wundervoll! Nichts und niemand war mehr vor ihr sicher. Wer einmal töten konnte, der konnte es auch ein zweites Mal. Sie hörte ein lautes Lachen, das irgendwie durchgeknallt klang, und brauchte eine Weile, um zu begreifen, dass dieses Lachen von ihr selbst ausging. Es blubberte unter der Handfläche aus ihr heraus und füllte die Stille, die dieser Schuss hinterlassen hatte, wie Musik. Nein, es war Musik. Die beste, die sie seit Langem gehört hatte. Und Ophelia war nach Tanzen zumute.
Doch stattdessen hockte sie sich neben ihren toten Sicherheitschef und betrachtete diesen. Zwar hatte sie schon Menschen sterben sehen, aber dieser Moment war etwas Besonderes. Intim.
In Ophelia stiegen Gefühle auf, die fast schon liebevoll waren. Zärtlich und warm und … dankbar. Dieser arme, dumme Tölpel. Dieses große Kind. Warum hatte er nur alles verdorben? Er hätte wissen müssen, was passierte, wenn er sie anlog. Schließlich hatte er sie doch gut gekannt, so gut wie kaum jemand anders. Könighaus hätte wissen müssen, dass sie jemanden, der sie anlog, nicht gebrauchen konnte. Und er wusste zu viel, um ihn einfach zu entlassen. Was hätte sie denn tun sollen? Er hätte ihr dasselbe geraten, wenn es um jemand anderen gegangen wäre. Niemals hätte sie gedacht, dass er so dumm sein könnte. So eine Verschwendung. So eine blöde Situation.
Ehrlich, hätte er nicht auch mal an sie denken können? Wie stand sie denn jetzt da, so ganz ohne ihn? Schließlich brauchte sie ihn noch für all das, was vor ihr lag. Sie war so dicht dran an ihrem großen Ziel. Und jetzt warf sie der Verlust von Könighaus um Längen zurück. Dieser elende Egoist. Er konnte sie doch nicht einfach so zurücklassen. Was sollte sie jetzt bloß ohne ihn anfangen?
Ja. Was?
Ophelia Sander betrachtete sein friedliches Gesicht und kehrte allmählich in die Realität zurück. Die Euphorie ebbte erstaunlich schnell ab und hinterließ ekelhafte Ernüchterung.
Und während die Sekunden verstrichen, kroch ein Gefühl in ihre Kehle, das sie erst nicht zuordnen konnte, weil es ihr absolut unbekannt war. Es war subtiler als die Euphorie und ganz anders als beispielsweise Hass. Ein graues Gefühl, das sie trotzdem nicht ignorieren konnte. Das sich nach oben in ihr Bewusstsein drängte, aufstieg aus einem zähen Sumpf. Und schließlich begriff sie: So fühlte es sich also an, einen Fehler gemacht zu haben. Und was für einen gewaltigen Fehler. Das graue Gefühl in ihrer Kehle war Reue. Schreckliche Reue.
Ophelia hatte nicht weiter als bis zum Schuss gedacht. Nicht mit den Konsequenzen gerechnet, sie nicht einkalkuliert. Keine Alternativen durchdacht. Die Verletzung, die Wut auf Könighaus hatten sie geblendet. Vielleicht auch, weil sie nicht geglaubt hatte, den Mut dafür aufzubringen. Weil sie nicht gedacht hätte, dass sie den Finger tatsächlich krümmen würde. Und jetzt? Stand sie da mit tausend Fragen.
Was sollte sie nur mit der Leiche anfangen? Das war eine dieser Fragen. Und die drängendste in diesem Moment. Schließlich konnte sie ihn nicht einfach hier liegen lassen. Könighaus wog locker über hundert Kilo, sie selbst nur knappe sechzig. In den letzten Jahren hatte er sich immer sehr zuverlässig darum gekümmert, dass Leichen verschwanden und alles wieder in Ordnung kam. Er hatte alles organisiert und keine großen Worte verloren. Ophelia hatte ihrerseits nie gefragt. Wie sollte sie das allein anstellen? Verflucht. Sie hatte sich immer zu sehr auf ihn verlassen. Nur war leider nicht zu erwarten, dass er sich selbst hier wegräumte.
Aber das war nicht das einzige Problem. Nur Könighaus wusste, wo die Autoschlüssel waren. Er hatte die Zugangscodes zu allen Alarmanlagen, Schließanlagen, Kameras. Er. Nicht sie.
Weil sie zu beschäftigt gewesen war, um sich mit solchen Details zu befassen. Weil sie ihm zu sehr vertraut hatte.
Scheiße. Könighaus war der Einzige, der gewusst hatte, wie man die Zellen im Keller öffnete. Wie man sie bediente. Wie Sauerstoff da reinkam und Wasser.
Allmählich fühlte sie Panik in sich aufsteigen. Was zur Hölle hatte sie bloß getan? Wie dumm konnte man sein? Ihr brach der Schweiß aus.
Zitternd griff Ophelia zum Hörer des hausinternen Intercoms und drückte auf die Schaltfläche für das brandneu eingerichtete Labor.
»Ja?«
»Silbermann, kommen Sie sofort zu mir hoch«, schrie sie, und ihre Stimme überschlug sich dabei. »Und bringen Sie Ihre Tasche mit. Wir haben ein Problem.«
»Was für ein Problem?«
Ophelia grub sich die langen Fingernägel in den Unterarm, als sie sagte: »Könighaus ist tot.«
Silbermann zog hörbar Luft durch die Zähne.
»Ich komme sofort. Wie lautet der Code für die Tür?«
Ophelia schloss die Augen. Sie hatte keine verschissene Ahnung, wie der Code für die Tür lautete.
»Kommen Sie durch den Garten«, blaffte sie und legte auf.
Othello
»Scheiße, Scheiße, Scheiße!« Othello versuchte, an irgendeinen Punkt an der Decke zu starren, während Ingrid den Verband um seine linke Hand aufwickelte.
»Warum hast du nicht früher was gesagt?«, schimpfte seine Assistentin und sog kurz darauf scharf Luft ein, als sie die Bisswunde sah, die Nina ihm zugefügt hatte. Sie saßen in Othellos Büro auf dem Fußboden am Fenster, eine der Tageslichtlampen von seinem Schreibtisch zwischen sich. Draußen wurde die Berliner Dämmerung von immer mehr Lichtern bevölkert. Die blaue Stunde war die schönste Zeit des Tages, zumindest für ihn. Alles in allem hätte es wirklich gemütlich sein können. Wenn seine Hand nur nicht so scheiße wehgetan hätte.
»Du hast gesagt, du wurdest von einer Schlange gebissen«, sagte Ingrid mit fassungslos hochgezogenen Brauen. »Was für eine Schlange war das denn? Eine Anakonda?«
»Eine sehr spezielle Schlange«, knurrte Othello ausweichend und dachte schon wieder an Ninas verhunzten Körper. Diese Schuppen hatten ihm das Herz gebrochen. Genau so fühlte er sich. Als wäre die Frau, die er liebte, gestorben. Und ein bisschen war es ja auch so. Er hatte sogar Schwierigkeiten gehabt, einen hochzukriegen, Herrgott. Es beruhigte ihn ein wenig, dass er doch noch steif geworden war. Kurz bevor sie ihn dann durch ihr halbes Zimmer geschleudert hatte. Othellos Rücken schmerzte von dem Aufprall, er hatte ein großes, flächiges Hämatom im Schulterbereich, doch das wurde durch den Schmerz in seiner Hand um ein Vielfaches in den Schatten gestellt. In den letzten Stunden war es immer schlimmer geworden, und so war ihm nichts anderes übrig geblieben, als Ingrid einzuweihen. Wen, wenn nicht sie? Er vertraute sonst niemandem.
Othello versuchte, nicht hinzusehen. Dafür, dass er das größte Unternehmen für Medizintechnik in Deutschland leitete, konnte er mit Wunden nur schlecht umgehen. Schon im Kindesalter hatte er sich geschämt, weil ihm schwindelig wurde, sobald er Blut sah. Die vielen Versuche seines Vaters, ihn in diesem Punkt abzuhärten, hatten es nur schlimmer gemacht. Je tiefer eine Wunde war, desto mulmiger wurde ihm. Am schlimmsten war es, wenn man Muskeln und Fasern sehen konnte. Wenn deutlich wurde, dass der Körper Schichten hatte. Am schlimmsten war das weiße Fett. Dieser gallertartige Beweis für einen Mangel an Disziplin.
Noch so ein Grund, weshalb er dem Fight Floor im Gardens lieber fernblieb und den Kämpfen, die dort stattfanden, so gar nichts abgewinnen konnte. Er mochte es nicht, daran erinnert zu werden, dass Menschen aus Blut, Exkrementen und Fett bestanden. Haut, die erschlaffen, und Sabber, der aus Mundwinkeln rinnen konnte. Typen, die sich vor Angst in ihre engen, glänzenden Nylonhosen pissten. Bah. Ihm wäre lieber, aus etwas anderem gemacht zu sein. Aus Carbon zum Beispiel. Doch er war gebaut wie alle anderen. Aus Blut und Fleisch. Und Eiter. Othello konnte es riechen, und ihm drehte sich der Magen um.
»Wann ist das passiert?«, holte ihn Ingrids strenge Frage wieder in die Realität zurück.
»Vorgestern Abend.«
»Othello!«
»Ingrid, du bist nicht meine Mutter. Ich hatte und habe keine Lust, einem Arzt die genauen Umstände zu erklären, die mir diese Wunde eingebracht haben, und es ist nicht deine Aufgabe, mir die Leviten zu lesen. Hast du das Antibiotikum?«
Ingrid nickte. »Das Schäferlein gibt mir immer, was ich brauche. Überhaupt kein Problem, du hättest nur früher was sagen müssen. Ich schätze zwar, dass du schon längst tot wärst, wenn dieser riesige Biss giftig gewesen wäre, aber entzündet ist das so oder so. Und offensichtlich tut es auch weh. Vielleicht dosiere ich jetzt etwas über, aber du kannst Antibiotika ja gut ab.«
Sie holte eine Spritze und eine kleine Ampulle hervor, zog die Spritze mit dem Antibiotikum auf und rammte ihm die Nadel ohne weitere Ankündigung zwischen den beiden Eintrittswunden ins Fleisch.
»Scheiße«, zischte Othello, während Ingrid ungerührt ein Kühlpad in ein Leinentuch wickelte und sanft auf seinen Handballen legte.
»Wir warten ein bisschen, dann bekommst du noch Schmerzmittel. Und dann säubere ich alles, und es kommt ein frischer Verband drum. Einverstanden?«
»Hm«, machte Othello. Er mochte es nicht, von einer Frau umsorgt zu werden. Dann fühlte er sich immer so schwach und kindlich.
»Und willst du mir vielleicht die genauen Umstände erklären? Immerhin mache ich mir jetzt sowieso die wildesten Gedanken«, sagte sie, während sie sehr selbstverständlich zum hinteren Aktenschrank ging und den japanischen Whisky sowie zwei dickwandige Gläser herausnahm. »Ich bin ganz Ohr. Ist wahrscheinlich eine ziemlich gute Geschichte.«
»Sie ist auf jeden Fall schmerzhaft«, murmelte Othello, und Ingrid lächelte wissend.
»Das sind gute Geschichten doch immer. Wir sollen uns auf dieser Welt schließlich nicht langweilen, oder?«
Sie schenkte ihnen beiden einen großzügigen Schluck ein.
Othello überlegte kurz, ob er protestieren sollte, ließ es dann aber bleiben. Zwar war diese eine Flasche mehr wert als Ingrids neues Cabrio, aber eigentlich war das auch schon egal. Er machte sich nichts aus dem Zeug. Der Spaß an der Sache war sowieso gewesen, diese spezielle Flasche einem chinesischen Geschäftsmann bei einer Auktion vor der Nase wegzuschnappen, für den die Abfüllung die Krönung seiner Sammlung bedeutet hätte.
Er stieß mit seinem Glas sacht gegen Ingrids und seufzte. Othello wusste nicht, ob er das, was ihm mit Nina widerfahren war, überhaupt jemandem erzählen konnte, ohne völlig verrückt zu klingen. Auf der anderen Seite konnte er es auch nicht für sich behalten. Es musste raus aus seinem Kopf, sonst wurde er noch bescheuert. Und er bezahlte Ingrid dafür, dass sie ihn respektierte, also musste er sich keine allzu großen Sorgen machen.
»Ich habe keine Ahnung, ob ich das Ganze erklären kann.«
Ingrid musterte ihn. »Versuch es doch einfach. Ich habe eine Verschwiegenheitsklausel in meinem Vertrag.«
Othello lachte kurz auf. Deswegen mochte er Ingrid so sehr. Sie dachte in vielen Dingen wie er selbst. Manchmal war das regelrecht beängstigend.
Dann nahm er einen Schluck und amüsierte sich kurz mit der Frage, wie viel Geld er gerade mit der Zunge durch seinen Gaumen in Richtung Kehle schob.
»Als ich dir gesagt habe, mich hätte eine Schlange gebissen, habe ich nicht die ganze Wahrheit erzählt, aber auch nicht gelogen.«
Die Brauen seiner Assistentin schossen in die Höhe. »Aha. Jetzt bin ich schon viel schlauer.«
»Ich versuch es ja zu erklären.« Othello seufzte. »Du weißt doch, dass ich manchmal ins Gardens gehe.«
»Jeder geht manchmal ins Gardens«, gab Ingrid zurück und nickte. »Der Unterschied ist nur, dass die meisten Menschen es im Gegensatz zu dir sogar genießen.«
»Früher habe ich es nie genossen. Das stimmt«, gab er zu und lächelte freudlos. »Meine Eltern haben mir nie beigebracht, etwas zu genießen, weißt du. Auch diesen Drink genieße ich nicht. Meine Arbeit genieße ich nicht. Mein Apartment genieße ich nicht. Es ist kein Problem, das ich speziell mit dem Gardens habe, verstehst du?«
Ingrid nickte.
»Ich bin nur hin, um Geschäfte zu machen. Viele Geschäfte kann man leider nur dort abwickeln. Jedes Mal bin ich schnell rein und noch schneller wieder raus. Doch dann habe ich Nina kennengelernt.« Sein Blick zuckte kurz zu Ingrid, die sich vollkommen entspannt auf dem dicken Hochflorteppich rekelte. In ihrem Gesicht las er nur mildes Interesse. »Sie arbeitet dort im Bordell«, schob er deshalb nach.
Ingrid zuckte die Schultern. »Der Name sagt mir nichts.«
Nun war es an Othello, überrascht dreinzuschauen. »Du gehst ins Rouge?«
»Wenn ich Bock auf ’ne schnelle Nummer habe? Natürlich. Immerhin habe ich nicht ständig Lust, jemanden mit nach Hause zu nehmen. Und?«
Er lachte laut auf. »Und? Und diese Nina hat mich in die Hand gebissen.«
Ingrid blickte kurz zu der Hand, auf der immer noch das Kühlpad lag. Er hob es vorsichtig an und zeigte ihr noch einmal die beiden kreisrunden, mittlerweile dunkel verfärbten Punktierungen, die jeweils knapp drei Millimeter Durchmesser hatten.
»Wenn ich jemanden beiße, sieht das aber anders aus«, sagte Ingrid mehr oder weniger unbeeindruckt. »Du bist sicher, dass sie es war und nicht irgendeine echte Schlange aus der Menagerie?«
»Ingrid. Du weißt, dass ich kaum Alkohol trinke und keine Drogen nehme. Ich bin mir sicher. Auch, weil …«
»Weil?«
»Wir haben gestritten. Ich habe sie provoziert und bin handgreiflich geworden. Sie hat sich gewehrt.«
Ingrid legte den Kopf schief und musterte ihn neugierig. »Wieso weiß ich nichts davon, dass es eine Frau in deinem Leben gibt, die dir etwas bedeutet?«
»Du bedeutest mir doch auch was!«, gab Othello ausweichend zurück.
»Danke. Aber den Quatsch kannst du lassen. Zwischen uns wird nie etwas laufen.«
Er lächelte. »Was deiner Mutter das Herz brechen wird, sollte sie es jemals herausfinden.«
»Ganz genau.« Ingrid nahm einen Schluck und musterte ihn wieder so forschend. Wie immer fragte er sich, was seiner Assistentin wohl gerade durch den hübschen skandinavischen Kopf schoss. Sie war sehr schwer zu lesen. »Also? Warum weiß ich nichts davon?«, wiederholte sie schließlich.
Othello zog die Brauen hoch. »Na, weil es mir unangenehm ist. Deshalb. Nina ist … speziell.«
»Okay. Ich versuche jetzt einfach mal, nicht darüber nachzudenken, wie viel du über mein sehr spezielles Sexleben weißt.«
Othello prostete ihr zu. »Schuldig. Aber das ist mein Privileg als dein Boss. Ich darf mehr von dir wissen als du von mir.«
»Hm«, machte Ingrid wenig überzeugt. »Warum habt ihr gestritten?«
»Weil Nina … eine Veränderung hat vornehmen lassen, die man nicht rückgängig machen kann. Und die mir nicht gefällt. Sie hat sich das Genmaterial einer Python injizieren lassen.«
»Aaaaah!«, sagte Ingrid und blickte dabei drein, als hätte ein Physiotherapeut gerade eine schmerzhafte Blockade in ihrem Rücken gelöst. »Jetzt ergibt das alles Sinn.«
»Tut es das?«
»Ja. So erklärt sich der Biss, oder?«
Othello lachte trocken und goss sich großzügig nach. »Also mir erklärt sich dadurch überhaupt nichts. Ich meine: Du hättest sie sehen sollen. Nina ist eine Schlange. Jedenfalls zum Teil. Ihre Haut ist schuppig und schimmernd, ihre Zunge gespalten, und ihre Zähne sehen zwar normal aus, aber offenbar hat sie jetzt deutlich mehr davon als vorher.«
Ingrid runzelte die Stirn. »Ich wusste nicht, dass so was überhaupt geht.«
»Ja, eben!«
»Wieso wissen wir nichts darüber? Wieso weiß die Firma nichts davon?«
Othello schüttelte den Kopf. »Ich hab keine Ahnung. Nina hat erzählt, dass sie auch nicht weiß, wer dahintersteckt. Die Mädchen wurden vom Gardens für eine Testreihe verkauft, und sie ist nicht in der Position, Fragen zu stellen.«
»Oh. Krass. Wie gut, dass ich was Anständiges gelernt habe«, murmelte Ingrid und wirkte nun doch zumindest moderat beeindruckt.
»Mehr kann ich dir auch nicht sagen«, überging er ihren Kommentar. »Aber ich frage mich, ob die Metzgers sich mit diesen Tests nicht verkalkuliert haben.«
»Wieso?«
»Nina ist einen Kopf kleiner als du und wiegt vielleicht fünfundfünfzig Kilo. Als sie mich von sich weggestoßen hat, bin ich durch den halben Raum geflogen und an der gegenüberliegenden Wand gelandet. Wenn alle, die diese Art der Behandlung erhalten, auch solche Kräfte entwickeln, dann gibt es kaum etwas, das sie stoppen könnte.«
Ingrid legte den Kopf schief und lächelte versonnen. »Das …«, sagte sie langsam, »… klingt nach verdammt viel Potenzial.«
»Für mich klingt es nach Ophelia.«
Seine Assistentin machte eine wegwerfende Handbewegung und schnalzte missbilligend mit der Zunge.
»Kannst du auch mal aufhören mit Ophelia? Es gibt schließlich noch andere Menschen auf der Welt.«
»Aber nicht so viele mit dermaßen viel Macht und Geld.«
»Nein.« Ingrid schüttelte den Kopf. »Nicht ihr Stil. Genetische Veränderung von Menschen ist viel zu fantasievoll und hat mit ihrem großen Ziel überhaupt nichts zu tun.«
Othello leerte sein Glas. Mit einem Mal hatte er genug von dieser Konversation.
»Und was ist ihr großes Ziel, deiner bescheidenen Meinung nach?«
Ingrid ließ sich von seinem gereizten Ton nicht aus der Ruhe bringen.
»Das weißt du ganz genau, Othello Mephisto Sander. Du hast schließlich dasselbe.«
Silbermann
Er hatte wieder zu viel getrunken. Ausgerechnet heute, ausgerechnet jetzt. Verflucht. Sein Herz pumpte zu hektisch, und der klebrige Schweiß auf seiner Stirn verriet ihn. Und er stank. Silbermann konnte sich selbst riechen, verflucht. Weil er so schnaubte, hastete er permanent durch seinen eigenen Alkoholdunst.
Wie widerlich er doch geworden war. Wie armselig. Der Umzug nach Berlin hatte ihn und seine Familie kalt erwischt. Nun hagelte es auch zu Hause nichts als Vorwürfe. Doch das interessierte sie ja nicht.
Silbermann hatte gewusst, dass Berlin nur Unglück bringen würde. Gewusst hatte er es. Und er war trotzdem folgsam gekommen. Wie ein Hündchen. Ein Sklave war er; nichts weiter. Von dieser schrecklichen Frau.
Keuchend und vor Anspannung zitternd stieg er den Hügel im Garten in Richtung Terrasse hinauf und versuchte, nicht allzu viel nachzudenken. Es ging eigentlich nie gut aus, wenn er das tat. Wie hatte jemand, der so brillant war wie er, in diese Situation geraten können? Der Arzt fühlte sich wie eine Maus in der Falle. Wie ein Käfer unter der Schuhsohle eines Menschen.
Nicht irgendeines Menschen.
Ophelia stand wie immer mit verschränkten Armen an der Terrassentür und starrte in den Garten hinaus, als wollte sie jeden, der es wagte, sich zu nähern, niederstarren. Doch er bemerkte eine gewisse Fahrigkeit, Unsicherheit und Hektik, die er noch nie an ihr wahrgenommen hatte. Ophelia Sander wirkte – er konnte es nicht besser beschreiben – durcheinander.
Sie öffnete die Tür, noch bevor er die Terrasse erreicht hatte. »Jetzt beeilen Sie sich gefälligst, verdammt noch mal!« Ihre Stimme überschlug sich fast, und Silbermann entging nicht, dass auf dem Küchentresen ein randvolles Glas Rotwein neben einer frisch geöffneten Flasche stand.
Sie also auch. Irgendwie hatte das etwas Tröstliches. Seine Chefin war also doch, tief im Inneren, ein Mensch wie er. Es war eine gewisse Überraschung.
Der Anblick, der sich ihm bot, als er den Küchentresen umrundete, brachte ihn kurzzeitig ebenfalls komplett aus der Fassung. Da lag er tatsächlich. Könighaus. Mausetot. Den Sicherheitschef von SanderSolutions leblos auf dem Boden liegen zu sehen, traf ihn härter, als Silbermann erwartet hatte. Fast fühlte er Tränen in sich aufsteigen. Noch eine Überraschung.
Ronny Könighaus war ein Rüpel gewesen, unhöflich, grobschlächtig und abstoßend. Doch er hatte die Sanderin in Schach gehalten und für ihrer aller Sicherheit gesorgt. Und jetzt lag er tot auf dem Fußboden in seinem eigenen Blut. Ein dunkler Fleck im Schritt zeigte an, dass sich seine Blase entleert hatte. Der gewaltige Körper erinnerte Silbermann an einen mächtigen Baum, der gefällt worden war.
»Was ist passiert?«, fragte er, während er sich neben Könighaus auf den Boden sinken ließ und den Puls fühlte. Der natürlich nicht mehr da war. Wenn Silbermann eines wusste, dann, wie ein toter Mensch aussah.
»Was soll passiert sein?«, fragte Ophelia Sander zurück und nahm einen großen Schluck Wein. »Er wurde erschossen.«
»Von wem?«
»Sind Sie jetzt Arzt oder Polizist?«
»Schon gut.« Silbermann nickte. Er hatte den Wink verstanden und wurde noch eine Spur nervöser, weil ihm sofort aufging, was das hieß.
Er befand sich in brandgefährlicher Gesellschaft. Ophelia hatte Könighaus erschossen. Es konnte gar nicht anders sein. Außer diesen beiden durfte niemand in den Wohnbereich des Hauses.
»Natürlich. Aber ich weiß nicht, was ich hier noch ausrichten soll. Warum haben Sie mich gerufen? Könighaus ist tot.«
»Das sehe ich selbst. Aber das geht nicht. Er kann nicht tot sein – wir brauchen ihn noch.«
Vielleicht hätte sie daran denken sollen, bevor sie ihn über den Haufen geschossen hat, dachte Silbermann bitter, hatte sich aber genug im Griff, es nicht laut auszusprechen. Beinahe hätte er gelacht, so absurd war die Situation. Fehlte nur noch, dass sie mit dem Fuß aufstampfte und »Ich will aber!« schrie.
»Woran denken Sie?«, fragte er mit gespielter Ruhe und fühlte sich auf unangenehme Weise an ein Gespräch erinnert, das er vor ein paar Monaten in einer ganz ähnlichen Situation mit ihr geführt hatte. Das war der Moment, an dem er hätte gehen müssen. Einfach seine Sachen nehmen und gehen. Doch er war immer noch hier.
»Woran soll ich schon denken?! Transferieren Sie ihn!«, rief sie aus und gestikulierte dabei so heftig, dass Wein aus ihrem Glas auf den Boden schwappte. »Holen Sie ihn mir zurück!« Der Wissenschaftler atmete einmal so tief durch, wie er konnte. Okay. Sie war wirklich vollkommen übergeschnappt.
»Das dürfte schwierig werden, die Hirnströme setzen sofort aus und …«
»Das interessiert mich alles nicht. Sie werden von mir nicht fürs Nichtstun bezahlt. Jetzt machen Sie schon!«
Silbermann blickte auf Ronny Könighaus hinab und überlegte einen Moment. Diese Frau war völlig wahnsinnig. Jeder wusste, dass man Tote nicht wiederauferstehen lassen konnte, verdammt. Wenn das ginge, dann müsste er sich nicht jeden Tag mit literweise Wodka betäuben.
Was sie verlangte, war unmöglich.
Oder?
Was nun passierte, war der Grund, warum ihm gelang, was anderen niemals gelingen würde. Ohne sein Zutun ging sein medizinisch geschulter, mit Erfahrung gefütterter visionärer Verstand auf Reisen und gelangte dabei wie von selbst an Orte, an die andere Menschen nicht einmal zu schauen wagten. Diese Art zu denken war sein großes Pfund und würde noch seinen Untergang bedeuten.
Doch egal, wie viel er soff, seinen Geist brachte er nicht zum Schweigen. Ein simples »vielleicht« war für ihn schon immer ein starker Trigger gewesen. So auch jetzt.
Vielleicht war es möglich, das Gehirn des Mannes gezielt unter Strom zu setzen und somit wieder »zum Leben« zu erwecken. Vielleicht könnte er es lange genug versorgen, um die wichtigsten Informationen rüberzukopieren. Vielleicht … Aber ohne Blut aus dem Herzen …
»Wird’s bald!«, schrie Ophelia, und der Arzt zuckte zusammen.
»Ich brauche zwei meiner Leute, die ihn runtertragen. Allein schaffe ich das nicht.«
Die Softwaremagnatin stand eine Weile ganz still da, dann nickte sie.
»Ich ziehe mich zurück. Sagen Sie Ihren Leuten, jemand hätte versucht, in die Villa einzudringen, und Könighaus dabei erschossen. Sagen Sie, ich würde die Polizei rufen.«
»Die Polizei wird nach der Leiche fragen«, wandte Silbermann ein und erntete einen langen Blick von seiner Chefin.
»Sie sollen sagen, dass ich die Polizei rufe. Mehr nicht. Und kümmern Sie sich schon mal um die Stellenanzeige.«
»Stellenanzeige?«
Ophelia zog die Brauen hoch. »Wir brauchen einen neuen Sicherheitschef. Außerdem noch jemanden, der Ronnys andere Aufgaben übernimmt und mir nicht auf die Nerven geht. Solange wir keinen Ersatz haben, müssen Sie sich um meine Belange kümmern.«
Ophelia war schon halb die Treppe hochgegangen, als sie noch einmal innehielt.
»Und rufen Sie seine Witwe an.«
Mit diesen Worten verschwand sie im Obergeschoss und ließ Silbermann vollkommen fassungslos zurück.
»Scheiße, Mann«, flüsterte er mit Blick auf Ronnys Leiche. »Wie konntest du mich nur mit dieser Frau allein lassen?«
Laura
Da war es nun also. Das Gefühl völliger Hilflosigkeit. Machtlosigkeit. Kraftlosigkeit. Das Ende der Fahnenstange.
Seit Fennes Tod war sie immer in Bewegung geblieben, wie ein Kreisel, um nicht umzufallen. Verbissen, wütend, schlaflos. Aber immer handlungsfähig. Zu ermitteln, sich mit allem, was sie hatte, in die Aufklärung des Todes ihrer Freundin zu werfen, hatte ihr Kraft gegeben. Und sie am Laufen gehalten. Es hatte ihrem Leben einen Sinn gegeben.
Doch mit Birol schien auch dieser Sinn verschwunden zu sein. Er hatte ihn mitgenommen. An einen Ort, den sie nicht kannte. Ein Teil von Laura wünschte sich inständig, sie wäre ihm niemals begegnet.
Sie war nach Berlin gekommen, um ihre eigene Agenda zu verfolgen, Fennes Tod aufzuklären und Antworten zu finden. Was sie stattdessen gefunden hatte, war ein neues Meer an Fragen. Sie war in Birols Geschichte mit reingezogen worden und nun auch in Ravens. Wusste mehr, als sie jemals hatte wissen wollen, und hatte doch nur Chaos im Kopf.
Gegen das, was hier gerade geschah, erschien Fennes Schicksal geradezu lächerlich klein. Ihr Tod, so musste Laura sich eingestehen, war in den Hintergrund getreten, wurde verdrängt von der Angst, nun noch die beiden anderen Menschen zu verlieren, die ihr wirklich etwas bedeuteten. Die erste richtige Liebe. Die zweite vertraute Freundin. Der Rucksack, den sie mit sich herumschleppte, wurde schwerer und schwerer und schwerer. Laura hatte das Gefühl, Berlin würde sie in die Knie zwingen.
Die Angst, die sich ihrer bemächtigte, wann immer sie an Birol dachte, vernebelte ihre Sinne. Um Fenne hatte sie wenigstens niemals Angst gehabt. Auf die Normalität ihres Alltags waren sofort Wut und Trauer gefolgt. Nun merkte sie, dass banges Warten, Hoffen und Rätseln noch einmal viel, viel schlimmer waren als die Gewissheit, dass etwas Schreckliches geschehen war.
Die wilden Gedanken trennten sie von der Außenwelt. Alles um sie herum bewegte sich in Zeitlupe.