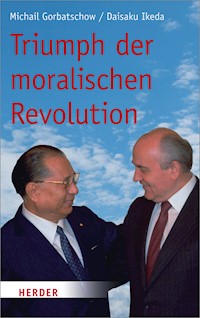19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Daisaku Ikeda hat Tschingis Aitmatow den Partner gefunden, vor dem er Bilanz über Leben und Werk ablegen konnte. Er war sonst eher wortkarg und verschlossen gewesen, wenn er über sich und sein Werk Auskunft geben sollte. Jetzt erzählt er persönlich, offen und leidenschaftlich, denn »das Wort stirbt, wenn wir es nicht mit anderen teilen«. Ein weiter Horizont wird gezogen, bisher unbekannte Lebensabschnitte und Themenbereiche werden erschlossen. Was hier an Gedanken, Erfahrungen, Hoffnungen und Ängsten geäußert wird, verbindet sich bei Aitmatow immer auch mit persönlichen Erinnerungen. Beide Gesprächspartner mahnen und denken über Auswege nach.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 566
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
In Daisaku Ikeda hat Tschingis Aitmatow den Partner gefunden, vor dem er Bilanz über Leben und Werk ablegen konnte. Er war sonst eher wortkarg und verschlossen gewesen, wenn er über sich und sein Werk Auskunft geben sollte. Jetzt erzählt er persönlich, offen und leidenschaftlich, denn »das Wort stirbt, wenn wir es nicht mit anderen teilen«.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Tschingis Aitmatow (1928–2008) erlangte mit der Erzählung Dshamilja Weltruhm. Er besuchte das Maxim-Gorki-Literaturinstitut in Moskau und war Redakteur einer kirgisischen Literaturzeitschrift. Sein Werk fußt auf den Erzähltraditionen Kirgisiens und verarbeitet die Grundfragen der Zeit.
Zur Webseite von Tschingis Aitmatow.
Daisaku Ikeda (1928-2023) war Philosoph, Theologe, Schriftsteller und Stiftungsvorstand der internationalen Vereinigung »Soka Gakkai«, die 1937 zur Erneuerung des Buddhismus gegründet wurde. 1983 wurde er mit dem Friedenspreis der Vereinten Nationen geehrt.
Zur Webseite von Daisaku Ikeda.
Friedrich Hitzer (1935–2007) war freischaffender Autor, Übersetzer und Redakteur und engagierte sich als Kulturvermittler zwischen Europa, Russland und Mittelasien. 2006 wurde er mit der Puschkin-Medaille für sein Lebenswerk als Brückenbauer geehrt.
Zur Webseite von Friedrich Hitzer.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Englische Broschur, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Tschingis Aitmatow, Daisaku Ikeda
Begegnung am Fudschijama
Ein Dialog
Aus dem Russischen von Friedrich Hitzer
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
© by Tschingis Aitmatow und Daisaku Ikeda 1992
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Kateryna Pruchkovska
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30763-6
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 19.10.2024, 17:44h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
BEGEGNUNG AM FUDSCHIJAMA
Dialog an Ikedas Feuerstelle1 — Krieg. Literatur. JugendDer Weg zur LiteraturRückkehr zu geistigem HaltWas wünschen wir der Jugend?Was ist Gerechtigkeit?Was ernährt die Kulturen?Peripherien: Lebensquelle der KulturLesestoff der JugendSoziale Verantwortung der LiteratenDas Erbe mündlichen VolksschaffensLiebe zur Heimat. Hunger nach Frieden2 — Über Literarische WerkeTraditionen und Besonderheiten der russischen LiteraturUnveränderliches und Veränderliches in der ReligionBedeutung und universeller Charakter der MythenTiergestalten in literarischen WerkenTragisches ist eine GabeEine Warnung an die FührerDer verdrängte TodÜber das Schicksal. Die Kraft der SelbsterkenntnisDie Gestalt des Volkes in literarischen WerkenÜber die MutterDer Blick auf die Kinder3 — Der lange Weg zu sich selbstDostojewskis religiöse AnsichtenDie Rationalität des Buddhismus. Dharma – das GesetzDie Wechselbeziehung von Gut und BöseNihilismus und Wiederbelebung der ReligionEntfremdung des MenschenOffensichtliche und verborgene Bedeutung von WörternTraditionsquellen des östlichen DenkensZerstörung der Umwelt und das philosophische Prinzip der Einheit von Subjekt und ObjektDie neun Aspekte der Erkenntnis und die Psychologie des UnterbewusstenDas Drama des Lebens und Lotos-SutraDas Zeitalter der Zweiten Achse4 — Fernes und NahesSoziale Revolution und die Revolution im MenschenWechselbeziehung von Literatur und PolitikGlaube ans Wort – Glaube an den MenschenÜber die Wichtigkeit des DialogsHarmonische Einigkeit des VolkesEugene Carrs Ansichten über die russische Revolution5 — Das neue Denken und die ZukunftDas Atom hat alles verändertDie pazifische Epoche und die Hoffnungen auf JapanVom Wohl eines Landes zum Wohle der MenschheitVon der Zersplitterung zur Harmonie6 — Nach dem August-PutschAm schwierigsten ist der Sieg über sich selbstDer Orden der Weisen sind Hoffnung und FreundschaftEin Gleichnis für Michail GorbatschowMehr über dieses Buch
Über Tschingis Aitmatow
Tschingis Aitmatow: Über mein Leben
Kasat Akmatow: Tschingis Aitmatow bei sich zu Hause
Über Daisaku Ikeda
Über Friedrich Hitzer
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Tschingis Aitmatow
Zum Thema 2. Weltkrieg
Zum Thema Asien
Zum Thema Japan
Zum Thema Religion
Dialog an Ikedas Feuerstelle
Jedes Wort hat sein Zuhause. Jeder Mensch ist Haus und Herr des Wortes. Selbst wenn er sich Gott zuwendet und insgeheim hofft, dessen Stimme zu vernehmen, hört er sich selbst in seinem Wort. Das Wort lebt in uns, entfernt sich und kehrt wieder, es dient uns selbstlos. Von der Wiege bis zum Grab. Es enthält das Weltall des Geistes und gleichermaßen die Gestalt des Universums, das wir uns nach wie vor nur in der Magie des Wortes vorstellen können und damit fast ein fotografisches Abbild unserer Persönlichkeit erhalten.
Von Daisaku Ikeda, dem japanischen Denker, Schriftsteller und Oberhaupt der buddhistischen Gesellschaft Soka Gakkai, trennen mich riesige geografische Weiten, aber wir besitzen ein gemeinsames Gut – unser Wort.
Das Wort verkümmert und stirbt, wenn wir es nicht mit anderen teilen. Aber wie gehen wir damit um, wie finden wir interessierte Gesprächspartner? Nicht alles im Leben ist spannend und unterhaltsam, und nicht jeder Text liest sich mit Faszination. In diesem Sinn gehört das Gespräch zum schwierigsten Genre und erfordert vom Leser Geduld und Einfühlungsvermögen. Deshalb möchte ich gleich zu Beginn erläutern, was dieser Dialog für mich bedeutet.
Der beste Teil dessen, was du im Schweiß deines Angesichts erarbeitest, dient stets als Samen einer neuen Ernte. Für das tägliche Brot wie für das Leben gilt, die Erfahrung der Jahre zu nutzen und das fruchtbare Samenkorn des Wortes zu hinterlassen. Trägt das Wort Früchte, lebt die Nachfolge der Generationen.
Insgeheim habe ich seit Langem auf den glücklichen Zufall eines Gesprächs mit einem Zeitgenossen gewartet, das vieles berühren würde, womit ich im Verlauf meines Lebens zu tun hatte. Es würde Erinnerungen, Analyse und Verkündigung wie in ein Flussbett in sich aufnehmen. Die Empfindung, es müsse einmal früher oder später zu solch einem Zwiegespräch kommen, hat mich nie verlassen. Nun wage ich sogar zu glauben, dass uns beiden das vorherbestimmt war, als seien wir, jeder mit seiner Lebensbürde, schon seit Langem aufeinander zugegangen. Und ich begreife auch, dass die einzigartige Persönlichkeit Daisaku Ikedas in dieser Sache die Hauptrolle spielte. Er zog mich an wie ein Magnet.
In meiner Jugend habe ich mich oft über die alten Kirgisen im Ail gewundert, die sich darüber beklagten, dass sie niemanden hätten, dem sie ihr Herz ausschütten könnten. »Wie das? Mit niemandem reden können?«, fragte ich erstaunt. »Bei all den Leuten ringsum!« Jetzt kann ich sie verstehen – die Sehnsucht nach dem richtigen Gesprächspartner.
Womit ist die Begegnung mit Ikeda zu vergleichen? Ich suche das Bild und weiß, dass nur er imstande war, mir die unfassliche Gesetzmäßigkeit der Vorbestimmung lebensnah und philosophisch zu erschließen und zu erklären. Vielleicht vermittelt das Bild mein inneres Streben nach etwas, das uns Menschen mitunter unbewusst verzehrt. Plötzlich verspüren wir die ungewöhnliche Freude einer Einsicht – wir sehen das Gesicht eines Menschen. Und das Gespräch wird wie von selbst geboren. Von Herz zu Herz. Von Verstand zu Verstand.
So war es. Wie zwei Wanderer, die lange Zeit allein unterwegs sind und sich zufällig begegnen. Sie sind bereits erschöpft, war ihr Lebensweg doch lang, mühsam und voller wundenschlagender Dornen. Der Durst plagt sie. Noch unerträglicher ist der Hunger. Nicht der des Körpers, nein, der hat sich einigermaßen stillen lassen. Ich spreche vom Hunger des Geistes, von den Versuchen, das Dasein zu begreifen. Dieser Hunger gleicht den Qualen des Schaffens. Unwillkürlich denkst du an Saint-Exupéry, der das am eigenen Leib verspürte und dann in die Worte fasste: Man muss erst allein mit der Wüste sein, um zu erkennen, was man tatsächlich wert ist.
Wenn das Schweigen unerträglich wird und die Wüste der Alltäglichkeit den Menschen zu verschlingen droht, dann errettet uns das Leben, das weiser und gnädiger ist als wir, vor der Verzweiflung.
Wir haben uns schließlich getroffen. Unterwegs. Ich war noch ganz in meine Angelegenheiten vertieft, als ich eines Abends einen Menschen, der ruhig neben dem Feuer am Straßenrand saß, erblickte – Daisaku Ikeda.
Wie das Gespäch anfing? Ich erinnere mich nur, wie der Faden des Gedankenaustauschs weitergesponnen wurde, wir hatten ja bereits zuvor miteinander geredet, ohne einander zu kennen, jeder für sich allein. Aber jetzt verflochten sich unsere Gedanken und schlugen unwillkürlich Funken. Wir waren erleichtert, die Welt tat sich für uns auf, wie wir sie entdeckten.
Das Gespräch dauerte bis zum frühen Morgen. Für mich war das die Begegnung an Ikedas Feuerstelle. Es lag noch Glut unter der Asche, nur Worte unterbrachen die Stille am Fuß des Fudschijama.
Wir trafen uns in einer außerordentlich schwierigen Zeit. Das 20. Jahrhundert hat nicht nur ganze Gesellschaften in kontinentalen Erdrutschen verschoben und katastrophale Krisen, Kriege und Revolutionen hervorgebracht, sondern es vollzog einen noch nie da gewesenen Sprung in der Beherrschung der Naturkräfte, sodass das moderne technische Denken zusehends zum neuen Intellekt im postindustriellen Zeitalter wurde. Gleichermaßen berührten sich die Gegensätzlichkeiten, Gut und Böse traten in gewachsenen, massenhaften Dimensionen hervor.
Die globale Informationszivilisation, geschaffen durch eine nicht zu bändigende Entdeckungskraft, verkörpert ebenso die gottgleiche Allmacht des Menschen wie die Apokalypse der Selbstvernichtung, sie gleicht dem Wasser, dessen Druck der letzte Damm kaum noch standhält. Allmacht und Apokalypse liegen in nichts anderem als in uns selbst. Wie auf Waagschalen im Wahnsinnsgetümmel unserer Lebensweise schwanken beide auf und ab. Sind wir uns immer bewusst, dass das Schicksal des Planeten heute das persönliche Los eines jeden Einzelnen von uns und unseren Nachkommen ist? Das ist zwar schwer vorzustellen, aber so und nicht anders verhält es sich. Das Persönliche, Private und das Universelle und Allumfassende berühren sich in unserem täglichen Leben. Wir sind aufgerufen, den Globus als unser Haus zu verstehen. Wollen wir diese riesenhafte Verantwortung auf uns nehmen und als Regel für alle und jeden begreifen? Dass es um die Frage geht, zu leben oder nicht zu leben?
An allem sei ja nur die Zeit schuld. Stimmt denn das? Läuft die Zeit nicht in uns selbst ab? Durch Geist, Verstand und Verhalten? Ist nicht der Mensch der Ursprung der Zeit, auf die er sich als eine von ihm unabhängige Erscheinung beruft? Lebt doch unser Geist im unaufhörlichen Ringen inmitten aller Widersprüche, die eine Antwort verlangen. Für heute und morgen.
Dreht sich nicht das Rad der Ewigkeit, während uns der Augenblick stets als das Wichtigste erscheint? Wie ist das Zeitlose mit dem Vorübergehenden in Einklang zu bringen?
Der epische Blick auf die Welt, der in Jahrhunderten so vieles zum Ausdruck brachte und die traditionellen Kulturen aufblühen ließ, wird bedrängt durch eine avantgardistische Invasion, verblasst und verschwindet. Die Parabel in der Kunst vergeht, und das Absurde treibt Blüten. Wie sollen wir herausfinden, ob das zum Guten gereicht oder zum Bösen? Können sich die Schiffe der Tradition im stürmischen Meer der Massenkultur über Wasser halten?
Über all das wollte ich am Fuß des Fudschijama sprechen.
Und ich will noch etwas sagen. Der Dialog, so meinen manche, müsse unbedingt kontrovers verlaufen und aus Lebenserfahrungen, die einander diametral entgegengesetzt sind, hervorgehen. Ich glaube aber, dass ein Gespräch unter Menschen, die sich auch in Andeutungen verstehen, weitaus fruchtbarer sein kann. Wer den Werten des Friedens und des Lebens zuneigt, kann den Gleichklang der Stimmen erreichen, an dem auch andere Zeitgenossen teilhaben.
Der Dialog ist ein weises Mittel, das uns der Wahrheit näherbringt und verwirft, was persönlichen Ehrgeiz und eigennützige Ziele befriedigt. Leider erleben wir, wie manche Redner, die im Parlament zu Zeiten der Stagnation bescheiden schwiegen oder beifällig zustimmten, nunmehr schrille Töne von sich geben. Die Perestroika brachte Freiheit und beseitigte die Angst vor den bedrohlichen Folgen eines offenen Wortes, doch die Rohheit der Reden steigert sich mitunter bis zu brutalen, persönlichen Verletzungen, und erst noch beklatscht von einem Großteil der Anwesenden. Das weckt wiederum die niedrigsten Instinkte, die allemal die Vorläufer des Bösen in der Gesellschaft sind. Wir wissen schließlich, dass mit der elementaren Verachtung und der Unlust, eine andere Meinung anzuhören, beginnt, was im Terror endet.
Dieser Tragik, darin bin ich mir sicher, wird auch unser Dialog begegnen. Abschließend möchte ich auf die Spannung, ein Wesensmerkmal des Dialogs, verweisen. Sie ergibt sich aus der Wechselwirkung der Partner und dem Streben nach Wahrheit, vor der wir alle gleich und eins sind.
Unser Gespräch ist nicht frei von Unruhe, auch wenn Ikedas Feuerstelle zu Besinnlichkeit einlädt. Aber die Stelle leuchtet von weither und lässt den Wanderer, der sich in der Dunkelheit verirrt und den es nach einem menschlichen Wort dürstet, auf eine gute Nachricht hoffen.
1
Krieg. Literatur. Jugend
Der Weg zur Literatur
Ikeda: Für die Ausbildung des Charakters ist es unerlässlich, die Menschen im jugendlichen Alter, da die Umwelt besonders scharf wahrgenommen wird, an bedeutende literarische Werke heranzuführen. Ich habe große Schriftsteller am konzentriertesten in der Jugend gelesen. Das hat in mir eine besondere Art der Wahrnehmung geweckt, die bei der Lektüre in den folgenden Jahren unerreichbar war. Selbstverständlich bedeutet das nicht, dass ich der Lektüre in reifen Jahren und im Alter ihre Bedeutung abspreche. Der Leseprozess erweitert nicht nur das Wissen, sondern ruft die ungewöhnliche Empfindung der eigenen Erneuerung hervor. Soweit mir bekannt ist, haben Sie an einer landwirtschaftlichen Lehranstalt Viehwirtschaft studiert und sich gleichzeitig für die Literatur interessiert. Ich möchte gerne erfahren, was Sie zur Literatur hingezogen hat, welche Schriftsteller und Werke Sie in Vergangenheit und Gegenwart beeinflussten.
Aitmatow: Mich freut aufrichtig, dass Sie unser Gespräch mit diesem Thema beginnen. Denn wer hat nicht sein Buch der Kindheit, das schon in frühen Jahren Spuren hinterlässt. Denken wir nur an die Welt von Robinson Crusoe. Ich glaube, dass auch für japanische Kinder Bücher wie Robinson Crusoe oder Das Dschungelbuch aufregende Entdeckungen bieten. Ich sehe darin etwas Gesetzmäßiges in der Entwicklung des Menschen, der von Natur aus zum Guten neigt. Deshalb besitzen Romantik, Abenteuer und Didaktik eine so enorme Kraft der Einwirkung, solange die Gemüter noch rein und naiv sind. Wovon ich träumte, als ich diese wunderbaren Bücher las, und wie sich all das mit der Wirklichkeit verband, das allein wäre eine Geschichte für sich. Wie etwa die Bereitschaft, dem Edelmut und den Heldentaten selbstlos nachzueifern, im wirklichen Leben mit Bitternis, Angst, Täuschung und Feindseligkeit konfrontiert wurde und unsere Buchwelten zusammenbrechen ließ. Dennoch wird das Licht dieser ersten Bücher nie ganz erlöschen und ein Leben lang ein Ideal bleiben. Für meinen Teil möchte ich hoffen, dass meine Novellen Frühe Kraniche und Der Junge und das Meer etwas Ähnliches enthalten. Wenn wir im Dschungel der Erwachsenenwelt und der Massenkultur allmählich auf ernsthafte Literatur stoßen und lernen, mit Dialektik, künstlerischer Analyse und Philosophie umzugehen, haben wir, nach meiner Ansicht, den gemeinsamen Weg vor uns, auf dem wir die gesammelte ästhetische und soziale Erfahrung der Literatur und Kunst aller Welt erwerben können.
Im Rückblick dürfte jeder von uns sagen können, am Anfang war wirklich das Wort. Am Ursprung der Ursprünge wie zu Beginn eines jeden Menschen, der auf die Welt kommt. Das Wort in all seiner Vieldeutigkeit, seinen Dimensionen und unter allen möglichen Umständen, in Freud und Leid, aber auch in der kalten Durchdringung des Wesens aller Dinge. Ich bin davon überzeugt, dass Gott im Wort zu suchen ist. Im allumfassenden Wort. Unser ganzes Leben kreist um Gott und die Dimensionen von Gut und Böse. Ohne das Wort kann der Mensch keinen Schritt tun. Das gilt für alle Zeiten. Ich betone das, weil die schnellen Impulse der jugendlichen Jahre gepflegt und gefördert werden müssen, und zwar mit dem Buch und dem Wort. Dem Menschen soll das Licht der Jugend möglichst lange erhalten bleiben. Das Wort müsste der Idee des Guten als dem wichtigsten Lebensziel dienen. Die Behauptung des Guten erfordert immer neue Kräfte, weil das Böse in der Welt seit jeher eine ursprüngliche Überlegenheit besitzt. Das Böse ist stets vitaler als das Gute, aus sich selbst heraus gebiert und vermehrt es sich stets neu, es ist allgegenwärtig. Im Großen wie im Kleinen. Nur das Wort kann ihm widerstehen – das Wort als göttliche Macht. Von Tag zu Tag. Von Jahrhundert zu Jahrhundert.
Der satanische Fluch des Turmbaus zu Babel hat vor allem das Wort getroffen. Die Menschen verlernten, einander zu verstehen. Das Gott-Wort war zersplittert und zersprungen. Wird der Fluch ewig auf uns lasten?
Muss diese Zersplitterung unter den Menschen erst solches Leid hervorrufen, bis sie sich danach sehnen, es wieder als ein Ganzes zu vernehmen? Vielleicht ist das sogar genetisch angelegt: Braucht es die Ängste und Qualen angesichts der Katastrophen und der Drohung, dass die menschliche Spezies überhaupt verschwindet?
Unser Wort, Ikeda-Sensei, ist die Literatur. Wie ist die Welt zu retten? Kann die Literatur den Zusammenbruch abwenden helfen? Und zwar nicht nur das Ende der Geschichte hinauszögern, sondern das bereits denkbare tragische Ende überhaupt ausschließen? Natürlich wäre mehr als naiv, auf die Literatur als das einzige, universale Mittel zu vertrauen. Dagegen ist der Glaube an das neue Wort nicht naiv.
Woher kommt dieses Wort? Können wir darauf hoffen? Ich glaube, es entspringt einem neuen Weltempfinden, was viele noch nicht anerkennen wollen. Tatsächlich ist das gar nicht so neu, wie manche annehmen, in der Literatur hat es das von Anfang an gegeben. Goethes Idee von der Weltliteratur bedeutete, was wir heute die Priorität der allgemeinmenschlichen Werte nennen, für ihn lagen darin Sinn und Aufgabe der Kunst, die alle Menschen brauchen. Ihre Frage hat mich über diese Zusammenhänge intensiver als zuvor nachdenken lassen.
Wie nähern wir uns der Literatur? Wie ist die junge Generation an die Literatur heranzuführen? Um welche Literatur geht es dabei? Ich glaube, von der Antwort auf diese Fragen hängt das Schicksal der Welt in entscheidendem Maß ab.
Vielleicht sollte man ein internationales Institut des Buches schaffen, das sich zur Aufgabe setzt, eine Bibliothek der Weltjugendliteratur zu edieren. Diese Bibliothek sollte jedem Land zur Subskription offen stehen. Im Geist Wilhelm von Humboldts könnten wir als Leitspruch wählen: Denken heißt die Annäherung des Gedankens ans Allgemeinmenschliche.
Ikeda: Es wäre sehr interessant, eine universale Möglichkeit zu finden, die dem Wort in allen Sprachen dient und gleichermaßen von allen Menschen verstanden wird. Die Literatur sollte, wie Sie sagten, vor allem dem Guten und dem besseren Verstehen unter den Menschen dienen. In diesem Sinn habe ich mich für unsere »Literarische Gedenkstätte Victor Hugo« bei Paris eingesetzt, zu deren Eröffnung Sie gekommen sind. Selten sind Werke anzutreffen, in denen die Unterscheidung zwischen Gut und Böse so deutlich markiert ist wie bei Victor Hugo. Dabei geht es überhaupt nicht um simples Moralisieren, etwa nach dem Muster: »Lobet die Tugend und bestrafet das Laster!« Ich habe Victor Hugo schon in meiner Jugend gern gelesen und bin den Verstrickungen seiner Geschichten, aus denen schließlich die Idee des Guten siegreich hervorgeht, voller Spannung gefolgt. Sie haben völlig recht, dass die Kräfte des Bösen überwiegen, wenn wir dagegen nichts unternehmen. Das 20. Jahrhundert demonstriert allenthalben die Gespenster des Bösen, und die Menschheit darf das an der Schwelle zum neuen Jahrhundert nicht ignorieren. Deshalb halte ich Werke wie die von Victor Hugo für so wichtig. Der moderne Mensch, der jeden Traum und jede Romantik verloren hat, mag solche Geschichten für altmodisch halten, ich glaube aber, dass ihr poetischer Geist noch nicht erschöpft ist. Und meine Initiative für die Gedenkstätte auf französischem Boden soll ein Zeichen für die Globalität unserer Aufgaben setzen. Jedenfalls darf die ältere Generation, nur weil sie selbst geistig erlahmt, die Keime der Jugend und die kreativen Kräfte nicht zertreten.
Aitmatow: Lew Tolstoi hat in ziemlich reifem Alter eine Liste von Büchern zusammengestellt, die ihn am stärksten beeindruckten und sein Leben entscheidend beeinflussten, angefangen von Kindheit und Jugend bis zu den folgenden Jahrzehnten (Tolstoi hielt zehn Jahre für Meilensteine seiner Biografie). Die Liste ist erstaunlich. In früher Jugend ließ er sich von philosophischen Arbeiten Rousseaus und Schopenhauers hinreißen, die nach unseren geläufigen Vorstellungen einem Heranwachsenden unzugänglich sind. In den späteren Listen finden wir – Märchen. Zunächst wundert man sich, aber sollten wir nicht aufhören, aus reiner Gewohnheit über Dinge zu staunen, die ganz normal sind?
In allen Listen Tolstois finden wir als die unerlässliche Lektüre das Buch der Bücher – die Bibel.
Ikeda: Junge Menschen sind ja weitaus prinzipieller als Erwachsene an den »ewigen Fragen« interessiert, wie Leben und Tod, Sinn des Lebens. Und sie hoffen aufrichtig auf Antworten. Eine andere Sache ist freilich, ob die moderne Zivilisation sie ihnen bietet. In dieser Hinsicht fühle ich mit Ihrem Sohn Eldar und kann ihn vielleicht besser verstehen als jeder andere. Er ist mit Ihnen als Elfjähriger nach Japan gereist. Sie haben ihn einmal, wie ich erfuhr, sehr traurig und nachdenklich mit einem Buch in der Hand angetroffen und fragten ihn, warum er so verstimmt sei. Und er antwortete: »Papa, da steht, dass die Sonne in anderthalb Milliarden Jahren erlischt und das Leben auf der Erde abstirbt. Was kann man da machen, dass das nicht passiert?« Was der Junge aussprach, war nur scheinbar naiv, tatsächlich bezeugte er damit das erstaunliche Potenzial eines denkenden Wesens im Universum!
Aitmatow: Wenn das stimmt, hat das seinen Ursprung zweifellos im Buch und dem Wissen im Wort. Ich bin sehr gerührt, dass Sie sich an diese kleine Begebenheit erinnern. Aber lassen Sie mich versuchen, Ihre Frage zu beantworten, wie ich zur Literatur gelangt bin.
Tolstoi wurde durch die geistige Atmosphäre, die er einsog – Russland, Europa, die Aufklärung und das Volkstum –, zum Lesen erweckt … Unsere Generation dagegen wurde bestohlen. Die Theorien über die Klassengesellschaft bedeuteten in der Praxis, dass wir nur das lesen sollten, was dem revolutionären Bewusstsein entsprach, anders gesagt: eng gesteckten politischen Zielen. Das schränkte den Kreis des kreativen Schaffens und des Lesestoffes ein. Wir haben in dieser Hinsicht viel versäumt und gar nicht geahnt, welche Bücher es draußen noch gab. Dennoch konnten uns die Theorien der Klassengesellschaft von der Welt nicht völlig isolieren. Der Drang zur Lektüre war enorm. Woher kam das?
Mutter und Vater waren für ihre Zeit gebildete Leute. Sie lasen selbst und regten uns Kinder zum Lesen an. Ich war der Älteste und hatte deshalb noch eine andere Quelle – über die Märchen meiner Großmutter Ajimkan. Sie hat gerne Märchen erzählt und mir Lust darauf gemacht. Der russische Schriftsteller Juri Olescha hat einmal gesagt, wer in der Kindheit von einem weisen Mentor umhegt werde, könne sich selig schätzen. Die Großmutter war mir eine solche Mentorin. Ich glaube, jede Familie sollte die Kinder vor ideologischer Aggressivität und totaler Angriffslust schützen. Der Drang zur humanistischen Literatur gehört zum Wesen des Menschen.
Schließlich war auch der Krieg ein Thema für die Jugend. In ideologisierten Gesellschaften dient das Buch mehr als alles andere der Vorbereitung der jungen Generation auf den Krieg des Staates. Ich weiß, wovon ich spreche: Meine Kindheit und Jugend fielen in die Jahre des Zweiten Weltkrieges. Erst viele Jahre nach Kriegsende habe ich allmählich begriffen, wie massiert und propagandistisch zielstrebig der Militarismus in unser noch halb kindliches Bewusstsein eingedrungen ist, wie sehr unser Leben den militärischen Interessen unterworfen und wie uns all das über die Kinderbücher jener Jahre eingepflanzt worden war. Die belletristischen Werke priesen als höchsten patriotischen Heldenmut, sich auf dem Altar des Krieges zu opfern.
Wir sind Altersgenossen, auch Sie, Ikeda-Sensei, dürften sich daran erinnern, wie das Jugendbuch in den Jahren des japanischen Supermilitarismus benutzt wurde. Auch in Ihrem Land haben Heroisierung und Poetisierung des Krieges ihre Blüten getrieben.
Mitunter versuche ich, mir folgendes Bild vorzustellen: Die im Krieg mit Hurragebrüll auf den Lippen gefallenen Soldaten stehen wieder auf und werden gefragt, ob sie sich nochmals in den Kampf stürzen möchten, um in der Schlacht den Heldentod zu sterben. Was würden sie antworten? Ich glaube, dass kaum einer von diesen Soldaten, egal auf welcher Seite, dazu bereit wäre, mit welchen Argumenten man sie auch agitieren würde. Die bedingungslose Bereitschaft zum Heldentod lässt sich beim Menschen nur zu Beginn des bewussten Lebens erzielen. Die Ideologie wirkt nur dann erfolgreich, wenn sie möglichst früh, das heißt schon im Kindesalter, die Menschenseele erfasst. Auf unseren Alltag traf dies jedenfalls zu.
Unsere Bücher über den Krieg haben in der Regel nur in einer Richtung erzählt, nämlich der des Heldentums, des Sieges und der Opferbereitschaft. Dabei verfügte der Held über keine eigene Persönlichkeit, er strebte auch nicht danach, einen eigenen Standpunkt über das Wesen des Krieges zu erarbeiten. Die Persönlichkeit als solche hatte ja keinerlei historische Bedeutung. Diese ideologische Einstellung zum Kriegsthema blieb bis in die letzten Jahre unerschüttert. Auf meinem literarischen Weg stieß ich mit dieser unerschütterlichen Macht zusammen. Meine erste Novelle – Aug in Auge (in manchen Übersetzungen hat sie jetzt den Titel Die Frau des Deserteurs) – konnte erst dreißig Jahre nach Erscheinen um das Kapitel ergänzt werden, in dem das Schicksal eines Deserteurs, seiner Familie und die psychologischen Motive seiner Handlungen dargestellt wurden. Zuvor war das aus ideologischen Gründen unmöglich durchzusetzen.
Ikeda: Ich plane, Ihrem Gesamtwerk eine eigene Arbeit zu widmen. Als ich in Japan vor einer tausendköpfigen Menge über den Inhalt Ihrer Novelle Aug in Auge erzählte, kam es zu einer leidenschaftlichen Reaktion. Angesichts der von Ihnen geschilderten weiblichen Kraft, der Unbeugsamkeit und des Leids konnten insbesondere viele Frauen ihre Tränen nicht zurückhalten. Ich freute mich und war zugleich verwundert, wie diese vor dreißig Jahren geschriebene Geschichte über eine Frau ein so starkes Mitgefühl im modernen Japan hervorrufen konnte, also in einem Land, das zum ersten Mal in seiner Geschichte eine so lange Zeit des Wohlstands und Friedens erleben durfte. Ähnliches lässt sich auch über Ihre anderen Werke sagen, bis hin zur Novelle Die weiße Wolke des Tschinggis-Chan. Wir sprachen über den Gegensatz des Mütterlichen und der Macht. Ihre Frauengestalten treten ja nie mit Losungen auf. Sie protestieren auch nicht gegen den Krieg von ideellen Positionen her. Jede Gestalt befindet sich in besonderen Umständen und ist von dem tiefen Gefühl durchdrungen, dass sie etwas kolossal Böses, nämlich den Krieg, erlebt und all ihre Kraft hergibt, um zu überleben. Der Seelenschrei dieser Frauen kann den Wortschleier zerreißen, mit dem man den Krieg zu schmücken pflegt. Gerade deshalb verbirgt dieser Schrei die Kraft, die einen vor dem Grauen des Krieges zurückschrecken lässt. Die Augen dieser Frauen sind die Augen des Lebens und der Wirklichkeit – die Augen des Menschen. Das Leben und die Wirklichkeit, auf die sich die lauthals verkündeten Losungen berufen, sind stets bedroht. Man muss nur auf die Menschheitsgeschichte zurückblicken und schrickt vor all den Illusionen und Irrwegen zurück.
Ich erinnere mich hier an das Bett des Prokrustes. Der Wegelagerer Prokrustes lockte bekanntlich die Vorüberziehenden an, fesselte sie und passte sie seinem Bett an. Waren die Leute zu lang hackte er ihnen Arme und Beine ab; waren sie zu kurz, streckte er sie. Wird der Mensch nach vorgefertigtem Maß verstümmelt, werden das Leben, die Wirklichkeit und der Mensch nach Ideologien und Losungen ausgerichtet, kommt es zwangsläufig zu Opfern. In unserem Jahrhundert der Kriege und Revolutionen haben keine anderen Völker ein so tragisches Schicksal durchgemacht und so viele Opfer gebracht wie die Nationen der Sowjetunion – im Krieg mit Deutschland und im furchtbaren Orkan des Stalinismus.
Auch Japan, das die Kriegskatastrophe in der Region des Stillen Ozeans auslöste, bildet hier keine Ausnahme. Jedenfalls sollten wir mit dem Bösen aufhören, dessen Sinnbild das Prokrustesbett darstellt.
Rückkehr zu geistigem Halt
Ikeda: Wir beide gehören dem Jahrgang 1928 an. Geburt und Erziehung sind zwar von unterschiedlichen Bedingungen und einem jeweils anderen sozialen Milieu geprägt, wir haben jedoch etwas gemeinsam: Wir gehören der »darbenden Generation« an, die in ihrer Jugend die schweren Jahre des Zweiten Weltkrieges mitmachte und in der Epoche lebte, die beträchtlichen Schwankungen der Wertvorstellungen ausgesetzt war. Zweifellos möchte der Mensch nicht nur leben, sondern gut leben, wie Sokrates sagte. Je größer das Chaos bei den Ansichten über die echten Werte, desto stärker das Bedürfnis nach Idealen.
Als Ihr Zeitgenosse möchte ich fragen, was Ihnen in der Jugend, als Sie Ihre subjektiven Beziehungen zur Gesellschaft abzutasten begannen, den geistigen Halt gegeben hat?
Mein geistiger Halt war der Buddhismus, der Umgang mit dem »Lehrer des Lebens«, mit Josei Toda, dem zweiten Präsidenten der Gesellschaft Soka Gakkai.
Aitmatow: So früh dachte ich über meine subjektiven Beziehungen zur Gesellschaft kaum nach. Eine viel zu harte, gegenüber dem Menschen erbarmungslose Zeit herrschte im Land. Das totalitäre Regime, in dem wir aufwuchsen und dem wir uns widerspruchslos unterordneten, sah nicht vor, über die gesellschaftlichen Probleme von einer individuellen Position her nachzudenken, jedenfalls nicht offen und öffentlich. Im Gegenteil wurde das stahlharte Postulat der totalen Unterordnung des Menschen unter das Diktat des Staates und der Macht von den meisten als normale Ordnung akzeptiert, ja noch viel mehr – als revolutionäre Errungenschaft gepriesen. Das Postulat lautete: Kein Mensch ist unersetzbar. Darauf beruhte unsere Tragödie, die nicht hinterfragt wurde. Die Persönlichkeit hatte einwandfrei zu funktionieren und diente lediglich als Mittel zur Durchsetzung ideologischer und politischer Ziele. Alles Übrige – geistige und sittliche Traditionen, Moral und sogar verwandtschaftliche Beziehungen – wurde verworfen, falls es nicht den sogenannten Klasseninteressen entsprach; verworfen als Überbleibsel der Vergangenheit und unerlaubter Allüren des bürgerlichen Individualismus. Wer beispielsweise einen Verstorbenen traditionell bestattete, musste damit rechnen, dass diese jahrhundertealte Sitte als politische Unreife angesehen und Menschen dafür verfolgt wurden. Unter solchen Bedingungen bezeichnete sich die herrschende Partei, die über eine unbefristete Monopolmacht verfügte, als Verstand, Gewissen und Ehre der Epoche, zugleich war sie die strafende Macht. Den Lehrer, den Sie, verehrter Ikeda, im Auge haben, kann es unter solchen Bedingungen nicht geben.
Wir lebten in Übereinstimmung mit Prinzipien, die gewaltsam erdacht und uns aufgezwungen wurden, ein in der Geschichte der Neuzeit einmaliger Vorgang. Ich erwähne das, weil ich keinen Lehrmeister nennen könnte, der wie Ihr Josei Toda meine geistige Stütze gewesen wäre. Dennoch möchte ich einige Personen, die in meinen jungen Jahren eine entscheidende Rolle bei der Erneuerung der Gesellschaft und ihren geistigen Bestrebungen spielten, beim Namen nennen: Nikita Chruschtschow und Alexander Twardowskij, Chefredakteur der Zeitschrift Novyj Mir, der mir den für jene Zeit nicht so leichten Weg in die große Literatur ebnete. Unter den mittelasiatischen Kulturschaffenden erinnere ich mich dankbar an den Klassiker der kasachischen Literatur, an Muchtar Auesow, der an meiner literarischen Bildung unmittelbar Anteil nahm.
Natürlich hat es auch in jenen Zeiten Menschen gegeben, die allein durch ihre Lebensweise Ehre, Edelmut und Zivilcourage personifizierten. Bis heute wundere ich mich, wie sie, unter den unmenschlichen Bedingungen des totalen Einheitsdenkens und des Untertanenrummels, diese Eigenschaften bewahren und überleben konnten. Die brutale Logik der Zeit verlangte, sie wie Unkraut auszurotten – der Kult des Denunzierens wurde ja auch gegenüber Familienangehörigen gefördert. Ein Sohn, der den Vater bei den Machthabern als zweifelhaften Menschen anzeigte, wurde Held und Vorbild. Straßen, Jugendgruppen und Lehranstalten wurden nach ihm benannt, den Vater erschoss man. In der sowjetischen Literatur ist meine Generation von dieser Tragödie besonders schmerzhaft berührt. Der belorussische Schriftsteller Vasil Bykau hat das Thema in einer eindrücklichen Novelle mit dem Titel Die Treibjagd dargestellt. Ich erwähnte bereits meine erste Novelle – Aug in Auge –, die damit zu tun hat. Das war unsere Lektion, die wir nicht verschweigen dürfen, sondern erzählen müssen, welchen Preis der Mensch für diese furchtbare Tragödie zu bezahlen hatte.
Ikeda: Eine furchtbar traurige Geschichte, die die ganze Grausamkeit und Unmenschlichkeit totalitärer Ideologie zeigt.
Letzten Endes zählen der gesunde Menschenverstand und das von ihm geleitete sittliche Empfinden. Um welche Philosophie oder Ideologie es sich auch handeln mag, Verletzungen des gesunden Menschenverstands dürfen nie zugelassen werden. Der Philosoph ist dazu berufen, den gesunden Menschenverstand – die geistige Basis für Gesellschaft und Volk – zu kultivieren.
Auch unser Land hat, wohl nicht in dem Ausmaß wie in der UdSSR, eine Periode durchgemacht, als der Zyklop einseitiger und unduldsamer Ideologie, vor allem auf dem Gebiet der Presse und des Erziehungswesens, wütete. Selbst unter solchen Bedingungen hört aber der gesunde Menschenverstand nicht auf zu existieren. Menschen, die ihr Gewissen bewahrten, beackerten unauffällig, aber beharrlich das Feld des gesunden Menschenverstands. Solange einer Mensch bleibt, werden alle fanatischen Ideologien an ihm abprallen und früher oder später ihr wahres Wesen offenbaren.
Aitmatow: Zu meinem Glück begegnete ich in früher Kindheit Menschen, die den Ideen des Totalitarismus innerlich trotzten. Sie beschenkten mich mit ihrem Mut, lehrten mich, trotz alledem stets Mensch zu bleiben und die Würde des Menschen über alles zu achten.
Nie vergesse ich den Dorfschullehrer, der einmal die strengen Worte an mich richtete: »Blicke niemals zu Boden, wenn der Name deines Vaters fällt!« Torekul Aitmatow, mein Vater, war der Repression zum Opfer gefallen. Er wurde 1937 hingerichtet, danach musste sich unsere Familie in einem abgeschiedenen Ail verstecken.
Man kann sich heute einen Menschen wie diesen Lehrer kaum vorstellen: Nur schon daran zu denken, war unheimlich, aber er brach sogar das Schweigen, um mir zu sagen, ich könne auf meinen Vater stolz sein. Jetzt verstehe ich den Sinn seiner Worte, damals habe ich ihn nur verspürt.
Die Lehre ist mir unvergesslich. Es gab auch andere Beispiele der Unerschrockenheit. Meist ohne Worte. Die Weisheit des kleinen Mannes, durch seine Arbeit und Person, ohne zu ahnen, dass er ein Vorbild abgibt.
Ich hatte also meine »Lehrmeister des Lebens«. Integre, ja heilige Menschen meiner Heimat, vor denen ich mich verneige! Sie sind mir bis heute ein geistiger Halt. Man kann und darf nie vergessen, woher man stammt und was man den Menschen, die einen lieb hatten, verdankt, gerade dann nicht, wenn man Augenblicke des Glückes, des Erfolgs und, verzeihen Sie, auch des Ruhmes erlebt.
Viele Angehörige meiner Generation haben am eigenen Leib verspürt, wie unwahrscheinlich schwierig und qualvoll es war, zur echten Kultur und zum geistigen Ursprung des Guten zu finden. Ein schreckliches Gift war in unseren Kreislauf eingedrungen. Hätten wir auf unserem Weg keine solchen »Lehrmeister des Lebens« gehabt, wäre es wohl unmöglich gewesen, sich davon zu befreien. Ich persönlich konnte darauf mein ganzes Leben bauen und bin glücklich, dass ich immer wieder Menschen begegnete, die mir zu leben halfen. Viele meiner Altersgenossen haben ja nicht aus den ideologischen Schatten der Stalin-Ära heraustreten können und klammern sich hartnäckig an überlebte Dogmen.
Meinerseits möchte ich nach Kräften den jungen Menschen von heute helfen, in unserer komplizierten und widersprüchlichen Welt einen richtigen Weg zu finden. Sogar durch meine Fehler. War es nicht Bismarck, der gesagt hat, die Dummen lernen aus eigenen, die Klugen aus fremden Fehlern?
Ikeda: Meinem Lehrer Toda begegnete ich im Alter von neunzehn Jahren zum ersten Mal und stellte ihm drei Fragen: »Was heißt für den Menschen, richtig zu leben? Was ist ein echter Patriot? Was halten Sie vom Kaiser?« Diese Fragen gaben die für einen jungen Menschen unvermeidlichen Zweifel wieder, dessen Jugend von Militarismus und Faschismus zertreten wurde. Aber denkt man genauer nach, ergibt sich schon aus der ersten Frage das schwierigste Problem in der Menschheitsgeschichte. Meine Fragen waren intuitiv gestellt. Noch heute erinnere ich mich deutlich an die Worte des verehrten Lehrers, der ohne Zögern erwiderte: »Das ist eine schwierige Frage.« Was er konkret ausführte, weiß ich nicht mehr, aber ich sehe noch sein Lächeln vor mir und erinnere mich, dass er seine frei fließende Rede gerne mit Scherzen ausstattete, keine komplizierten philosophischen Begriffe verwendete und nie in den Ton des Moralisierens fiel … Dieser Mensch konnte mit einfachen, jedermann verständlichen Wörtern der Umgangssprache die profundeste Philosophie ausdrücken und dabei den Zuhörer mit unerschütterlicher Überzeugungskraft bestärken. Dem war kaum zu widerstehen, und ich habe damals intuitiv gespürt, dass man diesem Menschen folgen kann. Was ich empfunden habe, wurde in den folgenden Jahren, als ich meinen Lebensweg an der Seite dieses Lehrers ging, hinreichend bestätigt. Mit seiner Hilfe habe ich Gesellschaft, Volk und Menschen zu erkennen gelernt. Mein Lehrer war wie ein Spiegel, der mich das wahre menschliche Leben begreifen ließ. In dieser Hinsicht war er alles für mich. Ich sage das mit größter Freude und größtem Stolz.
Was wünschen wir der Jugend?
Ikeda: Man kann nicht sagen, dass wir unsere Jugend unter günstigen Bedingungen zubrachten. Vielleicht verspürten wir deshalb den Drang nach dem gedruckten Wort, waren bestrebt, zu lernen und neues Wissen zu schöpfen. Mir fällt ein, wie ich nach dem Krieg, als es allenthalben am Notwendigsten mangelte, bei einem Buchladen anstand, nachdem wir erfuhren, dass ein bekanntes Werk erschienen war oder neu aufgelegt wurde. Mit Freunden organisierte ich Zirkel für Leseratten, so groß war damals bei uns der Wissensdrang.
Unsere Aufmerksamkeit galt vor allem dem Teil der Information, deren Zugang eingeschränkt war. Und was wir damals lernten, ist mir bis auf den heutigen Tag frisch im Gedächtnis geblieben. »Wir waren nie so frei wie zur Zeit der deutschen Okkupation«, hat Sartre gesagt. In dieser paradoxen Äußerung klingt an, wie kompliziert und gespannt die Beziehungen zwischen Umwelt und Persönlichkeit sind.
Im Vergleich zu unseren Jugendjahren bieten sich heute den jungen Menschen vielfältige Informationen an. Zugleich ist zu fragen, ob die Jugend nicht einer wachsenden geistigen Leere und einer haltlosen Lebensweise anheimfällt?
Aitmatow: Ich verstehe Sie sehr wohl. Gibt es denn eine aktuellere und alarmierendere Frage? Hinter der Alltäglichkeit des Problems verbirgt sich doch etwas Zeitloses. Was bringt die Jugend an Neuem und Besserem hervor, wenn es zutrifft, dass hinter der Geschichte eine Tendenz des Fortschritts steht? Die Eltern treten ab, ihr größtes und widerspruchsvollstes Vermächtnis sind die Kinder. Eine Abfolge ohne Ende. Voller Sorge und Verzweiflung denken die Eltern an die Nachkommen und gehen durch ungeahnte seelische Wechselbäder.
Ich fürchte mich vor diesem Thema und möchte nicht als banaler Moralapostel dastehen, weil meine Ängste und Zweifel allgemein bekannten Ansichten folgen. Aber man kann nicht vor sich selbst davonlaufen.
Mit jedem Tag verspüre ich den Abstand des Alters, was ich früher gar nicht bemerkte. Vielleicht sehe ich deshalb immer zugespitzter, wie unterschiedlich die Standpunkte bei den verschiedenen Generationen sind, was sie für vernünftig und unvernünftig halten, welche Entwicklungen der Gesellschaft sie als gerechtfertigt oder ungerechtfertigt bewerten. Es ist so schwer zu sagen, wer in welchem Maß recht hat. Wie soll man etwa das Schuldgefühl gewichten, das die ältere Generation der sowjetischen Bürgerinnen und Bürger empfindet, die sich ohne eigene Schuld in der Steppe der Historie verirrte und damit die Jugend der Achziger- und Neunzigerjahre in eine Sackgasse führte? Wir, die Väter, haben uns in die Perestroika gestürzt und hofften dabei, die Jugend würde die Sache der Perestroika fortsetzen. Aber entspricht die Jugend unseren Erwartungen? Wie versteht sie die Ansprüche der Älteren an die Perestroika? Würdigt sie denn unsere neuen Impulse und Handlungen bei der demokratischen Umgestaltung der Gesellschaft? Verlachen sie nicht die Qualen der Eltern und rächen sich gar an ihnen, die sie seit jungen Jahren verachteten?
Ich wage nicht, das eindeutig zu beantworten, und will mich kurzfassen.
Das Leben von heute ist dermaßen kompliziert, dass die üblichen hausbackenen Moralpredigten kaum etwas bewirken, obwohl mich beispielsweise die epidemieartige Leidenschaft für jede Art von Seximitation befremdet; eben all das, was mit dieser Pseudofreiheit zusammenhängt, die in Wirklichkeit Haltlosigkeit und Pornografie ist, ich würde sogar sagen, eine Verschleuderung jenes Erbes, das dem Menschen von der Natur als rein intimes Gut gegeben ist. Alle Welt macht den modernen Film, das Entertainment, das Theater, die Kunst und andere visuelle Kommunikationsmittel dafür verantwortlich. Aber gäbe es denn die Angebote ohne die Nachfrage?
Ikeda: Mit dem Bruch zwischen den Generationen habe ich mich viel befasst. Wir verspüren ihn heute besonders stark und stellen fest, wie daraus ein tiefes soziales Problem geworden ist, auch wenn seit den Zeiten des antiken Griechenlands die Worte gelten: »Die Jugend in unserer Zeit ist aber …« Die Brüche zwischen Alt und Jung haben indessen in der Gegenwart Dimensionen angenommen, die schwer zu überwinden sind. Das geht sicher auf die stürmischen sozialen Veränderungen zurück, vor allem auf die geschwächte Erziehungsfunktion der Familie, die über Jahrhunderte hindurch die wichtigste Brücke zwischen den Generationen bildete. Die Veränderungen vollziehen sich aber dermaßen schnell, dass die Jungen von heute schon nach wenigen Jahren zur alten Generation gehören. Das Gefühl für den historischen Fortschritt kommt in der Gesellschaft immer mehr abhanden. Die schönen Begriffe wie »Ideal«, »Ziel« und »Hoffnung«, die von alters her die Jugend begleiten, verflüchtigen sich. Was Sie ansprechen, bekommen besonders häufig die Vertreter der älteren Generation in den entwickelten Ländern zu verspüren. Die Lehrkräfte an japanischen Mittel- und Oberschulen beklagen sich darüber häufig. Die meisten Schwierigkeiten bereiten ihnen die Probleme der Sittlichkeit: Je mehr man mit der Jugend über die Wahl wichtiger ethischer Normen spricht, desto stärker ist das Gefühl, dass alle Anstrengungen ins Leere laufen.
Was müssen wir unternehmen, um nicht in den Ton »hausbackener Moralpredigten« zu verfallen? Ich würde zweierlei vorschlagen: Wir sollten auf einseitige Kritik verzichten und der Jugend vertrauen. Wir können doch nicht bestreiten, dass die ältere Generation die moderne Gesellschaft geschaffen hat. Die Kinder sind der Spiegel dieser Gesellschaft. Abweichungen und Fehlverhalten drücken die in der Gesellschaft vorhandenen Widersprüche aus.
Aber können die Älteren von sich behaupten, dass sie den Jungen vertrauen? Die Fähigkeit, an jemanden zu glauben, hängt von niemandem anderen als dem Menschen selbst ab. Das hat eine völlig andere Dimension als all diese Bezichtigungen, wonach die moderne Jugend kein Vertrauen verdiene. Jeder Mensch ist vertrauenswürdig. Dieser Gedanke muss die Grundlage eines unerschütterlichen Glaubens und der inneren Überzeugung sein.
Der japanische Schriftsteller Soseki Natsume glaubte, dass sich der Mensch im Leben nicht auf einen anderen, sondern auf sich selbst hin orientieren sollte. Darin beruht letztlich das sittliche Fundament des Vertrauens, der Liebe und des Mitgefühls. Hauptsache wäre, im besten Sinn des Wortes sich selbst zu folgen, und genau das vergessen heute viele Vertreter der älteren Generation.
Ich sage das nicht bloß so dahin. Mein Glaube gründet auf eigener Erfahrung. Ich habe mit vielen Jugendlichen zu tun gehabt, den Kontakt zu zahlreichen jungen Burschen und Mädchen gepflegt und mit ihnen an gemeinsamen Aktionen teilgenommen. Die Jugend erwidert das Vertrauen mit Vertrauen. Erwachsene, die sich über die unzureichende Herzlichkeit der Jugend beklagen, sollten sich fragen lassen, wie groß ihr eigenes Herz ist.
Aitmatow: Was wünsche ich der Jugend, wenn ich mich auf meine Lebenserfahrung stütze?
Ganz einfache Dinge. Erstens: Wie alles Schöne auf der Welt vergeht die Jugendzeit sehr rasch. Heute bist du noch jung und morgen schon in den Jahren. Man sollte deshalb die Welt nicht von der Warte infantiler Privilegien und seniler Absonderlichkeiten betrachten. Gutes und Böses gilt gleichermaßen für alle Altersstufen. Man sollte sich nicht zu lange mit dem jugendlichen Eigensinn herausreden, sondern sich von frühen Jahren an sagen, dass man die Verantwortung eines erwachsenen Menschen in sich trägt. Das braucht den jungen Menschen nicht daran zu hindern, bei reifem Verstand jung zu bleiben. Zweitens: Ein väterlicher Rat. Berauscht euch nicht an sozialen Revolutionen. Revolution ist Aufruhr und eine Massenkrankheit. Revolution bedeutet massenhafte Gewalt und die allgemeine Katastrophe der Nation und der Gesellschaft. Wir haben das bis zur Neige ausgekostet. Sucht nach Wegen demokratischer Umgestaltungen, den Weg der unblutigen Evolution und konsequenter Reformen. Die Evolution erfordert Geduld und Kompromisse, Regelungen und Wachstum, aber nicht die gewaltsame Einführung von Glück. Ich bete zu Gott: Mögen die jungen Generationen aus unseren Fehlern lernen!
Und schließlich die ewige Frage, seit der Mensch auf die Welt gekommen ist: Worin liegt der Sinn des Lebens? Die Befragung hört nie auf, im Gegenteil, sie nimmt zu und verschärft sich – Kriege, Revolutionen und alle möglichen Theorien und Lehren, tiefe innere Erschütterungen und Einsichten aktualisieren sie; ganz gleich, ob ein kritisch denkendes Volk wie in der Sowjetunion die Arena betritt oder ob es um China geht, wo sich vor unseren Augen eine Tragödie der Demokratiebewegung abspielt. In keiner Situation dürfen wir das Feuer der Befragung erlöschen lassen und müssen weiterhin an den Sinn des Lebens denken. Wir wollen wissen, warum der Mensch lebt, welche Pflichten jede Generation hat, die diese unerschöpfliche Frage aus eigener Einsicht zu beantworten sucht.
Die jungen Menschen sollten selbst darüber nachdenken, worin sie das Ziel des Lebens sehen. Wie verstehe ich diese Frage? Die Bedürfnisse des Augenblicks sind stets präsent und haben im Allgemeinen den Vorrang. Im unabänderlichen Element des Menschen, in seinen Irrungen und Wirrungen, in der Arbeit, dem Chaos und den Gesetzmäßigkeiten des Daseins dürfte die geistige Kultur eine der wichtigsten Errungenschaften sein, wenn nicht die Hauptsache, die Sinn und Bestimmung des Menschen rechtfertigt. Dostojewski hat sich damit abgequält und gefragt, was sein würde, wenn in der Welt alles wohlgeordnet, alle satt, bekleidet und beschuht wären, wenn alle ein Feuer im Herd und ihr Dach überm Kopf hätten? Stellen wir uns also vor, dass alle Mühsal, die Qualen der wirtschaftlichen Rückständigkeit, der Armut, des Elends und der Unterentwicklung, die riesige Regionen auf dem Planeten betreffen, mithilfe der technologischen Zivilisation und der postindustriellen Entdeckungen beseitigt wären; wenn es also dem Menschen gelänge, das Niveau des Weltschöpfers zu erlangen, der materielle Wohlstand überall garantiert wäre wie Aufgang und Untergang der Sonne, würden wir, das heißt unsere fernen Nachfahren, nicht entdecken, dass der materielle Anreiz überhaupt kein Selbstzweck ist? Jetzt mag uns das noch so erscheinen, da ja alles Übrige für uns vorerst reine Rhetorik bleibt, aber dann wird sich herausstellen, dass es ein höheres Ziel gibt, das wir in den Mühen der Erkenntnis und der Selbstverwirklichung erlangen – die unaufhörliche, sittliche und geistige Vervollkommnung der Menschen von Geschlecht zu Geschlecht, von Generation zu Generation. Diese unendliche Steigerung und das Nahen einer vielleicht fernen Dimension, nämlich des Göttlich-Menschlichen im Menschen …
Was ist Gerechtigkeit?
Ikeda: Als Sie sich an Ihre Kindheit erinnerten, sagten Sie: »Der Hunger, der Mangel am Nötigsten, Krankheiten und die Trauer über die Toten in jedem Haus, all diese harten Ereignisse haben mir zahllose Leiden gebracht, aber auch die Möglichkeit gegeben, aufgrund eigener Erfahrungen über den Sinn des menschlichen Lebens tief nachzudenken … Es war zum Herzzereißen, als ich sah, wie der Witwe und den Waisen, die nichts zu essen hatten, das letzte Schaf weggenommen wurde. Ja, es war eine grausame Zeit …«
Die Konfrontationen mit den realen Widersprüchen der Gesellschaft haben in Ihnen offensichtlich den unstillbaren Drang nach Gerechtigkeit geweckt, der wohl besonders stark in den Jahren der Jugend mit der ihr eigenen Wahrnehmungsschärfe hervorgetreten ist.
In jugendlichen Jahren, da ich alles Lesbare wie ein Schwamm aufsog, bekam ich Viktor Hugos Roman Die Elenden in die Hand. Ich weiß noch, wie mich der Weg der Hauptfigur – Jean Valjean – vom Erwachen des Bewusstseins bis zur allumfassenden Liebe zu armen Leuten erschütterte. Die Liebe zu den ungerecht unterdrückten Volksmassen, die Ideale der sozialen Veränderungen und der unbezwingbare Drang nach Idealen haben mich verstehen lassen, dass die Gerechtigkeit im wahren Sinn des Wortes von Güte und Strenge begleitet sein sollte. Mit anderen Worten: Die Quellen der Gerechtigkeit sind unter einer ansehnlichen Schicht sozialer Widersprüche verborgen.
Wie bewerten Sie die Unzufriedenheit mit den sozialen Widersprüchen? Was hat Ihnen dazu verholfen, die Richtung Ihrer Tätigkeit bei der Suche nach den Quellen der Gerechtigkeit zu bestimmen?
Aitmatow: Wenn man tiefer schürft, und zwar im Traum von der Gerechtigkeit, wonach der Mensch, unabhängig von Geburt und Zugehörigkeit zu dieser oder jener Schicht, das Recht auf Selbstverwirklichung und Führung eines Lebens in Würde erhalten soll, stößt man auf die Idee des Sozialismus.
Der Begriff ist zwar ziemlich jung, aber der Traum uralt. Vielleicht gehört er zum genetischen Code der Menschheit.
Die Alten – das gilt für die antiken Völker, von denen historische Zeugnisse erhalten sind – hatten den Traum vom Goldenen Zeitalter. Später hat ihn das Christentum – die Religion der Armen – aufgegriffen. Was hat die Christen nur bewegt, im Namen des Glaubens die schrecklichsten Qualen zu erdulden? Der Traum! Sie waren davon überzeugt, dass ihnen für alle irdischen Leiden und Nöte das Paradies beschert werde – eher gehe ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher dorthin komme.
Und was für eine Literatur und Kunst, die von den christlichen Idealen beseelt war, besitzen wir!
Einer Ihrer Lieblingsautoren ist Dostojewski. Er hat mit dem Roman Arme Leute begonnen. Und Tolstoi hat die gesamte Literatur in eine christliche und eine unchristliche aufgeteilt, anders gesagt – in eine humane und eine antihumane.
Bemerkenswert! O ja …
Und was zeigt unser sozialistisches Experiment? Wir haben die Reichen vernichtet und die Armen nicht reich gemacht. Wir haben Armut und Elend wie seit eh und je.
Worauf will ich hinaus? Vielleicht auf den Gedanken, dass sich die Gerechtigkeit kaum durch eine unversöhnliche Abgrenzung von Armen und Reichen durchsetzen lässt. Wofür kämpfen wir denn, wenn wir uns den blinden Instinkten ergeben, in rasender Wut das Ziel zu erreichen: Alle müssen gleich sein, alle müssen reich sein? Meines Erachtens muss die Frage anders gestellt werden. Es geht nicht um ein Stück Brot. Für jede Gesellschaft, wie sie auch heißen mag, ist es eine Schande, Arme und Elende zu haben. Sie hat dann keinen Anspruch darauf, der Gerechtigkeit zu dienen.
Mir geht es aber nicht nur darum, und ich will meinen Gedanken in Senecas Worten äußern: »Arm ist nicht, wer wenig hat, sondern wer nicht mehr haben möchte.«
Wie geht das? Daran gibt es nichts zu deuteln: Es klappt nur auf Kosten derer, die weniger haben. Und weiter: Was heißt hier »mehr« und was »weniger«?
Leider können wir in unserer verwahrlosten, gespaltenen und grausamen Welt über nichts anderes als das tägliche Brot reden. Auf dem Erdball leben Millionen hungernder und obdachloser Menschen. Sie sind Vorwurf und Fluch für jede Sozialordnung, in der ein Mensch in solch eine Lage geraten kann. Sie sind ein zum Himmel schreiendes Bild bitterster Ungerechtigkeit, die einem das Wort in der Kehle erstarren lässt. Aber darf man schweigen?
Worin liegt die Wurzel des Übels, das in vorbiblische Zeiten und in die Anfänge der Schöpfung zurückreicht?
Ikeda: Als Sie Seneca erwähnten, fiel mir Shakespeares Othello ein – der Eifersüchtige zweifelt nicht, weil er dafür Gründe hätte, sondern weil er von Natur aus argwöhnisch ist. Bei Seneca und Shakespeare richtet sich der Blick nicht aufs Äußere, sondern aufs Innere. Richtet man die Aufmerksamkeit nur auf äußerliche Faktoren, kann das im Fall von Armut und Eifersucht nur zu Tragödien führen. Um das argwöhnische Herz zu besänftigen, gibt es keinen anderen Weg, als den Partner, das Objekt der Eifersucht, anzubinden oder gar zu töten. Bleibt das argwöhnische Herz unverändert, findet sich keine andere Lösung des Problems. Kollisionen wie im Othello sind so alt wie die Welt und wiederholen sich immer wieder.
Die Tragödien, deren Ursachen in der extremen Orientierung auf äußere Faktoren liegen, fanden ihren symbolhaften Ausdruck im Nazismus und Stalinismus – zwei ungeheuerliche Formen des Bösen, die unser Jahrhundert mit Strömen von Blut übergossen haben. Im Nazismus war es die »Nation«, im Stalinismus die »Klasse«, da wie dort wurde der äußere Faktor als die Wurzel des Bösen ausgegeben. Daher rührte die Aufgabe, die feindliche, angeblich niedrige Rasse beziehungsweise die feindliche Klasse zu vernichten. Hier die sogenannte Reinheit der arischen Rasse und der Völkermord an den Juden; dort die massenhaften Säuberungen unter den bösartigen Losungen des Kampfes gegen die sogenannten Volksfeinde. Wenn solcher Wahnsinn wütet, ist es tatsächlich nicht leicht, den Blick nach innen zu bewahren. Das gilt aber nicht nur für den Nazismus und den Stalinismus, sondern auch für Japan während des Krieges, als unserem Land Losungen eingepflanzt wurden, die sich auf den staatlichen Schintoismus beriefen. Losungen wie »amerikanische Teufel« kennzeichneten die geistige Atmosphäre jener Jahre.
Ihre Frage nach der Wurzel des Bösen quält von alters her viele Denker. Im Rahmen der westeuropäischen Zivilisation fand das seinen Ausdruck in den griechischen Tragödien und den Gedanken des heiligen Augustinus, sie erzählten auf dramatische Weise von der qualvollen Suche des Geistes. Um diesem Teufelskreis zu entrinnen, muss man auf die Trägheit des Denkens, das nur auf das Äußere gerichtet ist, verzichten und konzentriert auf das Innere in sich selbst blicken.
Aitmatow: Das Wesen der Ungerechtigkeit liegt meines Erachtens in der Verachtung des Menschen gegenüber anderen. Wenn der Mensch nicht als höchster Wert anerkannt wird. Wenn – aus bestimmter Sicht – ganze Völker als Sklaven geboren werden. Wenn Propheten auftreten, die das Recht beanspruchen, andere zu beglücken, selbst wenn diese die Gnade nicht wünschen, der gnädige Prophet aber zu wüten beginnt und sich in einen unerbittlichen Henker verwandelt.
Ich streite mit mir selbst und demjenigen, der ich früher war. Angesichts der Erniedrigung und Beleidigung der Menschen presst sich mir wie zuvor das Herz zusammen. Umso mehr – und das ist das Schrecklichste –, als der Mensch unter Umständen nicht begreift, was ihn erniedrigt, seine Menschenwürde verhöhnt und sein heiliges Recht eines frei Geborenen, wie es wenigstens die Deklaration der Menschenrechte definiert, mit Füßen tritt.
Als ich die Zeilen schrieb, die Sie zitierten, bewegte mich das Gefühl des Mitleids. Die heiße Empörung kam erst später, als ich begriffen hatte, wer hinter den Handlungen derer stand, die den Hungernden das letzte Schaf wegnahmen und sie damit zum Untergang verurteilten; was sie anstiftete und auf welch »große Idee« sie sich stützten, konnten diese Leute freilich nicht ahnen. Letzteres kann sie nicht rechtfertigen, vielmehr macht das ihre Schuld zu dem schwersten, ja unverzeihlichen Verbrechen. Diese »große Idee«, von der sie sich leiten ließen, ist der zur Staatspolitik erhobene Menschenhass.
Als Schriftsteller muss ich auch die Psychologie des Verbrechers begreifen. Aber wenn ich auch nicht verpflichtet bin, ein Urteil zu fällen, kann ich als Mensch das Verbrechen nicht verzeihen.
Als Schriftsteller muss ich auch die Philosophie derer verstehen, die Menschen – das waren sie ja – in eine blinde Waffe satanischer Willenskräfte verwandelten. Welches Gericht ist für sie zuständig? Sind sie als Menschen oder als Unmenschen zu verurteilen? Gibt es überhaupt eine Definition für sie? Unversehens fallen einem die Worte vom Jüngsten Gericht ein. Aber auch da wird einem nicht leichter ums Herz, wenn man keine Rache will, sondern Gerechtigkeit erwartet.
Sie fragen nach den Quellen der Gerechtigkeit und was mir half, diese zu orten? Wenn ich das nur wüsste. Ich möchte glauben – in der Liebe zum Menschen, der geboren wurde, frei und glücklich zu sein. Alle Ideologien wie auch jede staatliche Ordnung verblassen dagegen. Und wenn diese Ordnung etwas zählen will, dann nur, wenn sie die Gerechtigkeit am höchsten wertet und bestätigt.
Ikeda: Nach all dem Unheil, das über ihn hereingebrochen war, rief Hiob voller Schmerz aus: »Wie viel ist meiner Missetaten und Sünden?« Auch im Osten kennen wir diese Frage, etwa bei Shiba Sen, einem Historiker des alten China, der durch ein kaiserliches Urteil unschuldig verurteilt wurde und gequält fragte: »Gibt es denn Gerechtigkeit am Firmament?« Da wie dort ist der Mensch vom heißen Drang nach Gerechtigkeit durchdrungen.
Ihre eigenen Worte über die Ursprünge der Gerechtigkeit, die in der Liebe zum Menschen liegen, lassen die Gefühle auf das Wesen der Dinge hin sublimieren. Das kann nur der Mensch sagen, der im persönlichen und gesellschaftlichen Leben vielen Prüfungen ausgesetzt war.
Ihr schmerzhaftes Geständnis lautet: »Ich streite mit mir selbst und demjenigen, der ich früher war.« Ich bin Ihnen für diese Worte zutiefst dankbar und bewahre sie in meinem Herzen auf. Sie drücken die Tragödie aus, die eine totalitäre Ideologie – die »große Lehre« – über die Menschen bringt, die in der sowjetischen Gesellschaft mehr als ein halbes Jahrhundert herrschte, die Seelen zerriss und entstellte. Nehmen wir an, dass viele Sowjetmenschen, wenngleich in unterschiedlichem Maß, zu einem dem Ihren ähnlichen Schicksal verurteilt waren, dürfen wir uns nicht wundern, wenn nun mancher, nach dem Wegfall der »großen Lehre«, keinen geistigen Rückhalt findet. Und es ist nur zu verständlich, dass die herrschende Stimmung im Volk aus Hass besteht. Ihr Eingeständnis deutet darauf hin, wie breit und tief der Abgrund ist, der sich nach der siebzigjährigen materialistischen Erziehung herausbildete. Die Gesellschaft dürfte lange brauchen, um den Materialismus im Streben nach göttlicher Rettung und Gerechtigkeit zu überwinden. Allerdings vollziehen sich Modernisierungen, die das Tempo der Säkularisierung beschleunigen, überall in der Welt. Und dieser Vorgang dürfte sich kaum mehr rückgängig machen lassen.
Jedenfalls sollten wir unser Augenmerk stets auf den Menschen und die Menschlichkeit richten. André Gide besuchte die Sowjetunion in den Dreißigerjahren, als der Bolschewismus Triumphe feierte, aber er warnte die Welt schon damals vor den Gefahren des Totalitarismus. Die Angriffe vonseiten der Linken kümmerten ihn herzlich wenig, er beharrte auf seinem Standpunkt und verteidigte den Menschen, die Menschheit und Menschlichkeit. Lassen Sie uns in diesem Sinn das Wesen des Humanismus verstehen und unser Gespräch fortsetzen.
Was ernährt die Kulturen?
Ikeda: Bekanntlich haben in den ersten Jahren nach der russischen Revolution, als man nach Gedrucktem hungerte, die Dichter in Kaffeehäusern, bei Begegnungen und Versammlungen ihre Gedichte rezitiert. In unserer Zeit ist die Rezitation durch Schauspieler im Fernsehen und in Theatern zu einer angesehenen Kunstgattung geworden.
Die Gesellschaften der Lieder- und Literaturfreunde, die während der letzten Jahre in Japan aufgekommen sind, bilden vorerst noch eine Ausnahme.
Nach meiner Ansicht manifestiert die Kunst ihre Wirksamkeit nicht nur in einseitigen Handlungen der Schriftsteller, Schauspieler und anderen Kulturschaffenden, sondern bei aktiver Anteilnahme der Leser, Zuschauer und Hörer. Erst dann stellt sich das Gefühl der Befreiung ein; die lebendige Wirkungskraft der Kunst kommt zur Geltung.
Das Theater des antiken Griechenlands zeichnete sich dadurch aus, dass die Bühne dem Publikum nah war, der Zuschauer wurde in die dramatische Handlung mit einbezogen. Das galt auch für das Theater Shakespeares. Schauspieler und Publikum lebten, noch mehr, als das auf Schriftsteller und Leserschaft zutrifft, gleichsam in einer Welt. Sie erfuhren dasselbe, Freud und Leid. Keine geistigen Mauern trennten ihre Herzen, sie schwangen im Gleichklang. Ein lebendiges Geschehen berührte die zartesten Saiten der Seele.
Mit der Entwicklung der modernen Gesellschaft sind diese Bedingungen allmählich leider abhandengekommen. Nach meiner Meinung darf man aber nicht hinnehmen, dass die Kraft der Einwirkung, die der Kunst ursprünglich zu eigen ist, geschwächt wird oder gar ganz verschwindet.
Aitmatow: Der unmittelbare Umgang mit der Kunst und die Einbeziehung des Forums sind eine besondere Art der demokratischen Kultur. Sagen, Epen, Wandertheater, Sängerfeste von Barden und Poeten sind nationale Formen der Volkskunst. Ihr Inhalt ist zutiefst national und enthält zugleich allgemeinmenschliche Werte, die unsere offizielle Klassenideologie noch vor gar nicht so langer Zeit als Ausgeburt des feudal-patriarchalischen Bewusstseins geschmäht hat. Für unsere sozialistische Kultur galt sie deshalb als etwas Feindliches und sollte schlechthin ausgerottet werden.
Und man hätte diese Kunst ausgerottet, wäre sie nur zu packen gewesen. Aber das Epos wurde in den Tiefen der Volksseele aufbewahrt. Ein erstaunliches Phänomen der Kunst. Ein epischer Ozean im Gedächtnis von Generationen, der von Jahrhundert zu Jahrhundert weiterwogte. Kann sich überhaupt ein Mensch so einen »Ozean« merken? Ja, es geht. Ich verkehrte viele Jahre mit Sajakbaj Karalajew, einem hervorragenden und einzigartigen Erzähler. Er kannte eine Million Zeilen des ozeangleichen Manas. Ich habe noch die letzten großen Erzähler dieses kirgisischen Epos erlebt. Wahrhaft bedeutende Persönlichkeiten, die Poesie und Weisheit des Volkes in sich vereinigten. Lassen Sie mich von einer Begebenheit erzählen, deren Zeuge ich sein durfte.