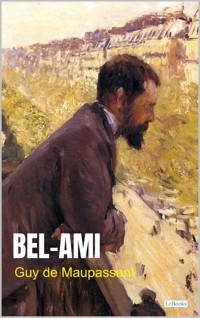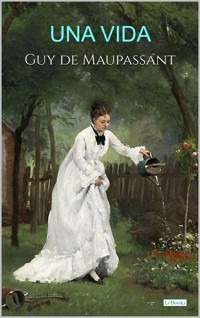9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
George Duroy, genannt Bel-ami, ist ein Mann mit großen Ambitionen und bescheidenen Fähigkeiten. Dennoch schafft er es quasi über Nacht die Karriereleiter als Journalist zu erklimmen und in die vornehme Pariser Gesellschaft aufzusteigen. Er sieht blendend aus, hat eine überwältigende Ausstrahlung und unwiderstehlichen Charme – und ein untrügliches Gespür dafür, was ihn nach vorne bringt und zum Liebling aller macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Georges Duroy ist ein Mann mit großen Ambitionen und bescheidenen Fähigkeiten. Er ist ein Abenteurer ohne Skrupel, der alles daransetzt, nach oben zu kommen. Er erklimmt in kürzester Zeit die Karriereleiter als Journalist und steigt in die vornehme Pariser Gesellschaft auf. Durch kühl kalkulierte Liebesabenteuer und Ehen wird Duroy schnell zum mächtigen Pressezaren. Er sieht blendend aus, hat eine überwältigende Ausstrahlung und unwiderstehlichen Charme – und ein untrügliches Gespür dafür, was ihn nach vorn bringt und zum Liebling aller macht, zum Bel-Ami.
Dieser Roman über die Presse als Machtinstrument begründete Maupassants Ruhm, der bis heute andauert.
Henri-René-Albert-Guy de Maupassant wurde 1850 auf Schloß Miromesnil/Seine-Inférieure geboren. Er ist einer der großen Romanciers Frankreichs. Existentielle Konflikte, Milieuschilderungen und psychologische Analyse machen seine Romane und Novellen zur auch heute noch fesselnden Lektüre. Er starb 1893 in Passy bei Paris.
Von Guy de Maupassant ist im insel taschenbuch außerdem erschienen: Pierre und Jean. Die Geschichte zweier Brüder
Guy de Maupassant
Bel-Ami
Aus dem Französischen vonFriedrich von Oppeln-Bronikowski
Umschlagabbildung: © studiocanal 2012
Studiocanal präsentiert eine Red Wave Production in Zusammenarbeitmit XIX Film, Protagonist Pictures und Rai Cinema Robert Pattinson, Uma Thurman, Kristin Scott, Thomas Christina Ricci und Colm Meany »Bel Ami«
Casting: Susie Figgis · Musik: Lakshman Joseph de Saram, Rachel PortmanKamera: Stefano Falivene · Schnitt: Masahiro Hirakubo, Gavin BuckleySzenenbild: Attila E. Kovacs · Kostüm: Odile Dicks-Mireaux · Maske: Jenny ShircoreKopruduzent: Laurie Borg · Executive Producer: Simon FullerDrehbuch: Rachel Bennette · Nach dem Roman von: Guy de MaupassantProduzent: Uberto Pasolini · Regie: Declan Donnellan, Nick Ormerod
www.belami.studiocanal.de
eBook Insel Verlag Berlin 2012
© Insel Verlag Berlin 2012
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des
öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung
durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form
(durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren)
ohne schriftliche Genehmigung des Verlages
reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme
verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Satz: Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn
eISBN 978-3-458-76651-3
www.insel-verlag.de
Bel-Ami
Erster Teil
Kapitel 1
Als die Kassiererin ihm auf sein Fünffrankenstück herausgegeben hatte, verließ Georges Duroy das Restaurant.
Da er ein schmucker Kerl war, sowohl von Natur wie durch seine soldatische Haltung als alter Unteroffizier, so warf er sich in die Brust, drehte seinen Schnurrbart mit gewohnter militärischer Bewegung und ließ einen raschen, umfassenden Blick über die verspäteten Tischgäste schweifen, einen jener Blicke schöner Männer, die wie Angelhaken um sich greifen.
Die Frauen blickten ihm nach: drei kleine Arbeiterinnen, eine Musiklehrerin in mittleren Jahren, schlecht frisiert und vernachlässigt, mit immer staubigem Hute, immer schief sitzendem Kleide; ferner zwei Bürgerfrauen mit ihren Männern, die in diesem Winkelrestaurant ihren festen Mittagstisch hatten.
Als er auf der Straße war, blieb er einen Augenblick unschlüssig stehen und bedachte sich, was er tun sollte. Es war der 28. Juni, und er hatte für den Rest des Monats gerade noch drei Franken vierzig in der Tasche. Somit hatte er die Wahl zwischen zwei Mittagessen ohne Frühstück oder zwei Frühstücken ohne Mittagessen. Er überlegte sich, daß das Frühstück nur zweiundzwanzig Sous kostete, während die Hauptmahlzeit dreißig Sous erforderte. Wenn er also mit dem Frühstück vorliebnahm, blieb ihm noch ein Franken zwanzig übrig, gerade soviel, als zweimal Brot mit Wurst und zwei Glas Bier auf den Boulevards kosteten: dies war nämlich seine Hauptausgabe und sein Hauptvergnügen am Abend. Und so schlenderte er denn die Rue Notre Dame de Lorette hinunter.
Er ging wie früher, wo er noch den Husarendolman trug, die Brust aufgeworfen, die Beine etwas nach außen gedrückt, als ob er just aus dem Sattel käme. So schritt er rücksichtslos durch die Menge, streifte die Schultern der Vorübergehenden und rempelte sie an, um selbst nicht ausweichen zu müssen. Seinen rauhgewordenen Zylinder hatte er schief auf das Ohr gesetzt, und seine Schritte schallten auf dem Pflaster. Er schien immerfort etwas herauszufordern, die Menschen, die Häuser, die ganze Stadt, wie es sich für einen schmucken Soldaten gebührt, der ins Zivil hat zurückkehren müssen.
Obwohl er einen fertigen Anzug zu sechzig Franken trug, so besaß er doch eine gewisse, zwar aufdringliche und etwas gewöhnliche, aber doch tatsächliche Eleganz. Er war groß, gut gewachsen, blond, von einem kastanienbraunen, etwas rötlichen Blond, hatte einen hochgedrehten Schnurrbart, der sich auf seiner Oberlippe zu kräuseln schien, klare, blaue Augen mit einer ganz kleinen Pupille und natürlich gelocktes Haar mit dem Scheitel in der Mitte. So glich er ganz dem Leichtfuß in den Kolportageromanen.
Es war einer jener Sommerabende, wo keine Luft in Paris ist. Die Stadt war heiß, wie ein Dampfbad, und schien an diesem erstickenden Abend zu schwitzen. Die Wasserablässe hauchten verpestete Dünste aus ihrem granitenen Munde, und aus den Küchen im Untergeschoß drang durch die niedrigen Fenster der widrige Geruch von Spülwasser und alten Saucen.
Die Portiers saßen in Hemdärmeln rittlings auf ihren Rohrstühlen und rauchten die Pfeife unter den Hofeinfahrten. Und die Passanten gingen mit müden Schritten, barhäuptig, den Hut in der Hand.
Als Georges Duroy den Boulevard erreichte, blieb er abermals stehen, unschlüssig, was er tun sollte. Er hatte jetzt Lust, in die Champs-Élysées und die Avenue de Bois de Boulogne zu gehen, wo er unter den Bäumen etwas Luft schöpfen wollte. Aber zugleich quälte ihn ein anderes Verlangen: nach einem Liebesabenteuer.
Wie er das finden sollte, wußte er nicht. Doch er wartete darauf seit drei Monaten, tagaus, tagein, Abend für Abend. Dank seinem hübschen Gesicht und seinem galanten Wesen stahl er sich wohl hin und wieder ein bißchen Liebe; doch er hoffte stets auf mehr und auf Besseres.
Mit heißem Blut und leerer Tasche regte er sich auf, wenn die Dirnen ihn anstreiften und an den Straßenecken flüsterten: »Komm mit, hübscher Junge!« Doch er wagte ihnen nicht zu folgen; er konnte sie ja nicht bezahlen; und er wartete auch auf etwas Besseres, auf andere, minder gemeine Küsse.
Trotzdem liebte er die Orte, wo die öffentlichen Mädchen herumwimmelten, ihre Ballokale, ihre Cafés, ihre Straßen. Er mochte sie gern mit den Ellenbogen streifen, sie anreden, duzen, ihre aufdringlichen Parfüms einatmen, ihre Nähe fühlen. Sie waren doch schließlich Frauen, zur Liebe bestimmt. Er verachtete sie nicht mit dem angeborenen Abscheu des Familienmenschen.
Er lenkte die Schritte nach der Madeleinekirche und folgte dem Menschenstrom, der, von der Hitze bedrückt, träg dahinflutete. Die großen Cafés waren überfüllt; die Gäste saßen zum Teil auf dem Bürgersteig in dem blendenden, grellen Lichte der erleuchteten Spiegelscheiben. Vor ihnen, auf kleinen runden oder viereckigen Tischen, standen Gläser mit roten, gelben, grünen, braunen, in allen Farben schillernden Flüssigkeiten; und in den Karaffen sah man große, durchsichtige Eisstücke glänzen, die das schöne, klare Wasser kühlten.
Duroy hatte seine Schritte verlangsamt. Seine Kehle war wie ausgetrocknet. Ein brennender Durst, der Durst eines heißen Sommerabends, quälte ihn, und er dachte immerfort an das köstliche Gefühl, wenn ein kaltes Getränk durch die Kehle rinnt. Aber wenn er heute abend nur zwei Glas Bier trank, so war es mit dem kargen Abendbrot für morgen vorbei; und das Hungerleiden am Monatsende war ihm nur zu wohl bekannt.
Er sagte sich: »Bis zehn Uhr muß ich es aushalten; dann trink ich im Américain meinen Schnitt. Donnerwetter, was bin ich durstig!« Und er blickte all diese Menschen an, die da an den Tischen saßen und tranken, die sich ihren Durst löschen konnten, soviel sie wollten. Er schlenderte in kecker, herausfordernder Haltung an den Cafés vorüber und taxierte mit raschem Blick nach dem Aussehen und der Kleidung jedes Gastes, wieviel Geld er wohl bei sich trug. Und ein Zorn ergriff ihn gegen diese ruhig dasitzenden Leute. Wenn man ihre Taschen durchsuchte, so würde man Gold, Silber und Kleingeld finden. Durchschnittlich mußte jeder zwei Zwanzigfrankenstücke bei sich haben; es waren ihrer wohl hundert im Café. Hundert mal zwei Zwanzigfrankenstücke machte viertausend Franken! »Die Schweine!« brummte er und ging mit wiegenden Schritten weiter. Hätte er einen an einer Straßenecke im Dunkeln stellen können, weiß Gott, er hätte ihm unbedenklich den Hals umgedreht, wie den Hühnern der Bauern im Manöver!
Und er dachte an seine zwei Dienstjahre in Afrika und wie er die Araber in den kleinen Garnisonen im Süden ausgeplündert hatte. Und ein grausames, lustiges Lachen umspielte seine Lippen, als er eines Streiches gedachte, der drei Leuten vom Stamme der Ouled-Alan das Leben gekostet und ihm und seinen Kameraden zwanzig Hühner, zwei Schafe und Gold eingebracht hatte und Stoff zum Lachen für ein halbes Jahr.
Die Täter waren nie entdeckt worden; übrigens hatte man nicht nach ihnen geforscht, da der Araber sozusagen als natürliche Beute des Soldaten gilt.
In Paris war das anders. Da konnte man nicht mit dem Säbel an der Seite und dem Revolver in der Faust, fern von der bürgerlichen Gerichtsbarkeit, in voller Freiheit drauflosrabuschern. Er wünschte seine zwei Jahre in Afrika zurück. Wie schade, daß er nicht da unten geblieben war! Er hatte sich Besseres erhofft, als er heimkehrte. Aber nun! … Ja, jetzt hatte er was Rechtes!
Er bewegte die Zunge schnalzend im Munde herum, als wollte er die Trockenheit seines Gaumens feststellen.
Die Menge schob sich langsam und matt an ihm vorüber, und er dachte immer noch: »Dieses Pack! All diese Tröpfe haben Geld in der Tasche!« Er rempelte die Leute mit der Schulter an und pfiff eine lustige Weise. Herren, die er geschubst hatte, drehten sich schimpfend um; Frauen schalten: »So ein Rüpel!«
Er ging am Vaudeville vorbei und blieb vor dem Café Américain stehen; er fragte sich, ob er nicht seinen Schnitt trinken sollte; so peinigte ihn der Durst. Ehe er sich entschloß, blickte er nach den erleuchteten Uhren mitten auf dem Fahrdamm. Es war ein Viertel nach neun. Er kannte sich: sobald das Glas Bier vor ihm stand, goß er es herunter. Was sollte er nachher bis elf Uhr anfangen?
Er ging weiter. »Ich werde bis zur Madeleine gehen«, sagte er zu sich, »dann kehre ich ganz langsam wieder um.«
Als er an die Ecke des Opernplatzes kam, begegnete er einem dicken jungen Manne, dessen Gesicht er schon irgendwo gesehen haben mußte.
Er begann ihm zu folgen und suchte sich zu erinnern, während er halblaut vor sich hin sprach: »Zum Teufel, wo kenne ich diesen Kerl her?«
Er zermarterte sich das Hirn, ohne daß es ihm einfiel; dann plötzlich erschien ihm derselbe Mensch durch ein eigentümliches Spiel des Gedächtnisses weniger dick, jünger, in Husarenuniform. »Halt, Forestier!« rief er ganz laut, seine Schritte beschleunigend, und klopfte dem vor ihm Gehenden auf die Schulter. Dieser drehte sich um, blickte ihn an und fragte: »Was wünschen Sie, mein Herr?«
Duroy begann zu lachen: »Erkennst du mich nicht?«
»Nein.«
»Georges Duroy von den sechsten Husaren.«
Forestier streckte ihm beide Hände entgegen: »Ah, alter Junge! Wie geht's dir denn?«
»Ausgezeichnet. Und dir?«
»Oh, mir geht's nicht sehr gut. Denke dir, ich hab's auf der Lunge. Ich huste das halbe Jahr lang. Ich habe mir in Bougival einen Katarrh geholt in dem Jahr, wo ich nach Paris zurückkam; es ist jetzt vier Jahre her.«
»So, du siehst aber doch gesund aus.«
Und Forestier nahm den Arm seines alten Kameraden und erzählte ihm von seiner Krankheit, von den Ärzten, die er konsultiert hatte, deren Meinungen und Ratschlägen und der Schwierigkeit, in seiner Stellung ihren Verordnungen zu folgen. Er sollte den Winter im Süden zubringen; aber wie konnte er das? Er war verheiratet, Journalist, und hatte eine sehr gute Stellung.
»Ich habe den politischen Teil bei der ›Vie française‹, die Senatsberichte für den ›Salut‹ und schreibe hin und wieder literarische Feuilletons für den ›Planète‹. Ja, ich habe meinen Weg gemacht!«
Duroy blickte ihn erstaunt an. Er sah recht verändert, recht gereift aus. Er hatte jetzt das Auftreten, die Haltung und Kleidung eines selbstgewissen, sichergestellten Mannes und ein Bäuchlein, als ob er gut speiste. Früher war er mager, schmal und beweglich gewesen, ein farbiger Mensch, der Geschirr zerbrach, geräuschvoll und ewig in Unruhe. Paris hatte ihn binnen drei Jahren total umgewandelt; er war gesetzt und stark geworden und hatte an den Schläfen ein paar graue Haare, wiewohl er nicht älter als siebenundzwanzig Jahre war.
»Wohin gehst du?« fragte Forestier.
»Nirgends«, antwortete Duroy. »Ich bummle nur ein bißchen, eh' ich nach Hause gehe.«
»Schön; willst du mich nach der ›Vie française‹ begleiten? Ich habe da Korrekturen zu lesen; nachher können wir zusammen ein Glas Bier trinken.«
»Ich begleite dich.«
Damit setzten sie sich in Gang, Arm in Arm, mit der leichten Vertraulichkeit, die zwischen Schulkameraden und Waffengefährten herrscht.
»Was treibst du in Paris?« fragte Forestier.
Duroy zuckte die Achseln: »Ich verhungere schlecht und recht … Als meine Dienstzeit ablief, wollte ich hierher, um … um mein Glück zu machen oder vielmehr um in Paris zu leben; und nun bin ich schon ein halbes Jahr im Bureau der Nordbahn angestellt, mit fünfzehnhundert Franken jährlich, kein bißchen mehr.«
»Zum Teufel«, murmelte Forestier, »das ist nicht sehr viel.«
»Das glaub' ich. Aber was soll ich anfangen? Ich stehe allein, ich kenne keine Seele; ich kann mich niemandem empfehlen. An gutem Willen fehlt's mir nicht, aber an Mitteln.«
Sein Kamerad maß ihn vom Kopf bis zu den Füßen, als praktischer Mann, der einen Gegenstand abschätzt; dann versetzte er in überzeugtem Tone: »Sieh mal, mein Junge, hier hängt alles vom Auftreten ab. Ein etwas gewitzigter Mensch wird leichter Minister als Bureauvorsteher. Man muß fordern und nicht bitten. Aber wie zum Henker kommt es, daß du nichts Besseres gefunden hast als eine Stelle bei der Nordbahn?«
»Ich habe überall gesucht«, antwortete Duroy, »und nichts gefunden. Augenblicklich habe ich zwar etwas in Aussicht; man bietet mir eine Stelle als Stallmeister in der Reitbahn von Pellerin an. Da bekomme ich mindestens dreitausend Franken.«
Forestier blieb kurz stehen. »Mach doch so was nicht, das ist ja dumm, wo du zehntausend Franken verdienen kannst. Damit verdirbst du dir mit einem Schlag deine Zukunft. In deinem Bureau sieht man dich wenigstens nicht, kein Mensch kennt dich; wenn du was kannst, verläßt du es einfach und machst deine Karriere. Bist du aber mal Stallmeister, dann ist's aus. Das ist so ähnlich, als ob du Haushofmeister in einem Hause wärest, wo ganz Paris verkehrt. Hast du vornehmen Leuten oder ihren Söhnen erst Reitstunden gegeben, so gewöhnen sie sich nie mehr daran, dich als ihresgleichen anzusehen.«
Damit schwieg er, dachte ein paar Augenblicke nach und fragte dann: »Hast du das Abiturium gemacht?«
»Nein, ich bin zweimal durchgefallen.«
»Das tut nichts, wenn du nur die Schule bis zuletzt besucht hast. Wenn von Cicero oder Tiberius die Rede ist, dann weißt du doch ungefähr, was das ist?«
»Ungefähr, ja.«
»Gut. Mehr weiß keiner davon, ausgenommen Stücker zwanzig Dummköpfe, die nicht soviel Grips haben, sich durchzusetzen. Es ist ja nicht so schwierig, gebildet zu scheinen; es kommt nur auf eins an: sich nicht in flagranti ertappen zu lassen, wenn man etwas nicht weiß. Man dreht und wendet sich, man weicht dem Hindernis aus, umgeht es und leimt die anderen mit Hilfe des Konversationslexikons. Die Menschen sind allesamt dumm wie Gänse und unwissend wie Karpfen.«
Er sprach mit ruhiger Ironie, wie einer, der das Leben kennt, und lächelte mit einem Blick auf die vorüberflutende Menge. Plötzlich aber begann er zu husten und blieb stehen, bis der Anfall vorüber war. Dann fuhr er in mutlosem Tone fort: »Ist es nicht ein Elend, daß man diese Bronchitis nicht los wird? Dabei sind wir im Hochsommer. Ha! Im Winter geh ich nach Mentone, um mich auszukurieren. Was kann's helfen, mein Gott, die Gesundheit geht vor.«
Sie kamen zum Boulevard Poissonnière vor eine große Glastür, hinter der eine Zeitung mit der Außen- und Innenseite angeklebt war. Drei Leute standen davor und lasen sie.
Über der Tür prangte in riesiger Flammenschrift wie ein Reklameschrei: »La Vie française«. Und die Passanten, die plötzlich in den Lichtschein dieser drei leuchtenden Worte gerieten, erschienen mit einem Male lichtübergossen, klar und deutlich, wie am hellen Mittag, um sofort wieder ins Dunkel zurückzutreten.
Forestier öffnete die Tür. »Tritt ein!« sagte er.
Duroy trat ein, stieg eine pomphafte, schmutzige Treppe hinauf, die man von der ganzen Straße aus sehen konnte, gelangte in ein Vorzimmer, in dem zwei Bureaudiener seinen Gefährten grüßten, und endete dann in einer Art Wartezimmer, einem verstaubten und verwohnten Raume mit schmutziggrüner Tapete aus falschem Samt, die voller Flecken und hier und da durchlöchert war, als hätten die Mäuse sie angeknabbert.
»Setz dich«, sagte Forestier, »ich komme in fünf Minuten wieder.«
Und er verschwand in einer der drei Türen, die in dieses Zimmer führten.
Ein merkwürdiger, eigenartiger, undefinierbarer Geruch, der Geruch aller Redaktionsräume, herrschte. Duroy wartete unbeweglich, etwas verschüchtert und vor allem überrascht. Von Zeit zu Zeit liefen Leute an ihm vorbei; sie kamen aus der einen Tür und verschwanden durch die andere, noch ehe er Zeit gehabt hatte, sie anzusehen.
Es waren teils junge, sehr junge Leute mit geschäftiger Miene, in der Hand ein Blatt Papier haltend, das bei ihrem Laufen im Winde flatterte, bald Setzer, unter deren schwarzbespritztem Leinwandkittel ein sauberer, weißer Hemdkragen und eine elegante Tuchhose zum Vorschein kamen. Sie trugen vorsichtig bedruckte Papierstreifen, frische, noch feuchte Korrekturfahnen. Bisweilen kam ein kleines Herrchen vorbei, dessen Anzug eine auffällige Eleganz zeigte; die Taille des Überrocks war zu eng, die Beinkleider zu fest anliegend, die Stiefel zu spitz: es war irgendein Reporter aus der Gesellschaft, der die Nachrichten des Abends brachte.
Dann kamen noch andere, gravitätisch und mit wichtiger Miene; sie trugen Zylinder mit flachen Rändern, wie um sich durch diese Hutform von der übrigen Menschheit abzuheben.
Forestier kam wieder, Arm in Arm mit einem hochgeschossenen, mageren Menschen in den dreißiger Jahren. Dieser war im Gesellschaftsanzug mit weißer Krawatte, hatte dunkles Haar, einen Schnurrbart mit scharfgedrehten Spitzen und eine unverschämte, selbstbewußte Miene.
Forestier sagte: »Adieu, verehrter Meister!«
Der andere drückte ihm die Hand: »Auf Wiedersehen, mein Lieber!« Damit ging er pfeifend treppab, den Spazierstock unter dem Arme.
»Wer ist das?« fragte Duroy.
»Das ist Jacques Rival, weißt du, der berühmte Berichterstatter, der Duellreporter. Er hat eben seine Korrekturen gelesen. Garin, Montel und er sind die drei ersten Berichterstatter für geistiges Leben und Tagesereignisse, die wir in Paris haben. Er verdient sich hier seine dreißigtausend Franken für zwei Artikel wöchentlich.«
Im Weitergehen begegneten sie einem kleinen, dicken Herrn mit langen Haaren und unsagbarem Äußern, der prustend die Treppe heraufkam.
Forestier grüßte ihn sehr tief. »Norbert von Varenne«, sagte er. »Der Dichter der ›Erloschenen Sonnen‹, noch heute ein Mann, der hoch bezahlt wird. Jede Geschichte, die er uns gibt, kostet dreihundert Franken, und die längsten haben noch nicht zweihundert Zeilen. Aber wir wollen ins Néapolitain gehen, ich komme nachgerade vor Durst um.«
Sobald sie an dem Kaffeetisch Platz genommen hatten, rief Forestier: »Zwei Bier« und goß das seine in einem Zuge herunter, während Duroy es in kleinen Schlucken trank, mit Genuß und Verstand, wie einen seltenen Leckerbissen.
Sein Gefährte schwieg. Er schien nachzudenken. Plötzlich fragte er: »Warum willst du es nicht mit dem Journalismus versuchen?«
Der Gefragte blickte ihn überrascht an; dann sagte er: »Aber … ich habe doch … noch nie was geschrieben.«
»Bah! Du versuchst es halt, du machst einen Anfang. Ich könnte dich ganz gut brauchen, um Erkundigungen einzuziehen, Besuche und Gänge zu machen. Du bekämst zu Anfang zweihundertfünfzig Franken und die Droschken bezahlt. Soll ich mit dem Direktor reden?«
»Ei, gewiß, sehr gern.«
»Nun, dann komm doch morgen zu mir zum Essen. Ich habe nur fünf oder sechs Gäste, den Direktor, Herrn Walter mit Frau, Jacques Rival und Norbert von Varenne, die du eben gesehen hast, und noch eine Freundin meiner Frau. Einverstanden?«
Duroy zögerte, errötete und wurde verwirrt. Endlich murmelte er:
»Ich habe nämlich … nicht den passenden Anzug.«
Forestier war verblüfft. »Du hast keinen Gesellschaftsanzug? Verdammt! Das ist aber dringend nötig. In Paris, siehst du, ist's besser, man hat kein Bett, als keinen Frack.«
Dann wühlte er in seiner Westentasche und zog plötzlich ein paar Goldstücke hervor, nahm zwei Louisdor, legte sie vor seinen alten Kameraden und sagte in kordialem, vertraulichem Tone: »Du wirst es mir wiedergeben, wenn du es kannst. Borge oder kaufe dir auf Rechnung den nötigen Anzug und mache eine Anzahlung darauf; kurzum, arrangiere dich, aber komm morgen zum Essen um halb acht, Rue Fontaine siebzehn.«
Duroy steckte verwirrt das Geld ein und stammelte: »Du bist zu liebenswürdig; ich danke dir vielmals; verlaß dich darauf, ich vergesse es nicht.«
»Schon gut«, unterbrach ihn der andere. »Noch ein Bier, was?« Und er rief: »Kellner, zwei Bier!«
Als sie diese getrunken hatten, fragte der Journalist:
»Willst du noch ein Stündchen bummeln?«
»Ei, gewiß.«
Damit schlenderten sie wieder nach der Madeleine hinunter.
»Was sollen wir machen?« fragte Forestier. »Man sagt, in Paris hat man stets was zu tun, wenn man bummelt. Das ist nicht wahr. Wenn ich des Abends bummle, weiß ich nie, wohin ich gehen soll. Ein Gang durchs Bois ist nur amüsant mit einem weiblichen Wesen, und man hat nicht immer eins bei der Hand; die Cafés mit Musik mögen meinen Apotheker und seine Frau zerstreuen, mich nicht. Also was anfangen? Nichts. Man müßte hier einen Sommergarten haben, wie den Park Monceau, der des Nachts geöffnet ist, wo man ausgezeichnete Musik hört und unter den Bäumen Erfrischungen nimmt. Kein Vergnügungslokal, sondern ein Ort zum Promenieren. Man müßte hohe Eintrittspreise nehmen, um die schöne Welt herbeizulocken. Man könnte auf kiesbestreuten Alleen flanieren, die elektrisch beleuchtet sind, und sich setzen, wenn man Lust hätte, um die Musik anzuhören, aus größerer oder geringerer Entfernung. So etwas gab es früher bei Muzard, aber mit einem Stich ins Ballokalhafte, zu viel Tanzerei und zuwenig Platz, zuwenig Schatten und Dunkelheit. Es müßte ein sehr schöner, sehr großer Garten sein. Das wäre reizend. Wohin willst du gehen?«
Duroy wußte vor Verlegenheit nichts zu sagen. Endlich faßte er sich ein Herz. »Ich kenne die Folies-Bergère nicht. Ich ginge recht gern hin.«
»Die Folies-Bergère!« rief sein Gefährte aus. »Potztausend, da braten wir ja wie im Backofen. Na, meinetwegen, es ist immerhin spaßig.«
Damit drehten sie kurz um und lenkten die Schritte nach der Rue du Faubourg Montmartre.
Die erleuchtete Fassade des Theaters warf grellen Schein in die vier Straßen, die vor ihr zusammenstießen. Eine Reihe von Droschken wartete auf das Ende der Vorstellung.
Forestier trat ein; Duroy hielt ihn an.
»Wir haben die Kasse vergessen.«
Da antwortete der andere mit wichtiger Miene:
»Wenn man mit mir geht, bezahlt man nicht.«
Als sie an der Kontrolle vorbeikamen, grüßten die drei Kontrolleure ihn. Der mittelste reichte ihm die Hand.
»Haben Sie eine gute Loge?« fragte der Journalist.
»Ei, gewiß, Herr Forestier.«
Er nahm den Zettel, der ihm gereicht ward, öffnete die gepolsterte, kupferbeschlagene Tür, und sie standen im Theaterraum.
Tabakdunst verhüllte wie ein leichter Nebel den Hintergrund, die Bühne und die andere Theaterseite. Dieser leichte Nebel, der ununterbrochen in feinen bläulichen Streifen aus all den Zigarren und Zigaretten der Besucher emporquoll, ballte sich an der Decke und bildete unter der mächtigen Wölbung einen Wolkenhimmel von Rauch um den Kronleuchter und über der dicht mit Zuschauern besetzten Galerie.
In dem weiten Vestibül, das zu dem ringsumlaufenden Wandelgang führte, in welchem der Schwarm der geputzten Dirnen mit der dunkelgekleideten Herrenwelt herumflanierte, warteten mehrere Frauenzimmer auf die Ankömmlinge vor einem der drei Ladentische, hinter denen die geschminkten, welken Verkäuferinnen von Getränken und Liebe thronten.
Die hohen Spiegel hinter ihnen warfen das Bild ihres Rückens und die Gesichter der Vorübergehenden zurück.
Forestier durchschritt die Gruppen in raschem Gange, als Mann, der ein Recht auf Ansehen hat. Er trat an eine Logenschließerin heran und sagte: »Loge siebzehn.«
»Hier, bitte, Herr.«
Damit wurden sie in einen kleinen, hölzernen Käfig eingeschlossen, der keine Decke hatte, rot tapeziert war und vier Stühle in der gleichen Farbe enthielt, die so eng aneinanderstanden, daß man sich kaum hindurchzwängen konnte. Die beiden Freunde setzten sich; und rechts und links vor sich erblickten sie eine Reihe ebensolcher Kästen, die sich beiderseits in weitem Halbrund bis zur Bühne zogen und in denen gleichfalls Menschen saßen, von denen man nur die Brust und den Kopf erblickte.
Auf der Bühne machten drei junge Männer in enganliegenden Trikots, ein großer, ein mittelgroßer und ein kleiner, abwechselnd Trapezübungen.
Der Große trat zuerst vor, mit raschen, kurzen Schritten, lächelte und grüßte mit einer Kußhand.
Unter dem Trikot sah man seine Arm- und Beinmuskeln schwellen. Er blies seine Brust auf, um seinen dicken Bauch zu verbergen, und sein Gesicht glich dem eines Friseurgehilfen, denn ein tadelloser Scheitel teilte sein Haar in zwei gleiche Hälften, genau in der Mitte des Kopfes. Mit graziösem Sprung erreichte er das Trapez und umkreiste es dann, mit den Händen daran hängend, wie ein rollendes Rad; bisweilen auch hing er mit ausgestreckten Armen und steifem Körper unbeweglich wagerecht in der leeren Luft, allein durch die Kraft der Handgelenke gehalten.
Dann sprang er ab, grüßte abermals lächelnd unter dem lauten Beifall des Parketts und trat bis an die Wand zurück.
Nun trat der zweite, kleinere vor und wiederholte die gleiche Produktion, desgleichen der dritte, der noch lebhafteren Beifall fand.
Duroy kümmerte sich nicht im geringsten um die Darbietungen, sondern beobachtete mit zurückgewendetem Kopf immerwährend den großen Promenadengang mit seiner Fülle von Herren und Dirnen.
Forestier sagte zu ihm: »Sieh dir mal das Parkett an: nichts als Spießer mit ihren Frauen und Kindern, brave Dummköpfe, die zum Gaffen gekommen sind. In den Logen Stutzer, ein paar Künstler, ein paar Frauenzimmer – Mittelware und hinter uns das spaßhafteste Durcheinander, das in Paris existiert. Was sind diese Männer? Beobachte sie mal. Alles mögliche, alle Berufe und Klassen, aber das Gesindel ist in der Mehrzahl. Da sind Kommis, Bankbeamte, Leute aus den Ministerien, Reporter, Zuhälter, Offiziere in Zivil, Bummler im Frack, die im Restaurant gegessen haben oder aus der Oper kommen, ehe sie zu den Italienern[1] gehen; und dann noch ein ganzer Haufe verdächtiger Individuen, die den Scharfsinn herausfordern … Was die Weiber betrifft, so sind sie alle vom gleichen Schlage: die Halbwelt vom Américain, die Zwanzig- oder Vierzigfrankendirne, die auf einen Fremden pirscht, der hundert bezahlt, und die ihre Stammgäste herbeiwinkt, wenn sie frei ist. Man kennt sie alle seit sechs Jahren; man sieht sie allabendlich, das ganze Jahr lang, an den gleichen Orten, außer wenn sie mal in Saint-Lazare oder in Lourcine im Krankenhaus liegen.«
Duroy hörte nicht mehr zu. Eine jener Frauen hatte sich auf die Brüstung ihrer Loge gelehnt und blickte ihn an. Es war eine dicke Brünette, deren Haut durch die Schminke gebleicht war, mit schwarzen, durch den Farbstift verlängerten und unterstrichenen Augen, die von riesigen künstlichen Brauen umrahmt waren. Die dunkle Seide ihres Kleides straffte sich über ihrem allzu üppigen Busen, und ihre angemalten Lippen, rot wie eine Wunde, verliehen ihr etwas Tierisches, Glühendes, Übertriebenes, das trotzdem die Begierde wachrief.
Sie winkte mit einer Kopfbewegung eine ihrer Freundinnen heran, die gerade vorbeikam, eine Rothaarige, ebenfalls korpulent, und sagte zu ihr so laut, daß man es hören konnte: »Schau, das ist ein hübscher Kerl. Wenn er mich für zweihundert Franken will, sag' ich nicht nein.«
Forestier drehte sich um und schlug Duroy lächelnd auf den Schenkel: »Das gilt dir, du! Du machst Eindruck, mein Lieber, ich gratuliere.«
Der einstige Unteroffizier wurde rot; mechanisch befühlten seine Finger die beiden Goldstücke in seiner Westentasche.
Der Vorhang war gefallen; das Orchester spielte jetzt einen Walzer.
»Wollen wir einen Rundgang durch die Galerie machen?« schlug Duroy vor.
»Wie du willst.«
Sie verließen die Loge und wurden alsbald von dem Strom der Spaziergänger ergriffen, gedrängt, gestoßen, gequetscht und hin und her gerissen, während ein Wald von Hüten vor ihren Augen wogte. Die Frauenzimmer schoben sich, stets zu zweit, zwischen die Herrenmenge; sie schlüpften behend zwischen den Ellbogen, Brüsten und Rücken durch, als fühlten sie sich ganz zu Hause und so wohl wie die Fische im Wasser inmitten dieses Stromes von Männern.
Duroy war entzückt. Er ließ sich treiben, sog wie berauscht die stickige Luft ein, die durch Tabak, Menschenausdünstungen und aufdringliche Parfüms verpestet war. Aber Forestier schwitzte, prustete, hustete.
»Wir wollen in den Garten gehen«, sagte er.
Sie wandten sich nach links in eine Art von Wintergarten, dessen zwei große, geschmacklose Fontänen Kühlung spendeten. Unter Taxusbäumen und Thujas in Kübeln saßen Herren und Damen an Zinktischen und tranken.
»Noch ein Bier?« fragte Forestier.
»Ja, gern.«
Sie setzten sich und beobachteten die Vorübergehenden.
Von Zeit zu Zeit blieb eine der herumstreifenden Dirnen stehen und fragte mit banalem Lächeln: »Laden Sie mich nicht ein?« – Und wenn Forestier erwiderte: »Ja, zu einem Glas Brunnenwasser«, so zog sie ab und murmelte: »Grobian!«
Da tauchte die dicke Brünette, die sich vorhin an die Loge der beiden gelehnt hatte, wieder auf. Sie ging in herausfordernder Weise Arm in Arm mit der dicken Rothaarigen. Sie bildeten wirklich ein hübsches Frauenpaar, eine gute Zusammenstellung!
Sobald sie Duroy erblickte, lächelte sie, als ob ihre Augen sich schon Geheimnisse gesagt hätten. Sie nahm einen Stuhl und setzte sich ruhig ihm gegenüber, lud auch ihre Freundin ein, sich zu setzen; dann bestellte sie mit heller Stimme: »Kellner, zwei Granatsirupe!« Verblüfft sagte Forestier: »Du bist aber ungeniert!«
»Dein Freund hat's mir angetan«, antwortete sie. »Er ist wirklich ein hübscher Kerl. Ich glaube, für ihn könnt' ich Dummheiten machen.«
Duroy wußte vor Schüchternheit nicht, was er sagen sollte. Er drehte an seinem wohlgepflegten Schnurrbart und setzte ein dummes Lachen auf. Der Kellner brachte die Sirupe, und die beiden Freundinnen tranken sie in einem Zuge aus. Dann standen sie auf, und die Braune sagte zu Duroy mit kurzem, freundschaftlichem Kopfnicken, während sie ihm mit dem Fächer leicht auf den Arm schlug: »Danke, Schatz. Du bist nicht sehr gesprächig.«
Damit gingen sie, sich in den Hüften wiegend.
Forestier begann zu lachen. »Sag mal, Alterchen«, begann er, »weißt du, daß du wirklich Erfolg bei den Weibern hast? Das mußt du kultivieren. Es kann dich weit bringen.« Er schwieg eine Sekunde; dann setzte er hinzu, mit dem träumerischen Ton von Leuten, die laut denken: »Durch sie kommt man auch am schnellsten hoch.«
Und da Duroy noch immer lächelte, ohne etwas zu erwidern, fragte er ihn: »Willst du noch bleiben? Ich geh' nach Hause, ich habe genug.«
»Ja«, murmelte der andere, »ich bleibe noch etwas. Es ist ja noch nicht spät.«
Forestier stand auf. »Also lebe wohl, denn! Auf morgen! Vergiß nicht, Rue Fontaine 17, halb acht.«
»Abgemacht; auf morgen. Danke.«
Sie drückten sich die Hände, und der Journalist verschwand.
Sobald er fort war, fühlte Duroy sich frei. Er betastete von neuem die beiden Goldstücke in seiner Tasche; dann stand er auf und ließ seine Blicke suchend durch die Menge schweifen.
Bald erblickte er die beiden Mädchen, die Braune und die Rote, die noch immer mit ihrer bettelstolzen Miene durch den Schwarm der Männer schritten.
Er ging stracks auf sie zu; als er ihnen ganz nahe war, verlor er den Mut.
»Na, hast du die Sprache wiedergefunden?« fragte die Brünette ihn. Er stotterte: »Donnerwetter!« brachte aber kein anderes Wort mehr hervor.
Sie blieben alle drei stehen und hielten die Bewegung der Menge auf, die um sie her in dem Wandelgang strudelte.
Da fragte sie plötzlich: »Kommst du zu mir?«
Und er, vor Begierde bebend, antwortete brutal: »Ja, aber ich habe nur ein Goldstück in der Tasche.«
Sie lächelte gleichgültig: »Das tut nichts.«
Damit nahm sie seinen Arm zum Zeichen ihrer Angehörigkeit.
Als sie das Lokal verließen, überlegte er, daß er sich für die anderen zwanzig Franken bequem einen Frackanzug für den nächsten Abend leihen könnte.
[1] Ins »Théâtre des Italiens«, die heutige komische Oper.
Kapitel 2
»Bitte, wo wohnt Herr Forestier?«
»Im dritten Stock, linke Tür.«
Der Portier antwortete mit freundlichem Tonfall, in dem Hochachtung vor seinem Mieter lag. Und Georges Duroy stieg die Treppe hinauf.
Er war etwas befangen, verschüchtert und fühlte sich unbehaglich. Zum erstenmal in seinem Leben trug er einen Frack, und sein ganzer Anzug machte ihm Sorge. Er fühlte, daß nichts an ihm tadellos war. Seine Stiefel hatten zwar einen guten Schnitt, denn er hielt auf gute Fußbekleidung, waren aber doch nicht aus Lackleder; das Hemd hatte er sich erst am Morgen im Louvre erstanden, und der schmale gestickte Einsatz knitterte bereits. Die Hemden, die er sonst trug, waren mehr oder minder defekt; selbst das am wenigsten zerrissene hatte er nicht anziehen können.
Sein Beinkleid, etwas zu weit, ließ die Form des Beins kaum hervortreten und wickelte sich um seine Waden in dem schlotternden Sitz, den geliehene Kleidungsstücke auf den Gliedern ihres zufälligen Trägers annehmen. Nur der Frack saß leidlich; er paßte fast genau für seine Figur. Langsam stieg er die Treppe hinauf. Sein Herz pochte; er hatte ein banges Gefühl, und vor allem quälte ihn die Figur, sich lächerlich zu machen. Plötzlich sah er einen Herrn im Gesellschaftsanzug sich gegenüber stehen. Sie standen einander so nahe, daß Duroy zurückwich; dann blieb er verblüfft stehen: es war sein eigenes Spiegelbild in einem hohen Wandspiegel, der im Flur des ersten Stockes eine lange Perspektive vortäuschte. Eine Freudenwallung durchzitterte ihn; er fand sich viel besser aussehend, als er geglaubt hatte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!