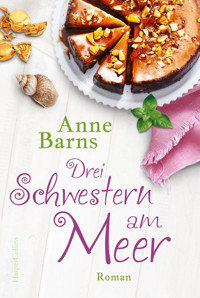9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lässt sich verlorene Zeit wieder aufholen?
Seit ihrer Kindheit schenkt Julia ihrer Mutter Christine Gutscheine – zum Geburtstag, zum Muttertag, zu Weihnachten, eben zu allen Gelegenheiten. Doch eingelöst hat sie nur einen Teil davon. Als Christine unerwartet ins Krankenhaus muss, wird Julia schmerzlich bewusst, wie wenig sie sich die letzten Jahre gekümmert hat – und dass die Zeit mit ihrer Mutter begrenzt ist. Um sie jeden Tag besuchen zu können, zieht Julia vorübergehend in das Haus ihrer Kindheit. Beim Aufräumen findet sie die Gutscheine und nimmt sich vor, alle zu erfüllen, wenn die Mutter nur wieder gesund wird. Nach einer überstandenen OP spricht Christine plötzlich ein paar Worte Friesisch, obwohl sie die Sprache nie gelernt hat. Gemeinsam reisen sie nach Amrum. Dort erkennen beide, was wirklich wichtig ist im Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Originalausgabe
© 2024 by HarperCollins in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg
Covergestaltung von Rothfos & Gabler, Hamburg
Coverabbildung von Private Collection © Max Ferguson / Bridgeman Images
E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783749907267
www.harpercollins.de
Widmung
Für meine Tochter
1.
Es war ein sonniger Tag wie heute, der Weg gesäumt von blühendem Flieder in den Vorgärten. Ich hatte gerade die Blumen gegossen, da sah ich dich mit deiner Oma um die Ecke kommen. Du trugst deine türkisfarbene Tunika, verziert mit hellgelben Schmetterlingen, blaue Leggings und die silbernen Ballerinas, auf die du so stolz warst. Du warst dreieinhalb Jahre alt, liebtest die Farben des Meeres, das Glitzern von Schuppen und Arielle, die Meerjungfrau.
»Mama!«, riefst du, als du mich entdecktest, und ranntest auf mich zu. Dein blondes Haar, das dir sonst bis auf die Schultern fiel, hatte ich am Morgen zu einem Zopf gebunden. Er wippte bei jedem deiner Schritte.
Lächelnd ging ich in die Hocke, breitete die Arme aus, wollte dich auffangen. Wie ich es schon so oft getan hatte.
Aber anstatt in meine Arme zu fliegen, bliebst du plötzlich ein paar Schritte von mir entfernt stehen. Du hast deine kleinen warmen Hände auf meine Wangen gelegt und mich angeschaut.
Wie viel Liebe und Zärtlichkeit in deinem Blick lagen!
»Ich hab dich lieb, Mama«, sagtest du mit einer Aufrichtigkeit, die mich zutiefst berührte.
Es gibt Momente im Leben, die brennen sich in unsere Seele ein und lassen uns nie mehr los. Dieser war einer davon.
Ein Geschenk, das du mir gemacht hast, eine Erinnerung, die ich für immer in meinem Herzen tragen werde.
Du warst und bist mein größter Schatz. Ich werde dich immer lieben, mehr als Worte es je ausdrücken könnten.
2.
Wind kam auf, strich über die Nadeln der Kiefern. Der würzige Duft von Harz und Menthol lag in der Luft. Licht brach durch die Äste der Bäume und zauberte ein sich stetig änderndes Schattenspiel auf den Waldboden. Ein Quellbach schlängelte sich durch das mit Farn und Moos bewachsene Unterholz. Das Plätschern des Wassers wurde begleitet vom Gesang einer Hohltaube.
In der Ferne klopfte ein Buntspecht rhythmisch auf Rinde.
Tok-tok, tok-tok.
Ich stand im Wald, lauschte, versuchte, Kraft aus der Natur zu schöpfen.
Doch Alexanders Worte drängten sich in meine Gedanken. Seine ernste Stimme hallte noch immer in meinen Ohren.
»Wir sind schon lange kein Paar mehr, Julia. Wir leben wie in einer Wohngemeinschaft. Wann haben wir uns das letzte Mal geküsst, Zärtlichkeiten ausgetauscht?«
Vor einem Jahr. Ich, um zu vergessen. Er, um mich vergessen zu lassen. Alexander wusste es, natürlich wusste er es noch. Warum hätte ich darauf antworten sollen?
Vor meinem inneren Auge sah ich ihn, wie er sich durch das dunkle Haar strich, an den Schläfen bereits von Grau durchzogen. Wie er mit sich rang, auf der Suche nach den richtigen Worten. »Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Nicht so. So will ich nicht leben. Du kannst, du willst mir einfach nicht verzeihen. Vielleicht sollten wir uns trennen. Damit wir neu anfangen können, jeder für sich. Was meinst du?«
»Einverstanden.« Ein Wort, das das Ende unserer Ehe besiegelte und das ich ohne zu zögern ausgesprochen hatte. Damit hatte Alexander nicht gerechnet, wie sein überraschter Blick verriet, gefolgt von der Traurigkeit in seiner Stimme. »So einfach willst du es dir machen?«
Ein verlockender Ausweg. »Ja.«
In meiner Vorstellung hatte ich den Wunsch nach getrennten Wegen schon etliche Male geäußert, hatte mir überlegt, wie ich es sagen würde, wann und wo. In meiner Vorstellung war ich die Möglichkeiten durchgegangen, wie es nach der Trennung weitergehen würde. Ob wir das Haus verkauften, ob ich in Frankfurt blieb (wo wir wohnten), nach Kassel zurückging (wo ich aufgewachsen war) oder vielleicht in eine völlig fremde Stadt. Ein kompletter Neuanfang ohne Altlasten. Wenn ich mutig wäre. Hamburg vielleicht, dort lebte eine gute Freundin. Oder doch irgendwo ans Meer?
Wenn es so weit war, würde ich wissen, was ich wollte.
Ich hätte alles vorbereitet. Eine Wohnung gesucht, die Küche eingerichtet, ein Bett gekauft. Wenn es so weit war, würde ich einfach gehen können.
Nun war Alexander mir zuvorgekommen. Und dann hatte er mich doch gebeten, noch einmal in Ruhe darüber nachzudenken.
Das tat ich. Wir würden uns trennen. Es war besser so.
War es das?
Ich spürte in mich hinein.
Wie konnte es sein, dass ich so gefühllos war, so leer? Wir waren seit siebzehn Jahren ein Paar, fünfzehn Jahre verheiratet, seit drei Jahren ausgesprochen (Ich hatte es zuerst laut gesagt und nicht nur gedacht.) unglücklich. Dass wir unser Leben ohne uns lebten. Dass wir etwas ändern mussten, an uns arbeiten, an unserem Wir. Dass ich nicht glücklich war.
Siebzehn, fünfzehn, drei – eins. Ungerade Zahlen mochte ich noch nie. Ich hätte Alexander gleich verlassen sollen. Es war jetzt ein Jahr her. Aber ich hatte an ihm festgehalten. Weil er die Affäre von sich aus beendet hatte. Weil er es bereut hatte. Weil es ein Schrei nach Leben gewesen war. Aber während er sich nun wieder lebendig fühlte und wieder der Mann geworden war, in den ich mich einst verliebt hatte, fühlte ich mich innerlich tot und trauerte. Es war jemand gestorben – wir.
Mein Handy durchbrach die Stille. Alexander rief an. Als hätte er gespürt, dass ich an ihn dachte. Noch immer hatte ich ihm das Lied, das mir vor einer gefühlten Ewigkeit so viel bedeutet hatte, als Klingelton zugeordnet. Das Lied, das wir für unsere Trauung ausgesucht hatten. Van Morrisons Someone Like You.
Ich ignorierte den Anruf.
Kurz darauf versuchte Alexander es noch einmal. Ungewöhnlich für ihn, schon der erste Versuch. Er wusste, dass ich für mich sein wollte. Normalerweise hielt er sich daran. Ein Punkt auf der positiven Seite der Pro- und Kontra-Liste. Wir respektierten unsere Bedürfnisse nach Raum und Abstand.
Es musste wohl etwas Wichtiges sein.
»Ja?«
»Wo bist du?«
»Im Wald.«
»Deine Mutter liegt im Krankenhaus.« Seine Stimme war sanft. »Eine Ärztin hat gerade auf dem Festnetz angerufen. Sie hat mir keine Einzelheiten genannt. Aber sie meinte, es wäre gut, wenn du dich so bald wie möglich auf den Weg machen würdest.«
Mein Magen zog sich zusammen. »Was hat sie? Was ist passiert?«
»Das weiß ich nicht. Die Ärztin wollte mit dir darüber sprechen. Ich habe ihr deine Handynummer gegeben. Aber sie musste in den OP und hat mich gebeten, es dir auszurichten. Und dass sie später versucht, dich noch zu erreichen, es aber nicht versprechen kann, weil sie sonntags nicht voll besetzt sind und sie viel zu tun hat.«
»Wo liegt sie?«
Er zögerte einen Moment, und ich kam ihm zuvor. »In der Klinik, in der auch mein Vater lag?«
»Ja.«
Es musste sich um einen Notfall handeln, meine Mutter hätte ein anderes Krankenhaus gewählt. »Ich komme nach Hause, packe meine Sachen und fahre dann sofort los.«
»Soll ich dich nicht besser abholen?«
»Nein. In spätestens einer Viertelstunde bin ich da.«
Tok-tok, tok-tok.
»Alte Bäume behämmert der Specht am liebsten«, hatte meine Mutter im letzten Jahr zu mir gesagt. Und dass der Arzt bei ihr eine beginnende Osteoporose diagnostiziert habe.
Bis dahin war sie immer gesund gewesen. Doch dann hatte sie sich eine Rippe gebrochen und nicht gewusst, wie es dazu gekommen war. Die damit verbundenen Beschwerden ertrug sie in der ihr eigenen stillen Zurückgezogenheit. Sie beklagte sich nie. Nur in Momenten, in denen sie sich unbeobachtet fühlte, verzog sie vor Schmerz das Gesicht.
War sie deswegen im Krankenhaus? Hatte sie sich wieder etwas gebrochen?
Für einen kurzen Moment schloss ich die Augen und atmete noch einmal tief durch, bevor ich den Pfad verließ, der abseits der Wege durch den Wald führte.
3.
Alexander goss Kaffee in die Thermosflasche, die wir uns für längere Autofahrten zugelegt hatten. Im Hintergrund spielte Klaviermusik, Comptine d’un autre été, leise Töne, die den lichtdurchfluteten Raum erfüllten, die offene Küche, die nahtlos in das Wohnzimmer überging. Inmitten dieses idyllischen Szenarios der vor sich hin summende Mann, der mit einem Lächeln das Eis zu schmelzen vermochte. Alles hätte perfekt sein können.
Noch hatte er mich nicht bemerkt. Ich stand in der Tür und betrachtete ihn. Wie er gewissenhaft den Deckel auf die Flasche schraubte und noch einmal überprüfte, ob sie dicht war. Wie er auf seine Armbanduhr blickte und sich dann plötzlich zur Tür drehte, mich sah.
Und dann sein erleichtertes Lächeln. »Du bist da. Gut.«
Es waren nur ein paar Schritte zu ihm.
Er nahm mich in die Arme und hielt mich fest. Die ungewohnte körperliche Nähe löste die Anspannung in mir. Sein Geruch (das Aftershave mit der frischen Note nach Citrus, das ich ihm geschenkt hatte) so vertraut und doch so fremd. Tränen schossen mir in die Augen, und ich konnte ein Schluchzen nicht unterdrücken.
Er strich mir über den Rücken. »Ich habe noch mal im Krankenhaus angerufen und mich als Sohn ausgegeben. Ein Mitarbeiter hat mich auf die Station weiterverbunden. Deine Mutter liegt auf der Intensiv. Ihr Zustand ist ernst, aber im Moment stabil. Mehr hat mir die Krankenschwester, mit der ich gesprochen habe, nicht sagen können.«
Stabil. Der Zustand, in dem sich auch mein Vater ein paar Tage lang befunden hatte. Bevor er aus dem Krankenbett gefallen war, sich eine Rippe gebrochen, die Lungenentzündung bekommen hatte, den Infekt durch den gelegten Katheter und dann die Sepsis – kurz nachdem ich Alexander gesagt hatte, wie unglücklich ich sei. Aber auf einmal waren andere Dinge wichtiger gewesen als wir. Die Bestattung, die Trauer, das Sortieren von Dokumenten, Behördengänge.
Nun war es wieder so weit. Alexander wollte sich trennen, und doch wollte er es nicht. Ich wollte mich trennen, und doch tat ich es nicht. Denn plötzlich waren andere Dinge wichtiger als wir. Meine Mutter.
Ich löste mich von ihm.
Er holte ein kleines Handtuch aus dem Schrank, hielt es unter fließendes Wasser, wrang es aus und reichte es mir.
Die Kühle tat gut in meinem Gesicht. »Danke.« Ich hatte mich wieder etwas gefasst. »Du hast schon Kaffee gekocht.«
Er lächelte mich an. »Und Brote geschmiert. Wenn du gepackt hast, können wir los.«
»Wir?«
»Egal was war und wie wir uns am Ende entscheiden. Ich lass dich jetzt auf keinen Fall allein fahren. Im Büro habe ich schon angerufen. Johannes weiß Bescheid. Er kommt morgen ohne mich klar. Und wenn wir wissen, wie es deiner Mutter geht, können wir vor Ort überlegen, wie lang ich bleibe.«
»Danke.«
»Doch nicht dafür.« Ein ernster Blick, dann ein leichtes Lächeln. »In Krisen von außen waren wir doch immer füreinander da.« Er sah wieder auf seine Armbanduhr. »Halb zwei, wenn wir bald losfahren, umgehen wir den Berufsverkehr.«
»Eine Viertelstunde, länger brauche ich nicht.«
»Was ist mit Emmi?«
»Die rufe ich an, wenn ich weiß, was los ist.«
Ich stieg die Treppe hinauf in mein Arbeitszimmer, das mittlerweile auch zu meinem Schlafzimmer geworden war. Das Bett war eins vierzig breit, die Matratze bequem. Ursprünglich hatte ich es für Gäste vorgesehen, in dem Wunsch, den Aufenthalt bei uns so angenehm wie möglich zu gestalten, falls sie bei uns übernachten sollten. Aber das war selten der Fall. Meine Mutter hatte es in den neun Jahren, in denen wir hier wohnten, nur zweimal geschafft, uns zu besuchen. Alexanders Eltern und Geschwister hatten ihre Häuser alle in einem Umkreis von etwa fünfzehn Kilometern. Sie fuhren zurück, sobald die Geburtstage oder andere Feierlichkeiten vorüber waren, und wenn es feuchtfröhlich wurde, nahmen sie ein Taxi. Birthe, die Freundin, die ich hier gefunden hatte, war unsere Nachbarin. Sie kam und ging wieder. Nur meine Tochter schlief gelegentlich bei uns im Haus. Dann freute ich mich über das Knarren der alten Holzdielen im Dachgeschosszimmer, die laute Musik, Emilias Lachen und das Klappern von Schubladen und Schranktüren.
Ich setzte mich an den Schreibtisch und ging in Gedanken durch, was ich nach Kassel mitnehmen würde. Das Notebook, die Ladekabel, das Telefon, mein Kopfkissen …
Da ich die lästige Angewohnheit hatte, immer etwas zu vergessen, hatte Alexander irgendwann eine Packliste für mich verfasst, die ich bei Bedarf abhaken und ergänzen konnte. Er hatte eine Schwäche für Listen, während ich eine gewisse Abneigung gegen sie hegte. Insbesondere gegen die, die ich selbst verfasst hatte und die in der obersten Schublade meines Schreibtisches ruhte. Alexander hatte die Pro- und Kontra-Liste vorgeschlagen, in der festen Überzeugung, dass die positive Seite für unsere Ehe länger ausfallen würde. Und das war auch der Fall. Aber immer, wenn ich etwas hinzufügte, wurde mir bewusst, dass ein einziger negativer Punkt ein Vielfaches an Gewicht haben konnte.
Ich straffte meine Schultern und begann, meine Sachen zu packen. Das Notebook, die Ladekabel …
Als ich mit meiner Tasche nach unten kam, reichte Alexander mir meine Brille.
»Sie lag auf der Couch.«
»Und ich habe oben überall nach ihr gesucht.«
»Du brauchst mich.« Ein kurzes Aufblitzen in seinen Augen. »Wer sonst sollte deine Sachen finden?«
Fünf Minuten später saß ich neben meinem Mann im Wagen und schrieb eine Nachricht an Birthe. Ich teilte ihr mit, was passiert war, dass sie allein zum Yoga gehen müsse und dass ich mich bei ihr melden würde, sobald ich mehr Informationen hätte.
Sie wollte nicht warten und rief mich sofort an.
Mein Telefon war mit der Freisprechanlage verbunden. Alexander blickte kurz zu mir rüber, und als ich nickte, nahm er den Anruf entgegen.
»Bist du schon unterwegs? Wo bist du? Wie geht es dir? Morgen ist mein unterrichtsfreier Tag. Ich werde dich auf keinen Fall allein fahren lassen. Ich komme mit.«
Ihre helle, melodische Stimme mochte ich sehr. Birthe sprach nicht, sie sang. Insbesondere dann, wenn sie aufgeregt war.
»Das ist lieb von dir, danke. Aber wir sind bereits auf der Autobahn. Alexander begleitet mich, er fährt.«
»Hallo, Birthe.«
»Hi. Gut, dass du bei Julia bist.« Sie mochte Alexander. Grundsätzlich hatte sie nichts gegen ihn. Ihr missfiel nur, dass es mir nicht gut ging mit ihm. »Haltet mich bitte auf dem Laufenden, falls irgendetwas ist. Soll ich die Blumen gießen und nach der Post sehen?«
»Ich melde mich bei dir, sobald ich im Krankenhaus war. Dann besprechen wir alles.«
»Mach das. Ich sende dir viel Kraft. Und deiner Mutter auch.«
Sie meinte es, wie sie es sagte. Ich verabschiedete mich und lächelte bei der Vorstellung, wie Birthe gleich ein Räucherstäbchen anzünden und das Universum anfunken würde, um die Energie in meine Richtung und dann an meine Mutter weiterzuleiten. Im Gegensatz zu mir war meine Freundin sehr spirituell. Sie lebte von innen heraus, beschäftigte sich mit Sinn- und Wertfragen ihrer eigenen Existenz. Sie glaubte an das Prinzip von Ursache und Wirkung, dass alles einen Grund hatte und es keine Zufälle gab.
»Es ist schön, dass ihr beide euch gefunden habt«, sagte Alexander.
»Ja.« Das war es. Ich hatte Menschen an meiner Seite, auf die ich mich – wie Alexander treffend bemerkt hatte – in Krisen von außen verlassen konnte. Das bedeutete mir viel, Birthe bedeutete mir viel. Ich würde sie vermissen, wenn ich umziehen würde. Aber noch hatte ich keine endgültige Entscheidung getroffen. Ich steckte fest. Irgendwo zwischen Halten und Loslassen.
»Das Kissen liegt in der Mitte auf der Rücksitzbank.«
Alexanders vorausschauende Fürsorglichkeit hatte mir von Anfang an gefallen. Mit den Jahren war sie abhandengekommen, wie so vieles andere. Nun hatte er sie wiedergefunden, seit Monaten zeigte er sich von seiner besten Seite. Ich griff zwischen den Sitzen nach hinten.
In der Nacht hatte ich kaum geschlafen. Wie so oft in den letzten Monaten. Aber hatte ich früher die Zeit zum Schreiben genutzt, wälzte ich nun Gedanken und mich unruhig im Bett hin und her. Dafür schlief ich am Tag, manchmal zwei bis drei Stunden. Meistens nach dem Mittagessen, etwa um diese Zeit.
Hier im Auto gelang es mir nicht. Meinen Kopf gegen das Kissen gelehnt, dachte ich mit geschlossenen Augen über die vergangenen drei Jahre nach. Über den Tod meines Vaters, die Krise mit Alexander, einhergehend mit beruflichen Problemen. Und nun meine Mutter. Zugleich nagte das schlechte Gewissen an mir.
Wann hatte ich das letzte Mal mit ihr gesprochen, sie besucht?
Zum Geburtstag vor zwei Wochen hatte ich ihr einen Blumenstrauß geschickt und einen Gutschein für den Besuch eines Musicals ihrer Wahl, zu dem ich sie begleiten wollte. Sie hatte sich für König der Löwen entschieden.
Den Termin hatten wir noch nicht festgelegt. Wir wollten das in Ruhe überlegen, nach meiner Manuskriptabgabe. Aber ich fand keinen Zugang zu den Worten. Seit Wochen steckten sie in mir fest.
Ich hätte den Termin einfach bestimmen und die Karten kaufen sollen. Meine Mutter hatte immer Zeit, fast immer. Einmal im Jahr besuchte sie eine gute Freundin, die an die Ostsee gezogen war, zu ihrem Geburtstag. Bei ihr blieb sie in der Regel für eine Woche.
Mir schickte sie zum Geburtstag ein Päckchen. Mit Kirschmarmelade, die sie das ganze Jahr über aus tiefgekühlten Früchten kochte. Badesalz mit getrockneten Blüten aus dem Garten. Pfefferminztee, den ich mit Milch und Honig trank. Schwarze Socken, die ich immer brauchte, weil sie auf geheimnisvolle Weise verschwanden. Eine mit Whisky gefüllte Tafel Schokolade. Und eine Geburtstagskarte. Sie gab sich mehr Mühe als ich.
4.
Ihr bleiches Gesicht wurde zur Hälfte von einer Sauerstoffmaske verdeckt. Ihre Augen waren geschlossen, ihre Hände ruhten auf der dünnen Decke, die Finger der rechten Hand waren leicht gekrümmt. Im linken Handrücken steckte eine Kanüle mit einem kleinen hellgrünen Verschluss, darunter verlief ein dunkelblauer Bluterguss. Ein Clip klemmte an ihrem Finger, verbunden mit einem der vielen Monitore. Sie schlief.
Ich trat näher an das Bett heran, meine Hand zitterte leicht, als ich sie sanft auf die meiner Mutter legte. Ihre Haut fühlte sich kühl an und trocken.
Ein Anflug von Hilflosigkeit überkam mich, während ich auf ihr regloses Gesicht blickte und dann auf den Brustkorb, der sich regelmäßig hob und senkte. In diesem Moment wünschte ich mir, Alexander wäre doch bei mir. Aber ich hatte darauf bestanden, ohne ihn zu gehen, während er einen Parkplatz suchen und dann in der Cafeteria auf mich warten würde. Ich wusste, wie empfindlich er auf Kanülen und Nadeln reagierte, die irgendwo im Körper steckten. Im schlimmsten Fall kippte er um. Das wollte ich ihm ersparen. Und mir auch.
»Ich bin bei dir, Mutti. Du bist stark, du schaffst das, wir schaffen das«, sagte ich in der Hoffnung, dass meine Worte ihren Weg fanden und meine Mutter meine Anwesenheit spürte. Mir tat es ebenfalls gut. Ich sprach nicht nur ihr, sondern auch mir Mut zu. »Jetzt musst du schlafen, damit dein Körper sich erholen kann. Du weißt doch, Schlaf ist die beste Medizin.« Ich sah zu dem Bildschirm, der die Vitalparameter anzeigte, achtete auf Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsättigung und Atemfrequenz. In den Wochen, die mein Vater hier verbracht hatte, war ich Profi im Interpretieren der Werte geworden.
Es sah soweit alles gut aus. Nur das Herz schlug sehr unregelmäßig.
Was hatte meine Mutter so aus dem Takt gebracht? Ich strich ihr eine Haarsträhne aus dem Gesicht, und mir fiel auf, dass sie schon längere Zeit nicht nachgefärbt hatte. Der weißgraue Ansatz war bestimmt drei Finger breit, ungewöhnlich für sie, die so viel Wert auf ein gepflegtes Äußeres legte und die Termine bei ihrer Friseurin im Abstand von zwei Monaten für ein ganzes Jahr im Voraus plante. Immer am ersten Dienstag im Monat, soweit das möglich war. Den letzten hatte sie wohl verpasst. Der Bob, kurz und akkurat geschnitten, begleitete sie seit Jahren. Sie liebte Blusen (glatt gebügelt, ohne eine einzige Falte) und quadratische Seidentücher in passenden Farben, die sie locker um den Hals knotete. Das Patientenhemd, das man ihr angezogen hatte, im Nacken mit zwei Bändern zusammengebunden, fände sie fürchterlich. Da halfen auch die kleinen blauen Sterne nicht, mit denen der weiße Stoff bedruckt war. Ich gab meiner Stimme einen festen Klang. »Alles wird gut, Mutti!«, sagte ich in der Überzeugung, dass es so sein würde. Sie war kräftiger als mein Vater damals, der bei der Einlieferung nur noch etwas über sechzig Kilo gewogen hatte, bei einer Größe von einem Meter achtzig. Und sie hatte keine Vorerkrankungen.
»Nicht erschrecken«, hörte ich eine leise Frauenstimme, und ich drehte mich zur Tür. »Die Ärztin hätte jetzt Zeit für Sie.«
Ich erkannte die Krankenschwester sofort, das kurze graue Haar, das rundliche Gesicht, die Wärme in ihrem Blick. Sie hatte auch meinen Vater versorgt und immer ein aufmunterndes Wort für uns gehabt. Auch als klar gewesen war, dass es zu Ende ging.
Ich lächelte sie an und sie brachte mich in das Besprechungszimmer, in dem ich schon einmal gesessen hatte, damals gemeinsam mit meiner Mutter.
»Das Herz Ihrer Mutter schlägt Kapriolen. Der Rhythmus ist aus dem Takt, die Herzschlagfolge muss sehr schnell gewesen sein, was zu einem Ohnmachtsanfall geführt hat«, sagte die Ärztin. »Sie war gerade im Garten und hat sich mit der Nachbarin unterhalten, als sie in sich zusammengesackt ist. Zum Glück war die Tochter der Nachbarin gerade zu Besuch. Sie hat vorbildlich Erste Hilfe geleistet.«
Ich schluckte bei der Vorstellung, wie meine Mutter auf dem Rasen lag, mit rasendem Herzschlag, und fühlte im gleichen Atemzug, wie meins kräftig von innen gegen meine Brust klopfte.
»Können Sie mir etwas mehr erzählen? Hat Ihre Mutter Vorerkrankungen, nimmt sie Medikamente?«
»Ein Osteoporose-Mittel.« Mehr wusste ich nicht. Ich schüttelte den Kopf. »Sie geht regelmäßig zur Gymnastik, fährt viel Fahrrad, trinkt selten, raucht nicht, isst nicht übermäßig fettig …«
»Hat sie eine Patientenverfügung, gibt es eine Vorsorgevollmacht?«
Jetzt wusste ich, was ich vergessen hatte. Ich hatte sie in meinem Ordner mit den Versicherungsunterlagen abgeheftet. An die wichtigste Sache hatte ich in meiner Aufregung nicht gedacht. »Ja. Allerdings nur in eingescannter Fassung. Kann ich sie per Mail senden?« Wenigstens hatte ich das Notebook dabei.