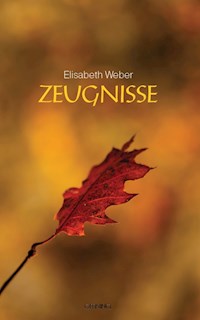Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was haben Gina Lollobrigida, ein Wellensittich und ein Trabbi gemeinsam? Ganz einfach, alle drei kommen in diesem Buch vor, aber wahrscheinlich etwas anders als Sie vielleicht vermuten. Gleiches gilt auch für spezielle geflügelte Wesen, ein Getränk namens Zwiebelmilch sowie die titelgebenden blinden Fische. In einer kurzweiligen Mischung aus persönlichen Erinnerungen, Anekdoten und Geschichten wirft Elisabeth Weber in ihrem neuen Buch einen Blick zurück auf ihre Kindheit und Jugend, ihre Familie, auf Begebenheiten aus dem Alltag und jede Menge mehr. Neben den Geschichten, mal berührend, mal nachdenklich, mal kurios, verrät die Autorin auch einige ihrer Lieblingsrezepte, die Sie so in keinem anderen Kochbuch finden werden und erzählt natürlich auch, was es mit diesen kulinarischen Köstlichkeiten auf sich hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 121
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Kinder und Enkelkinder
Trau Dich, sei mutig! Kein Übel ist so schlimm, wie die Angst davor. (Seneca)
Inhalt
Hommage an Gina
Wunschberuf?
Wunschberuf!
Blinde Fische
Als der Krieg zu Ende war
Natürlicher Kopfschmuck
Tautreten im Morgengrauen
Sprichwörtliches
Geflügelte Wesen
Waschtag
Nachbarschaft
Schlachtfest
Allerleirauh(es)
Gehhilfen
Späte Väter
Endgültiger Abschied
Friedhofszwang
Blutige Erinnerung
Reizwäsche
Ohrwurm
Haarige Erinnerungen
Aus zweiter Hand
Straßenkinder
Billiges Vergnügen
Leseleidenschaft
Nachsitzen
Nachhaltig
Mein erstes Mal
Geliebte Schwester
Schwiegermutter-Geschichte
Schwerwiegende Probleme
Freund auf Zeit
Bücherparadies
Großes Kino
Erbstück
Bloß von hier weg…
Handgemaltes
Rendezvous
Mogelpackung
Zwiebelmilch
Kochbuchpoesie
Klößchensuppe
Verreisen im Kochtopf
Anhang (Rezepte)
Heringssalat nach Hausherrenart
Kartoffelsalat nach Art des Hauses
Oma Gertruds Pfannesemmeln
Klößchensuppe à la Oma Regina
Quark-Sahne-Torte (ohne Sahne)
Sadah Pilau - gedünsteter Reis nach indischer Art
Fleisch – zweimal in den Topf
Apfel-Chutney
Vorwort
Was es mit den ominösen blinden Fischen, geflügelten Wesen und anderem Getier auf sich hat, mit wem ich wann und wo ein Rendezvous hatte oder wen Sie beim Tautreten im Morgengrauen beobachten können, erfahren Sie in diesem Buch.
Ob nachdenklich, komisch oder skurril – ich hoffe, das bunte Sammelsurium aus persönlichen Erinnerungen und Kurzgeschichten hält für jeden etwas bereit. Und selbst, wenn Sie „Reizwäsche“ oder eine „Blutige Erinnerung“ weniger interessieren, blättern Sie einfach weiter zur nächsten Geschichte. In der können Sie beispielsweise erfahren, warum eine Mogelpackung durchaus etwas Gutes sein kann und ob es sich bei Zwiebelmilch tatsächlich um ein Getränk handelt. Ach übrigens: Sollten Sie beim Lesen der einen oder anderen Episode Appetit bekommen, schlagen Sie einfach eines der ausgewählten Rezepte am Ende des Buches nach. Davon werden Sie zwar noch nicht satt, bekommen aber vielleicht Lust, eines davon nachzukochen. Und so wünsche ich Ihnen beides: Ganz viel Lesevergnügen und gutes Gelingen!
Hommage an Gina
Wenn Sie bei dem Namen „Gina“ unwillkürlich an die großartige Schauspielerin Gina Lollobrigida denken, ist das zwar verständlich, aber Sie liegen trotzdem völlig falsch. Nein, nicht der italienische Filmstar soll hier gewürdigt werden. Vielmehr geht es um meine Mutter, die Großmutter meiner Kinder, die sie liebevoll Oma Gina nannten. Getauft wurde meine Mutter nur wenige Tage nach ihrer Geburt Anfang Juni 1913 auf den schönen Namen „Regina“, der bekanntlich aus dem Lateinischen stammt und „Königin“ bedeutet. Zu verdanken hatte sie diesen Namen, wie es zu Beginn des 20. Jahrhunderts gang und gäbe war, ihrer Patin, einer Verwandten aus dem Nachbarort. Meine Mutter muss diese Frau sehr gemocht haben, denn sie erzählte, dass sie in ihrer Kindheit oft ins vier Kilometer entfernte Nachbardorf gelaufen war, um ihre Patin Regina zu besuchen. Der Name - man beachte den Wohlklang der Vokale –RE-GI-NA -, wurde natürlich gehörig verhunzt: Zu Hause wurde das Mädchen von den Eltern und Geschwistern „Reginchen“ genannt. Mit dem Älterwerden verschwand das „chen“ und man rief sie nur noch „Regin“. Dass ihre Enkelkinder sie später beinah zärtlich „Oma Gina“ nannten, hörte sie gern. Wenn sie aus ihrem Leben erzählte, fasste sie es in etwa so zusammen: „Ich wurde 1913 unterm Kaiser geboren, bin im Ersten Weltkrieg aufgewachsen und habe die schlechten Zeiten nach dem Krieg bis hin zur Weltwirtschaftskrise in meiner Jugend mitgemacht. Unter Hitler habe ich dann geheiratet, den Zweiten Weltkrieg erlebt, in dem zwei meiner Brüder gefallen sind und zwei meiner Kinder starben. Dann habe ich unter Walter Ulbricht gelebt und gearbeitet, später unter Erich Honecker. Und nun? Nun erlebe ich auch noch den Kohl als Kanzler.“ Kann man 80 Jahre deutscher Geschichte kürzer zusammenfassen? Das Leben ist Veränderung. Nichts bleibt, wie es ist. Das war ihr Credo. Wieso hatte ich eine ganze Weile gedacht, dass es in meinem Leben keine einschneidenden Veränderungen (mehr) gibt?
Wunschberuf?
Als meine Mutter ihre Berufstätigkeit begann, war sie erst dreizehn Jahre alt. Sie wurde zu Ostern nach achtjährigem Schulbesuch aus der Schule entlassen, aber Anfang Juni erst vierzehn. Das bedeutete für sie den sofortigen Einstieg ins Erwerbsleben, denn eine Ausbildung im heutigen Sinn absolvierte sie nicht. Sie wurde im wahrsten Sinn des Wortes in die ortsansässige Zigarrenfabrik gesteckt und musste von da an, Tag für Tag, ihr ganzes Leben lang, Zigarren oder Zigarillos rollen. Natürlich lernte sie ihren Beruf von der Pike auf und niemand konnte ihr in Punkto Tabak etwas vormachen, aber sie erwarb keinen Berufsabschluss. Erst sehr viel später wurde ihr und ihren Kolleginnen auf Grund ihrer langjährigen Erfahrungen der Facharbeiterstatus zuerkannt. Ihr ganzes langes Arbeitsleben brachte sie in ein und derselben Zigarrenfabrik zu. Obwohl die Firmennamen wechselten, blieb ihr Arbeitsplatz immer derselbe, die Tätigkeit immer dieselbe. Ich sehe sie noch an ihrer „Stehde“ sitzen, dem speziellen Arbeitstisch der Zigarrenroller, ganz vertieft in ihre Arbeit, die sehr große Fingerfertigkeit, enorme Schnelligkeit und vor allem auch Ausdauer verlangt. Eine Zeit lang übte meine Mutter diese Tätigkeit auch in Heimarbeit aus, damit sie meinen kranken Vater zu Hause betreuen konnte. Das bedeutete für sie, dass sie oft bis spät in die Nacht hinein Zigarren rollte, denn am Tag hatte sie ja mit der Pflege meines Vaters zu tun. Also verschob sich die Arbeitszeit in die Abend- und Nachtstunden, bis sie ihr Pensum geschafft hatte. Der würzige Tabakgeruch zog durch unsere ganze Wohnung, machte sich überall breit, war zu riechen, fast zu schmecken. Geraucht wurde natürlich auch in unserem Haushalt, schließlich bekam ja jede Zigarrenarbeiterin ein monatliches Deputat in Form von Zigarren, Zigarillos und Zigaretten. Daher verbreitete sich nicht nur der Duft des Tabaks, nein, auch dicke Rauchschwaden waberten von Zeit zu Zeit durch Küche und Stube. Ob Java, Havanna, Sumatra, Brasil oder Virginia – die Namen der Tabaksorten waren meiner Mutter ein Leben lang geläufig, damit kannte sie sich aus. Mir klangen diese Namen wie Musik in den Ohren und ich träumte von Kuba, Indonesien und anderen, ach so fernen Ländern, aus denen der Tabak kam. Ob es meiner Mutter genauso ging, ob auch sie das Fernweh plagte, das weiß ich nicht. Wir haben nie darüber gesprochen. Als ich vor ein paar Jahren Kuba bereiste und dabei auch eine Zigarrenfabrik besuchte, stellte ich mir vor, meine Mutter wäre dabei gewesen. Ich glaube, ohne dass sie ein Wort Spanisch gesprochen hätte, wäre sie mit den Zigarrenarbeiterinnen ganz schnell „ins Gespräch“ gekommen. Und am Ende hätte sie wahrscheinlich selbst an deren Arbeitsplatz gesessen und hätte eine echte „Havanna“ gerollt. Gelernt ist eben gelernt!
Wunschberuf!
Mutters eigentlicher Wunschberuf, von dem sie wahrscheinlich ein Leben lang träumte, war Krankenschwester. Sie erzählte immer wieder davon, dass sie als fünftes von acht Kindern, aus einfachen familiären Verhältnissen stammend, keine Chance bekam, diesen Beruf zu erlernen. Noch dazu kam, dass ihr als Mädchen im Gegensatz zu ihren Brüdern von vornherein keine großen beruflichen Ambitionen zugestanden wurden. Ihre Aufgabe sah man in diesen Zeiten eher darin, als Hausfrau und Mutter zu wirken und zusätzlich noch Fabrikarbeit zu leisten. Und diese Arbeit bestimmte ihr ganzes Leben, hielt sie aber nicht davon ab, eine Familie zu gründen. Sie bekam fünf Kinder, von denen zwei im Säuglingsalter starben, was sie zeitlebens nicht verwinden konnte. Ihre anderen drei Kinder zog sie liebevoll, aber auch mit der nötigen Strenge auf, kümmerte sich um Haus und Garten und alles, was sonst noch in einer fünfköpfigen Familie zu tun war.
Aber ihre Leidenschaft für die Krankenpflege und alles, was damit verbunden ist, ließ sie trotzdem ihr ganzes Leben lang nicht los. Sie umsorgte natürlich im Krankheitsfall alle Familienmitglieder vorbildlich, half aber auch Nachbarn und Freunden, wenn Not am Mann war. Außerdem engagierte sie sich beim Deutschen Roten Kreuz, besuchte Erste-Hilfe-Kurse und konnte so ihre Begabung wenigstens ein bisschen ausleben.
Denn begabt war Mutter in Gesundheitsfragen wirklich: Wunden versorgen, Verbände, Umschläge und Wickel anlegen, diverse Diäten verabreichen, eben Fürsorge walten lassen; das war ihre Profession. Ich hätte sie mir sehr gut als Oberschwester Regina in einer Krankenhausabteilung vorstellen können. Couragiert wie sie war, hätte sie dort „den Laden geschmissen“. Beliebt bei Patienten und Mitarbeitern, aber ganz gewiss auch ein wenig gefürchtet.
Blinde Fische
Meine Mutter aß leidenschaftlich gern. Eigentlich gab es nichts, was sie verschmähte. Das schien daher zu rühren, dass sie in den schlechten Zeiten, die sie erlebte, froh war, überhaupt etwas zu essen zu haben. Trotzdem frönte sie einer Essleidenschaft, die für mich und sicher für die allermeisten Menschen nicht unbedingt nachvollziehbar ist: Sie aß Fischaugen! Wenn sie also als Kind losgeschickt wurde, um im örtlichen Kolonialwarenladen Heringe für das Mittagessen einzukaufen, gab es für sie nichts Schöneres, als auf dem Heimweg die Heringsaugen herauszupulen und genüsslich zu verspeisen. Zu Hause wurde sie natürlich von ihrer Mutter, meiner Großmutter Else, dafür getadelt. Aber auch beim nächsten Heringskauf konnte meine Mutter der Verlockung nicht widerstehen, und die Heringe landeten wieder „blind“ auf dem Küchentisch meiner Großmutter und harrten so ihrer Weiterverarbeitung. Da in diesen Zeiten Hering und Pellkartoffeln sehr oft auf dem Speiseplan standen, es war ein typisches „Armeleuteessen“, war daher der ständige Ärger mit dem „heringsaugenessenden“ Kind vorherbestimmt. Zum Eklat kam es aber erst, als eines Tages eine der Nachbarinnen meine Mutter bat, auch für sie Heringe einzukaufen. Und so kam es wie es kommen musste:
Hin- und hergerissen zwischen dem festen Vorsatz, sich diesmal ganz gewiss nicht an den fremden Fischen zu vergreifen und der gleichzeitig wachsenden Gier nach der vermeidlichen Delikatesse machte sich Klein-Regina auf den Heimweg. Unterwegs aber wurde der Drang einfach unwiderstehlich, doch ein paar der Heringsaugen zu probieren. Sie überlegte krampfhaft, wie sie es anstellen könnte, Heringsaugen zu naschen, ohne dass es die Nachbarin merkt. Da kam ihr die geniale Idee, von jedem Fisch nur jeweils ein Auge zu verspeisen und die Fische so einzupacken, dass es auf den ersten Blick nicht auffiel. Aber wie heißt es so schön: Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach! Nach und nach wurden alle Fische ihre beiden Augen los, nur ein einziger schaute noch mit einem Auge traurig aus dem Zeitungspapier, ehe er endgültig eingewickelt wurde. Natürlich plagte die kleine Naschkatze das schlechte Gewissen: Würde die Nachbarin die „blinden Fische“ bemerken und sie ihr vielleicht sogar vor die Füße werfen? Und dann erst der Ärger mit der Mutter, die sie bestimmt tüchtig ausschimpfen würde. Aber es half nichts. Sie musste den Einkauf der Nachbarin bringen, die ja schon darauf wartete. Die wunderte sich nur, dass es das Nachbarsmädchen sehr eilig hatte und gar nicht wie sonst, auf eine kleine Belohnung erpicht war. Etwas später, die Heringe waren längst zubereitet, trafen sich die Nachbarin und meine Großmutter auf der Straße: „Sag mal Else, die Heringe haben wohl neuerdings keine Augen mehr?“ fragte die Nachbarin und lächelte dabei verschmitzt. „Oh je, dieses Kind, hat mal wieder die Fischaugen gegessen!“ jammerte meine Großmutter und schämte sich für die ungewöhnlichen Gelüste ihrer Tochter. Sie schimpfte Regina zwar tüchtig aus, aber so richtig böse sein konnte sie ihr trotzdem nicht. Fortan aber schickte sie lieber eines ihrer anderen Kinder zum Heringskauf.
Jahre später, als ich ein Kind war, sah ich meiner Mutter oft beim Ausnehmen der Salzheringe zu. Dabei war ich hin- und hergerissen zwischen Faszination und Ekel ob dieser Tätigkeit. Im Nachhinein bin ich auch davon überzeugt, dass meine Mutter ab und zu eines der Fischaugen aß. Bewusst kann ich mich aber nicht daran erinnern. Ich habe noch nie Fisch ausgenommen. Trotzdem gibt es bei uns heute Heringssalat, den mein Mann ganz vorzüglich zubereitet. Und von Fischaugen ist weit und breit nichts zu sehen. (Rezept im Anhang)
Als der Krieg zu Ende war
Im April 1945 war die Sehnsucht der Menschen nach Frieden groß. Auch die Bewohner des kleinen eichsfeldischen Dorfes unweit der hessischen Grenze hofften auf das Ende des Krieges, der sie zwar mit Zerstörung verschont hatte, sie aber vor bitterem Leid, den der Tod vieler ihrer Männer, Väter, Söhne oder Brüder mit sich brachte, nicht bewahrte. So sehnten sie das Kriegsende herbei, das dem sinnlosen Sterben endlich ein Ende bereiten sollte. Gleichzeitig schauten sie voller Bangen in die Zukunft und fürchteten wohl auch die Rache der Sieger.
Auch meinen Eltern erging es so. Zwei Brüder meiner Mutter waren bereits in diesem schrecklichen Krieg gefallen, von den anderen drei, die sich auch im Krieg befanden, hatte sie schon sehr lange nichts mehr gehört. Mein Vater war auf Grund körperlicher Einschränkungen nicht zum Wehrdienst einberufen worden.
Nichtsdestotrotz wurde er zum Arbeitsdienst in einem Rüstungsbetrieb, dem sogenannten „Gerätebau“, einem Zweigbetrieb der Uhrenfabrik Ruhla, verpflichtet. Dort, gut getarnt im Mühlhäuser Stadtwald gelegen, fertigte man Zünder für die verschiedensten Waffen an. Der größte Teil der Beschäftigten waren Zwangsarbeiterinnen aus der Ukraine, aus Polen, Ungarn und Russland. Immer wieder erzählte mein Vater meiner Mutter von den furchtbaren Bedingungen, unter denen diese aus ihren Heimatländern verschleppten Mädchen und Frauen arbeiten und leben mussten. „Also wenn die Russen hier bei uns einmarschieren und euch Frauen so behandeln, wie diese Frauen behandelt werden, dann Gnade euch Gott.“ Eigentlich durfte mein Vater über das in der Rüstungsfabrik Erlebte nicht sprechen. Aber konnte er das, was sich dort abspielte, so einfach für sich behalten? „Sprich mit niemandem darüber, hörst du, mit niemandem“, schärfte er meiner Mutter immer wieder ein, „sonst bin nicht nur ich, sondern auch du wegen Feindpropaganda in Gefahr“. Noch dazu wo mein Vater begann, den Frauen, mit denen er unmittelbar zusammenarbeitete, das eine oder andere Mal ein Stück Brot oder einen Apfel zuzustecken. Meine Mutter wunderte sich nur, dass mein Vater, der eigentlich kein guter Esser war, neuerdings größere Mengen an Frühstücks- oder Vesperbroten mitnahm und davon auch kein Krümelchen wieder mit heimbrachte. Irgendwann tauchte, woher auch immer, ein Russischwörterbuch in unserem Bücherschrank auf. Mein Vater las am Abend darin und prägte sich die eine oder andere Vokabel ein, um sich mit den Frauen besser verständigen zu können. Er wusste ganz genau, dass ihm auch das zum Verhängnis werden konnte, denn Gespräche mit den Zwangsarbeiterinnen waren ihren deutschen Kollegen streng verboten.
Mittlerweile rückte das Osterfest des Jahres 1945 heran. Meine Eltern, die regelmäßig den sogenannten „Feindsender“ Radio London hörten, wussten daher, dass in den nächsten Tagen die Amerikaner in Thüringen einmarschieren würden. „Was wird uns dieser Einmarsch bringen? Wird es zu Kämpfen kommen und damit auf den letzten Metern des Krieges noch zu Toten und Verletzten? Werden vielleicht ganz zum Schluss noch unsere Häuser oder Wohnungen zerstört?“ Diese bangen Fragen bewegten nicht nur meine Eltern. Doch besonders für meine Mutter waren diese Tage voller Angst, denn sie war im vierten Monat schwanger und lebte in ständiger Sorge um das Ungeborene. Hatte sie doch zuvor in den