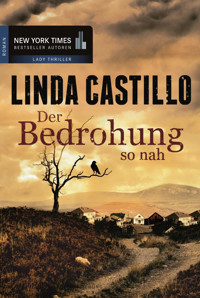9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kate Burkholder ermittelt
- Sprache: Deutsch
Sie war aufsässig und rebellisch. Doch kannte der Mörder auch ihr dunkles Geheimnis? In einem Motel in Painters Mill wird die Leiche einer jungen Frau gefunden – brutal ermordet. Als Kate Burkholder zum Tatort gerufen wird, ist sie schockiert. Sie kennt das Opfer von früher. Rachael Schwartz war eine charmante, aber auch rebellische junge Frau, die der strengen Ordnung ihrer amischen Familie vor vielen Jahren für immer entfloh. Doch warum kehrte sie jetzt zurück? Und wer hat sie so brutal umgebracht? Kate erinnert sich, dass Rachael als Kind und Teenager genauso aufsässig war wie sie selbst damals, Rachael hielt sich nicht an die Regeln, beachtete keine Konventionen und hinterließ Familie und Freunde nach ihrer Flucht völlig zerstört. Es gab einige, die ihr nichts Gutes nachsagten. Doch was nur wenige wussten: Rachael hütete ein dunkles Geheimnis. Und derjenige, der Rachael getötet hat, wird alles daran setzen, dass ihr Geheimnis nicht ans Tageslicht kommt. Dafür ist ihm jedes Mittel recht. Um die ganze Wahrheit aufzudecken und den Mörder zur Strecke zu bringen, braucht Kate einen ausgeklügelten Plan. Sonst wäre Rachaels Geheimnis für immer vergessen. Und ihr Schicksal bliebe ungesühnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Linda Castillo
Blinde Furcht
Der neue Fall für Kate Burkholder
Thriller
Über dieses Buch
Sie war eine rebellische junge Amisch-Frau. Besiegelte sie damit ihr Schicksal?
Ein brutaler Mord in einem Motel schockiert ganz Painters Mill. Für Polizeichefin Kate Burkholder ist das Opfer keine Unbekannte. Rachael Schwartz war eine charmante, aber auch rebellische junge Frau, die der strengen Ordnung ihrer amischen Familie entfloh. Doch was nur wenige wissen: Rachael hütete ein dunkles Geheimnis. Eines, das auch der Mörder kennt. Und er wird alles daran setzen, dass es nicht ans Tageslicht kommt. Der dreizehnte Fall für Kate Burkholder von der Spiegel-Bestseller-Autorin Linda Castillo.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Linda Castillo wuchs in Dayton im US-Bundesstaat Ohio auf, schrieb bereits in ihrer Jugend ihren ersten Roman und arbeitete viele Jahre als Finanzmanagerin, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Der internationale Durchbruch gelang ihr mit »Die Zahlen der Toten« (2010), dem ersten Kriminalroman mit Polizeichefin Kate Burkholder. Linda Castillo kennt die Welt der Amischen seit ihrer Kindheit und ist regelmäßig zu Gast bei amischen Gemeinden. Die Autorin lebt heute mit ihrem Mann und zwei Pferden auf einer Ranch in Texas.
Helga Augustin hat in Frankfurt am Main Neue Philologie studiert. Von 1986–1991 studierte sie an der City University of New York und schloss ihr Studium mit einem Magister in Liberal Studies mit dem Schwerpunkt ›Translations‹ ab. Die Übersetzerin lebt in Frankfurt am Main.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Ich widme dieses Buch allen meinen wunderbaren Freundinnen und Freunden von der Stadtbücherei in Dover, Ohio:
Danke für all die schönen (und vergnüglichen!) Veranstaltungen, die ihr in den letzten elf Jahren ausgerichtet habt. Ihr tut stets so viel mehr, als ihr müsstet. Euch und eure treuen Besucher zu treffen ist für mich zu einer Tradition geworden, die ich mehr schätze, als ihr euch vorstellen könnt. Eure Bücherei ist mein zweites Zuhause, wenn ich unterwegs bin, und dafür bin ich jeder und jedem Einzelnen von euch dankbar.
1. Kapitel
Es würde nicht leicht werden, nach so vielen Jahren zurückzukehren. Sie hatte viel Leid hinterlassen, als sie damals ging, und nicht einmal Reue empfunden. Sie hatte den Menschen weh getan, die sie liebte, und Beziehungen zerstört, die ihr wichtig hätten sein sollen. Wenn das Pech sie wieder einmal verfolgte, hatte sie andere dafür verantwortlich gemacht und nie eingeräumt, sich vielleicht zu irren. Dabei gehörten Irrtümer zu ihrem Leben, was sie nur allzu oft bewiesen hatte.
Es gab einmal eine Zeit, da war Painters Mill ihr Zuhause gewesen. Sie hatte sich zugehörig gefühlt, war in die Gemeinde integriert und hatte sich kaum dafür interessiert, was es jenseits der Maisfelder, der malerischen Farmhäuser und gewundenen Nebenstraßen noch alles gab. Die kleine Stadt war der Mittelpunkt ihrer Welt gewesen. Ihre Familie wohnte noch immer dort – eine Familie, der sie seit zwölf Jahren nicht mehr angehörte. Doch ob es ihr gefiel oder nicht, ihre Verbundenheit mit diesem Ort und seinen Menschen war stark – ihrer Meinung nach zu stark –, und diese Verbundenheit konnte sie nicht länger leugnen, auch wenn sie es noch so sehr versuchte.
Die beschauliche Kleinstadt mit der typisch amerikanischen Hauptstraße und der malerischen Umgebung war aber nicht immer gut zu ihr gewesen. Für das siebzehnjährige Mädchen war Painters Mill auch ein Ort bitterer Lektionen gewesen, mit Regeln, die sie nicht befolgen konnte, und vernichtenden Anschuldigungen von Menschen, die – wie auch sie selbst – die Macht besaßen, andere zu verletzen.
Es dauerte Jahre, bis sie begriffen hatte, dass all das Leid und die Mühe, den Erwartungen von anderen gerecht zu werden, vergeblich waren. Denn wie ihre Mamm immer sagte: Zeit war ein wichtiger Faktor und das Leben ein grausamer Lehrmeister. In diesem Punkt hatte ihre Mutter ausnahmsweise einmal recht gehabt.
Painters Mill hatte sich kein bisschen verändert. An der Hauptstraße prägten die amischen Touristenläden und reizvollen Fassaden noch immer das Bild der historischen Innenstadt, und auf den pittoresken Farmen und den Nebenstraßen sah man hier und da noch immer einen Buggy oder Heuwagen. So kam ihr die Rückkehr vor, als beträte sie eine Zeitschleife – als wäre sie nie fort gewesen und hätte alles, was seither geschehen war, nur geträumt. Dass alles so unverändert war, verstörte sie auf eine Weise, die sie nicht erwartet hatte.
Auch das Willowdell-Motel gehörte zu den Orten, an denen die Zeit stillgestanden hatte – dieselbe schäbige Fassade und derselbe staubige Schotterparkplatz. Im Zimmer lag noch der gleiche abscheuliche orangerote Teppichboden, im Bad hing noch dieselbe geschmacklose Tapete, und die Luft roch wie früher nach dürftig kaschiertem Zigarettenrauch und muffigen Handtüchern. Es war ein Ort, den sie mit siebzehn besser nicht hätte kennen sollen.
Wenn das Leben ihr eine Lektion erteilt hatte, die alle anderen in den Schatten stellte, dann diese: Schau immer nach vorn und niemals zurück; konzentriere dich auf Ziele anstatt auf Dinge, die du bereust. Sie hatte viele Jahre gebraucht und zahllose Opfer gebracht, um sich aus dem Sumpf herauszuziehen, in den sie sich selbst hineinmanövriert hatte. Letztendlich hatte sie es geschafft – besser, als sie es jemals für möglich gehalten hätte – und sich ein gutes Leben aufgebaut. Ob all das jetzt noch irgendeine Rolle spielte? War es genug?
Rachael Schwartz warf ihre Reisetasche aufs Bett. Sie hatte lange genug darauf gewartet, endlich ein paar Dinge richtigzustellen. Es war an der Zeit, dieses eine Unrecht wiedergutzumachen, das sie begangen hatte und das sie nachts nicht schlafen ließ. Die eine schlechte Entscheidung, von der sie immer wieder eingeholt wurde – und die ihr seit Jahren zunehmend zu schaffen machte. Wie es ausgehen und ob sie bekommen würde, was sie wollte, wusste sie nicht. Aber dass sie es versuchen musste, das wusste sie genau. Was immer dabei herauskommen würde, ob es gut oder schlecht war oder irgendetwas dazwischen, sie würde damit leben müssen.
Um zwei Uhr morgens klopfte es an der Tür. Sie wusste, wer es war, schob die Decke zur Seite und sprang aus dem Bett. Die Freude, die sie beim Blick durchs Guckloch erfasste, vermochte ihre Nervosität nicht ganz zu verdrängen. Sie öffnete die Tür.
»Nun, das wurde aber auch Zeit«, sagte sie.
Ihre Worte trafen auf ein halbherziges Lächeln, gefolgt vom Aufflackern der Erinnerung. »Ich hatte nicht gedacht, dich jemals wiederzusehen.«
Sie grinste. »So kann man sich irren.«
»Tut mir leid, dass es so spät ist. Kann ich hereinkommen?«
»Ich bitte darum. Es gibt eine Menge zu bereden.« Sie trat zurück und deutete mit einer ausladenden Handbewegung ins Zimmer. »Ich mache das Licht an.«
Ihr Herz schlug heftig, als sie zum Nachttisch mit der Lampe ging. All die Worte, die sie monatelang eingeübt hatte, purzelten wie Würfel in ihrem Kopf umher. Irgendetwas stimmte nicht, aber was hatte sie denn erwartet?
»Ich hoffe, du hast den Wein mitgebracht«, sagte sie und beugte sich vor, um die Lampe anzuknipsen.
Der Schlag kam aus heiterem Himmel. Weißes Licht blitzte vor ihren Augen auf, gepaart mit einem ohrenbetäubenden Krach, als explodierte Dynamit in ihrem Kopf. Rasender Schmerz, und sie sank geschockt und verwirrt auf die Knie.
Sie streckte die Hand aus, hielt sich am Nachttisch fest und rappelte sich ächzend auf die Füße, taumelte nach links und drehte sich um, sah den Baseballschläger und das, was ihr zuvor entgangen war: die böse Absicht und versteckte Wut. Lieber Gott, wie hatte sie nur so naiv sein können?
Wieder fuhr die Keule auf sie nieder, durchschnitt zischend die Luft. Sie stolperte, versuchte nach rechts zu entkommen, war nicht schnell genug. Der Schlag traf sie an der Schulter, brach ihr das Schlüsselbein. Der Schmerz nahm ihr den Atem. Wimmernd drehte sie sich um, wollte weglaufen und fiel wieder auf die Knie.
Schritte hinter ihr. Es war noch nicht vorbei. Sie drehte den Oberkörper, hob die Hände zum Schutz. Der Baseballschläger traf ihren Unterarm, sie jaulte auf, Schmerz und Schock durchströmten ihren Körper.
»Nein!«, schrie sie.
Sie hob den Kopf, blickte auf Lippen, die einen dünnen Strich bildeten, und Augen so tot wie die eines ausgestopften Tieres. Der Baseballschläger traf ihre Wange so hart, dass ihr Kopf nach hinten schnellte. Sie biss sich auf die Zunge, schmeckte Blut. Dunkelheit breitete sich vor ihren Augen aus, das Gefühl, ins Leere zu fallen. Der Boden kam auf sie zu, prallte an ihre Schulter, harter Teppichboden scheuerte über ihr Gesicht. Sie wusste, dass sie schwer verletzt war, und auch, dass es nicht aufhören würde – dass sie sich furchtbar verrechnet hatte.
Schlurfende Schritte auf dem Teppichboden, heftiges Atmen. Sie kämpfte gegen den Schwindel an, streckte die Hand nach dem Bett aus, bekam das Betttuch zu fassen, versuchte, sich daran hochzuziehen. Der Schläger landete auf der Matratze nur Zentimeter neben ihrer Hand. Sie konnte es schaffen, konnte noch immer entkommen. Einen Schmerzensschrei ausstoßend, hievte sie sich aufs Bett, kroch zur anderen Seite, packte die Lampe und riss das Kabel aus der Steckdose.
Der Baseballschläger traf sie im Rücken, die Wucht nahm ihr den Atem, sekundenlang war sie wie gelähmt und einer Ohnmacht nahe. Sie wollte die Lampe schwingen, aber ihre Verletzungen waren zu schwer, und sie glitt ihr aus der Hand.
»Verschwinde!«, schrie sie.
Sie rollte sich vom Bett, versuchte zu stehen, aber ihre Beine gaben nach, und sie fiel zu Boden. Dann sah sie die Tür, sie stand offen, fahles Licht drang ins Zimmer. Wenn sie es dorthin schaffen würde … Freiheit, dachte sie. Leben. Sie kroch darauf zu, der Schmerz tobte wie ein ratternder Güterzug in ihrem Körper.
Schritte von links, Beine verstellten ihr den Weg. »Nein!«, stieß sie hervor, ein Schrei aus dem tiefsten Inneren, voller Entrüstung und Panik. Keine Zeit, sich auf den nächsten Schlag vorzubereiten.
Und der landete mit solcher Wucht auf ihren Rippen, dass sie, einen animalischen Laut ausstoßend, zur Seite kippte. Sie öffnete den Mund, um Luft zu holen. Und schluckte Blut. Keuchend rollte sie sich auf den Rücken und blickte hinauf in ein Gesicht, das einer seelenlosen Maske glich. In den kalten Augen sah sie die unheilvolle Absicht, aber kein Fünkchen Verstand oder Gefühl. Da wurde ihr klar, dass sie sterben würde. Sie wusste, dass ihr Leben in diesem schmutzigen Motel enden würde und es nichts gab, um das noch zu verhindern.
Auf Wiedersehen in der Hölle, dachte sie.
Den nächsten Schlag bekam sie schon nicht mehr mit.
2. Kapitel
Der Winter im Nordosten Ohios ist endlos. Die Menschen sitzen die meiste Zeit in ihren Häusern und Wohnungen fest, zumal auch die Sonne oft wochenlang nicht zu sehen ist. Wenn dann die schonungslose Kälte und der viele Schnee endlich überstanden sind und das erste Grün die Felder färbt, brechen mit der Wucht einer Flutwelle die Frühlingsgefühle hervor.
Mein Name ist Kate Burkholder, und ich bin Chief of Police in Painters Mill, Ohio. Die hübsche Kleinstadt wurde 1815 gegründet, hat etwa fünftausenddreihundert Einwohner und liegt im Herzen des Amish Country. Ich bin als Amische geboren, aber anders als die meisten amischen Jugendlichen, habe ich die Glaubensgemeinde mit achtzehn Jahren verlassen und bin ins nahe gelegene Columbus gezogen. Dort habe ich die Hochschulreife erlangt, ein Diplom in Strafrecht gemacht und bin schließlich bei der Polizei gelandet. Nach einigen Jahren in der Großstadt hat es mich zurück zu meinen Wurzeln gezogen, und als der Stadtrat mir eine Stelle als Polizeichefin anbot, bin ich in meine Heimatstadt zurückgekehrt. Ich habe es nie bereut.
Heute Morgen plane ich, zusammen mit meinem Lebensgefährten John Tomasetti – er ist Agent beim Ohio Bureau of Criminal Investigation, kurz BCI – Reparaturen an unserer Scheune durchführen. Wir haben uns, kurz nachdem ich Polizeichefin geworden war, während der Ermittlungen in einem Mordfall kennengelernt und sind trotz eines holprigen Starts bald ein Paar geworden. Dass daraus tief empfundene Verbundenheit und eine dauerhafte Beziehung wurde, überraschte uns beide, und ich bin zum ersten Mal in meinem Erwachsenenleben vorbehaltlos glücklich.
Wir wollen einige Stellen der äußeren Scheunenverkleidung ausbessern, weshalb Tomasetti in einer Holzhandlung zwanzig Nut-und-Feder-Bretter und mehrere Liter Farbe gekauft hat. Während wir das Material aus dem Pick-up laden, picken und scharren ein Dutzend Buckeye-Hühner im Erdboden.
Auf unserer zweieinhalb Hektar großen Farm gibt es immer etwas zu tun. Das liegt hauptsächlich daran, dass wir das meiste selber machen, und wie so oft im Leben, lernt man nie aus. Wir hoffen, mit der Reparatur der Außenwände am nächsten Wochenende fertig zu werden. Das Wochenende darauf wollen wir alles grundieren und streichen. Und wenn das Wetter mitspielt, werden wir übernächstes Wochenende mit der Gartenarbeit beginnen.
»Ich hab gehört, du hast endlich jemanden für die Telefonzentrale gefunden«, sagt Tomasetti, während er die Bretter von der Ladefläche auf den Stapel am Boden zieht.
»Gestern hat sie angefangen«, sage ich. »Passt gut zu uns.«
»Mona ist sicher froh darüber.«
Bei dem Gedanken an Mona, meine frühere Telefonistin – und jetzt unser erster weiblicher Officer in Vollzeit –, muss ich lächeln. »Nicht nur sie«, sage ich. »Auch die Chefin wird jetzt hin und wieder einen Tag frei haben.«
Inzwischen steht er auf der Ladefläche, in jeder Hand einen knapp vier Liter schweren Farbeimer, und sieht auf mich herab. »Sie gefällt mir jetzt schon.«
Ich lasse das letzte Brett auf den Stapel fallen und sehe zu ihm hoch. »Hat dir schon mal jemand gesagt, wie gut du mit den Lederhandschuhen aussiehst?«, frage ich.
»Das höre ich andauernd«, sagt er.
Als er vom Wagen heruntersteigt, vibriert mein Handy an der Hüfte. Ich blicke aufs Display, auf dem die Nummer meines Reviers steht, und nehme ab. »Hi, Lois.«
»Chief.« Lois Monroe hat Frühschicht in der Telefonzentrale. Sie ist eine selbstbewusste Frau, Großmutter, Kreuzworträtsel-Ass und eine erfahrene Telefonistin. Ihre Stimme sagt mir, dass sie um Fassung ringt.
»Mona hat einen Anruf des Managers vom Willowdell-Motel entgegengenommen und gerade per Funk durchgegeben, dass in einem der Zimmer eine Leiche liegt.«
Sofort frage ich mich, ob es sich um einen natürlichen Tod handelt – einen Herzinfarkt oder unglücklichen Sturz – oder, was am schlimmsten wäre, um eine Überdosis. Denn das ist in letzter Zeit viel zu oft der Fall, selbst in einer kleinen Stadt wie Painters Mill.
»Wissen Sie schon etwas Genaueres?«, frage ich.
»Mona sagt, es sieht nach einem Tötungsdelikt aus, Chief. Und dass es ein schlimmer Anblick ist. Sie klang ziemlich mitgenommen.«
Solche Anrufe bekomme ich nicht oft.
»Ich bin unterwegs«, sage ich. »Mona soll den Tatort absperren und mögliche Beweise sichern. Niemand darf das Zimmer betreten. Schicken Sie einen Krankenwagen hin, und geben Sie dem Leichenbeschauer Bescheid.«
Ich brauche zwanzig Minuten von unserer Farm in Wooster zum Motel, eine Rekordzeit, zumal ich erst noch die Uniform anziehen und den Ausrüstungsgürtel umschnallen musste.
Das Willowdell-Motel gehört zu den Wahrzeichen von Painters Mill. MODERNISIERTES MOTEL DER FÜNFZIGER JAHRE, SAUBERE ZIMMER und GLITZERNDER POOL heißt es auf dem Schild an der Straße, das Touristen anlocken soll, die zur Erholung ein paar Tage im Amish Country verbringen wollen. Die Einwohner der Stadt würden es etwas weniger euphorisch beschreiben, denn der Pool funkelt nicht wirklich, die Fassade müsste dringend frisch gestrichen werden, und die Zimmer wurden seit den 1980er Jahren nicht mehr renoviert.
Ich fahre auf den Schotterparkplatz, wo Monas Streifenwagen mit flackerndem Blaulicht neben dem Eingang zum Büro steht. Sie selbst unterhält sich gerade vor Zimmer 9 mit einem korpulenten Mann in Camouflage-Hose und Golfshirt. Ich bin ihm schon begegnet, kann mich aber nicht mehr an seinen Namen erinnern. Wahrscheinlich der Manager. Ich parke meinen Explorer neben dem Streifenwagen, nehme das Handfunkgerät und lasse Lois in der Telefonzentrale wissen, dass ich am Tatort eingetroffen bin.
Als ich aussteige, wirkt Mona über die Maßen erleichtert, mich zu sehen. Sie ist sechsundzwanzig und erst seit wenigen Wochen Vollzeit-Officer – vorher hat sie in der Telefonzentrale gearbeitet –, aber sie ist noch immer genauso fasziniert von der Polizeiarbeit wie am ersten Arbeitstag. Trotz fehlender Erfahrung ist sie eine gute Polizistin mit wachem Instinkt, hoch motiviert und bereit, auch unbeliebte Schichten zu übernehmen, was in einem Revier mit nur fünf Officers ein echtes Plus ist.
Mir fällt sofort ihre ungewöhnliche Blässe auf, ihre Hand ist zittrig und kalt bei der Begrüßung. Dabei ist Mona wirklich keine Mimose. Wie die meisten meiner Officers zieht sie Action der Langeweile vor, und es gab noch kein Verbrechen, dessen Untersuchung sie nicht fasziniert hätte. Aber heute Morgen ist ihr Gesicht wie versteinert, und ich bin ziemlich sicher, auf dem Ärmel ihrer Jacke Spuren von Erbrochenem zu sehen.
»Was gibt es?«, frage ich.
»Die Tote ist eine Frau.« Sie deutet mit dem Blick zu Zimmer 9. »Sie liegt auf dem Boden. Und überall ist Blut, Chief. Ich hab keine Ahnung, was passiert ist.« Sie blickt über die Schulter zu dem Mann, der angestrengt versucht, jedes Wort zu verstehen, und senkt die Stimme. »Es sieht nach einem heftigen Kampf aus. Ich kann nicht erkennen, ob sie erstochen oder erschossen oder … anders zu Tode gekommen ist.«
Ich wende mich an den Mann. »Sie sind der Manager?«
»Doug Henry.« Er tippt auf das MANAGER-Schild an seinem Shirt. »Ich hab angerufen.«
»Eine Ahnung, was passiert ist?«, frage ich. »Haben Sie irgendetwas gesehen?«
»Also spätestens um elf Uhr muss ausgecheckt werden. Das Zimmermädchen ist heute nicht da, deshalb wollte ich selber sauber machen. Gegen zehn Uhr dreißig hab ich im Zimmer angerufen, aber niemand hat sich gemeldet, da hab ich bis elf gewartet und dann an die Tür geklopft. Als sie nicht geantwortet hat, bin ich mit meinem Schlüssel rein.« Er atmet tief auf. »So was hab ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen, und ich hab hier im Schlachthof gearbeitet. Überall Blut und umgeworfene Sachen. Ich hab schnell die Tür zugemacht und die Polizei angerufen.«
»Wie heißt die Frau, die das Zimmer gebucht hat?«, frage ich.
»Ihr Nachname ist Schwartz«, sagt er.
Kein ungewöhnlicher Name in diesem Teil von Ohio, bei Amischen wie bei Englischen. Wenn mein Gedächtnis mich nicht trügt, gibt es mindestens zwei Familien mit dem Namen hier in Painters Mill. »Vorname?«
»Ich kann gehen und nachsehen, wenn Sie wollen«, bietet er an.
»Das wäre nett.« Ich wende mich an Mona. »Haben Sie sichergestellt, dass niemand mehr im Zimmer ist?«
Sie verzieht das Gesicht und schüttelt den Kopf. »Bei ihrem Anblick war mir sofort klar, dass ich damit nicht klarkomme, und bin raus.«
»Hat danach noch jemand das Zimmer betreten?«
»Nein, niemand sonst.«
»Leichenbeschauer und Krankenwagen sind unterwegs?«
Sie nickt. »Und auch die Kollegen vom Sheriffbüro.«
»Wir stellen zuerst sicher, dass niemand mehr im Zimmer ist«, sage ich und trete zur Tür von Zimmer Nummer 9. »Achten Sie auf mögliche Beweisstücke. Und nichts anfassen«, füge ich hinzu, als Mona hinter mich tritt.
»Roger.«
Ich brauche einen Moment, bis sich meine Augen an das düstere Innere gewöhnt haben. Noch bevor ich das Blut sehe, steigt mir dessen unangenehmer Geruch nach Metall und Schwefel in die Nase. Dann fällt mein Blick auf einen tellergroßen rotschwarzen Fleck im Teppichboden, etwa einen Meter entfernt. Schmierspuren auf dem Bettzeug, Spritzer an Kopfteil und Wand und sogar an der Zimmerdecke. Auf der anderen Seite des Bettes sehe ich die Hand des Opfers.
»Sie checken das Bad«, sage ich.
Als ich mich dem Bett nähere, spüre ich den vertrauten Knoten im Bauch – Ausdruck meines tiefen Grauens vor einem gewaltsamen Tod. Ganz egal, wie oft ich dem Anblick schon ausgesetzt war, rebelliert doch immer wieder mein Magen, und ich ringe um Luft. Ich umrunde das Bettende und werfe einen ersten Blick auf das Opfer. Eine Frau. Sie liegt auf dem Bauch, Beine gespreizt, ein Arm unter ihr, der andere liegt ausgestreckt auf dem Teppichboden, die Hand darin verkrallt, als hätte sie versucht, sich zur Tür zu schleppen. Sie ist bekleidet mit einem pinkfarbenen T-Shirt und einer Unterhose. Socken.
Ich brauche mehr Licht und ziehe die Mini-Maglite aus dem Ausrüstungsgürtel. Der Strahl fällt auf ein schlimmes Szenario: Eine Lampe liegt auf dem Boden, der Schirm ist zerbrochen, das Kabel aus der Steckdose gerissen. Was immer der Frau angetan wurde, sie hat sich gewehrt und es ihrem Angreifer nicht leicht gemacht.
Tapferes Mädchen, flüstert eine leise Stimme in meinem Kopf.
»Badezimmer ist sauber«, höre ich Mona rufen.
»Blut?«
»Nein.«
Ich blicke zurück über die Schulter und sehe Monas Umrisse im Licht, das durch die Tür fällt. Doch in Gedanken bin ich bei der Sicherung der Beweise, wobei mir klar ist, dass wir sie gerade kontaminieren. Was sich in diesem Fall aber nicht vermeiden lässt.
»Gehen Sie raus und sichern Sie den Tatort weiträumig mit Absperrband«, beauftrage ich sie, ich nehme die Anspannung in meiner Stimme deutlich wahr. »Niemand darf in die Nähe kommen, keine Fahrzeuge außer dem Wagen des Leichenbeschauers.«
»Okay.«
Gewalt und die unaussprechlichen Dinge, die Menschen einander antun, sind mir nicht fremd. Trotzdem ringe ich in diesem Moment um Fassung.
Das Gesicht der Frau ist mir abgewandt, das Kinn auf unnatürliche Weise verrenkt. Das rotblonde Haar blutverschmiert, die Haut am Hinterkopf geplatzt und die Schädeldecke zertrümmert. Grünblauer Nagellack, goldenes Armband. Schöne Hände. Und mir wird bewusst, dass ihr noch vor wenigen Stunden so banale Dinge wie Maniküre und Schmuck wichtig waren.
Vorsichtig, um möglichst keine Spuren zu verwischen, gehe ich herum zur anderen Seite der Frau. Ihre linke Gesichtshälfte ist völlig zerstört – der Wangenknochen eingedrückt, der Augapfel außerhalb der Augenhöhle, die Nase nur noch ein Klumpen. Die Zunge hängt zwischen abgebrochenen Zähnen, Blut und Speichel rinnen wie an einem Faden auf den Teppichboden und haben eine faustgroße Lache gebildet.
Ich richte den Strahl der Taschenlampe auf ihr Gesicht, und mir wird ganz komisch, denn ich habe das Gefühl, die Frau zu kennen. Eine verschüttete Erinnerung drängt sich in mein Bewusstsein, gefolgt von Grauen, denn eine Fremde wäre mir in diesem Moment lieber. Doch ich kenne sie, und mir wird so übel, dass ich einen Schritt zurücktreten muss.
Ich beuge mich vor, die Hände auf die Knie gestützt, und atme tief durch. »Verdammt.«
Ein mir unbekannter Laut entkommt meinem Mund, und ich huste. Aber ich reiße mich zusammen, richte mich auf und lasse den Blick durchs Zimmer wandern. Auf dem Stuhl liegt eine teure Lederhandtasche mit Fransen. Auf dem Boden vor dem schmalen Wandschrank steht eine Reisetasche. Ich gehe zu dem Stuhl, nehme einen Stift aus der Jackentasche und öffne damit die Lasche. In der Tasche befinden sich ein Lederportemonnaie, ein Schminktäschchen, Kamm, Parfüm. Ich nehme die Geldbörse heraus, in der mehrere Zwanzigdollarscheine stecken, und weiß, dass es dem Täter nicht ums Geld ging.
Das Führerscheinfoto starrt mich durch die Plastikhülle an, und als ich den Namen lese, schwankt der Boden unter meinen Füßen: Rachael Schwartz. Das Grauen, das schon die ganze Zeit in mir lauert, bricht sich Bahn beim Anblick der schönen jungen Frau mit den rotblonden Haaren und dem angedeuteten Lächeln, das so typisch für sie war. Ein Lächeln, das sagte: Ich werde es weit bringen, und wenn du nicht mithalten kannst, bleibst du eben zurück! Genau so war Rachael – nicht einfach im Umgang, hoch emotional und mit einer Vorliebe für eindrucksvolle Auftritte. Schon als Kind wollte sie immer recht haben, selbst wenn sie offensichtlich unrecht hatte. Wenn man ihr weh tat oder sie verärgerte, schlug sie mit unverhältnismäßiger Härte zurück. Aber abgesehen davon war sie leidenschaftlich und loyal. Das weiß ich alles, weil ich eine der wenigen Amischen war, die sie verstanden, auch wenn ich es niemals laut ausgesprochen hätte.
Ich schließe die Augen und kämpfe gegen die aufkommenden Gefühle an. »Mistkerl«, flüstere ich.
Ich kannte Rachael Schwartz, als sie noch Windeln trug. Sie war sieben Jahre jünger als ich und das mittlere Kind einer Swartzentruber-Familie hier in Painters Mill. Swartzentruber-Amische gehören zu den konservativsten religiösen Gemeinschaften der Alten Ordnung, die strikt an den alten Traditionen festhalten. Sie verzichten auf die meisten Annehmlichkeiten, die andere amische Glaubensgemeinschaften erlauben, benutzen zum Beispiel keine Spülklosetts oder Schotter für lange Wege, und lehnen den Gebrauch von Schildern mit der Aufschrift »Langsam fahrendes Vehikel« an ihren Buggys ab. Die Familie hatte fünf Kinder, und als Teenager war ich manchmal Babysitter bei ihnen. Ihre Mamm und ihr Datt wohnen noch immer in dem alten Farmhaus an der Hogpath Road.
Durch meinen Weggang hatte ich Rachael aus den Augen verloren. Ich wusste nur, dass sie Painters Mill schon vor meiner Rückkehr als Polizeichefin verlassen hatte. Sie war das einzige Mädchen, das ich je kannte, dem es noch schwerer fiel als mir, amisch zu sein.
Mit meinem Smartphone mache ich ein Foto ihres Führerscheins für den Fall, dass ich die Informationen noch brauche.
»Chief?«
Ich schrecke zusammen, drehe mich um und hoffe, dass Mona mir ansieht, welche Gefühle mich gerade umtreiben. »Haben Sie alles abgesperrt?«, frage ich.
»Ja, Ma’am.« Sie sieht mich fragend an: »Sie kennen die Tote?«
Ich seufze, schüttele den Kopf. »Nicht gut, aber …« Ich weiß nicht, wie ich den Satz beenden soll, und lasse es einfach.
Mona gibt mir einen Moment Zeit, dann wandert ihr Blick zur Geldbörse. »Etwas gefunden?«
»Führerschein. Bargeld.« Wobei mir auffällt, dass etwas fehlt. »Kein Handy. Haben Sie eins gesehen?«
»Nein.«
Mit dem Stift schiebe ich die wenigen Gegenstände in der Tasche umher, dann lasse ich die Geldbörse wieder hineinfallen.
Als ich aufsehe, habe ich meine Gefühle wieder unter Kontrolle. »Ich rufe das BCI an, sie sollen die Spurensicherung schicken. In der Zwischenzeit checken wir die anderen Zimmer und Gäste. Der Manager kann uns sagen, welche Zimmer belegt sind, dann beginnen wir mit denen, die dem Tatort am nächsten sind. Wir werden alle befragen, vielleicht hat ja irgendjemand etwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört.«
»Okay.«
Wir verlassen den Raum. Auf dem Weg davor bleibe ich kurz stehen und atme zweimal tief ein und aus. »Glock soll auch herkommen«, sage ich; Rupert »Glock« Maddox ist mein erfahrenster Officer. »Hier stehen insgesamt vier Fahrzeuge. Wenn ich herausgefunden habe, welches ihr gehört, soll die Spusi es untersuchen.«
»In Ordnung, Chief.«
Ich nehme mein Handy und rufe im Revier an. Normalerweise kommunizieren wir über Funk, aber ich will nicht, dass Rachaels Name im Äther kursiert, falls jemand den Polizeifunk abhört.
»Lassen Sie Rachael Schwartz durch LEADS laufen«, beauftrage ich Lois. LEADS ist die Abkürzung für eine Datenbank der Ohio State Highway Patrol, in der Polizeibehörden checken, ob jemand ein Strafregister hat oder polizeilich gesucht wird. »Überprüfen Sie, ob es unter ihrem Namen irgendwelche Einträge, Telefonnummern oder Bekannte gibt. Was immer Sie finden.« Ich blicke auf das Foto vom Führerschein, das ich gemacht habe, und gebe die Adresse durch. »Checken Sie auch, wem die Immobilie gehört, in der sie wohnt, und ob sie Grundbesitz hatte.«
»Roger.«
Ich lege auf und gehe zum Manager des Motels, der ein paar Schritte entfernt gerade eine Zigarette raucht. »Ist sie tot?«, fragt er.
Ich nicke. »Haben Sie im Kopf, welche Zimmer belegt sind?«
»Zwei, vier, sieben und neun.«
Ich gebe die Information an Mona weiter, die sogleich auf Zimmer 7 zusteuert.
»Wissen Sie, welches Auto Frau Schwartz gehört?«, wende ich mich wieder an den Manager.
Er konsultiert das Papier in seiner Hand. »Ja, gut, sie hat die Info auf dem Anmeldeformular vermerkt«, sagt er und zeigt auf den Lexus ein paar Parkplätze von ihrem Zimmer entfernt. »Der dort.«
»War sie allein?«, frage ich.
»Ich hab sonst niemanden gesehen. Sie hat keinen zweiten Namen mit eingetragen und auch nur einen Schlüssel verlangt.«
Ich nicke, sehe mich um und entdecke ein paar Meter weiter unter dem Dachvorsprung eine Überwachungskamera. »Funktionieren Ihre Kameras?«
»Soviel ich weiß, ja.«
»Ich muss mir die Aufnahmen ansehen«, sage ich. »Können Sie sie mir zur Verfügung stellen?«
»Ich denke schon.«
»Wann genau hat sie eingecheckt?«
Wieder blickt er aufs Anmeldeformular. »Gestern Abend kurz nach acht.«
Ich nicke. »Können Sie sich noch eine Weile zur Verfügung halten, falls ich weitere Fragen habe?«
»Ich bin bis siebzehn Uhr hier.«
Ich danke ihm und drücke die Kurzwahltaste für John Tomasetti.
3. Kapitel
»Ich hab doch gewusst, dass du es nicht lange aushältst, ohne den Klang meiner Stimme zu hören.«
Mir gelingt zwar ein halbwegs manierliches Lachen, aber Tomasetti ist ein scharfsinniger Mann – oder mein Versuch, entspannt zu klingen, war nicht so überzeugend, wie ich glaubte, denn er fragt: »Was ist passiert?«
»Eine Frau wurde ermordet«, sage ich. »Im Motel.«
Kurzes Schweigen, dann: »Was brauchst du?«
»Erst einmal die Spurensicherung.«
»Schussverletzung oder Stichverletzung? Familienstreit? Worum genau geht es?«
»Ich bin nicht sicher. Vermutlich totgeprügelt. Schwer zu sagen, es gibt eine Menge Blut. Sie ist dreißig Jahre alt.«
»Ich schicke meine Leute so schnell wie’s geht hin.« Er wartet, zögert, will den Anruf noch nicht beenden, weil er weiß, dass das nicht alles ist. »Sonst noch was, Kate?«
»Tomasetti, die Frau … sie war einmal amisch. Vor vielen Jahren. Ich wusste, dass sie die Gemeinschaft verlassen hatte.« Ich weiche aus, laviere herum, doch dann räuspere ich mich und sage es endlich. »Ich habe sie gekannt. Ich meine, als sie noch ein Kind war.«
»Eine Vermutung, wer sie getötet haben könnte?«
»Nein. Es ist viele Jahre her, seit ich sie zum letzten Mal gesehen habe.« Ich kann es selbst nicht fassen, dass mich eine so weit zurückliegende Verbindung dermaßen aufwühlt. »Wer immer das war … es sieht schlimm aus. Nach viel Gewalt.«
»Dann hat der Mörder sie gekannt.«
»Wahrscheinlich.« Ich reibe mir mit der Hand übers Gesicht. »Ich muss es ihren Eltern sagen.«
»Warte noch. Ich komme, so schnell es geht.«
Ich habe gerade aufgelegt, als auf dem Schotterplatz hinter mir Autoreifen knirschen. Ich drehe mich um und sehe einen Streifenwagen des Holmes-County-Sheriffbüros mit rotierendem Blaulicht neben meinem Explorer halten. Kurz darauf steigt Dane »Fletch« Fletcher aus, den ich ganz gut kenne. Seit ich hier Chief bin, hatten wir mehrere gemeinsame Einsätze bei Verkehrsunfällen, wir haben einige häusliche Konflikte entschärft und sind bei einer Schlägerei im Brass Rail eingeschritten. Letzten Sommer haben wir uns auch an einer Spendenaktion für eine Jugendhilfeorganisation beteiligt. Dabei haben wir fast den ganzen Tag in einem Wassertank verbracht, während Jugendliche mit einem Ball auf eine Zielscheibe dahinter geworfen haben – und sich bei jedem Treffer ein Eimer Wasser über uns ergoss. Er ist ein guter und besonnener Polizist und hat einen wunderbaren Humor, den ich sehr zu schätzen weiß.
»Hi, Fletch«, sage ich und gehe auf ihn zu.
Wir schütteln uns die Hand. »Ich hab gehört, es gibt eine Leiche.«
Ich erzähle ihm das wenige, was ich bislang weiß. »BCI ist unterwegs.«
»Und das kurz vorm Wochenende. Wenn Sie Hilfe vom Sheriffbüro brauchen, Anruf genügt, Kate.«
Das Willowdell-Motel liegt zwar innerhalb der Stadtgrenze von Painters Mill und somit in meiner Zuständigkeit, aber ich arbeite schon immer eng mit dem Sheriffbüro von Holmes County zusammen. Wir pflegen eine gute Beziehung, und je nach verfügbaren Einsatzkräften und der Arbeitslast helfen wir uns gegenseitig aus.
Er kratzt sich am Kopf, den Blick auf die offene Tür von Zimmer Nummer 9 gerichtet. »Das Opfer?«
Ich gebe ihm die Infos über Rachael Schwartz, die ich habe, halte mich an Fakten und lasse meine Gefühle außen vor.
»Sie war mal amisch?« Er reibt sich mit der Hand übers Kinn. »Verdammt. Dann war sie hier, um die Familie zu besuchen?«
»Vielleicht.« Ich stoße einen Seufzer aus, blicke um mich. »Ich hab das Zimmer oberflächlich in Augenschein genommen und eine Geldbörse mit Führerschein gefunden. Geld war noch drin, also kein Raubüberfall. Ein Handy habe ich nicht gefunden, aber sobald das BCI hier ist, wird das Zimmer genau durchsucht.« Ich bin froh, dass ich mit den Gedanken wieder langsam bei der Sache bin und ich meinen Verstand auf die Polizeiarbeit fokussieren kann.
Ich mache mich auf zum Lexus, der ein Stück von Zimmer 9 entfernt steht, und streife mir auf dem Weg ein paar Handschuhe aus der Tasche am Ausrüstungsgürtel über. Der Wagen, eine ziemlich neue, rot glänzende schnittige Limousine, verrät Wohlstand und Erfolg.
Der Deputy ist mir gefolgt und steht jetzt hinter mir. Er reckt den Hals, um ins Wageninnere zu sehen. »Netter Schlitten für eine amische Lady«, bemerkt er.
»Ehemals amisch.«
Eigentlich möchte ich nichts anfassen, aber weil in meiner Stadt ein Killer frei herumläuft, ignoriere ich das und öffne die Fahrertür. Der Innenraum ist warm und riecht nach Leder und Parfüm, aber auch der vage Geruch von Fastfood hängt in der Luft. Auf dem Boden hinter dem Vordersitz liegt eine zusammengeknüllte McDonald’s-Tüte, über der Rückenlehne des Beifahrersitzes hängt eine hübsche geblümte Jacke, und auf dem Boden davor liegen königsblaue Stöckelschuhe. Ich beuge mich vorsichtig ins Wageninnere und klappe die Mittelkonsole auf, sehe darin einige Hörbücher, ein Päckchen Marlboro, Münzgeld und eine kleine Packung Ibuprofen. Kein Handy. Gerade will ich die Konsole zuklappen, als mein Blick auf ein gefaltetes Stück Papier in der Zellophanhülle der Zigarettenschachtel fällt. Ich mache mit dem Smartphone einige Fotos, dann ziehe ich den Zettel heraus und falte ihn auf. Darauf steht mit blauer Tinte eine Adresse, zweimal unterstrichen.
1325 Superior Street
Wooster
»Hallo, was haben wir denn da«, sage ich, lege den Zettel auf den Sitz und mache ein weiteres Foto.
»Was ist das?«, fragt Fletch hinter mir.
»Ich bin nicht sicher«, sage ich. »Eine Adresse.«
Er versucht, mit zusammengekniffenen Augen das Geschriebene auf dem Stück Papier zu lesen. »Wow.«
Fletch ist ein guter Polizist, der weiß, dass sich möglichst wenige Menschen innerhalb einer Absperrung aufhalten sollten. Zudem sitzt er mir etwas zu dicht auf der Pelle, und ich schiebe ihn ein Stück weg, damit er mir mehr Raum gibt. »Haben Sie Leitkegel und Absperrband dabei?«, frage ich.
Er versteht den Wink. »Sie wollen, dass ich den Parkplatz absperre?«, fragt er.
»Das wäre sehr hilfreich. Auch wenn die Chance minimal ist, noch Reifen- oder Fußspuren sichern zu können.«
»Wie Sie wollen, Chief.«
Ich lasse den Zettel auf dem Sitz liegen, gehe vorn um den Wagen herum zur Beifahrerseite und werfe dort ebenfalls einen Blick ins Innere, finde aber nichts Interessantes.
Als ich gerade die Tür schließe, biegt Doc Coblentz, der Leichenbeschauer des Countys, in seinem Escalade auf den Parkplatz und bleibt wenige Meter von mir entfernt stehen.
Ich hole mein Handy heraus und rufe im Revier an.
»Hi, Chief.«
»Lois, ich bin’s noch mal. Können Sie herausfinden, wer unter folgender Adresse wohnt?« Ich rufe das Foto auf, das ich vom Zettel gemacht habe, und lese ihr die Adresse vor. »Namen und wenn möglich Telefonnummer. Lassen Sie den oder die Namen dann durch LEADS laufen, ob irgendetwas vorliegt.«
»Geben Sie mir zwei Minuten.«
»Danke.«
Ich lege auf und blicke mich um. Mona und Fletch befragen gerade das stark tätowierte Pärchen, das zwei Zimmer neben der Nummer 9 eingecheckt hat und nun wie gebannt auf jene Tür starrt. Selbst aus acht Metern Entfernung sehe ich den Schock und die Neugier in ihren Gesichtern.
Painters Mill ist eine kleine Stadt, und so ist es nicht ungewöhnlich, dass ich in meinem Job mit Menschen zu tun habe, die ich kenne, ob sie Opfer oder Täter oder einfach nur Zeugen sind. Das hier ist anders. Als erwachsene Frau hatte ich Rachael Schwartz kaum gekannt und ehrlich gesagt auch vergessen. Erst als sie vor zwei oder drei Jahren ein Enthüllungsbuch über die Amischen veröffentlichte, wurde ich wieder auf sie aufmerksam, aber selbst dann hatte sie kaum mehr mein Interesse geweckt. Gelesen habe ich ihr Buch nicht.
Doch ich kannte sie als Kind – und damals hat sie mich beeindruckt. Rachael war lebhaft und geradeheraus, was sie von anderen amischen Kindern unterschied. Sie war allerdings auch altklug und streitlustig und rebellierte gegen Autoritäten – alles Eigenschaften, die ihr schadeten. Als sie in ihren Teenagerjahren den Älteren den Respekt verweigerte und ihren Glaubensbrüdern mit Geringschätzung begegnete, führte das zu großen Problemen für alle Beteiligten – und nicht zuletzt für Rachael selbst.
Als Letztes hatte ich gehört – wahrscheinlich im Verlauf eines Gesprächs mit einem ortsansässigen Amischen –, dass Rachael vor zwölf oder dreizehn Jahren sowohl die Glaubensgemeinschaft als auch Painters Mill verlassen hatte. Wo war sie hingegangen? Gab es außer dem Buch, das sie geschrieben hatte, noch etwas, womit sie die Wut einiger Leute erregte? Warum war sie jetzt zurückgekommen? Wer hasste sie so sehr, dass er sie bis zur Unkenntlichkeit zu Tode prügelte?
Die Fragen setzen mir zu wie ein eitriger Zahn, und ich werde in den nächsten Tagen alles tun, um Antworten zu bekommen, auch wenn sie mir vielleicht nicht gefallen.
4. Kapitel
Rhoda und Dan Schwartz wohnen an einer unbefestigten Straße etwas außerhalb von Painters Mill, etwa eine Meile von der Hogpath Road entfernt. Das Paar ist seit jeher eine Säule der amischen Gemeinde, und da die Kinder nun alle erwachsen und verheiratet sind, unterrichtet Rhoda wieder in der Zwei-Klassenzimmer-Schule weiter unten in der Straße. Dan betreibt zusammen mit seinem ältesten Sohn einen Milchbauernhof. Sie sind ehrbare, hart arbeitende Menschen und gute Nachbarn. Allerdings haben sie mich auch bedenkenlos verurteilt, wenn ich als Teenager in Schwierigkeiten gesteckt hatte. Und ich frage mich, ob ihre Intoleranz mit ein Grund war, dass ihre Tochter die Gemeinde verlassen hat.
Der Tod eines Kindes ist die schlimmste Nachricht, die Eltern bekommen können, und den Schmerz darüber nehmen sie mit bis ins Grab. Es verändert die Ordnung ihrer Welt, stiehlt alle Freude aus ihrem Leben und alle Hoffnung. Im Allgemeinen gehen Amische mit Trauer eher stoisch um, zum Teil aufgrund ihres Glaubens, der das ewige Leben verspricht. Doch beim Verlust eines Kindes erspart ihnen selbst dieser Glaube nicht den peinigenden Schmerz.
Als ich in die unbefestigte Straße zu ihrer Farm einbiege, spüre ich den Knoten in meinem Bauch. Das Farmhaus selbst ist alt, mit einem Obergeschoss und mehreren, über die Jahrzehnte angebauten Erweiterungen. Die Steinfassade bröckelt an einigen Stellen, und die vordere Veranda hängt etwas durch, aber der weiße Anstrich wirkt neu, und der seitliche Garten mit dem Lattenzaun und der frisch umgegrabenen Erde gleicht einem Postkartenmotiv.
Ich parke hinter dem Haus neben einem alten Gülleverteiler und folge dem Plattenweg zur Vorderseite, wo Rhoda auf der Rundumveranda kniet. Neben ihr stehen auf Zeitungspapier von The Budget ein halbes Dutzend Tontöpfe, ein Sack Topferde lehnt am Geländer. Sie ist um die fünfzig, hat eine freundliche Ausstrahlung, silbergraues Haar unter einer Kapp und beim Lächeln zwei Grübchen, die sie an ihre Tochter vererbt hat.
»Hi, Rhoda«, sage ich und gehe die Treppe hinauf.
Sie blickt von ihrer Arbeit auf. »Katie Burkholder! Das ist aber eine Überraschung!« Sie steht auf und streift die Hände am Rock ab. »Wie bischt du heit?« Wie geht es dir?
Sie ist mir gegenüber herzlich und offen, aber auch überrascht, mich zu sehen – fragt sich wohl, warum ich gekommen bin, und dann auch noch in Uniform. Ich erschüttere ungern ihre Welt und spüre in mir eine Welle von Hass hochkommen auf die Person, die ihre Tochter umgebracht hat.
Sie drückt mir fest die Hand. »Wie geht es deiner Familie, Katie?« Ihre Fingernägel sind kurz geschnitten, die Handflächen schwielig. »Ist deine Schwester wieder ime familye weg?« Amische haben eine Abneigung gegen das Wort »schwanger« und sagen stets »in anderen Umständen«. »Diese Sarah, sie macht es immer spannend.«
Ich sehe in ihre Augen und bemerke zum ersten Mal, dass sie auch die graublaue Iris an ihre Tochter vererbt hat. Bei der Vorstellung, ihr gleich großen Kummer bereiten zu müssen, wird mir schwer ums Herz.
»Es tut mir leid, Rhoda, aber ich bin in offizieller Funktion hier.« Ich drücke ihre Hand. »Ist Dan zu Hause?«
Ihr Lächeln erstirbt. Mein Gesichtsausdruck oder meine Stimme macht sie stutzig. Sie legt den Kopf schief, und ein Anflug von Sorge steht in ihren Augen. »Ist alles in Ordnung?«
»Wo ist Dan?«, frage ich wieder.
»Im Haus«, sagt sie. »Ich hab Sandwiches mit gebratener Mortadella zum Mittagessen gemacht. Vermutlich lässt er sich gerade heimlich ein zweites schmecken. Wenn du einen Moment Zeit hast, können wir uns ein wenig unterhalten, was es alles Neues gibt.«
Sie ist nervös und redet drauflos. Sie weiß, dass ich schlechte Nachrichten überbringe. Bestimmt hat sie Hunderte Szenarien im Kopf, die alle mit ihrer Tochter zu tun haben – als hätte sie schon immer gewusst, dass ihre Tochter durch ihre Eskapaden irgendwann in Schwierigkeiten kommen würde, und ahnte nun, dass es jetzt so weit war.
»Du glaubst es nicht, aber der Mann futtert wie ein Scheunendrescher«, sagt sie auf Deitsch.
Ich möchte sie in die Arme nehmen, damit sie aufhört zu plappern, und sie halten, wenn sie zusammenbricht. Ich möchte ihr etwas von dem Schmerz abnehmen, den ich ihr gleich zufügen werde, aber weil das unmöglich ist, gehe ich an ihr vorbei und mache die Hintertür auf. »Dan?«, rufe ich. »Hier ist Kate Burkholder.«
Dan Schwartz erscheint in der Tür, die vom Wohnzimmer in die Küche führt, ein Sandwich in der Hand. Er hat einen flachkrempigen Strohhut auf, ein blaues Arbeitshemd und braune Hosen mit Hosenträgern an. Er grinst freundlich, dabei sieht man die Lücke, wo der obere Eckzahn fehlt, an die ich mich noch von früher erinnere.
»Wie geht’s alleweil?« Doch als er dann seine Frau ansieht, verschwindet sein Grinsen. »Was der schinner is letz?« Was um Himmels willen ist passiert?
»Es geht um Rachael«, sage ich. »Sie ist tot. Es tut mir leid.«
»Was?«, stößt Rhoda ungläubig aus, sie hebt die Hand und weicht einen Schritt zurück, als wäre ihr gerade bewusst geworden, dass ich eine ansteckende tödliche Krankheit habe. »Sell is nix as baeffzes.« Das glaube ich nicht.
Dan eilt auf sie zu, will nach seiner Frau greifen, fasst daneben, stolpert näher und nimmt ihre Hand in seine. Er sagt nichts, aber ich sehe den Schmerz, der ihn überkommt. Denn während die Amischen an die göttliche Ordnung der Dinge glauben und an das Leben nach dem Tod, sind sie doch Menschen wie alle, und ihr Schmerz trifft mich tief ins Herz.
»Rachael?« Rhoda legt sich die Hand auf den Mund, als wolle sie den Schrei unterdrücken, der herauswill. »Nein. Das kann nicht sein. Ich hätte es gewusst.«
»Bist du sicher?«, fragt Dan.
»Sie ist tot«, sage ich. »Letzte Nacht. Es tut mir leid.«
»Aber … wie?«, fragt er. »Sie ist jung. Was ist mit ihr passiert?«
Fast hätte ich die beiden gebeten, sich zu setzen, doch ich merke rechtzeitig, dass es nur ein kläglicher Versuch wäre, den zweiten schlimmen Schlag hinauszuzögern. Aber schlechte Nachrichten müssen schnell überbracht werden. Angehörige müssen ohne Zögern benachrichtigt werden, offen heraus, ohne Umschweife. Man muss die Tatsachen aussprechen, sein Mitleid bekunden und sich dann so weit distanzieren, um die nötigen Fragen stellen zu können.
Da es noch keine offizielle Todesursache gibt, beschränke ich mich auf das Nötigste. »Ich weiß nur, dass ihre Leiche heute Vormittag gegen elf Uhr gefunden wurde.«
Der amische Mann sieht mich an, Tränen in den Augen. Doch er hält sie zurück. »War es ein Unfall? Mit dem Auto?« Er presst die Lippen zusammen. »Oder Drogen? Was?«
Es gelingt mir nur schlecht, die Fakten darzustellen, denn mein Kopf ist vernebelt von den eigenen Emotionen, von den Bildern im Motel und dem, was ich über ihre Tochter weiß. »Sie wurde in einem Zimmer im Willowdell-Motel gefunden«, sage ich. »Wir wissen noch nicht, was genau passiert ist, aber ihr Körper weist Verletzungen auf. Die Polizei ermittelt.«
Rhoda Schwartz presst beide Hände an ihre Wangen. Ihre Augen füllen sich mit Tränen. »Mein Gott.«
Dan sieht mich an, blinzelt heftig in dem Versuch, die Information zu absorbieren. »Was für Verletzungen?«
So wie er mich ansieht, vermutet er bereits, dass Rachaels Verhalten, ihre Lebensweise, sie schließlich eingeholt haben.
»Ich glaube, sie wurde ermordet«, sage ich.
»Jemand … hat ihr das Leben genommen?« Rhoda stößt einen Laut aus, halb Schluchzen, halb Winseln. »Wer tut denn so etwas? Und warum?«
Dan wendet den Blick ab, schweigt. Sein Kiefer zuckt, auch in seinen Augen schimmern Tränen, aber er lässt ihnen keinen freien Lauf.
Dann blickt er mich wieder an. »Rachael ist hier, in Painters Mill?«
»Ihr wusstet nicht, dass sie in der Stadt ist?«, frage ich und sehe sie beide an.
Sie schütteln den Kopf.
»Könnt ihr euch vorstellen, warum sie gekommen ist?«, frage ich.
Rhoda scheint die Frage nicht einmal zu hören. Sie hat sich abgewandt, die Arme um sich geschlungen, ist blind und taub in ihr Elend gehüllt. Ihre Schultern beben, während sie lautlos schluchzt.
»Wir haben es nicht gewusst«, sagt Dan.
»Wann habt ihr sie das letzte Mal gesehen?«, frage ich.
Dan blickt zu Boden, und ich wende mich an Rhoda.
Sie sieht mich an, als hätte sie vergessen, dass ich da bin. Ihr Gesicht ist kreidebleich, ihre Nase gerötet, und sie blinzelt, als müsse sie mich in ihr Blickfeld zurückholen. »Kurz vor Weihnachten, vor einem Jahr, glaube ich.«
Dass Rachael ihre Eltern fast eineinhalb Jahre nicht gesehen hat, sagt viel über die Beziehung zwischen ihnen. »Hat sie bei ihrem Besuch etwas von Problemen erzählt? Steckte sie in irgendwelchen Schwierigkeiten?«
Die amische Frau schüttelt den Kopf. »Sie kam mir vor wie immer. Vielleicht ein bisschen verloren. Aber du weißt ja, wie das ist. Sie hat die Gemeinde verlassen, und das passiert dann.«
»Hattet ihr regelmäßigen Kontakt?«, frage ich. »Hat sie angerufen oder geschrieben?«
»An ihrem Geburtstag hab ich mit ihr gesprochen«, sagt Rhoda. »Ich hab sie angerufen, von der Telefonzelle unten an der Straße. Ist jetzt ein Jahr her.«
»Und was für einen Eindruck hattest du bei dem Gespräch?«, frage ich. »Hat sie erzählt, was in ihrem Leben so alles passiert? Vielleicht Probleme erwähnt? Irgendetwas Ungewöhnliches oder Besorgniserregendes?«
»Es ging ihr gut.« Die amische Frau verzieht das Gesicht, beugt sich vor und vergräbt es in den Händen.
Ich warte einen Moment, dann dränge ich weiter. »Wie war denn eure Beziehung insgesamt?«
»Den Umständen entsprechend gut«, sagt Rhoda. »Bischof Troyer hat sie ja unter Bann gestellt, aber ich habe die Hoffnung nie aufgegeben, dass sie zu uns und unserer amischen Lebensweise zurückfindet.«
Zum ersten Mal entdecke ich in den Gesichtern der beiden außer dem Kummer auch Schuldgefühle, so als wäre ihnen gerade bewusst geworden, dass sie die unnachgiebige Haltung gegenüber ihrer Tochter aufgeben und trotz der Regeln engeren Kontakt hätten pflegen sollen.
»Stand sie denn sonst noch mit jemandem aus Painters Mill in Verbindung?«, frage ich.
»Mit Loretta Bontrager war sie immer eng befreundet«, erwidert Rhoda.
Ich kenne Loretta nicht persönlich, aber das Bild eines ruhigen, kleinen amischen Mädchens erscheint vor meinem inneren Auge. Damals hieß sie mit Nachnamen Weaver und war das genaue Gegenteil von Rachael, nämlich zurückhaltend und schüchtern anstatt laut polternd und vorlaut. Niemand hatte verstanden, wieso die beiden Busenfreundinnen waren. Loretta lebt noch immer in Painters Mill, ich sehe sie hin und wieder in der Stadt. Es heißt, sie habe geheiratet und ein Kind bekommen.
Ich hole den Notizblock aus der Jackentasche und notiere ihren Namen.
»Sie waren schon als kleine Mädchen befreundet«, sagt Dan.
»Ich weiß nicht, ob sie sich immer noch sehen«, fügt Rhoda hinzu. »Aber wenn Rachael in Painters Mill überhaupt noch mit jemandem außer mit uns Kontakt hatte, dann mit Loretta.«
Ich nicke, formuliere im Kopf bereits die nächste Frage. »Fällt euch sonst noch jemand ein, den sie mal näher kannte?«
»Wenn es noch jemanden gab, dann wissen wir nichts davon«, antwortet Dan.
»Hatte sie einen Freund?«, frage ich.
Dan blickt zu Boden, überlässt seiner Frau die Antwort.
»In solchen Dingen war sie sehr verschwiegen«, sagt Rhoda leise.
Ich nicke, denn falls Rachael tatsächlich eine Beziehung hatte, werden sie wahrscheinlich nichts davon wissen. »Hat sie vielleicht mal Probleme erwähnt? Dass sie mit jemandem Streit hatte?«
Der Mann schüttelt den Kopf, den Blick noch immer gesenkt und die Lippen zusammengepresst.
Wieder ist es Rhoda, die antwortet. »So etwas hat sie nie erwähnt, jedenfalls nicht uns gegenüber.«
»Wahrscheinlich wollte sie nicht, dass wir uns Sorgen machen«, fügt Dan hinzu. »In der Beziehung war sie rücksichtsvoll.«
Als »rücksichtsvoll« würde ich Rachael ganz bestimmt nicht bezeichnen. »Kennt ihr Freunde von ihr in Cleveland?«, frage ich.
Das Paar sieht sich an.
Dan schüttelt den Kopf. »Wir wissen nichts über ihr Leben dort«, sagt er, wobei seine Missbilligung eindeutig mitschwingt.
»Wisst ihr, wovon sie gelebt hat?«, frage ich. »Wo sie gearbeitet hat?«
»In irgendeinem schicken Restaurant«, sagt Rhoda.
»Weißt du den Namen?«
»Nein.« Sie schüttelt den Kopf, blickt hinab auf ihre Hände. »Sie hat ja dieses Buch geschrieben. Die vielen Lügen.« Sie schluckt heftig. »Dass amische Männer ihren Willen auf der Rückbank ihres Buggys durchsetzen. Großer Gott.«
»Hat in Painters Mill viel böses Blut erzeugt.« Dans Gesicht wird schamrot. »Wir wussten, dass die Großstadt einen schlechten Einfluss auf sie haben würde.«
»Ein übles Pflaster«, fügt Rhoda hinzu. »Wir haben versucht, ihr das klarzumachen, aber sie war halsstarrig und hat nicht auf uns gehört. Du kennst sie ja selbst.« Wieder schüttelt sie den Kopf. »Hier wäre sie sicherer gewesen. Sie hätte geheiratet, eine Familie gehabt und wäre nahe bei Gott geblieben.«
Ich erinnere sie nicht daran, dass Rachael wahrscheinlich hier in Painters Mill umgebracht wurde, vermutlich von jemandem, der sie kannte. Jemandem voller Wut, der außer sich war und gewissenlos – und wohl auch fähig, so etwas wieder zu tun.
5. Kapitel
Bei meiner Ankunft im Willowdell-Motel wimmelt es von Polizisten. Um mögliche Reifenspuren zu sichern, haben alle Einsatzfahrzeuge am Straßenrand vor dem Motel geparkt – Glocks Streifenwagen, der SUV des Holmes-County-Sheriffbüros sowie der Dodge Charger der Ohio State Highway Patrol. Innerhalb der Absperrung stehen lediglich der Van der BCI-Spurensicherung und der des Leichenbeschauers.
Ich rufe über Funk die Zentrale meines Reviers an. »Haben Sie etwas über Schwartz herausgefunden?«
»Zweimal Trunkenheit am Steuer in den letzten vier Jahren«, berichtet Lois. »Immer außerhalb von Cuyahoga County. Sie hat sich beide Male nicht gegen die Anklage gewehrt. Vor sechs Jahren ein ungedeckter Scheck, da hat sie eine Strafe gezahlt. Letzten Sommer wurde sie wegen häuslicher Gewalt festgenommen. Die Anschuldigung wurde später fallen gelassen.«
Ich werde hellhörig. »Hat der Traummann einen Namen?«
»Jared Moskowski. Zweiunddreißig Jahre alt, keine Akte, nie festgenommen.« Sie rasselt seine Adresse in Cleveland herunter. »Und jetzt halten Sie sich fest: Moskowski hat sie wegen häuslicher Gewalt angezeigt.«.
Bei häuslichen Auseinandersetzungen rufen meistens die Frauen, die von ihrem männlichen Partner geschlagen wurden, die Polizei an. Aber so wie ich Rachael Schwartz in Erinnerung habe, überrascht es mich nicht, dass sie mindestens genauso sehr Initiatorin wie Opfer einer Auseinandersetzung war. Trotzdem werde ich Tomasetti bitten, sich Moskowski genauer anzusehen.
Ich will ihr schon danken und auflegen, aber sie hat noch etwas. »Es geht um die Adresse, die Sie mir gegeben haben.«
»Ich höre.«
»Da ist kein Wohnhaus, sondern eine Bar, sie heißt The Pub.«
»Sie sind wirklich eine Quelle interessanter Informationen«, sage ich.
»Das Internet hilft ein wenig.«
Während ich hinter Glocks Streifenwagen parke, frage ich mich, ob Rachael noch immer ein Verhältnis mit Moskowski hatte – ob es eine wechselvolle Beziehung war. Und ich überlege, warum Rachael die Adresse der Bar in Wooster aufgeschrieben hat, wo sie doch in Cleveland wohnte, also etwa eine Autostunde weit weg. War sie dort mit jemandem verabredet? Oder hat sie die Person bereits unterwegs auf der Fahrt von Cleveland nach Painters Mill getroffen? Hatte es Streit gegeben? Ist ihr die Person bis nach Painters Mill gefolgt und hat sie dann im Motel zur Rede gestellt?
Ein paar Meter entfernt entdecke ich Tomasettis Tahoe. Er lehnt an der Motorhaube und telefoniert. Als er mich kommen sieht, beendet er das Gespräch.
»Hast du mit der Familie gesprochen?«, fragt er.
Ich frage mich, ob mir das noch anzusehen ist, und nicke. »Es hat sie ziemlich mitgenommen.«
Er betrachtet mich etwas eindringlicher, als mir lieb ist. »Dich offensichtlich auch«, sagt er.
»Und ich dachte immer, meine toughe Fassade gibt nichts preis«, sage ich betont locker.
»Wie gut kanntest du sie eigentlich?«