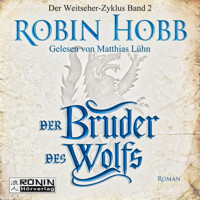12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Regenwildnis-Chroniken
- Sprache: Deutsch
Das Finale der großen Regenwildnis-Saga von World-Fantasy-Award-Gewinnerin Robin Hobb erstmals auf Deutsch!
Die Drachen von Kelsingra haben ihre neue Heimat erfolgreich verteidigt. Nun haben ihre menschlichen Hüter Zeit gewonnen, um zu wahren Gefährten der Drachen zu werden. Und auch die Drachen haben jetzt die Ruhe, um ihre Flügel voll zu entwickeln und die sagenumwobenen Silbervorkommen zu finden, die sie zum Überleben brauchen. Doch gerade dieser neue Reichtum von Kelsingra ruft neue Neider auf den Plan. Noch sind die Drachen schwach, noch sind sie angreifbar – und eine Armee der Menschen nähert sich durch die Regenwildnis ihrer Stadt!
Die New-York-Times-Bestsellersaga »Regenwildnis« von Robin Hobb ist unabhängig von der Weitseher-Saga lesbar und erscheint komplett bei Penhaligon:
1. Wächter der Drachen
2. Stadt der Drachen
3. Kampf der Drachen
4. Blut der Drachen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 838
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Die Drachen von Kelsingra haben ihre neue Heimat erfolgreich verteidigt. Nun haben ihre menschlichen Hüter Zeit gewonnen, um zu wahren Gefährten der Drachen zu werden. Und auch die Drachen haben jetzt die Ruhe, um ihre Flügel voll zu entwickeln und die sagenumwobenen Silbervorkommen zu finden, die sie zum Überleben brauchen. Doch gerade dieser neue Reichtum von Kelsingra ruft neue Neider auf den Plan. Noch sind die Drachen schwach, noch sind sie angreifbar – und eine Armee der Menschen nähert sich durch die Regenwildnis ihrer Stadt!
Autorin
Robin Hobb wurde in Kalifornien geboren, zog jedoch mit neun Jahren nach Alaska. Nach ihrer Hochzeit zog sie mit ihrem Mann nach Kodiak, einer kleinen Insel an der Küste Alaskas. Im selben Jahr veröffentlichte sie ihre erste Kurzgeschichte. Seither war sie mit ihren Storys an zahlreichen preisgekrönten Anthologien beteiligt. Mit »Die Gabe der Könige«, dem Auftakt ihrer Serie um Fitz Chivalric Weitseher, gelang ihr der Durchbruch auf dem internationalen Fantasy-Markt. Ihre Bücher wurden seither millionenfach verkauft und sind Dauergäste auf der New-York-Times-Bestsellerliste. Robin Hobb hat vier Kinder und lebt heute in Tacoma, Washington.
Die Regenwildnis-Saga von Robin Hobb ist unabhängig von der Weitseher-Saga lesbar und erscheint komplett bei Penhaligon:
1. Wächter der Drachen
2. Stadt der Drachen
3. Kampf der Drachen
4. Blut der Drachen
Die Chronik der Weitseher von Robin Hobb bei Penhaligon:
1. Die Gabe der Könige
2. Der Bruder des Wolfs
3. Der Erbe der Schatten
Das Erbe der Weitseher von Robin Hobb bei Penhaligon:
1. Diener der alten Macht
2. Prophet der sechs Provinzen
3. Beschützer der Drachen
Das Kind der Weitseher von Robin Hobb bei Penhaligon:
1. Die Tochter des Drachen
2. Die Tochter des Propheten
3. Die Tochter des Wolfs
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
Robin Hobb
Blut der Drachen
Roman
Deutsch von Simon Weinert
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel »Blood of Dragons (Rain Wilds Chronicles Book 4)« bei Spectra, New York.
Dieser Roman erscheint erstmals auf Deutsch.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright der Originalausgabe © 2013 by Robin Hobb
Copyright dieser deutschsprachigen Ausgabe © 2022 by Penhaligon in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Alexander Groß
Umschlaggestaltung und -illustration: © Max Meinzold, www.meinzold.de
HK · Herstellung: MR
Satz: Vornehm Mediengestaltung, München
ISBN 978-3-641-27094-0V002
www.penhaligon-verlag.de
Ich vermisse Dich, Ralph.
Prolog
VERÄNDERUNGEN
Als Tintaglia erwachte, fühlte sie sich alt und durchgefroren. Sie hatte eine schöne Beute gerissen und ausführlich gegessen, danach aber nicht gut geschlafen. Wegen der eiternden Wunde unter ihrem linken Flügel konnte sie nicht bequem liegen. Wenn sie sich streckte, wurde die schmerzhaft geschwollene Stelle gedehnt, und wenn sie sich zusammenrollte, drückte der eingedrungene Pfeil in ihr Fleisch. Der Schmerz strahlte inzwischen auch in ihre Schwinge aus, wenn sie sie öffnete, so als würde sich eine Distel mit ihren stachligen Trieben in ihr ausbreiten. Je weiter sie in Richtung Regenwildnis flog, desto kälter wurde das Wetter. Es gab keine Wüsten mehr, keinen warmen Sand in dieser Weltgegend. In den chalcedischen Wüsten schien die Hitze aus dem Herzen der Erde hervorzusprudeln, weshalb es dort in dieser Jahreszeit beinahe so warm wurde wie in den Ländern im Süden. Aber sie hatte das trockene Land und den warmen Sand verlassen, und der Würgegriff des Winters forderte vom Frühling immer noch seinen Tribut. Aufgrund der Kälte wurden die Muskeln rund um ihre Wunde steif, und jeder Morgen wurde zu einer Qual.
Eisfeuer war nicht mitgekommen. Sie hatte erwartet, dass der alte schwarze Drache sie begleiten würde, auch wenn sie sich nicht mehr erinnern konnte, warum. Drachen waren lieber allein als mit anderen zusammen. Um ausreichend Futter zu finden, brauchte jeder Drache ein riesiges Jagdrevier. Erst nachdem sie ihn verlassen hatte und er ihr nicht gefolgt war, kam ihr die beschämende Erkenntnis, dass sie ihm die ganze Zeit über hinterhergelaufen war. Sie konnte sich nicht erinnern, dass er sie ein einziges Mal gebeten hatte zu bleiben. Noch hatte er sie gebeten, ihn zu verlassen.
Er hatte bekommen, was er von ihr brauchte. Denn in der ersten Begeisterung über ihre Begegnung hatten sie sich gepaart. Wenn die Zeit für sie gekommen wäre, würde sie zur Nistinsel fliegen und die Eier legen, die er befruchtet hatte. Aber seit der Besamung der Eier hatte er keine Veranlassung mehr, bei Tintaglia zu bleiben. Schlüpften aus dem Gelege erst einmal Schlangen und glitten ins Meer, um den endlosen Kreislauf von Drache, Ei, Schlange, Kokon, Drache zu erneuern, würden die Erinnerungen seines Geschlechts fortbestehen. Sollte ihm irgendwann wieder nach Gesellschaft sein, gäbe es neue Drachen, mit denen er sich treffen konnte. Tintaglia war verblüfft, dass sie so lange bei ihm geblieben war. Hatte sie von den Menschen etwa undrachisches Verhalten übernommen, weil sie so allein und abgeschnitten geschlüpft war?
Langsam entrollte sie sich und spreizte dann vorsichtig die Flügel. Unter dem verhangenen Himmel streckte sie sich. Sie vermisste den warmen Sand. Sie versuchte, nicht darüber nachzugrübeln, ob die Reise nach Trehaug ihre Kräfte womöglich übersteigen würde. Hatte sie zu lange gewartet in der Hoffnung, dass ihre Wunde von selbst heilen würde?
Den Hals zu recken, um ihre Wunde zu begutachten, tat weh. Die Wunde roch faulig, und wenn sie sich bewegte, quoll Eiter heraus. Wütend zischte sie. Dass ihr so etwas widerfahren war! Sie nutzte ihre Wut, um die Muskeln rings um die Wunde anzuspannen. Damit presste sie noch mehr Eiter hervor. Es tat weh und stank fürchterlich, aber danach fühlte sich ihre Haut weniger steif an. Sie konnte fliegen. Zwar nicht schmerzfrei und nicht schnell, aber sie konnte fliegen. Und am Abend würde sie bei der Wahl des Rastplatzes mehr Sorgfalt walten lassen. Von diesem Platz hier am Ufer loszufliegen, würde schwierig werden.
Sie wollte direkt nach Trehaug fliegen, denn sie hoffte, Malta und Reyn rasch zu finden und einen der Uraltendiener zu heißen, ihr die Pfeilspitze herauszuziehen. Auf geradem Wege wäre es besser gewesen, aber das war wegen der dichten Wälder in dieser Gegend nicht möglich. Selbst für einen kerngesunden Drachen wäre es schwierig gewesen, in einem derart dicht mit Bäumen bestandenen Gelände zu landen; mit ihrem verletzten Flügel würde sie ganz bestimmt durch das Blätterdach krachen. Deshalb war sie erst der Küste gefolgt und dann dem Regenwildnisfluss. Die Schlammbänke und sumpfigen Ufer boten leichte Jagdbeute, denn hier tauchten Flusssäuger auf, um sich auszuruhen, und Waldbewohner kamen zum Saufen her. Wenn sie Glück hatte, so wie am Abend zuvor, konnte sie sich auf eine große Mahlzeit auf einem schlammigen Uferstreifen stürzen und hatte dabei gleich auch einen sicheren Landeplatz.
Wenn sie kein Glück hatte, musste sie in flachen Stellen des Flusses landen und ans Ufer waten. Sie fürchtete, dass ihr am heutigen Abend nichts anderes übrig bleiben würde. Zwar würde sie eine derart kalte und unangenehme Landung zweifellos überleben, aber ihr graute davor, von einer solchen Stelle wieder losfliegen zu müssen. So wie jetzt.
Mit halb ausgebreiteten Flügeln ging sie ans Wasser, soff und rümpfte wegen des sauren Geschmacks die Nase. Als sie ihren Durst gestillt hatte, spreizte sie die Schwingen und schnellte in die Luft.
Mit wildem Flügelschlag plumpste sie wieder zur Erde. Es war kein tiefer Sturz, aber der Aufprall machte aus ihrem Schmerz scharfkantige Splitter, die überall in ihrem Körper stachen. Die Erschütterung presste die Luft aus ihrer Lunge, sodass sie einen heiseren Schmerzensschrei nicht unterdrücken konnte. Mit halb ausgebreiteten Flügeln schlug sie mit der empfindlichen Flanke schmerzhaft auf. Benommen lag sie da und wartete, bis die Schmerzen aufhören würden. Aber das taten sie nicht. Doch sie ließen allmählich nach und wurden erträglich.
Tintaglia zog den Kopf an die Brust, sortierte ihre Beine und klappte langsam die Flügel ein. Sie wollte sich ausruhen. Doch wenn sie sich ausruhte, würde sie noch hungriger und steifer erwachen als jetzt schon, und der Tag wäre vorbei. Nein. Sie musste jetzt losfliegen. Je länger sie wartete, desto mehr würden ihre körperlichen Kräfte nachlassen. Sie musste fliegen, solange sie es noch konnte.
Sie machte sich auf die Schmerzen gefasst, ließ nicht zu, dass ihr Körper sich um sie drückte. Denn sie musste sie einfach aushalten und so fliegen, als würde es nicht wehtun. Diesen Gedanken brannte sie sich ins Bewusstsein und spreizte unvermittelt die Schwingen, ging in die Hocke und sprang in die Luft.
Jeder Flügelschlag fühlte sich so an, als würde ein Flammenspeer in sie gerammt. Sie brüllte, verlieh ihrer Wut und ihrem Schmerz eine Stimme, behielt den Rhythmus ihres Flügelschlags jedoch unverändert bei. Langsam stieg sie höher, glitt über das flache Flussufer, bis sie schließlich über die Baumwipfel stieg, deren Schatten auf dem Fluss lagen. Das bleiche Sonnenlicht traf sie, und ein kräftigerer Wind peitschte sie. Eisiger Regen lag schwer in der Luft. Nun, sollte er kommen. Tintaglia flog nach Hause.
Fünfzehnter Tag des Fischmonds
IMSIEBTENJAHRDESUNABHÄNGIGENHÄNDLERBUNDS
Von Reyall, stellvertretender Vogelwart in Bingstadt, an Erek Dunwarrow
In einer Standardnachrichtenröhre
Mein lieber Onkel,
ich antworte Dir so spät auf Dein Angebot, weil ich davon völlig überrumpelt wurde. Ich habe es immer und immer wieder gelesen und mich gefragt, ob ich schon so weit bin. Und wichtiger noch: ob ich dessen würdig bin. Dass Du Dich nicht nur bei einem Meister für meine Beförderung einsetzt, sondern mich auch auswählst, Deine Vögel und Schläge zu übernehmen … mir verschlägt es angesichts dieser Ehre die Sprache. Ich weiß, was Dir diese Tauben bedeuten, und ich habe in Deinen Zuchtbüchern und Deinen Aufzeichnungen gewissenhaft nachgelesen, wie Du sowohl Geschwindigkeit als auch Zähigkeit der Vögel gesteigert hast. Ich bewundere Dein Wissen. Und nun schlägst Du vor, Deine Vögel und Dein ausgefeiltes Zuchtprogramm in meine Hände zu legen?
Mir bangt, Du könntest das falsch verstehen, aber ich muss trotzdem fragen: Bist Du Dir sicher, dass Du das willst?
Wenn Du es Dir noch einmal gründlich überlegen und mir diese außergewöhnliche Chance dann immer noch geben willst, nehme ich sie an und werde für den Rest meines Lebens mein Äußerstes geben, um mich als würdig zu erweisen! Aber ich verspreche Dir, dass ich es Dir nicht übelnehmen werde, solltest Du es Dir noch einmal anders überlegen. Zu wissen, dass Du mich für diese Ehre und Verantwortung überhaupt in Erwägung gezogen hast, erfüllt mich bereits mit dem Ehrgeiz, tatsächlich der Vogelwart zu werden, den Du in mir zu erahnen scheinst.
Mit demütigem Dank,
Dein Neffe Reyall
Und bitte richte Tante Detozi meine besten Wünsche aus und sage ihr, wie sehr ich mich freue, dass sie so glücklich mit Dir verheiratet ist!
1
EINLEBENBEENDEN
Sie schlug die Augen auf. Es war Morgen, ein Morgen, den sie nicht wollte. Mit großem Widerwillen hob sie den Kopf und sah sich im Zimmer um. In der Kammer war es kalt. Vor Stunden schon war das Feuer erloschen, und die klamme Feuchtigkeit des ungewöhnlich kühlen Frühlings war unaufhaltsam hereingekrochen, während sie sich unter ihrer verschlissenen Decke verborgen und darauf gewartet hatte, dass ihr Leben weggehen würde. Aber das hatte es nicht getan. Das Leben war geblieben, um sie erneut und hinterrücks mit Kälte und Feuchtigkeit, mit Enttäuschung und Einsamkeit zu überfallen. Sie drückte sich das dünne Laken an die Brust, während ihr Blick zu den wohlgeordneten Papierstapeln und Pergamenten wanderte, mit denen sie sich in den letzten Wochen beschäftigt hatte. Da war es. Das Lebenswerk von Alise Finbok, alles auf einem Stapel. Übersetzungen antiker Texte, ihre eigenen Mutmaßungen, genaue Abschriften alter Dokumente in schwarzer Tinte, fehlende Worte darin mit Rot nach ihren Vermutungen eingefügt. Da ihr eigenes Leben keinerlei Ziel gehabt hatte, hatte sie sich in die Antike zurückgezogen und sich etwas auf ihr gelehrtes Wissen eingebildet. Sie wusste, wie die Uralten einst gelebt hatten, welchen Umgang sie mit den Drachen hatten. Sie kannte die Namen einstiger Uralter und Drachen, sie kannte ihre Sitten. Sie wusste so viel über eine Vergangenheit, die keine Bedeutung mehr hatte.
Uralte und Drachen waren in die Welt zurückgekehrt. Sie war Zeugin dieses Wunders geworden. Und sie würden sich die alte Stadt Kelsingra wieder zu eigen machen und dort leben. Die vielen Geheimnisse, die sie den Schriftrollen und schimmligen Wandteppichen hatte entreißen wollen, hatten nun keine Bedeutung mehr. Wären die neuen Uralten erst einmal in die Stadt eingezogen, brauchten sie nur den Gedächtnisstein dort zu berühren, um von ihrer Geschichte zu erfahren. All die Geheimnisse, von deren Entdeckung sie geträumt hatte, all die Rätsel, die sie nur zu gerne gelöst hätte, waren nun ohne ihr Zutun dahin. Sie war bedeutungslos.
Dass sie plötzlich trotzdem die Decke von sich warf und aufstand, überraschte sie selbst. Sofort wurde sie von Kälte eingehüllt. Sie ging zu ihren großen Reisetruhen, die sie in Bingstadt mit so viel Hoffnung gepackt hatte. Zu Beginn ihrer Reise waren sie vollgestopft gewesen, voller Kleider, wie sie sich für eine Dame auf Abenteuerfahrt schickten. Dicke Baumwollblusen mit nur ganz wenig Spitze, geschlitzte Röcke zum Wandern, Hüte mit Gesichtsnetzen gegen die Mücken und die Sonne, robuste Lederstiefel … von all dem blieben ihr kaum mehr als Erinnerungen. Während der mühseligen Reise waren die Stoffe zerschlissen, ihre Stiefel waren angestoßen und undicht, und die Schnürsenkel waren eine einzige Kette aus Knoten. Sie hatte keine andere Wahl gehabt, als ihre Sachen im sauren Flusswasser zu waschen, aber nun waren die Nähte aufgerissen und die Säume ausgefranst. Sie zog irgendwelche Kleider an, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie sie darin aussehen mochte. Es beachtete sie ohnehin niemand. Sie würde sich nie wieder Gedanken darum machen, wie sie aussah oder was andere Leute von ihr hielten.
Ein Uraltengewand, das Leftrin ihr geschenkt hatte, hing an einem Haken. Von all ihren Kleidungsstücken hatte dieses als einziges die leuchtenden Farben behalten und war fein und weich geblieben. Sie sehnte sich nach seiner Wärme, konnte sich aber nicht dazu durchringen, es anzuziehen. Rapskal hatte es überdeutlich gesagt: Sie war keine Uralte. Sie hatte kein Anrecht auf die Stadt Kelsingra, kein Anrecht auf irgendetwas, was mit den Uralten zu tun hatte.
Bitterkeit, Schmerz und Resignation angesichts der von Rapskal ausgesprochenen Tatsache zogen sich zu einem strammen, festen Knoten in ihrer Kehle zusammen. Sie starrte das Uraltengewand an, bis die leuchtenden Farben in den Tränen in ihren Augen verschwammen. Beim Gedanken an den Mann, der es ihr geschenkt hatte, wurde ihr Kummer nur noch größer. Ihr Seelenschiffkapitän. Leftrin. Trotz der Standesunterschiede hatten sie sich auf der beschwerlichen Flussreise ineinander verliebt. Zum ersten Mal in ihrem Leben hatte ein Mann ihren Verstand bewundert, ihre Arbeit anerkannt und ihren Körper begehrt. Und er hatte in ihr die gleiche Leidenschaft entfacht und ihr gezeigt, was zwischen einem Mann und einer Frau möglich war. Er hatte in ihr Begierden geweckt, die sie zuvor nicht gekannt hatte.
Und dann hatte er sie hier zurückgelassen. Allein in einer primitiven Hütte …
Hör auf. Heul nicht rum. Sie betrachtete das Uraltengewand und zwang sich, sich an den wundervollen Moment zu erinnern, als Leftrin es ihr geschenkt hatte, ein unbezahlbares Artefakt, ein Familienerbstück. Er hatte es ihr ohne den geringsten Vorbehalt gegeben. Und sie hatte es als Rüstung gegen Kälte, Wind und selbst gegen Einsamkeit getragen. Hatte es getragen, ohne an seine geschichtliche Bedeutung zu denken. Wie hatte sie die Hüter nur dafür tadeln können, dass sie auch etwas so Warmes und Undurchlässiges wollten wie ihr »unbezahlbares Artefakt«, das sie so oft mit Genuss getragen hatte? Und Leftrin? Gab sie etwa ihm die Schuld für ihre Einsamkeit? Scheinheilige!, schalt sie sich.
Leftrin hatte keine andere Wahl gehabt, als nach Cassarick zurückzufahren, um Vorräte zu holen. Er hatte sie nicht im Stich gelassen. Es war ihre Entscheidung gewesen hierzubleiben, denn sie hatte geglaubt, es wäre wichtiger, ihre Entdeckungen in der unberührten Uraltenstadt aufzuzeichnen. So hatte sie es beschlossen, und Leftrin hatte das akzeptiert. Und jetzt gab sie ihm die Schuld dafür? Er liebte sie. Sollte ihr das denn nicht genug sein?
Einen Moment lang stand sie kurz davor, sich damit zufriedenzugeben. Ein Mann, der sie liebte: Was brauchte eine Frau mehr? Dann knirschte sie mit den Zähnen, als wollte sie sich einen Verband von einer nicht ganz verheilten Wunde reißen.
Nein. Es war nicht genug. Nicht für sie.
Es war Zeit, sich nicht weiter etwas vorzumachen. Zeit, dieses Leben hinter sich zu lassen. Zeit, sich nicht mehr einzureden, dass alles gut wäre, wenn Leftrin zurückkehren und ihr sagen würde, dass er sie liebte. Was konnte er schon an ihr lieben? Wenn ihr alles genommen worden war, was war dann von ihr noch echt und wert, geliebt zu werden? Was wäre sie für ein Mensch, wenn sie sich an die Hoffnung klammerte, dass jemand anders kommen und ihrem Leben einen Sinn geben würde? Wenn sie jemanden brauchte, um ihrer eigenen Existenz Gültigkeit zu geben, war sie dann nicht nur ein zuckender Parasit?
Schriftrollen und Skizzen, Papiere und Pergament in sauberen Stapeln, wo sie sie gelassen hatte. Ihre Forschungen und Aufzeichnungen lagen neben dem Ofen. Der Impuls, alles zu verbrennen, war gewichen. Den hatte sie in der abgründigen Verzweiflung des gestrigen Abends verspürt, eine Finsternis, so pechschwarz, dass sie nicht einmal die Kraft gehabt hatte, die Blätter in die Flammen zu werfen.
Das kühle Tageslicht offenbarte die gestrige Anwandlung als törichte Eitelkeit, einen kindischen Anfall von: »Schau, was ich wegen dir gemacht habe!« Was hatten Rapskal und die anderen Hüter ihr getan? Nichts, außer dass sie ihr die Realität ihres Lebens vor Augen geführt hatten. Wenn sie ihre Arbeit verbrannt hätte, hätte sie weiter nichts bewiesen, als dass sie den Wunsch gehabt hatte, sie in ein schlechtes Licht zu rücken. Einen Moment lang zitterte ihr Mund, bis er sich zu einem sehr eigentümlichen Lächeln verzog. Ah, die Verlockung war noch da. Zu machen, dass es ihnen genauso schlecht ging wie ihr! Aber es würde ihnen nicht schlecht gehen. Sie würden gar nicht verstehen, was sie zerstört hatte. Außerdem war es der Mühe nicht wert, bei einem der anderen Hüter anzuklopfen und um Kohlen zu bitten. Nein. Sollte alles so bleiben. Sollten sie ruhig das Mahnmal finden für das, was sie gewesen war, eine Frau aus Papier und Tinte und Verstellungen.
In ihre kalten Kleider eingewickelt, drückte sie die Tür ihrer Hütte auf und trat in den nassen, eisigen Tag hinaus. Der Wind schlug ihr entgegen. Ekel und Hass auf ihr bisheriges Leben stiegen wie eine Flutwelle in ihr hoch. Die Wiese vor ihr endete am Fluss, kalt, grau und unerbittlich. Einmal war sie von ihm fortgerissen worden und fast ertrunken. Sie ließ den Gedanken in ihrem Kopf Gestalt annehmen. Es würde schnell gehen. Kalt und unangenehm, aber schnell. Sie sprach die Worte laut aus, die während der Nacht rasselnd durch ihre Träume gespukt waren. »Zeit, diesem Leben ein Ende zu setzen.« Sie hob das Gesicht. Der Wind schob schwere Wolken über den fernen blauen Himmel.
Du würdest dich umbringen? Wegen so etwas? Weil Rapskal dir gesagt hat, was du ohnehin schon gewusst hast? Sintaras Gedanken, die an ihrem Bewusstsein rührten, waren auf kühle Weise amüsiert. Fern und vorurteilsfrei schienen die Gedanken der Drachin zu sein. Ich erinnere mich, dass meine Ahnen erlebt haben, wie Menschen beschlossen, ihre Lebensspanne zu verkürzen, obwohl sie doch ohnehin schon so kurz ist, dass sie keine Bedeutung hat. Wie Mücken, die in die Flammen fliegen. Sie stürzten sich in Flüsse oder hängten sich an Brücken auf. Also. Der Fluss? Willst du es auf diese Weise tun?
Sintara hatte ihr Bewusstsein seit Wochen nicht mehr gestreift. Dass sie sich jetzt wieder meldete und dabei eine so herzlose Neugier zeigte, machte Alise wütend. Sie sah zum Himmel. Da. Ein kleiner saphirblauer Fleck vor den fernen Wolken.
Sie sprach laut, machte ihrer Empörung Luft, denn in einer einzigen Sekunde war aus ihrer Verzweiflung Trotz geworden. »Diesem Leben ein Ende setzen, habe ich gesagt. Nicht meinem Leben ein Ende setzen.« Sie sah, wie die Drachin die Schwingen herumriss und steil abwärts auf die Hügel zuglitt. Eine Veränderung ging in ihr vor, wurde immer deutlicher. »Mich umbringen? Aus Verzweiflung über die viele Zeit, die ich vergeudet habe, darüber, wie ich mich auf vielerlei Weise selbst betrogen habe? Was würde ich damit beweisen, außer dass ich am Ende doch nicht meiner eigenen Torheit entrinnen kann? Nein. Ich endige mein Leben nicht, Drachin. Ich nehme es mir. Ich mache es zu meinem eigenen.«
Eine Weile spürte sie keine Reaktion von Sintara. Vermutlich hatte die Drachin Beute entdeckt und das Interesse an dem Mückenleben der Frau verloren, die nicht einmal ein Kaninchen töten konnte. Doch dann donnerten die Gedanken der Drachin ohne Vorwarnung wieder durch ihren Kopf.
Die Gestalt deiner Gedanken hat sich verändert. Ich glaube, du wirst endlich du selbst.
Plötzlich legte die Drachin die Flügel an und stürzte sich auf ihre Beute. Dass die Gedanken der Drachin so schlagartig aus ihrem Bewusstsein verschwanden, war wie ein plötzlicher Windstoß im Ohr. Alise fühlte sich benommen und einsam.
Sie selbst werden? Die Gestalt ihrer Gedanken hatte sich verändert? Sie kam jäh zu dem Schluss, dass Sintara sie nur wieder manipulieren wollte mit ihrer rätselhaften, verwirrenden Redeweise. Tja, auch damit sollte es nun ein Ende haben! Nie wieder würde sie sich willentlich in den Bann eines Drachen begeben. Es war Zeit, das sein zu lassen, Zeit, das alles hinter sich zu lassen. Sie machte auf dem Absatz kehrt und ging zurück in die kleine Hütte. Es war auch Zeit, die kindischen Zurschaustellungen ihrer verletzten Gefühle hinter sich zu lassen. Mit einer energischen Entschlossenheit, von der sie geglaubt hatte, sie zusammen mit ihrer Jugend eingebüßt zu haben, packte sie ihre Papierstapel in die Truhe und machte den Deckel zu. So. Sie sah sich in der Hütte um und schüttelte den Kopf. Wie jämmerlich, dass sie sich schon so lange in dieser winzigen Kammer verkrochen hatte, ohne sie etwas wohnlicher zu gestalten. Wartete sie etwa darauf, dass Leftrin die Annehmlichkeiten seiner Kajüte zu ihr brachte? Erbärmlich. Sie würde keine einzige weitere Stunde hier allein zubringen.
Sie warf sich die Schichten aller Kleider über, die sie besaß. Draußen hob sie den Blick zu den bewaldeten Hügeln hinter dem Flickenteppich des Dorfes. Das war die Welt, in der sie nun lebte und womöglich für immer leben würde. Es war Zeit, sie zu meistern. Ohne sich vom Graupelregen beirren zu lassen, ging sie hangaufwärts, folgte einem Pfad, den die Hüter ausgetreten hatten und der sich zwischen einigen anderen Hütten wand, bevor er den Rand des schlummernden Waldes erreichte. Ihr Entschluss festigte sich, als sie die Siedlung hinter sich ließ. Sie konnte sich verändern. Sie war nicht an ihre Vergangenheit gekettet. Sie konnte zu einem Menschen werden, der nicht nur das Produkt dessen war, was andere ihr angetan hatten. Es war noch nicht zu spät.
An einer Kreuzung wählte sie den Weg nach rechts und weiter hangaufwärts. Dann konnte sie nämlich auf dem Rückweg immer die Wege nach links und nach unten nehmen. Sie beachtete das Ziehen in Waden, Po und Rücken nicht und malträtierte stattdessen die Muskeln, die seit Wochen nichts mehr zu tun bekommen hatten. Im Gehen wurde ihr warm, und sie lockerte Mantel und Schal ein wenig. Sie betrachtete den Wald auf die gleiche Weise, mit der sie einst Kelsingra betrachtet hatte, registrierte im Kopf die Pflanzen, die sie bereits kannte, und diejenigen, die ihr unbekannt waren. Diese Sträucher mit den langen Stacheln könnten irgendwelche Beeren tragen. Das sollte man sich für den Sommer merken.
Sie gelangte an einen Bach, kniete sich hin, schöpfte mit den Händen Wasser und trank. Dann watete sie hindurch und ging weiter. In einer geschützten Senke fand sie immergrüne Sträucher, an denen noch rote Beeren hingen. Ihr kam es vor, als hätte sie einen Diamantschatz gefunden. Aus ihrem Schal machte sie einen Beutel und sammelte alle Beeren ein, die sie finden konnte. Die Beeren mit ihrem herben Geschmack würden ihren Speiseplan gut ergänzen und halfen gegen Halskratzen und Husten. Auch die Blätter pflückte sie, inhalierte dabei genüsslich ihren Duft und freute sich auf den Tee, den sie daraus brühen würde. Sie staunte, dass keiner der Hüter die Büsche entdeckt und abgeerntet hatte. Dann erst dämmerte ihr, wie fremdartig diese Pflanzen für Leute sein mussten, die in den Baumwipfeln aufgewachsen waren.
Sie band den Schalbeutel zu und befestigte ihn an ihrem Gürtel, bevor sie weiterging. Die laubwechselnden Bäume ließ sie bald hinter sich und drang in den immergrünen Wald vor. Die benadelten Zweige der Bäume berührten sich über ihrem Kopf, sodass es dämmriger wurde und der Wind nicht mehr so stark blies. Wegen des Teppichs aus duftenden Nadeln und der Stille nach dem unaufhörlichen Brausen des Windes kam es ihr so vor, als hielte sie sich die Ohren zu. Es war eine Erleichterung.
Sie ging weiter. Schließlich hatte sie Hunger. Sie steckte sich ein paar der Beeren in den Mund und zerbiss sie mit den Zähnen, sodass ihre Sinne ganz von dem herben Geschmack erfüllt waren. Der Hunger verging.
Alise gelangte zu einer kleinen Lichtung. Hier war ein Baumriese umgestürzt und hatte ein paar seiner Nachbarn mit sich gerissen. Der umgestürzte Baum war von efeuähnlichen Ranken überwuchert. Sie musterte sie eine Weile, griff dann nach einem der zähen Stiele und zerrte ihn, wenn auch gegen großen Widerstand, vom Stamm los. Dann machte sie die Blätter von ihm ab und testete seine Stärke. Wissend nickte sie vor sich hin, nachdem es ihr nicht gelang, den Stiel mit bloßen Händen zu zerbrechen. Sie würde noch einmal mit einem Messer herkommen und die Ranken abschneiden, um in ihrer Hütte etwas daraus zu flechten. Körbe. Fischnetze? Vielleicht. Sie betrachtete die Pflanze noch eingehender. Die Blätterknospen daran waren bereits angeschwollen. Vielleicht verlor der Winter allmählich seine Macht über das Land. Über ihr kreischte in der Ferne ein Habicht. Durch die Lücke im Blätterdach sah sie zum Himmel. Erst jetzt fiel ihr auf, wie weit der Tag schon vorgerückt war. Es war Zeit umzukehren. Eigentlich hatte sie grüne Erlenzweige sammeln wollen, um Fisch zu räuchern, hatte es nun aber nicht getan. Doch sie kam immerhin nicht mit leeren Händen zurück. Über die wintergrünen Beeren würden sich alle freuen.
Beim Marsch abwärts zwickten mehrere Muskeln in ihren Beinen. Sie biss die Zähne zusammen und ging weiter.
Geschieht mir recht, nachdem ich so lange zu Hause herumgehockt bin, sagte sie sich grimmig.
Dort, wo die Nadelbäume wieder den Laubbäumen wichen, nahm sie einen seltsamen Geruch wahr. Hier wehte der Wind bereits ungehindert. Sie blieb stehen und rätselte, was es war. Es roch widerlich und doch eigenartig vertraut. Erst als das Tier vor ihr auf den Pfad trat, stellte ihr Verstand die Verbindung her. Katze, dachte sie.
Dem Tier fiel sie erst gar nicht auf. Es hielt den Kopf tief und schnüffelte mit offenem Maul am Boden. Lange gelbe Reißzähne ragten über den Unterkiefer. Sein Fell war ungleichmäßig schwarz mit einigen dunkleren Flecken. Die Ohren waren pelzig, und die Muskeln unter dem glatten Fell wölbten sich bei jeder Bewegung.
Alise war fassungslos und betrachtete staunend das Tier, das seit Ewigkeiten niemand mehr zu Gesicht bekommen hatte. Und dann sprang ihr plötzlich ihre eigene Übersetzung eines Uraltenwortes ins Bewusstsein. »Pard«, hauchte sie. »Ein schwarzer Pard.«
Auf ihr Flüstern hin hob das Tier den Kopf und sah sie aus gelben Augen an. Da bekam sie es mit der Angst zu tun. Es war ihre Witterung auf dem Pfad – der war der Pard gefolgt.
Ihr Herz setzte einen Schlag aus und fing dann an, heftig zu hämmern. Das Tier starrte sie an, womöglich genauso verblüfft, einen Menschen zu sehen, wie sie beim Anblick des Pards. Die beiden Spezies waren sich bestimmt viele Generationen lang nicht begegnet. Er machte das Maul auf, nahm ihre Witterung auf.
Sie wollte schreien, tat es aber nicht. Dafür sandte sie panisch ihre Gedanken aus. Sintara! Sintara, eine große Raubkatze ist hinter mir her, ein Pard! Hilf mir!
Ich kann dir nicht helfen. Komm selber damit klar.
Den Gedanken der Drachin fehlte es nicht an Anteilnahme, aber sie blieben sachlich. In dem kurzen Moment ihrer Verbindung spürte Alise, dass die Drachin eben viel gefressen hatte und nun in eine satte Trägheit versank. Selbst wenn sie sich hätte aufraffen wollen, hätte es eine Weile gebraucht, bis sie losgeflogen wäre, den Fluss überquert und Alise gefunden hätte …
Das bringt nichts. Konzentrier dich auf das Hier und Jetzt.
Die Raubkatze beobachtete sie, und aus ihrem Misstrauen war Interesse geworden. Je länger Alise wie ein hypnotisiertes Kaninchen stehen blieb, desto kühner würde der Pard werden. Tu etwas.
»Keine Beute!«, rief sie dem Tier entgegen. Sie nahm die Revers ihres Mantels und hielt ihn weit auseinander, um doppelt so groß zu wirken. »Keine Beute!«, rief sie noch einmal mit tieferer Stimme. Sie schlug mit dem Mantel und brachte ihren zitternden Körper dazu, einen Schritt nach vorn zu springen. Rannte sie weg, würde der Pard sie einholen. Blieb sie stehen, würde er sie angreifen. Der Gedanke rüttelte sie wach. Mit einem unartikulierten, wütenden Verzweiflungsschrei griff sie das Tier an und ließ dabei den ausgebreiteten Mantel flattern.
Der Pard duckte sich, und da wusste Alise, dass er sie töten würde. Ihr tiefes Brüllen wurde zu einem zornigen Kreischen, und die Raubkatze erwiderte plötzlich das Fauchen. Alise ging die Luft aus. Einen Moment herrschte Stille zwischen der geduckten Katze und der mit dem Mantel schlagenden Frau. Dann wirbelte das Tier herum und rannte in den Wald. Da der Pfad nun frei war, bremste Alise ihren panischen Angriff nicht ab. Sie lief mit großen Sprüngen und rannte, wie sie es nie für möglich gehalten hätte. Um sie her verschwamm der Wald. Tief hängende Zweige rissen an ihren Haaren und Kleidern, aber sie lief nicht langsamer. Japsend sog sie die kalte Luft ein, die in ihrer Kehle brannte und ihren Mund austrocknete, aber sie rannte weiter. Sie lief, bis es in ihren Augenwinkeln dunkel wurde, und dann torkelte sie weiter, hielt sich an Baumstämmen links und rechts des Weges fest, um nicht umzufallen. Als ihre Panik sie irgendwann nicht mehr auf den Beinen hielt, brach sie zusammen, den Rücken an einen Baum gelehnt, und blickte zurück in die Richtung, aus der sie gekommen war.
Nichts regte sich im Wald. Und als sie sich zwang, den Mund zu schließen und ihren zitternden Atem anzuhalten, hörte sie nichts als ihren eigenen Herzschlag. Es schien Stunden zu dauern, bis sie durch ihren trockenen Mund wieder ruhig atmen konnte und ihr Puls sich so weit beruhigt hatte, dass sie die Geräusche des Waldes hören konnte. Sie lauschte angestrengt, hörte aber nur den Wind in den nackten Zweigen rauschen. Indem sie sich am Stamm festhielt, hievte sie sich auf die Füße und fragte sich, ob ihre zitternden Beine sie tragen würden.
Doch als sie sich auf den Weg hinunter zum Dorf machte, verzog sich ihr Gesicht zu einem absurden Grinsen. Sie hatte es getan. Sie hatte einem Pard die Stirn geboten und sich gerettet, und nun kehrte sie siegreich nach Hause zurück, mit wintergrünen Blättern, um Tee zu kochen, und obendrein mit Beeren. »Keine Beute«, flüsterte sie heiser vor sich hin, während ihr Grinsen breiter wurde.
Im Gehen ordnete sie ihre Kleider und schob sich das widerspenstige Haar aus dem Gesicht. Der Regen drang zu ihr durch. Hoffentlich war sie bald zu Hause, ehe sie völlig durchnässt wurde. Sie hatte heute noch einiges vor. Sie musste Feuerholz und Kienhölzer sammeln, Kohlen ausleihen, um ihr Feuer wieder in Gang zu bringen, und Wasser zum Kochen herbeitragen. Und sie sollte Carson von dem Pard berichten, damit er die anderen warnte. Dann konnte sie sich Tee brühen.
Eine wohlverdiente Tasse Wintergrüntee. Die gehörte nun zu ihrem neuen Leben.
Zwanzigster Tag des Fischmonds
IMSIEBTENJAHRDESUNABHÄNGIGENHÄNDLERBUNDS
Von der Vogelwartgilde in Bingstadt an alle Gildenmitglieder
In allen Hallen gut sichtbar auszuhängen
Es ist von höchster Wichtigkeit, dass alle Gildenmitglieder beachten, dass unser Beruf ein altehrwürdiges Gewerbe ist mit Regeln, fachlichen Vorschriften und Geheimnissen der Vogelhaltung, Dressur und Züchtung, die auf Gildenmitglieder beschränkt sind. Gildenvögel sind das Eigentum der Gilde, und auch die Nachkommen von Gildenvögeln bleiben das Eigentum der Gilde. Unser guter Ruf und die Kundschaft, die wir aufgebaut haben, gründen darauf, dass unsere Vögel die schnellsten, die am besten dressierten und die gesündesten sind. Unsere Kunden nutzen Gildenvögel und Vogelwarte, weil sie wissen, dass sie sich auf uns und unsere Vögel als schnelle und vertrauliche Nachrichtenübermittler verlassen können.
In jüngster Zeit kam es zu einer Flut von Beschwerden und Anfragen bezüglich möglicher Verstöße gegen das Briefgeheimnis. Gleichzeitig ist uns aufgefallen, dass immer mehr Bürger unabhängige Vogelschläge für ihren Nachrichtenaustausch wählen. Zudem haben sich viele unserer Kunden während der kürzlichen Rotlausplage geärgert, weil keine Botenvögel für ihre Briefe zur Verfügung standen.
Wir müssen alle daran denken, dass nicht nur unser Ruf, sondern auch unser Auskommen auf dem Spiel steht. Jedes Gildenmitglied ist ehrenhalber verpflichtet, jeden Verdachtsfall eines Verstoßes gegen das Briefgeheimnis zu melden.
Ebenso müssen alle Mitglieder gemeldet werden, die Eier oder Küken für ihren eigenen Gebrauch oder des Profits wegen stehlen.
Nur indem wir uns alle strikt an die Gildenregeln halten, können wir die Qualität unserer Dienstleistung, die unsere Kunden erwarten, aufrechterhalten. Indem wir die Vorschriften einhalten, sichern wir uns allen gemeinsam künftigen Wohlstand.
2
FLUG
Wie Schwalben zogen die Drachen weite Kreise über dem Fluss. Ihr Flug wirkte mühelos. Die scharlachrote Drachin war Heeby, und hoch über ihr, immer größere Kreise ziehend, segelte Sintara wie ein blauer Juwel am blauen Himmel. Sein Herz schlug höher, als er endlich zwei smaragdgrüne Flügel ausmachte. Fente. Seine Fente. Sie flog nun schon seit drei Tagen, und jedes Mal, wenn Tats sie in der Luft erspähte, schwoll ihm die Brust vor zärtlichem Stolz. Dem natürlich immer auch Sorge beigemischt war.
Dummer Junge. Ich bin eine Drachin. Mir gehört der Himmel. Ich weiß, dass erdgebundene Kreaturen das nicht so leicht verstehen, aber ich habe schon immer in die Luft gehört.
Über ihre Herablassung konnte er nur schmunzeln. Du fliegst wie Distelwolle, meine geflügelte Schönheit.
Distelwolle mit Krallen! Ich begebe mich auf die Jagd!
Mögest du blutiges Fleisch finden!
Tats beobachtete, wie sie die Schwingen kippte, sich von den anderen löste und auf die Hügel auf der anderen Flussseite zuflog. Er war ein wenig enttäuscht, weil er sie heute wahrscheinlich nicht mehr sehen würde. Sie würde jagen, Beute machen, sich vollfressen, schlafen, aber am Abend würde sie nicht zu ihm zurückkehren, sondern nach Kelsingra fliegen, um sich dort ins Bad zu legen oder in einem der erwachten Drachenheime zu nächtigen. Er wusste, dass es zu ihrem Besten war. Das musste sie tun, wenn sie wachsen und ihre Flugkünste verbessern wollte. Und er war so froh, dass seine Drachin zu den Ersten gehörte, die es geschafft hatten zu fliegen. Aber … aber er vermisste sie. Wegen ihres Erfolgs war er nun einsamer denn je.
Am Ufer versuchten sich mehrere Drachen an dem Kunststück, das ihr gelungen war. Carson stand neben dem silbernen Fauch, hielt die Spitze des ausgestreckten Flügels und suchte ihn nach Schmarotzern ab. Fauch glänzte bereits wie ein poliertes Schwert. Tats erkannte, dass Carson nur so tat, als würde er den Drachen absuchen, ihn aber eigentlich bloß dazu zwingen wollte, die Flügel zu spreizen. Fauch grummelte auf eine Art, die sowohl unzufrieden als auch bedrohlich klang. Doch Carson beachtete es nicht. Nicht alle Drachen nahmen an den Übungen mit derselben Begeisterung teil. Und Fauch war einer der widerspenstigsten. Ranculos war an einem Tag voller Tatendrang, am nächsten mürrisch. Dem mitternachtsblauen Kalo war anzumerken, wie wütend es ihn machte, dass bloße Menschen es wagten, seine Flugversuche anzuleiten, während Baliper ganz offen seine Angst vor dem Fluss zeigte und in seiner Nähe überhaupt nicht flog. Die meisten anderen waren einfach faul, fand Tats. Das Flugtraining war anstrengend und schmerzhaft.
Manche jedoch waren entschlossen, das Fliegen zu meistern, koste es, was es wolle. Dortean musste sich noch erholen, nachdem er durch die Bäume zur Erde gekracht war. Sestican hatte sich eine Schwinge aufgerissen. Sein Hüter Lecter hatte geweint, als er den Flügel aufgespannt hatte, damit Carson ihn nähen konnte.
Mercor hielt sich aufrecht, die Schwingen weit im spärlichen Sonnenlicht ausgebreitet. Harrikin und Sylve betrachteten ihn, und Sylve schnitt vor Anspannung eine Grimasse. Harrikins Drache Ranculos sah neidisch herüber. Der goldene Drache hob die Flügel an und schlug einmal kurz und kräftig mit ihnen, als wollte er sich vergewissern, dass alles in Ordnung mit ihnen war. Dann fasste er sich, verlagerte das Gewicht auf die Hinterbeine und sprang mit weit ausgreifenden, hektischen Flügelschlägen in die Höhe. Doch er kam nicht hoch genug, um die Schwingen ganz durchziehen zu können, und so schwebte er lediglich eine Weile am Fluss entlang, bevor er tollpatschig im Sand landete. Tats stieß einen enttäuschten Seufzer aus und sah, dass Sylve sich kurz die Hände vors Gesicht hielt. Der Golddrache wurde dünner, während er größer wurde, und er glänzte nicht mehr so wie früher. Für ihn war die Fähigkeit zu fliegen und zu jagen eine Frage des Überlebens. Für ihn wie für die anderen. Denn wohin er sie führte, würden sie ihm folgen.
Mercor hatte einen eigenartigen Einfluss auf die anderen, den Tats nicht ganz verstand. Als Schlangen hatte er das »Knäuel« angeführt. Tats überraschte es, dass die Gefolgschaftstreue aus einem früheren Leben noch immer bestand. Niemand hatte protestiert, als Mercor bestimmt hatte, dass die flugfähigen Drachen ausschließlich am anderen Ufer jagen und das Wild auf der Dorfseite in Ruhe lassen sollten, damit die an die Erde gebundenen Drachen weiterhin von den Hütern versorgt werden konnten. Jetzt schauten die anderen Drachen ihm zu, wie er seine Flügel lockerte, und Tats hoffte, dass die übrigen sich mehr bemühen würden, wenn Mercor es erst einmal gemeistert hatte.
Sobald die Drachen fliegen und jagen konnten, würde das Leben einfacher für sie alle werden. Dann würden auch die Hüter nach Kelsingra ziehen können. Tats dachte an warme Betten und heißes Wasser und seufzte. Er sah zum Himmel, wo Fente flog.
»Es ist nicht leicht, sie gehen zu lassen, nicht wahr?«
Widerwillig drehte er sich zu Alise um. Einen Moment lang war er befangen, weil er glaubte, dass sie ihm ins Herz sehen konnte und wusste, dass er wegen Thymara Liebeskummer hatte. Dann begriff er, dass sie von seiner Drachin sprach, und versuchte ein Lächeln. Die Bingstädterin war in letzter Zeit still und ernst und etwas distanziert gewesen. Es war fast so, als wäre sie wieder zur Fremden in der Gruppe geworden, zu der feinen Dame aus Bingstadt, über deren Teilnahme an der Expedition sich alle Hüter gewundert hatten. Anfangs hatte sie mit Thymara um Sintaras Gunst gewetteifert, aber Thymara war der Drachin wegen ihres Jagdgeschicks schnell, wenn nicht ans Herz, so doch an den Bauch gewachsen. Trotz allem hatte Alise sich eine Stellung im Expeditionstrupp erarbeitet. Sie jagte nicht, aber sie half bei der Pflege der Drachen und beim Versorgen von Wunden, so gut sie konnte. Und ihr Wissen über Drachen und Uralte hatte ihnen allen schon sehr geholfen. Eine Zeitlang hatte es den Anschein gehabt, als wäre sie eine von ihnen.
Doch Alise war von keinem der Drachen als Hüterin erwählt worden, und nachdem Rapskal verkündet hatte, dass die Stadt den Hütern gehörte, war sie vollends ins Abseits geraten. Noch heute zuckte Tats zusammen, wenn er an diese Auseinandersetzung dachte. Nach ihrer Ankunft in Kelsingra hatte Alise die Entscheidungsgewalt über die Stadt innegehabt und verfügt, dass dort nichts berührt oder verändert werden durfte, ehe sie nicht Gelegenheit gehabt hatte, es gründlich zu dokumentieren. Tats hatte ihre Regeln beherzigt, so wie die anderen Hüter. Jetzt staunte er darüber, wie viel Autorität er ihr zugestanden hatte, nur weil sie eine Erwachsene und eine Gelehrte war.
Doch dann war es zu der Konfrontation zwischen ihr und Rapskal gekommen. Rapskal war der einzige Hüter gewesen, der freien Zugang zu Kelsingra gehabt hatte. Seine Drachin Heeby war als Erste geflogen, und im Gegensatz zu den anderen Drachen hatte es ihr nichts ausgemacht, einen Reiter auf dem Rücken zu transportieren. Heeby hatte auch Alise viele Male in die Stadt gebracht. Doch als Rapskal mit Thymara einen Entdeckungsausflug dorthin gemacht und tags darauf einen Berg Uraltenkleider an die in Lumpen gehüllten Hüter verteilt hatte, war Alise wütend geworden. Tats hatte die vornehme Dame aus Bingstadt noch nie so in Rage erlebt. Sie hatte die Hüter angeschrien, dass sie die Kleider auf der Stelle niederlegen und nicht daran herumreißen sollten.
Und da hatte Rapskal sich ihr widersetzt. Er hatte ihr auf seine direkte Art mitgeteilt, dass die Stadt lebe und den Uralten gehöre, nicht ihr. Er hatte sie darauf hingewiesen, dass er und die anderen Hüter Uralte waren, während sie nur ein Mensch war und es auch bleiben würde. Obwohl es ihm an diesem Tag das Herz gebrochen hatte, Thymara und Rapskal zusammen sehen zu müssen, hatte er doch auch tiefes Mitleid mit Alise empfunden. Und eine Spur Scham und Bedauern, weil sie sich so rasch aus ihrer aller Gesellschaft zurückgezogen hatte. Wenn er jetzt darüber nachdachte, fühlte er sich schuldig, weil er nicht wenigstens einmal an ihre Tür geklopft hatte, um zu fragen, ob alles in Ordnung war. Doch er hatte sich in seinem eigenen Herzschmerz gesuhlt. Trotzdem hätte er zu ihr gehen und sich erkundigen sollen. Tatsächlich hatte er ihre Abwesenheit aber erst hinterher bemerkt, nachdem sie wieder aufgetaucht war.
Bedeutete ihr Versuch einer Unterhaltung, dass sie sich von Rapskals Rüffel erholt hatte? Er hoffte es.
Er lächelte. »Fente hat sich verändert. Sie braucht mich nicht mehr so sehr wie früher.«
»Bald wird das bei allen so sein.« Sie sah ihn nicht an. Stattdessen folgte ihr Blick seiner Drachin. »Du wirst anders über dich nachdenken müssen. Dein eigenes Leben wird mehr Bedeutung für dich haben. Die Drachen werden ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Und unseres vermutlich auch.«
»Was meinst du damit?«
Jetzt schaute sie ihn an, ganz direkt und mit hochgezogenen Augenbrauen, als wäre sie erstaunt, dass er nicht verstand, was sie meinte. »Ich meine, dass die Drachen wieder über die Welt herrschen werden. So wie einst.«
»Wie einst?«, wiederholte Tats, während er ihr zum Ufer folgte. Dass sich die Hüter und die nicht fliegenden Drachen morgens am Ufer versammelten, um über die täglichen Aufgaben zu reden, war zu einer neuen Gewohnheit geworden. Er schaute sich um und war einen Moment lang ganz ergriffen von dem herrlichen Anblick. Die Hüter schimmerten im sich auflösenden Morgennebel, denn sie trugen nun alle immerzu die Uraltengewänder. Ihre Drachen hatten sich über den Hang und das Ufer verteilt. Sie bewegten ihre Schwingen, übten im Gras kräftige Flügelschläge oder streckten Hälse und Beine. Auch sie leuchteten aus der tauglitzernden Wiese hervor. Am Fuß des Hügels hatte Carson seine Bemühungen bei Fauch aufgegeben und wartete auf sie; Sedric stand neben ihm.
Seine Führerrolle hatte sich weiterentwickelt. Zwar hatte Rapskal nach seiner Rückkehr aus Kelsingra eine charismatische Rede gehalten, aber er hatte nicht das Kommando an sich gerissen, wie Tats eigentlich angenommen hatte. Vermutlich lag ihm nichts daran. Er war gut aussehend und lustig, alle mochten ihn, doch die meisten sprachen mit einem liebevollen Lächeln von ihm und weniger mit Respekt. Rapskal blieb so sonderbar wie eh und je, im einen Moment in sich gekehrt, im nächsten übertrieben gesellig. Und zufrieden mit sich selbst. Der Ehrgeiz, der in Tats brannte, war bei ihm nicht einmal ein Funke.
Carson war von denjenigen, die sich eines Drachen angenommen hatten, der Älteste. Ihm die Führung zu überlassen, schien ganz natürlich zu sein, und der Jäger schreckte auch nicht davor zurück. Meistens verteilte Carson die Aufgaben an die Hüter, bestimmte, wer die Drachen zu pflegen und sich anderweitig um sie zu kümmern hatte, und der Rest wurde zum Jagen und zum Angeln geschickt. Wenn sich ein Hüter beklagte, dass er eigentlich an dem Tag etwas anderes vorhatte, ließ Carson ihm seinen Willen. Er wahrte ihrer aller Individualität und versuchte nicht, ihnen seine Autorität aufzuzwingen. Deshalb akzeptierten ihn alle.
Alise hatte sich stillschweigend einiger der niedrigen, aber notwendigen täglichen Aufgaben angenommen. Sie kümmerte sich um die Räuchergestelle, wo Fisch und Fleisch für alle haltbar gemacht wurden, sammelte essbare Pflanzen und half bei der Drachenpflege. Sylve, die keine besonders gute Jägerin war, richtete ihre Anstrengungen auf die Zubereitung der Mahlzeiten. Auf Carsons Vorschlag hin aßen die Hüter wieder alle gemeinsam. Es war eigenartig, aber auch nett, wieder als Gemeinschaft zu essen und sich dabei zu unterhalten, so wie sie es auf der Reise gemacht hatten.
So fühlte Tats sich etwas weniger einsam.
»So wie früher und wie es wieder sein wird«, fuhr Alise fort. Sie blickte ihn an. »Wenn ich sie fliegen sehe und euch, wie ihr euch verändert, erscheint alles, was ich im Lauf meiner früheren Studien herausgefunden habe, in einem anderen Licht. Drachen waren der Mittelpunkt der Uraltenzivilisation. Die Menschen lebten getrennt von ihnen in Siedlungen wie dieser, die wir hier entdeckt haben. Menschen haben Getreide angebaut und Vieh gezüchtet, das sie den Uralten im Tausch gegen Wunderdinge verkauft haben. Schau dir die Stadt da drüben an, Tats, und überlege: Wie haben die sich ernährt?«
»Nun, um die Stadt herum gab es Herden. Wahrscheinlich auch Felder …«
»Vermutlich. Aber darum haben sich die Menschen gekümmert. Uralte haben ihr Leben der Magie und der Drachenpflege gewidmet. Alles, was sie taten, bauten und erschufen, war nicht für sie selbst, sondern für die Drachen, die über ihnen standen.«
»Beherrscht? Sie wurden von den Drachen beherrscht?« Die Vorstellung gefiel ihm gar nicht.
»›Beherrscht‹ ist nicht der richtige Ausdruck. Beherrscht Fente dich?«
»Natürlich nicht!«
»Und dennoch hast du dein Leben der Jagd für sie gewidmet und der Pflege und der Sorge um sie.«
»Aber das wollte ich doch alles.«
Alise lächelte. »Und deshalb ist ›beherrschen‹ der falsche Ausdruck. Bezaubert? Verhext? Ich bin mir nicht sicher, wie man es nennen soll, aber du weißt schon, was ich meine. Wenn diese Drachen sich paaren und noch mehr ihrer Art in die Welt setzen, dann werden sie unausweichlich zu den Herrschern der Welt in ihrem eigenen Interesse.«
»Das hört sich so egoistisch an!«
»Wirklich? Ist es nicht genau das, was Menschen seit Generationen tun? Wir beanspruchen das Land für uns und unterwerfen es unseren Zwecken. Wir ändern Flussläufe und die Gestalt der Landschaft, damit wir mit dem Schiff reisen oder Getreide anbauen oder Vieh weiden können. Und wir halten es für natürlich, dass wir die ganze Welt so gestalten, dass sie uns angenehm ist und uns Früchte bringt. Wieso sollten die Drachen die Welt anders sehen?«
Tats schwieg eine Weile.
»Vielleicht ist es keine schlechte Sache«, stellte Alise fest. »Vielleicht legen die Menschen etwas von ihrer Kleinlichkeit ab, wenn sie sich mit Drachen konfrontiert sehen. Ah, schau! Ist das Ranculos? Ich hätte es nicht für möglich gehalten!«
Der riesige scharlachrote Drache war in der Luft. Er sah nicht anmutig aus, sein Schwanz war immer noch zu mager, und die Hinterbeine waren zu dünn für seine Größe. Tats wollte eben anmerken, dass er nur durch die Luft glitt, nachdem er sich von weiter oben abgestoßen hatte, aber in diesem Moment fing der Drache an, mit den Flügeln zu schlagen. Und aus dem Gleiten wurde ein angestrengter Flug in die Höhe.
Tats bemerkte Harrikin. Der hochgewachsene schlanke Hüter raste den Hang hinunter, beinahe im Schatten seines Drachen. Während Ranculos mit den Flügeln schlug und weiter in die Höhe stieg, rief Harrikin ihm nach: »Pass auf, wo du hinfliegst! Die Flügel kippen, nach links! Nicht auf den Fluss hinaus, Ranculos! Nicht auf den Fluss!«
Seine Stimme klang dünn und atemlos, und Tats bezweifelte, dass der riesige Drache ihn hörte. Wenn er es tat, dann achtete er nicht darauf. Vielleicht riss ihn die Begeisterung mit. Oder vielleicht hatte er beschlossen, alles auf eine Karte zu setzen.
Der rote Drache hievte sich in den Himmel. Seine Hinterbeine baumelten und zuckten, und er versuchte, sie in einer Linie mit seinem Körper auszurichten. Einige andere Hüter stimmten in Harrikins Rufe ein. »Zu früh, Ranculos, zu früh!«
»Komm zurück! Flieg einen Bogen!«
Doch der rote Drache wollte nichts davon wissen. Seine mühsamen Flugversuche brachten ihn immer weiter vom Ufer weg. Aus seinem regelmäßigen Flügelschlag wurde ein unstetes Flattern.
»Was macht er denn? Was will er nur?«
»Ruhe!« Wie ein Donnerschlag schmetterten Stimme und Gedanke von Mercor sie alle nieder. »Schaut!«, befahl er Menschen und Drachen.
Ranculos hing mit weit ausgebreiteten Schwingen in der Luft. Man sah ihm die Unsicherheit deutlich an. Kippend und hin und her wippend, ging er in einen weiten Bogen und verlor dabei an Höhe. Dann, als würde ihm jetzt erst auffallen, dass er Kelsingra näher war als dem Dorf, nahm er seinen Kurs wieder auf. Doch inzwischen war seine Erschöpfung offensichtlich. Sein Körper sackte zwischen den Flügeln ab. Der Zusammenstoß von Drache und Fluss zeichnete sich immer deutlicher ab, wurde unausweichlich.
»Neeeiiin!«, rief Harrikin gequält. Er stand steif da, hielt sich entsetzt das Gesicht, sodass sich seine Fingernägel in die Wangen gruben. Ranculos’ Gleitbahn brachte ihn immer weiter vom Dorf weg. Unter ihm floss gierig der graue Fluss. Sylve warf Mercor einen vorsichtigen Blick zu und lief dann an Harrikins Seite. Lecter trottete den Hang hinunter, um sich ebenfalls neben seinen Ziehbruder zu stellen. Dabei ließ er die Schultern hängen, als teile er Harrikins Verzweiflung und wüsste bereits, wie es ausgehen würde.
Ranculos fing an, mit den Flügeln zu schlagen, nicht stetig, sondern hektisch. Die Schläge waren so unregelmäßig, dass er schwankte und flatterte wie ein Küken, das zu früh aus dem Nest fällt. Sein Ziel war das andere Ufer, doch trotz seines Kampfes gegen den Wind war allen klar, dass er es nicht erreichen würde. Einmal, zweimal, dreimal tauchten seine Flügelspitzen weißen Schaum schlagend in den Fluss, dann verfingen sich seine hängenden Hinterbeine in der Flut, und das Wasser holte ihn aus der Luft, sodass er sich mit ausgebreiteten Flügeln ins Grau schraubte. Hilflos patschte er im Wasser mit den Flügeln. Dann ging er unter. Der Fluss glättete sich wieder über ihm, als wäre er nie da gewesen.
»Ranculos! Ranculos!« Harrikins Stimme klang schrill wie die eines Kindes. Langsam fiel er auf die Knie. Alle Blicke waren auf den Fluss gerichtet, hofften auf das Unmögliche. Nichts durchbrach das dahineilende Wasser. Harrikin starrte angestrengt auf den Fluss, die Hände zu Fäusten geballt. »Schwimm! Trete! Wehr dich, Ranculos! Gib nicht auf! Nicht aufgeben!«
Er sprang hoch und lief ein paar Schritte auf das Ufer zu. Sylve, die sich an ihn geklammert hatte, wurde mitgezerrt. Er blieb stehen, sah sich mit irrem Blick um. Dann durchlief ihn ein Schauder, und er rief: »BITTE! Bitte, Sa, nicht meinen Drachen! Nicht meinen Drachen!« Der Wind wischte sein untröstliches Gebet beiseite. Wieder fiel er auf die Knie, doch dieses Mal kippte auch sein Kopf nach unten, und er erhob sich nicht mehr.
Eine fürchterliche Stille breitete sich aus, während alle auf den leeren Fluss starrten. Sylve blickte zu den anderen Hütern zurück, sinnloses Entsetzen im Gesicht. Lecter ging auf sie zu. Er legte Harrikin eine geschuppte Hand auf die Schulter und neigte den Kopf. Seine Schultern bebten.
Tats sah schweigend zu und fühlte den Schmerz mit ihnen. Mit schlechtem Gewissen blickte er zum Himmel. Er brauchte einen Moment, bis er Fente ausmachen konnte, ein blitzendes grünes Juwel in der Ferne. Eben stürzte sie sich auf etwas herab, wahrscheinlich auf ein Reh. Weiß sie es nicht, oder kümmert es sie nicht?, fragte er sich. Vergeblich hielt er nach einer der anderen Drachinnen Ausschau. Sollten sie gemerkt haben, dass Ranculos gerade ertrank, zeigten sie es nicht. Lag das daran, dass sie überzeugt waren, dass niemand etwas tun konnte? Die scheinbare Herzlosigkeit der Drachen gegenüber ihren Artgenossen verstand er nicht.
Und manchmal auch gegenüber ihren Hütern, dachte er, als auf einmal Sintara in all ihrer blauen Schönheit durch sein Gesichtsfeld fegte. Auch sie war auf der Jagd, huschte über die fernen Hügel am anderen Ufer, ohne zu merken, dass Thymara alleine am Fluss stand oder dass Ranculos in den eisigen Fluten ertrank.
»Ranculos!«, bellte Sestican plötzlich.
Tats sah Lecter den Kopf heben. Er wirbelte herum und beobachtete voller Entsetzen, wie der blaue Drache ungestüm den Hang hinuntergaloppierte. Dabei breitete Sestican die Schwingen aus, sodass das leuchtend orangefarbene Geäder seiner blauen Flughaut zur Geltung kam. Lecter löste sich von seinem zusammengebrochenen Bruder und rannte ebenfalls los, um seinem Drachen den Weg abzuschneiden. Er brüllte und flehte Sestican an stehen zu bleiben. Davvie lief ihm nach. Der große blaue Drache hatte zwar eifrig trainiert, aber Tats war dennoch verblüfft, als das Ungetüm plötzlich in die Luft sprang, seinen Körper mit einem Ruck pfeilgerade streckte und mit jedem Flügelschlag an Höhe gewann. Er schoss über den Kopf seines Hüters hinweg, war aber kaum eine Flügelbreite über der Wasseroberfläche, als er mit der Flussüberquerung begann. Lecter verlor die Fassung. »Nein! Nein! Du bist noch nicht so weit! Nicht du auch noch! Nein!«
Nun war Davvie bei ihm und hielt sich vor Entsetzen beide Hände vor den Mund.
»Lass ihn«, sagte Mercor resigniert. Obwohl seinen Worten jede Kraft fehlte, erreichten sie jedes Ohr. »Er geht das Risiko ein, das jeder von uns früher oder später eingehen muss. Hierzubleiben bedeutet einen langsamen Tod. Vielleicht ist ein rasches Ertrinken im kalten Fluss die bessere Wahl.« Die schwarzen Augen des Golddrachen kreisten und waren auf den unbeholfen fliegenden Sestican gerichtet.
Der Wind wehte über der Wiese und trieb Regen herbei. Tats kniff die Augen zusammen und war dankbar für die Tropfen auf seiner Wange.
»Aber vielleicht auch nicht!«, donnerte Mercor unvermittelt. Er stellte sich auf die Hinterbeine, um weiter flussabwärts ans andere Ufer zu blicken. Einige andere Drachen machten es ihm nach. Plötzlich schnellte Harrikin auf die Beine, als Fauch rief: »Er ist draußen! Ranculos hat den Fluss überquert!«
Tats konnte nichts erkennen, sosehr er sich auch anstrengte. Der Regen bildete einen grauen Schleier, und der Bereich, den die Drachen beobachteten, war ein Gewirr aus verfallenen Uraltengebäuden direkt am Wasser. Doch dann rief Harrikin: »Tatsächlich! Er ist aus dem Fluss heraus. Ziemlich mitgenommen, aber er lebt. Ranculos lebt und ist in Kelsingra!«
Plötzlich schien Harrikin Sylve zu bemerken. Er nahm sie ungestüm in den Arm und wirbelte ausgelassen mit ihr herum. »Er ist in Sicherheit! Er ist gerettet!« Sylve stimmte lachend in sein Freudengeschrei ein. Doch auf einmal hielten sie inne. »Sestican?«, rief Harrikin. »Lecter! Lecter!« Er und Sylve liefen zu Lecter.
Lecters blauer Drache näherte sich dem anderen Ufer. Er krümmte den Körper, neigte den Kopf und die kürzeren Vorderbeine zu den plötzlich wieder hängenden Hinterbeinen, berührte die Erde mit allen vier Pranken, die Flügel ausgebreitet. Einen Moment lang wirkte seine Landung elegant. Aber dann erwies sich, dass er zu schnell gewesen war, und er machte mit gespreizten Schwingen einen Purzelbaum. Ein Chor aus Jubel, Ächzen und ein paar Lachern begleitete seine verunglückte Landung. Doch Lecter stieß einen Freudenschrei aus und machte einen Luftsprung. Mit einem breiten Grinsen fuhr er zu den Lachenden herum und fragte: »Kriegen eure Drachen das etwa besser hin?« Sein Blick fiel auf Davvie, und er stürzte sich auf seinen Liebhaber, umarmte ihn stürmisch.
Kurz darauf gesellten sich sein Ziehbruder und Sylve in die Umarmung. Erstaunt beobachtete Tats, wie Harrikin Sylve aus dem Pulk herauszog, sie einmal herumwirbelte, in seinen Armen auffing und sie innig küsste. Die versammelten Hüter liefen mit ausgelassenen Rufen herbei.
»Alles ändert sich«, murmelte Alise. Sie betrachtete die Umarmung, sah das Knäuel der Freunde und wandte sich dann zu Tats um. »Jetzt sind es fünf. Fünf Drachen in Kelsingra.«
»Dann fehlen noch zehn«, erwiderte Tats. Da er sah, dass Harrikin und Sylve noch immer in ihrer Umarmung verharrten und die jubelnde Menge um sie herum nicht wahrzunehmen schienen, fügte er hinzu: »Es hat sich verändert. Wie findest du das?«
»Meinst du, dass es für sie eine Rolle spielt, wie ich es finde?«, fragte Alise. Die Frage mochte säuerlich klingen, aber sie war ernst gemeint.
Tats schwieg einen Moment. »Ich glaube, das tut es«, sagte er schließlich. »Ich glaube, es spielt für uns alle eine Rolle. Du weißt so viel über die Vergangenheit. Ich glaube, du siehst manchmal klarer, was aus uns werden wird …« Er stockte, als ihm auffiel, dass seine Worte vielleicht unfreundlich klangen.
»Weil ich keine von euch bin. Weil ich nur beobachte«, sprach sie für ihn weiter. Als er darauf dumpf und verlegen nickte, lachte sie laut. »Das gibt mir einen Blickwinkel, der euch vielleicht fehlt.«
Sie zeigte auf Sylve und Harrikin. Hand in Hand standen sie neben Lecter. Die anderen Hüter umringten sie lachend und jubelnd. Davvie und Lecter hielten sich ebenfalls an den Händen. »In Trehaug oder Bingstadt wäre das ein Skandal. Dort wären sie bereits Ausgestoßene. Hier dagegen, wenn man hier wegschaut, wenn sie sich küssen, dann geschieht es nicht aus Ekel, sondern um ihnen ihre Privatsphäre zu lassen.«
Tats’ Aufmerksamkeit wanderte weiter. Er bemerkte Rapskal, der sich durch die Traube von Hütern an Thymara heranschob. Er sagte etwas zu ihr, worauf sie lachte. Dann legte er ihr die Hand auf den Rücken, die Finger sacht auf dem gewölbten Stoff des Uraltengewands, das ihre Flügel verbarg. Thymara wand sich, als würde sie erschauern, und rückte von ihm ab, doch ihre Miene zeigte keine Verstimmung.
Tats richtete den Blick wieder auf Alise. »Oder wir schauen weg, weil wir eifersüchtig sind«, sagte er und überraschte sich selbst mit seiner Ehrlichkeit.
»Für Einsame ist es schwer, das Glück zu betrachten«, gestand Alise, und Tats wurde bewusst, dass sie seine Bemerkung auf sich bezogen hatte.
»Zumindest weißt du, dass deine Einsamkeit bald enden wird«, sagte er.
Sie dankte es ihm mit einem Lächeln. »Das wird sie. Und irgendwann auch deine.«
Er brachte es nicht über sich, sie anzulächeln. »Wie kannst du dir da so sicher sein?«
Sie sah ihn mit zur Seite geneigtem Kopf an. »Es ist, wie du sagst. Ich habe einen anderen Blickwinkel. Aber wenn ich dir sage, was ich vorhersehe, wird es dir nicht gefallen.«
»Ich bin bereit, es zu hören«, versicherte er ihr und fragte sich, ob er das tatsächlich war.
Sie blickte über die versammelten Hüter hinweg. Am anderen Ufer konnte er durch Nebel und Regen vage die beiden Drachen ausmachen. Ranculos war ein großes Stück flussabwärts aus dem Fluss gewatet und stapfte am Ufer entlang auf Sestican zu. Dieser machte sich als kleine blaue Gestalt auf den Weg zu den großen Straßen der Stadt. Zum Drachenbad, nahm Tats an. Die an die Erde gefesselten Drachen sprachen über fast nichts anderes mehr. Er richtete den Blick wieder auf die Drachen an diesem Ufer, die sehnsüchtig hinüberschauten. Mercors Hals war in Richtung Kelsingra gereckt, als könnte er sich allein durch Willenskraft hinüberbringen. Der silberne Fauch und die untersetzte Relpda standen abseits, die Köpfe schief wie verwirrte Kinder. Die anderen hatten sich fächerförmig hinter Mercor aufgestellt. Der blauschwarze Kalo überragte Jerds grüne Veras. Baliper und Arbuc hielten ausreichend Abstand zu dem aufbrausenden schwarzen Drachen. Zunder, der einzige lavendelfarbene Drache, der an den Flügeln immer mehr königsblaues Geäder zeigte, stand neben den beiden orangefarbenen Drachen, Dortean und Skrim. Die beiden letzten Drachen erinnerten Tats sehr an ihre Hüter, Kase und Boxter. Sie schienen nie weit entfernt voneinander zu sein. Alises Worte holten ihn aus seinen Gedanken.
»Du bist jung, selbst nach den Maßstäben der Regenwildnis. Laut meinen Forschungsergebnissen hat dein Leben nach Uraltenmaßstäben noch kaum begonnen: Du hast nicht nur Jahrzehnte, sondern ganze Lebensalter vor dir. Und ich schätze, dass du, wenn Kelsingra sich wiederbelebt und seine Bevölkerung zunimmt, viele junge Frauen zur Auswahl haben wirst. Irgendwann wirst du eine finden. Oder vielleicht sogar mehrere über den Zeitraum vieler Jahre.«
Er starrte sie an, sprachlos angesichts solcher Aussichten.
»Uralte sind keine Menschen«, betonte sie ruhig. »Früher waren sie nicht an die Gepflogenheiten der Menschen gebunden.« Sie löste den Blick von ihm und sah über den Fluss nach Kelsingra, als könnte sie in der nebligen Stadt die Zukunft erkennen. »Und ich gehe davon aus, dass es wieder so sein wird. Dass ihr von uns abgesondert und nach euren eigenen Regeln leben werdet.« Sie neigte den Kopf in Richtung der feiernden Hüter. »Jetzt ist nicht der Moment, mit mir hier herumzustehen. Du solltest zu ihnen gehen.«