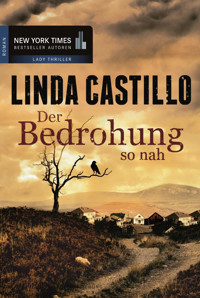9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kate Burkholder ermittelt
- Sprache: Deutsch
Sie töteten alle Mitglieder der Familie Plank. Die Leichen des Vaters und der beiden Söhne fand man im Wohnhaus, die der Mutter und des Babys auf dem Weg zur Scheune. Doch niemand war auf das vorbereitet, was sie in der Scheune fanden. Die beiden Mädchen, gefoltert und misshandelt. Die Familie gehörte zur amischen Gemeinde in Painters Mill, Ohio, sie lebten getreu ihren Glaubensgrundsätzen von Schlichtheit und Bescheidenheit, waren gottesfürchtige Leute. Fernab von den Verführungen der Zivilisation. Oder enthüllt das Tagebuch der ältesten Tochter eine andere Wahrheit? Spannungsgeladen und aufregend: Auch der zweite Thriller mit Polizeichefin Kate Burkholder ist Nervenkitzel pur. Ein Thriller, der Gänsehaut garantiert!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Linda Castillo
Blutige Stille
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Helga Augustin
Fischer e-books
Für meinen Mann Ernest.
Immer.
»Drei können ein Geheimnis bewahren, wenn zwei von ihnen tot sind.«
Benjamin Franklin
1. KAPITEL
Die letzte Tasse Kaffee hätte Officer Chuck »Skid« Skidmore sich besser sparen sollen. Und es wäre ja auch bei nur einer geblieben, würde im Diner nicht Brandy arbeiten, die neue Kellnerin. Verdammt süß, die Kleine! Also hatte er seine gesamte Pause an der Theke abgesessen und sich mit Koffein vollgepumpt wie ein Zehnjähriger mit Kool-Aid. Was Brandy ziemlich gut zu gefallen schien, denn sie hatte ihm ständig nachgeschenkt und ihn mit ihrem Girlie-Geplauder und üppigem Dekolleté unterhalten.
Seit ihn Chief Burkholder vor zwei Monaten zur Nachtschicht eingeteilt hatte, aß er jeden Abend im LaDonna’s Diner. Er hasste es, nachts zu arbeiten, respektierte aber die Entscheidung seiner Vorgesetzten. Aber er wollte unbedingt wieder zurück zur Tagschicht.
Skid bog mit dem Streifenwagen in die Hogbath Road ab, einem einsamen Stück Landstraße, die von Norden her von Miller’s Woods und südlich von einem Maisfeld begrenzt wurde. Mit knirschenden Reifen blieb er auf dem Schotterstreifen am Rand stehen und suchte im Handschuhfach nach seinen Marlboro Lights, als sich knisternd das Funkgerät meldete.
»Drei-Zwei-Vier. Bist du 10–8? Pause zu Ende?«
Mona arbeitete nachts in der Telefonzentrale und war der einzige Mensch, mit dem er sich um diese Zeit unterhalten konnte – jedenfalls nach Betriebsschluss des Diners. Sie hatte ihn viele Nächte vor dem Tod durch Langeweile bewahrt. »Ja, bin im Dienst.«
»Und, hast du mit ihr geredet?«
»Korrekt.«
»Habt ihr euch verabredet?«
Skid stieß die Tür auf, um den Streifenwagen nicht vollzuräuchern, und zündete sich eine Zigarette an. »Also das geht dich doch wirklich nichts an.«
»Du bist doch derjenige, der seit zwei Monaten von nichts anderem redet.«
»Sie ist zu jung für mich.«
»Seit wann hat dich das je gestört?«
»Du blockierst die Leitung.«
Mona lachte. »Du bist ein Feigling.«
Er zog an seiner Zigarette und wünschte, ihr nie davon erzählt zu haben, dass er in Brandy verknallt war. »Wie du meinst.«
»Rauchst du etwa?«
Lautlos formte er das Wort Scheiße.
»Du hast gesagt, du hörst auf.«
»Ich hab gesagt, ich höre entweder mit dem Trinken oder dem Rauchen auf. Aber ganz bestimmt nicht mit beidem auf einmal.« Er inhalierte tief. »Schon gar nicht, wenn ich zur Nachtschicht verdonnert bin.«
»Vielleicht ist der Chief ja noch sauer wegen der alten Dame, die du verprügelt hast.«
»Ich hab sie nicht verprügelt. Die alte Kuh war stockbesoffen.«
»Sie war zweiundsechzig Jahre alt.«
»Und splitterfasernackt.«
Mona kicherte. »Du kriegst immer die besten Einsätze.«
»Erinner mich bloß nicht daran. Der Anblick ihres runzligen Arsches hat bei mir bleibende Schäden hinterlassen.« Er seufzte, von seiner Blase daran erinnert, warum er überhaupt angehalten hatte. »Ich geh jetzt mal pinkeln.«
»So genau wollte ich es nun auch nicht wissen.« Sie legte auf.
Grinsend stieg Skid aus. Die Grillen verstummten, als er um den Wagen zum Straßengraben ging. Trockene Maisstängel raschelten in der leichten Brise, und ein voller Oktobermond tauchte das hohe Getreidesilo und Scheunendach einer nahe gelegenen Amisch-Farm in gelbes Licht. Es war so still, dass er sogar das Quakkonzert der Frösche vom vierhundert Meter entfernten Wildcat Creek hören konnte. Skid erleichterte sich und versuchte, nicht an die lange Nacht zu denken, die vor ihm lag. Er würde mit der Chefin reden. Er hatte die Nase voll von diesem Geisterstunden-Job. Er wollte wieder tagsüber arbeiten.
Er zog gerade den Reißverschluss zu, als ihn ein seltsames Geräusch aufhorchen ließ. Das klingt wie der Ruf eines Kälbchens nach seiner Mutter, dachte er, oder wie ein jaulender Hund, der von einem Auto angefahren worden ist. Doch als das Geräusch wiederkehrte, wusste er, dass es weder das eine noch das andere war. Seine Nackenhaare sträubten sich. Irgendwo da draußen schrie ein Mann.
Die Hand auf der .38er im Hüftholster, suchte sein Blick die Gegend jenseits des flüsternden und seufzenden Maisfeldes ab. Der dritte Schrei versetzte ihn endgültig in Panik. »Was zum Teufel …?«
Er riss die Tür des Streifenwagens auf, beugte sich hinein, stellte das Blaulicht an und ließ die Sirene ein paar Mal aufheulen. Dann tastete er nach dem Ansteckmikrophon an seinem Kragen und drückte drauf.
»Mona, bin hier draußen in der Nähe der Plank-Farm. Hab ein 10–88.« Das war der Code für verdächtige Aktivitäten.
»Was ist passiert?«
»Irgendein Irrer schreit wie am Spieß.«
»Seltsam.« Sie schwieg einen Moment. »Wer ist es?«
»Keine Ahnung, aber ich glaube, es kommt vom Haus. Ich fahr hin und sehe mal nach.«
»Verstanden.«
Skid stieg in den Wagen, fuhr los und bog auf die Schotterstraße ein, die zum Haus führte. Die Planks waren Amische, und die Amischen lebten für gewöhnlich ruhig und zurückgezogen. Die meisten begannen ihr Tagewerk vor Sonnenaufgang und waren im Bett, bevor andere Leute ihr Abendessen beendet hatten. Skid konnte sich niemanden vorstellen, der um diese Uhrzeit noch draußen sein könnte, um Lärm zu machen. Wenn zu dieser Stunde jemand so rumschrie, war es entweder ein besoffener Teenager in seiner Rumspringa – der Zeit, die man Jugendlichen zum Austoben zugestand, bevor sie der Glaubensgemeinschaft beitraten –, oder es hatte einen Unfall gegeben.
Auf halber Strecke zum Haus tauchte aus dem Schatten plötzlich ein Mann auf der Straße auf, und Skid musste voll abbremsen. Der Wagen schlingerte und verfehlte ihn nur knapp. »Verdammte Scheiße!«
Der Mann tastete sich am Wagen entlang und blieb mit den Händen auf der Motorhaube stehen, die Augen so groß wie Tennisbälle. Skid kannte ihn nicht, doch der volle Bart und flachkrempige Hut zeigten eindeutig, dass er der Amisch-Gemeinde angehörte. Er schob den Schalthebel auf Parken und stieg aus. »Was zum Teufel machen Sie denn da? Ich hätte Sie fast überfahren!«
Der Mann atmete schwer und zitterte wie Espenlaub, und obwohl es Oktober war, glänzten seine Wangen schweißnass. Skid fragte sich, ob er vielleicht auf einem Drogentrip war.
»Mein Gott!«, sagte der Mann auf Pennsylvaniadeutsch.
Skid verstand den Dialekt der Amischen nicht, was in dem Fall völlig unwichtig war, so verängstigt wie der Kerl schien. Ganz egal, was hier vor sich ging, er durfte diesen abgedrehten Typen keinesfalls näher kommen lassen. Wer wusste schon, ob er auf Crack war oder irgendwo ein Messer einstecken hatte. »Rühren Sie sich nicht vom Fleck, Kumpel. Und die Hände bleiben da, wo ich sie sehen kann.«
Der Mann hob die Hände. Er zitterte noch immer, was selbst aus zwei Metern Entfernung nicht zu übersehen war. Seine Brust hob und senkte sich, und es waren Tränen – kein Schweiß –, die auf seinen Wangen glänzten. »Wie heißen Sie?«, fragte Skid.
»Reuben Zimmerman!«, stieß er hervor.
Angst und Entsetzen standen ihm ins Gesicht geschrieben. Sein Mund bewegte sich, aber es kamen keine Worte heraus.
»Beruhigen Sie sich, Sir. Erzählen Sie mir, was passiert ist.«
Zimmerman zeigte zum Farmhaus, wobei seine Hand flatterte wie eine Fahne im Wind. »Amos Plank. Die Kinder. Da ist überall Blut. Sie sind tot!«
Der Typ war bestimmt verrückt. »Wie viele Leute?«
»Ich weiß es nicht. Ich hab … Amos und die Jungen gesehen. Auf dem Fußboden. Tot. Ich bin weggelaufen.«
»Sonst haben Sie niemanden gesehen?«
»Nein.«
Skid blickte zum Farmhaus. Es lag still da, alle Fenster waren dunkel. Er drückte auf sein Ansteckmikrophon. »Mona, ich hab vielleicht ein 10–16 hier.« 10–16 stand für häusliche Gewalt. »Ich sehe mir das mal an.«
»Meinst du die Planks?«
»Korrekt.«
»Soll ich das Sheriffbüro anrufen, dass sie einen Deputy schicken?«
»Ich guck mir das erst mal selber an. Kannst du Reuben Zimmerman durch LEADS laufen lassen?« LEADS war die Abkürzung für eine Datenbank der Polizeibehörden, in der alle noch nicht vollzogenen Haftbefehle aufgelistet waren.
»Verstanden.« Im Hintergrund hörte er das Klappern einer Tastatur. »Sei vorsichtig, ja?«, sagte Mona.
»Klar.«
Skid wollte so schnell wie möglich zum Haus und forderte den Mann auf, die Hände wieder auf den Wagen zu legen.
Zimmerman wirkte irritiert. »Ich hab nichts Verbotenes gemacht.«
»Das ist Vorschrift. Ich taste Sie ab, und die Handschellen sind zu Ihrem und zu meinem Schutz. Okay?«
Als wäre ihm klar, dass er keine Wahl hatte, drehte Zimmerman sich um und stützte die Hände auf den Streifenwagen. Skid tastete ihn rasch ab, Taschen, Socken und sogar zwischen den Beinen. Dann legte er ihm die Handschellen an. »Was machen Sie um diese Uhrzeit hier draußen?«
»Ich helfe beim Melken. Die Arbeit fängt um vier Uhr an.«
»Und ich dachte immer, meine Arbeitszeit wäre beschissen.«
Der Mann sah ihn verwirrt an.
»Vergessen Sie’s.« Skid öffnete die hintere Wagentür und ließ ihn einsteigen. »Auf geht’s.«
Er selbst glitt hinters Steuer, startete den Motor und fuhr los. Im Rückspiegel sah er Staub aufwirbeln, der im Schein des Rücklichts rot leuchtete, und vor ihm zeichneten sich die Umrisse des massiven Farmhauses und Getreidesilos in der einsetzenden Morgendämmerung ab. Von dieser Bilderbuchfarm hätte Skid nun wirklich keine Probleme erwartet. Er lebte schon seit vier Jahren in Painter’s Mill, und abgesehen von ein paar unbedeutenden Ordnungswidrigkeiten – einmal hatten sich zwei Jungen mit ihren Buggys auf der Hauptstraße ein Rennen geliefert –, waren die Amischen nahezu perfekte Bürger. Aber Skid war schon lange genug Polizist, um zu wissen, dass es für jede Regel auch Ausnahmen gab.
Vor dem Haus parkte er hinter dem Buggy, wobei sein Scheinwerfer das »Langsam fahrendes Vehikel«-Schild anleuchtete. Das Wohngebäude zu seiner Rechten lag im Dunkeln, und es sah nicht so aus, als wäre schon jemand darin aufgestanden. Er wandte sich Zimmerman zu. »Wie sind Sie reingekommen?«
»Die Hintertür ist nicht abgeschlossen«, antwortete er.
Skid griff sich die Stablampe und stieg aus. Auf dem Weg holte er seine .38er aus dem Holster. Auf der hinteren Veranda klopfte er mit der MagLite an die Tür. »Hier ist die Polizei«, rief er. »Machen Sie auf.«
In dem Moment fiel sein Blick auf die dunkle Schmiere am Türknauf. Er richtete den Strahl der Lampe darauf. Es sah aus wie Blut. Ein Handabdruck. Skid leuchtete über die Veranda. Da war noch mehr Blut. Dunkle Tropfen glänzten im Schein des Mondes. Auf den Stufen führten blutige Fußspuren hinunter zum Gehweg, der zur Scheune führte.
»Mist!« Skid drehte den Knauf und stieß die Tür auf. Mit klopfendem Herzen betrat er die Küche. Adrenalin durchflutete seinen Körper, und die Adern unter der Haut pulsierten wie Gleichstrom. »Hier ist die Polizei«, rief er wieder. »Mr und Mrs Plank?«
Das Haus war so still und dunkel wie ein Film aus den zwanziger Jahren. Skid wünschte, es gäbe irgendwo einen Lichtschalter, und verfluchte die Ablehnung der Amisch-Leute von modernem Komfort. Graues Mondlicht fiel durch das Fenster über der Spüle, ließ einfache Holzschränke und einen Tisch mit blauweiß karierter Decke erkennen, in dessen Mitte eine dunkle Laterne stand.
»Hallo? Hier ist die Polizei. Ist jemand zu Hause?« Auf halbem Weg durch die Küche bemerkte er den unangenehmen Geruch, der aber nicht an vergammelte Lebensmittel, Müll oder Haustiere erinnerte, sondern an ein verstopftes Klo.
Skid betrat das Wohnzimmer. Hier war der Gestank noch intensiver. Ein kalter Schauder lief ihm über den Rücken, als der Strahl seiner Taschenlampe auf eine Männergestalt fiel. Ein Amischer in blauem Arbeitshemd, Hosen mit Hosenträgern, auf dem Bauch liegend, der zur Seite gedrehte Kopf in einer tellergroßen Blutlache.
»Verdammte Scheiße.«
Skid starrte den Mann wie gebannt an. Er hatte eine große Wunde am Hinterkopf, Blut sickerte von seinem linken Ohr in den Vollbart und tropfte weiter in die Lache auf dem Boden. Seine blutige Zunge hing aus dem offenen Mund wie eine fette Schnecke.
Er hoffte, dass Zimmerman sich in der Anzahl der Opfer geirrt hatte und dort hinten auf dem Boden Wäsche zum Flicken lag; oder Futterbeutel, die jemand aus der Scheune hereingeholt hatte. Doch die Hoffnung wurde zunichtegemacht, als im Schein der Lampe zwei weitere leblose Körper sichtbar wurden. Ein Halbwüchsiger, der schwarze Hosen mit Hosenträgern trug. Und ein kleiner, rothaariger Junge, der in einer so großen Lache Blutes lag, dass sie unmöglich aus diesem schmächtigen Kinderkörper stammen konnte. Beiden hatte man in den Hinterkopf geschossen. Beiden hatte man die Hände auf dem Rücken zusammengebunden. Skid sah sofort, dass sie tot waren, das musste er nicht noch überprüfen.
Er war schon seit fast zehn Jahren Polizist, zuerst in Ann Arbor, Michigan, und jetzt hier in Painter’s Mill. Er hatte schon einige Tote gesehen, bei Autounfällen, Schusswechseln oder Messerstechereien. Doch nichts hatte ihn auf diesen Anblick hier vorbereitet.
»Großer Gott.« Er tastete nach seinem Ansteckmikrophon, überrascht, wie sehr seine Hand zitterte. »Mona, ich bin im Farmhaus der Planks. Ruf den Chief an. Sag ihr, hier hat’s ein Blutbad gegeben, mit mehreren Toten. Alle erschossen.« Seine Stimme versagte. »Scheiße.«
»Brauchst du einen Krankenwagen?«
Er sah in die starren Augen und auf die riesige Blutlache und wusste, dass er den Anblick so schnell nicht vergessen würde. »Schick nur den Coroner, Mona. Für die hier kommt jede Hilfe zu spät.«
2. KAPITEL
Ich befinde mich in dem eigenartigen Zustand zwischen Schlafen und Aufwachen, als auf dem Nachttisch das Telefon klingelt. Bei meinem letzten Blick auf den Wecker war es kurz nach drei, jetzt zeigen die roten Leuchtziffern vier Uhr dreißig an, und ich schätze mich glücklich, eineinhalb Stunden am Stück geschlafen zu haben. »Burkholder«, melde ich mich mit rauer Stimme.
»Chief, hier ist Mona. Skid meldet, dass draußen auf der Plank-Farm geschossen wurde.« Ihre Worte lassen mich hochfahren. »Gibt’s Verletzte?« Wahrscheinlich hat jemand sein Gewehr gereinigt und sich dabei versehentlich in den Fuß geballert.
»Laut Skid gibt es mehrere Tote.«
Mehrere Tote.
Im ersten Moment glaube ich, mich verhört zu haben. Dann nimmt mein Hirn seine Arbeit auf, und ich springe aus dem Bett. »Hat er den Schützen erwischt?«
»Ich weiß es nicht. Skid klang ziemlich durcheinander.«
Vier Officer gehören zu meinem kleinen Polizeirevier, und von ihnen ist Skid einer der erfahrensten. Da er zudem weder der Sensibelste noch schnell aus der Fassung zu bringen ist, muss etwas Schlimmes passiert sein. »Schicken Sie einen Krankenwagen hin, okay?«
»Klar. Und ich gebe Doc Coblentz Bescheid.«
»Gut.« Dr. Ludwig Coblentz ist der hiesige Kinderarzt und der für Holmes County zuständige Coroner. »Sagen Sie ihm, wir treffen uns auf der Farm.«
Während ich im Kleiderschrank meine Uniform vom Bügel zerre, versuche ich, die wenigen Informationen zu sortieren. Die Planks sind Amische. Ich weiß, dass viele amische Familien Gewehre zum Jagen oder auch zum Töten von Schlachtvieh besitzen. Sie sind eine friedfertige, pazifistische Gemeinschaft; Gewaltverbrechen sind selten. Es will mir nicht in den Kopf, dass es dort mehrere Tote geben soll. Vielleicht, weil das meine Unfalltheorie zunichtemachen würde.
Painter’s Mill ist eine kleine Stadt im Herzen des ländlichen Ohio. Ungefähr ein Drittel der fünftausenddreihundert Einwohner gehören der Amisch-Gemeinde an. Auch ich wurde vor etwas über dreißig Jahren in dieser Stadt als Amische geboren. Doch im Unterschied zu den etwa achtzig Prozent der amischen Jugendlichen, die mit achtzehn ihrer Glaubensgemeinschaft beitreten, habe ich mich nicht taufen lassen. Aber familiäre Wurzeln sitzen tief, besonders die der Amischen, und so haben mich diese Wurzeln wieder hierher zurückgebracht.
Seit fast drei Jahren bin ich jetzt Polizeichefin in diesem Ort. Der Job gefällt mir. In Painter’s Mill kann man gut leben, es ist ein angenehmer Ort, um eine Familie zu gründen und Kinder aufzuziehen. Ich würde gerne glauben, dass es hier keine schlimmen Verbrechen gibt, doch die Vergangenheit hat gezeigt, dass selbst idyllische Kleinstädte nicht immun gegen Gewalt sind.
Ich kenne die meisten Familien hier, sowohl die amischen als auch die »englischen«, wie die Amischen alle Nicht-Amischen nennen. Ich spreche fließend Pennsylvaniadeutsch, den amischen Dialekt. Und obwohl ich nicht mehr dem Grundsatz der Gelassenheit folge – die Maxime aller amischen Werte –, habe ich großen Respekt vor ihrer Kultur. Dieser Respekt rührt aus einem tiefen Verständnis nicht nur für die Menschen, sondern auch für das schlichte Leben als solches sowie deren Religion, das wesentliche Element, das beide zusammenführt.
Auf der Fahrt zur Farm wird mir bewusst, dass ich kaum etwas über Bonnie oder Amos Plank weiß. Ich krame in meinem Gedächtnis und erinnere mich, dass sie erst vor etwa einem Jahr aus Lancaster County hierhergezogen und somit neu in der Gegend sind. Sie haben mehrere Kinder und betreiben einen kleinen Laden mit Milchprodukten. Als ich auf die Schotterstraße biege, frage ich mich, welche Probleme sie wohl aus ihrem früheren Wohnort in Pennsylvania mit hierhergebracht haben.
Skids Streifenwagen steht hinter einem Buggy. Das eingeschaltete Blaulicht flackert über Haus und Nebengebäude und lässt den Eindruck eines bizarren Rock-Videos entstehen. Ich nehme meine MagLite, steige aus, ziehe meine .38er und gehe zur Hintertür. Dabei offenbart der Strahl meiner Lampe glänzend schwarze Tropfen auf Gehweg und Veranda, und ein Hauch von Unbehagen überfällt mich, als ich einen blutigen Handabdruck am Türrahmen erkenne. Ich stoße die Tür auf und trete in eine große Küche.
Durch das Fenster über der Spüle fällt Mondlicht herein, doch es reicht nicht aus, um das Dunkel zu durchdringen. »Skid!«, rufe ich laut.
»Ich bin hier!«
Beim Durchqueren der Küche steigt mir der Geruch von Blut in die Nase. Ich gehe durch die Tür in das angrenzende Zimmer. Als Erstes sehe ich das gelbweiße Licht von Skids Taschenlampe. Das Zimmer ist groß, und durch die zwei hohen, schmalen Fenster auf der gegenüberliegenden Seite fällt schwaches Licht. Langsam beschreibe ich mit dem Strahl meiner Lampe einen Kreis. »Was ist passiert?«
Noch während ich die Frage stelle, trifft mein Lichtkegel auf die erste Leiche. Ein Mann mittleren Alters liegt mitten im Raum.
»Da drüben sind noch zwei.« Skids Stimme scheint von weither zu kommen.
Ich gebiete meiner Hand, nicht zu zittern, als der Strahl meiner Lampe auf zwei weitere Tote trifft. Ungläubig kneife ich die Augen zusammen, als mir klar wird, dass es sich um Kinder handelt. Der Erste ist ein Junge im Teenageralter, mit schlaksigen Armen und Beinen und schlechtem Haarschnitt. Er liegt ausgestreckt da, in einem verblichenen Arbeitshemd, Hosen, die wegen eines Wachstumsschubs etwas zu kurz sind, und den obligatorischen Hosenträgern. Seine Hände sind auf dem Rücken zusammengebunden, der Hinterkopf ist blutverschmiert.
Kaum einen Meter weiter liegt ein kleinerer Junge auf der Seite, in einem Meer aus Blut, das den selbstgemachten kleinen Flickenteppich durchtränkt hat. Ich schätze ihn auf neun oder zehn. Er trägt ein Nachthemd. Auch seine Hände sind zusammengebunden. Seine Fußsohlen sind schmutzig, bestimmt ist er noch vor wenigen Stunden barfuß und unbekümmert durchs Haus gelaufen. Die verschleierten Augen scheinen mich aus dem blassen, ovalen Gesicht direkt anzustarren. Das Blut auf seiner Wange deutet darauf hin, dass die Kugel aus dem Mund wieder rausgekommen ist, seine Lippen zerfetzt und mehrere Zähne abgebrochen hat.
Es ist eine surreale Szene, und einige Herzschläge lang weigert sich mein Hirn, den Anblick zu verarbeiten. Das Entsetzen wütet in meinem Kopf wie ein wilder Bock. Tote Kinder, denke ich und bebe innerlich vor Empörung. Das Bedürfnis, zu ihnen zu gehen und Wiederbelebungsmaßnahmen durchzuführen, sie zu retten, ist gewaltig. Aber ich weiß, hier kommt jede Hilfe zu spät. Und das Letzte, was ich jetzt will, ist, den Tatort zu kontaminieren.
Ich leuchte mit der Taschenlampe wieder zu dem Erwachsenen. Ein Loch so groß wie meine Faust entstellt seinen Kopf, und ich erkenne Knochensplitter, Hirnmasse und Blut. Austrittswunde, denke ich, und weiß, dass er von vorn erschossen wurde.
»Haben Sie alle auf Lebenszeichen überprüft?«, höre ich mich fragen.
Skids Silhouette zeichnet sich vor dem Fenster ab. Selbst im Dunkeln sehe ich, wie er nickt. »Ich habe den Puls gefühlt. Sie waren schon tot, als ich ankam.«
In dem Moment wird mir klar, dass der Mistkerl, der das hier verbrochen hat, noch im Haus sein könnte. »Haben Sie das Haus gecheckt?«
»Noch nicht.«
Ich aktiviere mein Funkgerät. »Hier 235. Mona, ich bin 10–23.«
»Was ist da draußen los, Chief?«
»Rufen Sie Glock und Pickles zu Hause an. Sie sollen sofort herkommen.«
»Verstanden«, sagt Mona.
»Benutzen Sie das Handy, es könnte sein, dass irgendein Schlafloser den Polizeifunk abhört. Sagen Sie Glock, wir brauchen einen Stromgenerator und Arbeitslampen, okay?«
»Wird gemacht, Chief.«
Ich sehe Skid an. »Checken wir das Haus.«
Ich gehe zum Flur, gefolgt von Skid, der mir den Rücken deckt. Lautlos schleichen wir über den Holzboden zu den Schlafzimmern, wobei ich mich frage, ob wir da noch mehr Opfer finden werden. Ob vielleicht jemand überlebt hat. Und was für ein Monster unschuldige Kinder tötet …
Vor dem Badezimmer mache ich halt, schiebe die Tür mit dem Fuß auf und gehe, die .38er im Anschlag, in die Hocke. Ich leuchte zuerst den Boden ab, dann gleitet der Lichtstrahl über eine altmodische, freistehende Badewanne, ein kleines, verriegeltes Fenster und ein Porzellanwaschbecken. »Sauber.«
Ich drehe um und folge Skid den Flur entlang. Diesmal gebe ich ihm Rückendeckung. Er schlüpft ins erste Schlafzimmer, ich folge ihm dichtauf, alle Sinne auf die Umgebung konzentriert. Hier stehen zwei Einzelbetten, eine Kommode. Die beiden Fenster sind verschlossen. In der Ecke liegen ein Paar Schlittschuhe. Skid hebt die Waffe, reißt die Tür des begehbaren Schranks auf, und ich schnelle hinein. Leer. Ich trete vors Bett, knie mich hin und sehe darunter.
»Niemand hier«, sagt Skid.
»Wir sehen oben nach.«
»Gibt’s einen Keller?«, fragt er.
»Keine Ahnung. Wahrscheinlich.«
Nach zehn Minuten haben wir das ganze Haus gecheckt, einschließlich des Kellers, der Schlafzimmer im ersten Stock und des kleinen Dachbodens. Ich arbeite gern mit Skid zusammen, kann mich auf seinen Polizeiinstinkt verlassen; wir sind ein gutes Team. Doch letztlich ist unsere Mühe vergeblich, im Haus ist niemand mehr.
Wir gehen zurück ins Wohnzimmer, bleiben einen Moment lang schweigend stehen. Wir vermeiden es, auf die Leichen zu schauen, und ich glaube, dass wir beide versuchen, mit der ungeheuren Brutalität des Verbrechens klarzukommen.
»Was glauben Sie, ist hier passiert?«, fragt Skid schließlich.
»Schwer zu sagen.« Ich blicke auf den toten Jungen zu meinen Füßen. So jung und unschuldig. Ich sehe zum Vater, und erst jetzt registriere ich, dass seine Hände nicht gefesselt sind. Doch als Polizistin weiß ich, dass der erste Eindruck oft trügt. In eingefahrenen Mustern zu denken ist gefährlich, wenn man einen Tatort betritt, weshalb ich stets versuche, keine vorschnellen Schlüsse zu ziehen. Trotzdem frage ich mich beim Anblick des toten Mannes unwillkürlich: Warum sind seine Hände nicht auch gefesselt?
»Haben Sie eine Waffe gefunden?«, frage ich.
»Dort drüben liegt eine Pistole.«
Mein Blick folgt dem Strahl seiner Taschenlampe. Unter der rechten Hand des Mannes guckt tatsächlich der blaue Lauf einer halbautomatischen Pistole hervor. »Könnte eine Beretta sein.«
»Ich wusste nicht, dass Amische Waffen besitzen.«
»Das ist auch eher die Ausnahme. Und wenn, dann höchstens Gewehre, zum Jagen«, erwidere ich, »keinesfalls eine Halbautomatik.«
»Seine Hände sind nicht gefesselt«, bemerkt Skid.
»Das Loch in seinem Hinterkopf sieht aus wie eine Austrittswunde.«
Unsere Blicke begegnen sich. »Glauben Sie, er hat das getan?«
Ich will mir diesen furchtbaren Verdacht nicht eingestehen. Dass der Mann durchgedreht ist, seine beiden Söhne getötet und dann sich selbst erschossen hat. Solch ein Szenario läuft allen Überzeugungen der Amischen zuwider. Ich weiß, das ist eine Verallgemeinerung, aber Morde sind extrem selten in einer amischen Gemeinde. Ebenso Selbstmord. Es ist die einzige Sünde, für die es keine Vergebung gibt.
»Ich weiß es nicht«, antworte ich und blicke mich um. »Irgendein Hinweis auf die Mutter?«
»Nein.«
»Ich glaube, sie haben noch mehr Kinder«, sage ich. »Mädchen.« Mir fallen die blutigen Abdrücke an der Hintertür ein, und mir wird ganz mulmig bei den Gedanken, die sich jetzt in meinen Kopf schleichen. »Kommen Sie, wir überprüfen den Hof und die Nebengebäude.«
Im günstigsten Fall haben sich die Mutter und ihre Töchter versteckt und sind total verängstigt – leben aber. Der Knoten in meinem Bauch sagt mir, dass diese Hoffnung sehr optimistisch ist.
Mit immer noch gezückten Waffen gehen wir durch die Küche zur Hintertür hinaus, werfen einen kurzen Blick auf die blutigen Abdrücke am Türrahmen.
»Könnten von einer Frau stammen«, bemerkt Skid.
»Oder von einem Teenager. Wenn mich die Erinnerung nicht trügt, sind die beiden Mädchen Halbwüchsige.«
Der Strahl seiner Taschenlampe fällt auf Blutstropfen und einen blutigen Schuhabdruck auf dem Beton. »Sieht aus, als wäre jemand aus dem Haus gerannt.«
»Richtung Scheune.«
Nach den dunklen Räumen kommt mir das Mondlicht übermäßig hell vor. Mein Schatten folgt mir auf dem Gehweg. Wir sind ungefähr zehn Yards gegangen, als ich die Gestalt am Boden sehe. Eine erwachsene Frau in einem schlichten Kleid mit Schürze und der weißen Kappe liegt bäuchlings im Gras. Doch richtig aus der Fassung bringt mich erst der Säugling in ihrem Arm.
»Gütiger Gott.« Skid fährt sich mit der Hand übers Gesicht. »Ein Baby!«
Die graue Haut und die glasigen Augen lassen keinen Zweifel, dass Mutter und Kind tot sind. Blut klebt im Gras wie ausgelaufenes Motorenöl. Auf der Schulter der Frau erkenne ich ein Loch so groß wie eine Zehn-Cent-Münze im Stoff. »Sieht aus, als wäre die Kugel direkt durch sie hindurch ins Baby eingedrungen.«
»Schuss in den Rücken.«
»Während sie weglief.«
»Chief, wer zum Teufel macht so was?«
»Ein Ungeheuer.« Unsere Blicke treffen sich, und ich hoffe, meiner verrät nicht die dunklen Gefühle, die in mir wüten. Ich deute zur Scheune. »Hoffen wir, dass noch jemand lebt und uns alles erzählen kann.«
Die Scheune ist ein massives Steingebäude mit rostigem Wellblechdach. Eine Kuppel mit Wetterfahne ragt zwei Stockwerke hoch in den Nachthimmel. Die sechs schmalen Fenster darunter muten wie alte, traurige Augen an. Es ist eine der vielen Scheunen in dieser Gegend, die weit über hundert Jahre alt sind.
Skid und ich gehen schweigend den Weg entlang. Das Zirpen der Grillen scheint mir ungewöhnlich laut, doch nur, weil meine Sinne übernatürlich geschärft sind. Irgendwo in der Nähe brüllen Kühe. Da ich so manchen Morgen kurz vor der Dämmerung mit Melken verbracht habe, kenne ich den dringlichen Laut. Die Euter der Tiere sind voll, sie warten darauf, gemolken zu werden.
Ich erreiche die Scheune und schiebe die Tür mit dem Fuß auf. »Nach Möglichkeit nichts berühren«, flüstere ich.
Die Scharniere quietschen. Der erdige Geruch von Vieh, Heu und Mist schlägt mir entgegen. In der Scheune ist es stockfinster. Mit der MagLite in der linken und der Waffe in der rechten Hand trete ich ein und leuchte blitzschnell um mich herum. Skid ist hinter mir, der Strahl seiner Taschenlampe durchschneidet das Dunkel zu meiner Linken. Sein Atem geht heftig.
»Hier ist die Polizei!«, rufe ich. »Kommen Sie mit erhobenen Händen raus! Sofort!«
Wir gehen tiefer in die Scheune hinein. Das Rauschen des Blutes in meinen Adern ist ohrenbetäubend. Wenn sich jetzt jemand von hinten anschliche, würde ich ihn nicht einmal hören. Als sich vor mir etwas bewegt, fahre ich beinahe aus der Haut. Ich hebe den Arm mit der Waffe, den Finger am Abzug. Mein Hirn braucht ein paar Sekunden, um den Anblick von einem Dutzend Jerseykühen zu verarbeiten, die in ihren Verschlägen stehen und darauf warten, gemolken zu werden.
»Nur gut, dass ich nicht auf die Kuh geschossen hab«, murmele ich.
»Ein bisschen Licht wär nicht schlecht.«
»Wahrscheinlich gibt’s hier irgendwo eine Laterne.«
Zu meiner Linken erkenne ich Viehställe, weiter vorn ist der Melkbereich. Der Gestank von saurer Milch, typisch in Molkereibetrieben, steigt mir in die Nase. Mein Blick fällt auf den Stein- und Betonboden mit den Melkständen und Futterraufen. Obwohl viele Amische inzwischen moderne, mit Diesel oder Benzin betriebene Melkmaschinen verwenden, sehe ich nichts dergleichen hier. Die Planks melken offensichtlich noch mit der Hand.
Ich suche Skids Blick und bedeute ihm, nach links zu gehen. Ich wende mich nach rechts auf einen breiten Gang aus Lehm. Vor mir liegt ein großer Bereich mit landwirtschaftlichen Geräten. Ich erkenne einen Pflug mit Stahlrädern und Scharblättern, die nach dem Zufallsprinzip arbeiten, einen Buggy, dem ein Rad fehlt und der mit einem Wagenheber aufgebockt ist. Durch das Fenster fällt Mondlicht auf einen eingestaubten Gülleverteiler. Rechts von mir befindet sich eine geschlossene Tür. Da sie nahe den Pferdeboxen und Geräten ist, vermute ich, dass sich dahinter die Sattelkammer befindet, wo Pferdegeschirre, Tierpflegematerialien, Halfter und Tiermedizin gelagert werden. Hier bewegt sich nichts, also gehe ich hinüber zur Tür, drehe am Knauf und stoße sie auf.
Der Strahl meiner Lampe fällt in einen großen Raum mit grobbehauenen Wänden und einem Holzboden. Die hohe Decke wird von Balken getragen, die so breit wie Männerhüften sind. Als mein Blick auf das Mädchen fällt, fährt mir der Schreck durch alle Glieder. Instinktiv hebe ich die Waffe. Auf den ersten Blick scheint es, als hätte sie die Arme über dem Kopf ausgestreckt, doch dann sehe ich die gefesselten Handgelenke, die an einem Balken über ihr angebunden sind.
Eine Sekunde lang bin ich so schockiert, dass ich erstarre, nicht sprechen oder denken kann. Dann meldet sich die Polizistin zurück und hämmert die grauenvollen Details des Anblicks in mein Hirn. Das Opfer ist jung und weiblich. Nackt, bis auf die Kappe. Den Kopf nach vorne geneigt, so dass ihr Kinn auf der Brust liegt, ist sie mit den Händen am Deckenbalken angebunden. Ihre Knie sind eingeknickt, doch der Strick hält sie aufrecht.
»Mein Gott«, höre ich mich sagen.
Ich leuchte mit der Taschenlampe den Rest des Raumes ab und schnappe nach Luft, als der Strahl auf das zweite Opfer fällt. Ebenfalls weiblich, etwas älter. Ebenfalls nackt bis auf die Kappe. Und wie das andere Mädchen hängt auch sie an einem Deckenbalken.
Im Laufe meiner Polizeiarbeit bin ich schon öfter mit dem Tod konfrontiert worden, als mir lieb ist. Ich habe furchtbare Verkehrsunfälle gesehen, Menschen, die einen Herzschlag oder Schlaganfall erlitten haben, und erst vor zwei Monaten gab es da diesen Mann, der in Miller’s Pond ertrunken war. Ich habe auch schon Mordopfer gesehen, die grauenvoll zugerichtet waren. Doch das hier ist auch für eine erfahrene Polizeichefin zu viel.
Mit zittriger Hand taste ich nach meinem Ansteckmikrophon. »Skid … hier sind noch zwei.«
»Wo sind Sie?«
»In der Sattelkammer. Gleich rechts am Gang.«
»Bin unterwegs.«
Ich leuchte wieder das erste Opfer an, kann jetzt das Blut riechen, dunkel und metallisch. Ich bin nicht übermäßig empfindlich, doch als ich näher herantrete, rebelliert mein Magen. Ich will mir nicht vorstellen, was hier passiert ist, will nicht daran denken, was für Qualen diese Mädchen erlitten haben.
»O Mann.«
Bei Skids Worten fällt mir fast die MagLite aus der Hand. Ich drehe mich um und sehe ihn in der Tür stehen. Den Revolver in der rechten Hand und die Taschenlampe in der linken, ist sein Blick auf die beiden Leichen geheftet.
»Großer Gott, Chief.« Er kommt näher, die Stimme kaum mehr als ein Flüstern. »Was zum Teufel ist hier nur geschehen?«
Normalerweise lässt Skid sich nicht so schnell aus der Fassung bringen. Er gehört eher zur großspurigen Sorte und ist selbst bei unappetitlichen Polizeiaufgaben nicht sehr empfindlich, hat einen trockenen Humor und eine schnelle Auffassungsgabe. Doch angesichts dieses Blutbades fällt seine schnoddrige Fassade in sich zusammen. Sein Gesichtsausdruck spiegelt das gleiche Entsetzen und die Ungläubigkeit, die auch mich beherrschen.
Er tritt näher zu mir heran.
»Denken Sie an mögliche Fußabdrücke«, erinnere ich ihn.
Er leuchtet den Holzboden ab, nach rechts und nach links. Der Strahl meiner Lampe taucht die Leiche in ein furchtbar helles Licht. Dutzende Blutergüsse, Prellungen und Abschürfungen übersäen den Oberkörper, die Arme und Beine des toten Mädchens. Manche Hautstellen sind feuerrot, andere fast schwarz. Irgendwann hat sie sich übergeben, der saure Geruch hängt noch in der Luft.
»Ich habe einen Schuhabdruck«, ruft Skid.
»Kennzeichnen Sie ihn«, antworte ich, ohne den Blick von der Leiche zu wenden. »Sieht aus, als wären sie gefoltert worden.«
»Man hat sie gefesselt und sich dann an ihnen ausgetobt«, sagt Skid einen Moment später.
Er senkt die Hand mit der Taschenlampe, und in dem Sekundenbruchteil sehe ich zwei kleine Markierungen auf dem Boden. »Moment«, sage ich. »Was ist das?«
Ich gehe daneben in die Hocke und stelle bei näherer Betrachtung fest, dass es insgesamt drei Markierungen sind. In der dünnen Staubschicht sehen sie wie Kratzer aus und würden miteinander verbunden ein gleichschenkliges Dreieck ergeben.
»Was verdammt ist das?«, flüstert Skid verdutzt.
»Kennzeichnen Sie es, ja?«
»Sicher.«
»Und halten Sie nach weiteren Schuhabdrücken Ausschau.«
»Mach ich.«
Ich leuchte den Raum ab. Kaum einen Meter von mir entfernt liegen ordentlich nebeneinander auf einer Werkbank eine Propan-Lötlampe, ein kleiner Holzknüppel, ein blutverschmiertes Messer und ein dreißig Zentimeter langes, spießähnliches Instrument. Keine Dinge, die man normalerweise in einer amischen Scheune findet. Wer immer hier gewütet hat, hat sie zurückgelassen. »Vielleicht finden wir ein paar Fingerabdrücke auf diesen … Werkzeugen.«
»Ja.« Skids Lichtstrahl trifft auf meinen, und er gibt einen angewiderten Laut von sich. »Wie zum Teufel konnte jemand so was machen? Zwei amische Mädchen, verflucht nochmal.«
Darauf habe ich keine Antwort. Nicht einmal Worte. Einen Moment lang sind nur die unruhigen Kühe am Ende des Ganges und das gedämpfte Zirpen der Grillen zu hören.
»Glauben Sie, der Vater hat das getan?«, fragt Skid.
In seiner Stimme schwingen Zweifel mit, und ich schüttele den Kopf, weil ich es mir auch nicht vorstellen kann. »Ich weiß es nicht«, sage ich trotzdem.
Er richtet den Strahl wieder auf eines der Opfer. »Wurden sie auch erschossen?«, fragt er. »Oder erstochen?«
Ich atme tief durch und leuchte das Opfer in meiner Nähe an. Bleiches Fleisch voller Blut. Mein Lichtstrahl verharrt auf einem schwarzen, klaffenden Loch kurz unterhalb des Nabels.
»Was verdammt ist das denn?«, höre ich Skids Stimme hinter mir.
»Messerwunde?« Meine Stimme ist gefasst, doch meine Hand mit der Lampe zittert wegen des Brechreizes, der meinen Körper schüttelt.
»Gütiger Gott. Sieht aus, als hätte er sie aufgeschnitten.«
Ich leuchte ein Stück nach unten. Alles ist voller Blut, im Schamhaar teilweise verkrustet, dunkle Rinnsale auf der Innenseite der Beine. Ein Einschussloch sehe ich nicht. Im Stillen frage ich mich, ob sie noch gelebt hat, als ihr das angetan wurde.
Diese grauenvolle Vorstellung macht mich krank, trifft mich so fundamental, dass mir kurz die Luft wegbleibt. Ich habe nicht nah am Wasser gebaut, doch jetzt brennen Tränen in meinen Augen.
»Chief, alles okay?«
Ich unterdrücke den Schrei, der in mir wütet und aus mir herausbrechen will. Eine ganze Minute lang bleibe ich die Antwort schuldig. Als ich schließlich wieder sprechen kann, ist meine Stimme ruhig. »Rufen Sie noch mal Glock und Pickles an. Sagen Sie, wir brauchen die Lichter und den Generator gestern.«
»Ja, Ma’am.«
»Mona soll das Sheriffbüro informieren, damit sie ein paar Streifenwagen losschicken. Und sie soll T. J. Bescheid sagen, er kann auch Streife fahren. Solange wir noch nicht genau wissen, was passiert ist, müssen wir davon ausgehen, dass da draußen ein kaltblütiger Mörder mit einer Schusswaffe rumläuft.«
Während Skid meine Instruktionen über Funk weitergibt, blicke ich auf die beiden toten Mädchen, verspüre das drückende Gewicht der Verantwortung auf meinen Schultern, ihnen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Ich habe altgediente Polizisten von Fällen erzählen hören, die ihr Leben verändert und sie noch verfolgt haben, nachdem sie längst abgeschlossen waren. Auch ich hatte schon Fälle, die mich grundlegend verändert haben – meine Haltung gegenüber Menschen, meine Arbeitsauffassung als Polizistin. Und wie ich mich selbst sehe.
Ich stehe da, den Geruch von Tod in der Nase, und weiß, das hier wird einer dieser Fälle sein. Der mir viel abverlangt. Und nicht nur mir, sondern der ganzen Stadt, die ich lieben gelernt habe, und einer Gemeinde, die schon mehr als genug Gewalt erlebt hat.
3. KAPITEL
Ich stehe auf der hinteren Veranda und paffe die von Skid geschnorrte Marlboro, als mit flackerndem Blaulicht und heulender Sirene ein Streifenwagen mit kleinem Anhänger den Weg entlangkommt. Er bleibt hinter meinem Explorer stehen, wobei er eine Staubwolke aufwirbelt, die abwechselnd blau und rot leuchtet und die Szene noch surrealer macht, als sie schon ist.
Rupert »Glock« Maddox steigt aus, geht zum Anhänger, öffnet die zweiflüglige Hintertür und zieht eine kleine Rampe heraus. Glock ist ein ehemaliger Marine-Soldat und hat die zweifelhafte Ehre, der erste afro-amerikanische Polizist in Painter’s Mill zu sein. Er besitzt die Statur eines jungen Arnold Schwarzenegger, kann einem Murmeltier die Fellhaare wegschießen und ist einer der besten Polizisten, mit denen ich je das Vergnügen hatte zu arbeiten. Als ich zu ihm gehe, hoffe ich, dass sein unerschütterliches Wesen meinem inneren Tumult beruhigend entgegenwirkt.
Nachdem er den dieselbetriebenen Generator die Rampe hinuntergerollt hat, sieht er in meine Richtung. Unter normalen Umständen würde er mir wegen der Zigarette die Hölle heißmachen. Und wenn das hier kein Tatort wäre, hätte ich sie wahrscheinlich heimlich verschwinden lassen. Aber wir beide werden in den nächsten Stunden zu beschäftigt sein, um etwas so Profanes zu thematisieren.
»Muss schlimm sein, wenn Sie rauchen«, sagt er.
»Sehr schlimm.« Die Worte kommen mir wie eine obszöne Untertreibung vor.
»Ich wäre schon früher hier gewesen, aber ich musste noch den Generator und die Lampen holen.«
»Kein Problem.« Ein Seufzer entfährt mir. »Von denen hier geht keiner mehr weg.«
»Haben Sie den Schützen?«
»Ich weiß noch nicht einmal, womit wir es hier zu tun haben.«
Ich werfe den Zigarettenstummel auf den Boden und zermalme ihn mit dem Stiefel, wobei Glock mich etwas zu genau fixiert.
»Könnte ein Mord-Selbstmord sein«, füge ich erklärend hinzu.
»Mist.«
Ich zeige auf den Generator.
»Kümmern Sie sich ums Licht, ja?« Ich mache mich auf zu Skids Streifenwagen. »Ich rede mit dem Zeugen.«
Ich bin Reuben Zimmerman in den letzten Jahren mehrere Male auf der Straße begegnet. Er ist ein ruhiger, ernster Mann und einer der wenigen Amischen, die ich kenne, der keine Kinder hat. Er und seine Frau Martha besitzen ein kleines Haus und ein paar Äcker weiter unten an der Straße. Reuben war Schreiner, bevor er in Rente ging, und verbringt die meiste Zeit mit dem Bau dekorativer Vogelhäuser und Briefkästen für die Touristenshops in der Stadt.
Ich öffne die Hintertür des Streifenwagens und beuge mich zu ihm hinunter, will ihm in die Augen sehen. Zimmerman schiebt den Kopf vor und blickt mich an. »Haben Sie Bonnie und die anderen Kinder gefunden?«, fragt er.
Seine Hände sind mit Handschellen im Rücken gefesselt, was mich bestürzt, obwohl Skid lediglich die Dienstanweisung befolgt hat. Ich hole den Schlüssel aus meinem Gürtel. »Drehen Sie sich um, ich nehme Ihnen die Dinger ab.« Ich spreche mit ihm Pennsylvaniadeutsch, um das Misstrauen, das zwischen den Amischen und der englischen Polizei herrscht, abzubauen. Heute Morgen brauche ich seine volle Kooperation.
Er dreht mir den Rücken zu, ich stecke den Schlüssel ins Schloss der Handschellen, und sie springen mit einem Klick auf. »Was machen Sie um diese Uhrzeit hier draußen?«
Er reibt sich die Handgelenke. »Ich helfe beim Melken.«
»Warum braucht Amos Sie, wenn er zwei Söhne hat?«
Die Frage verwirrt ihn, aber nur kurz. »Er hat zweiundzwanzig Kühe und melkt zweimal am Tag. Ich bringe die Kannen zu Gordon Brehm in Coshocton County.«
Seine Antwort wird durch das Fehlen einer Melkmaschine und eines Generators in der Scheune untermauert. Ohne Kühlanlage ist es unmöglich, die Milch zu kühlen, weshalb sie nicht als Trinkmilch verkauft werden kann. Da sie vorübergehend in altmodischen Milchkannen gelagert wird, ist sie nur zum Käsemachen zu gebrauchen, was einen Buggy-Trip zum Käsehersteller im angrenzenden County nötig macht.
Ich neige den Kopf zur Seite und blicke ihm in die Augen. »Reuben«, sage ich mit fester Stimme, damit ihm klar ist, dass ich seine ungeteilte Aufmerksamkeit will. »Sie müssen mir genau erzählen, was Sie heute Morgen gesehen haben, als Sie herkamen.«
Er nickt. »Ich war zu früh und hab mich ein paar Minuten auf die hintere Veranda gesetzt. Normalerweise brennt dann im Haus schon eine Laterne. Amos und ich trinken zusammen Kaffee. Manchmal brät Bonnie Scrapple. Heute Morgen war das Haus aber dunkel.«
»Sind Sie deshalb reingegangen?«
»Ich hab geklopft, aber niemand hat geantwortet.« Sein Gesicht verzieht sich zu einem kleinen Lächeln. »Ich dachte, er hat wieder verschlafen. Deshalb bin ich reingegangen.«
»Wie sind Sie reingekommen?«
»Die Hintertür ist nie verriegelt.«
Ich speichere diese Information. Viele Amischen schließen die Tür nachts nicht ab, obwohl die Ordnung Schlösser durchaus erlaubt. Sie halten es einfach nicht für nötig. Und nicht nur die Amischen sehen das so locker, mindestens die Hälfte der Einwohner in diesem County lässt nachts die Türen unverriegelt. Meine Einstellung dazu hat sich wesentlich verändert, seit ich sechs Jahre lang Polizistin in einer Großstadt war. Ich verriegele meine Tür jeden Abend mit der Hingabe einer paranoiden Schizophrenen.
»War sonst noch jemand im Haus?«
»Nur Amos … und die beiden Jungen.«
»Und draußen? Auf dem Hof? Oder in der Scheune?«
»Da hab ich niemanden gesehen.«
»Irgendwelche Fahrzeuge oder Buggys?«
»Nein.«
»Ist Ihnen in letzter Zeit irgendetwas Ungewöhnliches an Amos aufgefallen? Stand er vielleicht unter Druck? Oder hat er über Probleme gesprochen?«
»Amos?« Reuben Zimmerman schüttelt den Kopf. »Nein.«
»Gab es irgendwelche Misstöne in der Familie?«
»Nein.«
»Probleme zwischen Amos und Bonnie? Oder zwischen Amos und den Kindern? Probleme mit englischen Freunden? Hatte er Geldsorgen?«
Er schüttelt so heftig den Kopf, dass sein Bart hin und her weht. »Warum fragen Sie solche Dinge, Katie?«
»Ich versuche nur herauszufinden, was passiert ist.«
Zimmerman starrt mich an. »Amos hat immer nach den Regeln der Gelassenheit gelebt. Er war ein guter amischer Mann. Er war bescheiden und hat ganz nach dem Willen Gottes gelebt. Er hat hart gearbeitet. Und er hat seine Familie geliebt.«
»Hatten die Planks Feinde?«, frage ich. »Haben sie mit jemandem Streit gehabt?«
Wieder nachdrückliches Kopfschütteln. »Die Planks liebten ihre Glaubensbrüder. Sie waren großzügig. Wenn man etwas brauchte, haben Amos und Bonnie es einem gegeben und gern selbst darauf verzichtet.«
Doch ich weiß, dass selbst anständige, gottesfürchtige amische Familien Geheimnisse haben.
Einen Moment lang ist nur das Brummen des Generators auf der hinteren Veranda und das Zirpen der Grillen zu hören. Dann flüstert Zimmerman: »Sind Bonnie und die anderen Kinder in Ordnung?«
Ich schüttele den Kopf. »Sie sind auch tot.«
»Mein Gott.« Er senkt den Kopf und reibt die Stirn so fest mit den Fingern, dass die Haut weiß wird. »Wer würde so eine furchtbare Sünde begehen?«
»Ich weiß es nicht.«
»Ich verstehe Gottes Willen nicht«, sagt Reuben.
Ich glaube nicht, dass Gott den Mord an den Planks gewollt hat, doch da meine Ansichten nicht gerade beliebt sind bei meinen ehemaligen Glaubensbrüdern, schweige ich lieber. »Würden Sie mir den Gefallen tun und mit einem meiner Kollegen aufs Polizeirevier fahren, damit er Ihre Fingerabdrücke abnehmen kann?«
In einem englischen Polizeiwagen zu fahren ist für Zimmerman kein kleines Opfer, denn es verstößt gegen die Ordnung, in der die Regeln der hiesigen Kirchengemeinde festgelegt sind. Doch er nickt. »Ich helfe, so gut ich kann.«
Ich schließe die Autotür und gehe zu meinem Explorer, wo ich den kleinen Koffer mit der kriminaltechnischen Ausrüstung heraushole. Die Ausrüstung ist nicht gerade Hightech und besteht lediglich aus Latexhandschuhen, Plastikhüllen für Schuhe, einem Skizzenblock und Notizbuch, fluoreszierenden Miniaturleitkegeln zum Markieren von Beweisen, einer Rolle Absperrband, ein paar billigen Schnelltests und einer neuen Digitalkamera, deren Anschaffung mir kürzlich vom Stadtrat genehmigt wurde.
Ich finde Glock auf der hinteren Veranda, wo er mit einer Arbeitslampe in der Hand die blutigen Abdrücke für die Spurensicherung markiert. »Konnte Zimmerman helfen?«, fragt er über das Brummen des Generators hinweg.
Ich schüttele den Kopf. »Er hat nichts gesehen.«
»Glauben Sie ihm?«
»Im Moment schon.«
Wir betreten die Küche. Nach der frischen Luft im Freien schnürt mir der Leichengeruch den Hals zu. Ich lege den Koffer auf den Tisch, hole die Mentholsalbe heraus und tupfe sie mir unter die Nase.
Ich biete sie auch Glock an, doch der lehnt wie gewöhnlich mit den Worten ab: »Kann den Geruch nicht ausstehen.«
Normalerweise sorgt dieser Vorgang zwischen uns für Heiterkeit, doch diesmal nicht.
Wir streifen Latexhandschuhe und Schuhhüllen über. Tatorte wie dieser sind für Polizisten ein Albtraum – weiträumig und teilweise im Freien, was das Einsammeln und Konservieren von Beweisen enorm erschwert. Obwohl ich im Moment nicht sicher bin, womit wir es hier zu tun haben – mehrfacher Mord oder Mord-Selbstmord –, will ich auf Nummer sicher gehen und so viel Material sichern wie möglich.
Ich gebe Glock die Kamera. »Fotografieren Sie alles, bevor Sie es berühren. Sie kennen den Ablauf.«
Er nickt und nimmt die Kamera. Wortlos gehen wir durch die Küche zum Wohnzimmer. In der Tür bleibe ich stehen und leuchte mit der MagLite auf Amos Plank.
»Sieht schlimm aus«, sagt Glock.
»In der Scheune noch schlimmer.«
Er sieht mich fragend an.
Ich erzähle ihm von den beiden Mädchen.
»Verdammt.« Er registriert sofort Planks ungefesselte Hände, die kurze Entfernung zwischen Waffe und Leiche, die Austrittswunde im Hinterkopf. Wie jeder gute Polizist zieht er Schlüsse daraus. »Glauben Sie, er war’s?«
»Ich weiß es nicht.« Ehrlicher kann ich nicht antworten. Dem Augenschein nach ist Plank durchgedreht, hat seine Familie ermordet und sich dann den Pistolenlauf in den Mund gesteckt und abgedrückt. Der amische Teil meines Selbst, der fest in mir verwurzelt ist, auch wenn ich mich noch so weit vom Amischsein entfernt habe, kann sich nicht vorstellen, dass ein amischer Mann – ein amischer Vater – seiner Familie so etwas antut. Zugegeben, ich habe Amos Plank nicht gekannt. Doch ich kenne die Kultur der Amische und weiß, dass Gewalt nicht dazugehört.
Während Glock Fotos macht, laufe ich im Wohnzimmer umher und versuche, mir den Tathergang vorzustellen. Ich studiere die Position der Leichen, die Wunden, die Entfernung zwischen Amos Plank und der Beretta.
»Was hast du getan?«, flüstere ich.
In einem kleinen Raum mit drei Toten zu sein, die gewaltsam gestorben sind, ist sehr bedrückend. Wie durch einen Schleier registriere ich, dass Glock Fotos schießt. Ich sehe das Blitzlicht der Kamera, höre das Klicken und Summen des Verschlusses, das Surren der Batterie zwischen den Aufnahmen.
»Chief.«
Glock kniet am Boden und schießt ein Foto.
»Hier ist ein Teilabdruck.« Er macht eine zweite Aufnahme.
Ich hole einen Stift zum Markieren der Beweise aus der Jackentasche.
»Reichlich Profil.«
»Sieht aus wie ein Stiefel. Von einem Mann. Größe neun oder zehn.«
Ich hebe die Augenbrauen. »Sie sind gut, Glock.«
»Sagt meine Frau auch.«
Wir lächeln uns kurz an, und ich bin froh, dass er mir hilft, das alles hier nüchterner zu betrachten. Ich gehe neben ihm in die Hocke und sehe mir den Abdruck genau an. Die vordere Hälfte eines Schuhs oder Stiefels. »Wo ist er ins Blut getreten?«, frage ich mich laut. »Es muss doch noch mehr geben.«
Glock sieht mich an. »Ich hab keine anderen Abdrücke gesehen.«
»Das ist ja wohl kaum möglich.« Ich blicke mich um, ermutigt durch die Aussicht auf Beweise.
Er macht ein letztes Foto, steht auf, und wir suchen weiter. Während er zu dem kleinen Jungen auf der anderen Seite des Zimmers geht und Fotos macht, gehe ich neben dem älteren Jungen in die Hocke.
Es fällt mir nicht leicht, einen toten Teenager anzusehen, der auf dem Bauch liegt und dessen Hände im Rücken gefesselt sind. Sein Kopf ist zur Seite gedreht, das Haar voller Blut. Kleine Brocken Hirnmasse sowie Knochensplitter seines Schädels sind über den Boden verteilt. Sein Mund steht offen. Ich sehe Blut zwischen den Zähnen, die rosa Zungenspitze ist dreiviertel abgebissen. Trotz der Mentholsalbe ist der Gestank von Urin und Fäkalien fast unerträglich.
Dann fällt mein Blick auf die Handfessel des Jungen, und meine Befindlichkeiten werden plötzlich belanglos. Lautsprecherkabel. So was hat kein amischer Mann im Haus oder sonstwo. Ordentliche Doppelknoten. Das Kabel so fest geschnürt, dass es ins Fleisch geschnitten hat.
Die Tatsache, dass der Mörder Lautsprecherkabel benutzt hat, beschäftigt mich auf dem Weg zur Küche. Wer hat Lautsprecherkabel herumliegen? Jemand, der zu Hause eine Musikanlage installiert hat? Oder in seinem Auto? Seinem Wohnwagen? Jemand, der mit Musik oder Soundsystemen arbeitet? Mit Computern? Ich spiele die Möglichkeiten im Kopf durch, als Glock mich ruft.
»Ich glaube, ich habe die Stelle gefunden, wo er ins Blut getreten ist.«
Ich gehe zu ihm, und er zeigt auf den kleinen toten Jungen. »Auf dem Teppich ist Blut. Meiner Meinung nach ist der Mörder auf den Teppich getreten und hat es mitgeschleppt.«
Er hat recht, was mir nicht gefällt. »Ich hatte gehofft, wir finden einen besseren Abdruck.«
»So leicht ist es leider nie.« Er macht mehrere Aufnahmen von dem blutgetränkten Teppich.
Ich gehe in die Küche und nehme den Skizzenblock aus dem Koffer. Zurück im Wohnzimmer, skizziere ich grob den Tatort, konzentriere mich auf die Stelle und Position jeder Leiche. Ich bin nicht künstlerisch begabt, aber zusammen mit den Fotos wird diese Darstellung genügen, einen Eindruck des Tatorts zu vermitteln, so wie wir ihn vorgefunden haben.
Ich gehe zu Amos Planks Leiche. Auch er liegt auf dem Bauch, den Kopf zur Seite gedreht. Die Blutlache um ihn herum glänzt im Schein der Arbeitslampe. Ich knie mich neben ihm auf den Boden. »Glock, haben Sie schon Fotos vom Vater gemacht?«
Er kommt und stellt sich neben mich. »Ein halbes Dutzend aus verschiedenen Perspektiven.«
Dann kann ich den Toten also bewegen. »Helfen Sie mir, ihn auf den Rücken zu rollen«, sage ich.
Glock hockt sich neben mich und legt die Hand auf die linke Hüfte des Toten. Ich platziere meine auf der linken Schulter. »Los«, sage ich, und wir drehen ihn gleichzeitig um hundertachtzig Grad.
Eine Menge Blut schwappt aus dem Mund, und wir schnellen zurück, um es nicht abzubekommen. In dem grellen Licht wirkt Amos Planks Gesicht überaus makaber. Er hat mehrere abgebrochene Zähne und vom Schießpulver graubraune Verbrennungen an den Lippen. Die Nase ist voll geronnenem Blut. Der Kiefer ist gebrochen, der Mund steht offen, die Zunge ist von der Kugel zerfetzt.
Die rechte Gesichtshälfte ist blaurot – Totenflecken, die auftreten, wenn das Herz aufhört zu schlagen. Das Blut wird nicht länger durch den Körper gepumpt und sackt dahin, wo er aufliegt. Die blutergussähnliche Verfärbung setzt bereits eine halbe Stunde nach dem Tod ein und wird mit der Zeit stärker. Das ist mein erster Hinweis auf den Todeszeitpunkt.
»Sieht aus, als wäre er mindestens eine Stunde tot«, sage ich.
»Wenn die Leute wüssten, was Kugeln mit ihrem Gesicht machen, hätten wir wesentlich weniger Selbstmorde«, bemerkt Glock.
Die Wunde scheint selbst beigebracht zu sein. Die Kugel ist im Mund ein- und am Hinterkopf ausgetreten, hat den Schädel zertrümmert und ein Stück Hirn weggerissen. Es gibt sicher Leute, die das für das angemessene Ende eines Mannes halten, der gerade seine ganze Familie umgebracht hat.
»Wenn er die Pistole in den Mund gesteckt und abgedrückt hat«, sagt Glock, »würde der Stoß ihn dann nicht nach hinten werfen? Hätte er dann nicht auf dem Rücken liegen müssen?«
»Normalerweise schon«, erwidere ich. »Aber wenn er sich vornübergebeugt hat, die Waffe genommen und den Kopf gesenkt …« Das Bild macht mich frösteln. »Dann ist der Stoß vielleicht nicht stark genug gewesen.«
»Beschissene Art, sich zu verabschieden.«
»Wieso hat ein amischer Mann Lautsprecherkabel?«, denke ich laut. »Wo er weder Radio noch Fernseher besitzt. Er benutzt ja nicht mal eine Melkmaschine oder einen Generator zur Milchverarbeitung.«
»Gute Frage.« Glock zuckt die Schultern. »Vielleicht hat er es irgendwo billig gekauft oder jemand hat es ihm gegeben. Er benutzt es, weil es viel aushält.«
»Und warum hat er das Seil von der Rolle hier nicht benutzt?«
»Worauf wollen Sie hinaus, Chief?«
Ich weiß nicht, wie ich meine Gedanken formulieren soll, ohne voreingenommen zu klingen. Aber die Erfahrung hat mich gelehrt, auf meinen Instinkt zu hören, und der sagt mir, dass hier nichts so ist, wie es zu sein scheint.
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein amischer Mann so etwas tut«, sage ich schließlich.
»Die Amischen sind auch nur Menschen«, erwidert er. »Sie können jähzornig sein. Stoßen an Grenzen und drehen durch.«
Er hat recht. Es kommt zwar selten vor, aber auch Amische haben schon getötet. 1993 hat Edward Gingerich seine junge Frau umgebracht und ausgeweidet. Einer von wenigen aktenkundigen Fällen.
»Das hier ergibt keinen Sinn«, sage ich. »Die ungeheure Gewalt. Die Pistole. Das Foltern der Töchter. Das Lautsprecherkabel.«
»Ein Vater, der seine Kinder tötet, ist schwer zu verkraften.«
Glock ist einer der besten Polizisten, die ich kenne. Er hat einen gesunden Menschenverstand, gute Instinkte und genug Erfahrung, um zu wissen, dass der Schein trügen kann. Er ist tough und loyal, manchmal sogar über die Maßen. Letzten Januar, als wir es mit einem Mörder zu tun hatten, der seine Opfer abschlachtete, riskierte er seinen Job, um mir zu helfen, nachdem der Stadtrat mich gefeuert hatte. Doch am meisten bewundere ich, dass er immer seine ehrliche Meinung sagt – auch wenn er weiß, dass ich sie nicht hören will.
»Wollen Sie damit andeuten, Sie halten es für möglich, dass ein anderer alle umgebracht hat und den Eindruck erwecken will, es wäre der Vater gewesen?«, fragt er.
»Klingt absurd, so wie Sie es sagen.«
Glock blickt auf den Toten, doch ich spüre, dass seine Aufmerksamkeit noch immer mir gilt. »Als ich in North Carolina stationiert war, hat ein Verrückter seine Kinder zerhackt und in einem Tontopf zusammen mit Süßkartoffeln gekocht. Als ihn der Psychiater später fragte, warum er das getan hat, antwortete er, er habe sie zu sehr geliebt, um sie leben zu lassen.«
»Das ergibt absolut keinen Sinn.«
Wieder zuckt er die Schultern. »Genau das meine ich. Man kann keinen Sinn in etwas sehen, das keinen Sinn macht, wie sehr man es auch versucht.«
Ich weiß, dass er recht hat. Taten wie diese kann der Verstand nicht fassen. Sie brechen einem das Herz. Sie fressen einen innerlich auf, wenn man es zulässt. Ein alter Hase, mit dem ich als frischgebackene Polizistin zusammengearbeitet hatte, sagte mir einmal, dass genau die Polizisten, die zu viel Zeit mit dem »Begreifenwollen« verbringen, am Ende selbst den Weg von Amos Plank gehen.
»In so einen Kopf will man nicht hineinsehen«, sagt Glock. »Ist bestimmt ein unheimlicher Ort.«
In dem Moment höre ich die Küchentür, drehe mich um und sehe den Coroner eintreten. Dr. Ludwig Coblentz hat eine koffergroße Arzttasche in der Hand. In der cremefarbenen Windjacke, die er über einer Flanell-Pyjamajacke und hellbraunen Dockers-Hosen trägt, sieht er aus wie eine Mischung aus einem Michelin-Männchen und einem Teigkloß. Doch seine äußere Erscheinung wird durch seine exzellente Arbeit wettgemacht. Er ist einer von fünf Ärzten hier in Painter’s Mill und seit fast acht Jahren der zuständige Coroner.
»Sagen Sie mir, dass es nicht so schlimm ist, wie es am Telefon klang«, beginnt er.
»Wahrscheinlich schlimmer.« Ich gehe zu ihm in die Küche, und wir geben uns die Hand. »Danke, dass Sie so schnell gekommen sind.«
Er stellt seine Arzttasche auf dem Küchentisch ab. »Wie viele?«
»Sieben. Die ganze Familie.«
»Großer Gott.« Mit der schnellen Bewegung eines Mannes, der seine Instrumente handhabt, als wären sie ein Teil von ihm, streift er Latexhandschuhe über, legt eine Plastikschürze an und bindet sie im Rücken zu. Dann zieht er Plastikhüllen über seine Hush-Puppys, holt ein kleines Vinylkästchen aus der Arzttasche und sieht mich über die Brille hinweg an. »Zeigen Sie mir wo.«
»Drei hier im Wohnzimmer. Zwei im Hof und zwei weitere in der Scheune.« Ich bedeute ihm, mir zu folgen.
Im Wohnzimmer stößt er einen Seufzer aus, der so alt klingt, wie ich mich fühle. »Ich bin nun schon eine ganze Zeitlang Coroner, aber an den Anblick von toten Kindern werde ich mich nie gewöhnen.«
»An dem Tag, an dem Sie sich daran gewöhnen, hören Sie auf, ein Mensch zu sein«, erwidere ich.
»Oder Sie wechseln den Beruf«, wirft Glock ein.
Der Doktor kniet neben dem älteren Jungen, stellt das Kästchen neben sich. »Etwas mehr Licht wäre hilfreich.«
Die Lampen, die wir zuvor aufgestellt haben, reichen nicht für die Arbeiten eines Coroners. Ich gehe zu ihm hin und leuchte das Opfer mit meiner MagLite an.
Der Doc sieht zu mir auf, der Blick in den großen Augen hinter den dicken Brillengläsern ist äußerst beunruhigt. »Haben Sie schon Aufnahmen von den Toten gemacht?«
»Wir haben alles dokumentiert«, sagt Glock. »Sie können bewegt werden.«
Vorsichtig legt der Doktor die Hand an den Kopf des Jungen und verlagert ihn leicht. Blutverkrustetes blondes Haar wird sichtbar. Coblentz teilt es mit den Fingern und offenbart ein kreisrundes Loch von der Größe eines Bleistiftradiergummis wenige Zentimeter über dem Nacken. »Das ist die Eintrittswunde. Das Kind wurde von hinten erschossen.«
»Können Sie schon sagen, mit welchem Kaliber?«, frage ich.
»Ich kann eine Vermutung anstellen.« Er drückt mit dem Finger rund ums Loch, und ich sehe die Druckstellen des bleichen Fleisches. Blut fließt aus dem Loch und weicht wieder zurück, als er den Druck wegnimmt. »Der Größe der Wunde und dem Ausmaß der Schädelverletzung nach zu urteilen, war es wahrscheinlich eine kleinkalibrige Handfeuerwaffe. Aus nächster Nähe.«
»Geht es noch etwas genauer, Doc?«
».22er Kaliber, vielleicht .23er.«
»Neun Millimeter?«, frage ich.
»Möglich, aber sicher kann ich das noch nicht sagen.« Mit der gleichen Vorsicht, wie er ein Neugeborenes behandeln würde, dreht er den Kopf des Jungen, wobei eine rosa Flüssigkeit aus dem linken Nasenloch rinnt. »Die Austrittswunde könnte helfen, es weiter zu spezifizieren.«
Mein Blick fällt auf ein Loch im Holzboden, und mein Puls schlägt schneller. »Sehen Sie im Keller nach«, bitte ich Glock, »ob die Kugel den Boden durchschlagen hat. Ich leuchte direkt ins Loch. Wenn die Kugel glatt durchgegangen ist, können Sie das Licht sehen.«
»Bin schon weg.«
Der Doktor dreht noch einmal den Kopf des Opfers. Die linke Seite ist blaurot angelaufen. Er drückt zwei Finger in die Wangen. »Die Totenflecken sind noch nicht fest.«
»Was bedeutet das?«
»Es bedeutet, dass er mindestens vor zwei Stunden, höchstens aber vor zehn Stunden gestorben ist. Totenflecken sind erst nach zehn Stunden unveränderlich.« Noch einmal drückt er zwei Finger in das blaurote Fleisch der Wange. »Wenn ich hier drücke, wird die Haut weiß, wenn ich loslasse, weicht das Blut zurück. Wenn er über zehn Stunden tot wäre, würden die Flecken bleiben.«
»Können Sie den Todeszeitpunkt noch weiter eingrenzen?«
»Dafür muss ich die Körpertemperatur messen.« Er dreht sich um und holt eine abgerundete Schere aus dem Kästchen. Mit der sachlichen Effizienz eines Profis schneidet er Hose und Unterwäsche des Jungen auf. Der Anblick des schmächtigen, weißen Körpers ist unsäglich traurig. Er sollte leben, denke ich nur, er sollte lachen, seinen jüngeren Bruder necken und seine älteren Schwestern ärgern.
»Kate?«
Die Stimme des Doktors reißt mich aus meinen Gedanken. Er hält mir die Kleidung hin, die eingetütet werden muss. Ich rufe mich innerlich zur Ordnung, hole aus meinem Tatortkoffer in der Küche eine große Papiertüte und gehe zurück ins Wohnzimmer, wo der Doktor die Hose hineinsteckt. Ich schreibe Datum, Zeit und den Namen des Opfers aufs Etikett.
»Die Körpertemperatur fällt pro Stunde zwischen einem und eineinhalb Grad.« Der Doktor schiebt ein spezielles Hightech-Thermometer in den After des Jungen. »Das gibt Ihnen eine ungefähre Vorstellung vom Todeszeitpunkt. Wenn ich ihn im Leichenschauhaus hab und die Lebertemperatur messen kann, wird’s noch genauer.«
»Ist es möglich, dass er noch eine Weile gelebt hat, nachdem auf ihn geschossen wurde?«
»Das Kind hier war sofort tot.«
Der Timer am Thermometer piept. Er zieht es heraus und liest es mit zusammengekniffenen Augen ab. »Dreiunddreißig Komma neun.«
Ich rechne nach. »Also vor dreieinhalb bis fünf Stunden.«
»Richtig.«
Ich sehe auf die Uhr. »Wir haben jetzt sechs Uhr dreißig. Der Tod ist dann wahrscheinlich zwischen zehn Uhr letzte Nacht und null Uhr dreißig heute Morgen eingetreten.«
»Klingt korrekt.«
»Kann ich kurz Ihre Schere haben?«, frage ich.
»Natürlich.« Er reicht sie mir.
Ich schneide das Lautsprecherkabel am Handgelenk des Jungen durch und werfe es in eine zweite Beweismitteltüte. »Ziemlich starke Blutergüsse am Handgelenk«, bemerke ich.
Der Doktor verzieht das Gesicht. »Das arme Kind hat sich gewehrt.«
»Ich muss seine Hände eintüten, damit die Spurensicherung seine Fingernägel auf DNA untersuchen kann.« Ich blicke auf die Finger, die krallenartig versteift sind. »Hat die Totenstarre schon eingesetzt?«, frage ich.
»Noch nicht. Die Totenstarre beginnt gewöhnlich im Gesicht, Kiefer und Hals.«
»Und warum sind die Hände dann so?«
»Wahrscheinlich eine kataleptische Totenstarre. Das passiert, wenn das Opfer kurz vor dem Tod extrem unruhig oder angespannt war.«
Ich will mir das Grauen nicht ausmalen, das der Junge vor seinem Tod erlebt hat. Ich war selbst schon Opfer eines Gewaltverbrechens, doch sich das Entsetzen und die Hilflosigkeit eines Kindes vorzustellen, das mit gefesselten Händen mit ansehen muss, wie ein Familienmitglied nach dem anderen erschossen wird, und dabei weiß, dass es das nächste ist, sprengt meine Vorstellungskraft.