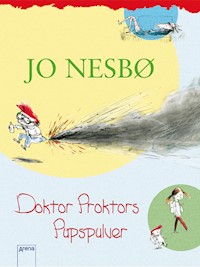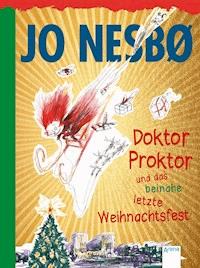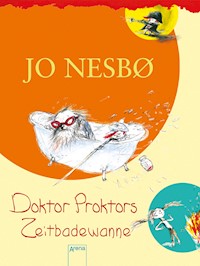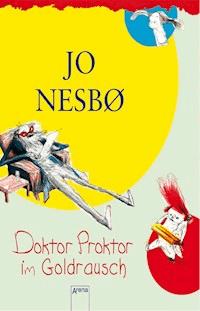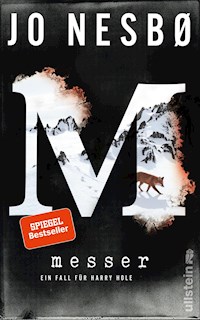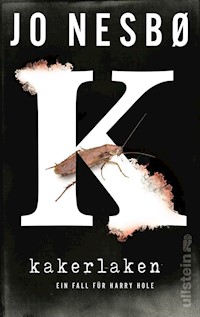11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Harry Hole – unerbittlich wie nie. Harry Hole hat alle Brücken hinter sich abgebrochen. In Los Angeles trinkt er sich als einer der zahllosen Obdachlosen fast zu Tode. Hin und wieder hilft er Lucille, einer älteren Filmdiva, die einem Drogenkartell eine Million Dollar schuldet. Zur gleichen Zeit werden in Oslo zwei Mädchen ermordet. Beide feierten auf der Yacht eines stadtbekannten Immobilienmaklers. Kommissarin Katrine Bratt fordert Harry Hole an, doch die Führungsetage der Polizei hat kein Interesse an dem Spezialisten für Mordserien. Der Makler hat weniger Skrupel und bietet Hole als privatem Ermittler ein Vermögen, um seinen Ruf zu schützen. Hole willigt ein, denn er sieht eine Chance, Lucille freizukaufen, und sucht sich ein Team, bestehend aus einem Kokain-dealendem Schulfreund, einem korrupten Polizisten und einem schwer an Krebs erkrankten Psychologen. Die Zeit läuft, während über Oslo ein Blutmond aufzieht. Der neue Bestseller aus Skandinavien, der Sie zum Schaudern bringt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 749
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Blutmond
Der Autor
JO NESBØ, 1960 geboren, ist Ökonom, Schriftsteller und Musiker. Er gehört zu den renommiertesten und erfolgreichsten Krimiautoren weltweit. Jo Nesbø lebt in Oslo.Günther Frauenlob, Jahrgang 1965. Er arbeitet seit über zwanzig Jahren als literarischer Übersetzer für Norwegisch und Dänisch. Zu den von ihm übersetzten Autoren zählen u.a. Lars Mytting und Gard Sveen. Er lebt in Waldkirch in der Nähe von Freiburg.
Das Buch
Drei Wochen war es her, seit Harry auf dem Parkplatz vor dem Creatures gestanden hatte, vor sich eine Glock 17. Er war sich ziemlich sicher gewesen, im Laufe der nächsten oder übernächsten Sekunde zu sterben. Und es wäre ihm recht gewesen. Ohne Frage. Doch seitdem kreisten seine Gedanken an jedem Tag, der verging, nur darum, nicht zu sterben. Begonnen hatte es mit dem Zögern des Mannes in dem Piqué-Shirt, der sich vielleicht fragte, ob Harry nur ein lästiges, aber ungefährliches Hindernis war, keine Kugel wert. Doch da hatte ihn Harry auch schon mit der Faust am Hals getroffen, und er war k. o. gegangen.
Jo Nesbø
Blutmond
Harry Hole ermittelt
Aus dem Norwegischen von Günther Frauenlob
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
© 2022 by Jo NesbøDie Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel Blodmåne bei Aschehoug, Oslo.© der deutschsprachigen Ausgabe 2022 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: BÜRO JORGE SCHMIDT, München, unter Verwendung einer Vorlage von © Eivind Stoud Platou / HandverkUmschlagabbildung: © Santana_Navarrette / iStock / Getty ImagesAutorenfoto: © Linda Bournane Engelberth / VII / Redux / laifE-Book powered by pepyrusISBN 978-3-8437-2877-5
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KAPITEL 36
KAPITEL 37
KAPITEL 38
KAPITEL 39
KAPITEL 40
KAPITEL 41
KAPITEL 42
KAPITEL 43
KAPITEL 44
KAPITEL 45
KAPITEL 46
KAPITEL 47
KAPITEL 48
KAPITEL 49
KAPITEL 50
KAPITEL 51
KAPITEL 52
KAPITEL 53
KAPITEL 54
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Motto
Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden,ehe denn der große und schreckliche Tag des HERRN kommt.
Joel 3,4
Prolog
»Oslo«, sagte der Mann und führte das Whiskyglas an die Lippen.
»Wirklich? Das ist deine Lieblingsstadt?«, fragte Lucille.
Er starrte vor sich hin, er schien über seine Antwort nachdenken zu müssen, dann nickte er. Sie musterte ihn, als er trank. Er war groß, und obwohl er neben ihr auf dem Barhocker saß, überragte er sie deutlich. Er musste mindestens zehn, vielleicht zwanzig Jahre jünger als sie mit ihren zweiundsiebzig sein, das ließ sich bei Alkoholikern nur schwer genauer sagen. Gesicht und Körper waren wie aus Holz geschnitzt: mager, konturiert und sehnig. Die Haut war blass, und auf der Nase zeichnete sich ein feines Netz blauer Adern ab, das zusammen mit den rot unterlaufenen Augen und der verwaschen blauen Iris zu erkennen gab, dass er ein hartes Leben mit viel zu viel Alkohol hinter sich hatte und hart aufgeschlagen war. Vielleicht hatte er auch zu sehr geliebt, denn im Laufe des Monats, in dem er zum neuen Stammgast im Creatures avanciert war, hatte sie manchmal Schmerz in seinem Blick gesehen. Wie ein geprügelter Hund, aus dem Rudel ausgestoßen, hatte er immer am hintersten Ende des Tresens gesessen. Neben Bronco, dem mechanischen Stier, den der Barbesitzer vom Filmset des gigantischen Flops Urban Cowboy hatte mitgehen lassen, wo er als Requisiteur gearbeitet hatte. Der Stier sollte daran erinnern, dass Los Angeles nicht auf Filmerfolgen beruhte, sondern auf einer Müllhalde finanziellen und menschlichen Scheiterns gebaut war. Mehr als achtzig Prozent der Filme waren totale Misserfolge und schrieben rote Zahlen. L. A. hatte den höchsten Anteil an Obdachlosen in den ganzen USA, vergleichbar mit Städten wie Bombay. Der Verkehr schnürte der Stadt langsam den Hals zu, wenn sie nicht bereits vorher in Straßenkriminalität, Gewalt und Drogen versank. Aber die Sonne schien. Ja, die verfluchte kalifornische Zahnarztlampe ging nie aus, sie brannte gnadenlos vom Himmel und ließ den ganzen Flitter dieser scheinheiligen Stadt wie Diamanten glitzern, wie echte Erfolgsstorys. Wenn sie nur wüssten. Wie sie, Lucille, es wusste, denn sie war da gewesen, hatte auf und hinter der Bühne gestanden.
Nicht so der Mann neben ihr, er hatte definitiv nie auf einer Bühne gestanden, Schauspieler erkannte sie auf den ersten Blick. Er sah aber auch nicht wie jemand aus, der voller Bewunderung, Hoffnung und Neid gen Rampenlicht starrte. Eher wie jemand, dem alles egal war. Der genug mit sich selbst zu tun hatte. Ein Musiker? Vielleicht. Eine Art Frank Zappa, der in irgendeinem Keller hier im Laurel Canyon unzugängliche Sachen produzierte und nie berühmt geworden war? Und auch niemals berühmt werden würde.
Nach einer Weile hatten Lucille und der Neue sich hin und wieder zugenickt oder kurz gegrüßt, wie es die Vormittagsgäste in einer Bar für seriöse Trinker taten. An diesem Tag nun hatte sie sich zum ersten Mal neben ihn gesetzt und ihm einen Drink spendiert.
Das heißt, sie hatte den Drink bezahlt, den er bereits bestellt hatte. Ben hatte ihm seine Kreditkarte mit einem Kopfschütteln zurückgegeben, das besagte, dass die Karte nicht gedeckt war.
»Und? Erwidert Oslo deine Liebe?«, fragte sie. »Das ist doch wohl die entscheidende Frage.«
»Wohl kaum«, sagte er. Als er sich mit der Hand über den kurzen Bürstenschnitt, das sehr helle, fast graue Haar fuhr, bemerkte sie, dass er am Mittelfinger eine Metallprothese trug. Er war kein gut aussehender Mann, und die dunkle Narbe, die sich wie ein J vom Mundwinkel bis zum Ohr zog – als hätte er einmal wie ein Fisch am Haken gehangen –, machte die Sache nicht besser. Aber er hatte etwas. In all der Hässlichkeit lag etwas Schönes, etwas Gefährliches, wie sie es auch von einigen ihrer Kollegen hier in der Stadt kannte. Christopher Walken. Nick Nolte. Und er hatte breite Schultern. Vielleicht schien das auch nur so, weil er so schmal war.
»Ach ja, so ist das doch oft mit den Menschen, die wir begehren«, sagte Lucille. »Sie erwidern unsere Liebe nicht, wir sind aber dumm genug zu glauben, dass sie es vielleicht doch irgendwann tun, wenn wir uns nur genug anstrengen.«
»Was machst du?«, fragte der Mann.
»Trinken«, erwiderte sie und hob das Whiskyglas. »Und Katzen füttern.«
»Hm.«
»Vermutlich willst du wissen, wer ich bin. Also, ich bin …« Sie schaute auf das Glas in ihrer Hand und fragte sich, welche Version sie ihm erzählen sollte. Die gesellschaftlich opportune oder die wahre? Sie trank einen Schluck, stellte das Glas ab und entschied sich für Letztere. Verdammt!
»Eine Schauspielerin, die eine große Rolle gespielt hat. Julia, in der noch immer besten Filmversion von Romeo und Julia, an die sich aber niemand mehr erinnert. Eine große Rolle hört sich nicht nach viel an, ist aber mehr, als die meisten Schauspieler hier in der Stadt erreichen. Ich war dreimal verheiratet, zweimal mit reichen Filmproduzenten, von denen ich mich habe scheiden lassen, wobei das beide Male sehr zu meinen Gunsten ausgegangen ist. Auch das ist nicht allen Schauspielern vergönnt. Nummer drei war der Einzige, den ich geliebt habe. Ein Schauspieler und Adonis ohne Geld, Disziplin und Gewissen. Er hat mein gesamtes Vermögen auf den Kopf gehauen und mich verlassen. Ich liebe ihn noch immer, möge er in der Hölle schmoren.«
Sie leerte das Glas, stellte es auf den Tisch und gab Ben ein Zeichen nachzufüllen. »Ja, und weil ich immer das will, was ich nicht haben kann, investiere ich Geld, das ich nicht habe, in ein Filmprojekt, das mit einer großen Rolle für eine ältere Frau lockt. Ein Projekt mit einem intelligenten Drehbuch, Schauspielern, die ihr Handwerk verstehen, und einem Regisseur, der die Zuschauer zum Nachdenken anregen will. Kurzum ein Projekt, bei dem jeder vernünftige Mensch weiß, dass es zum Scheitern verurteilt ist. So, jetzt weißt du es, ich bin eine Träumerin, eine Verliererin, eine typische angelina.«
Der Mann mit der J-Narbe lächelte.
»Okay, genug geplaudert«, sagte sie. »Wie heißt du?«
»Harry.«
»Du redest nicht viel, Harry.«
»Hm.«
»Schwede?«
»Norweger.«
»Bist du auf der Flucht vor etwas?«
»Sehe ich so aus?«
»Ja. Du trägst einen Ehering. Auf der Flucht vor der Frau?«
»Sie ist tot.«
»Aha, auf der Flucht vor der Trauer.« Lucille prostete ihm zu. »Willst du wissen, welchen Ort ich am meisten liebe? Diesen hier, Laurel Canyon. Nicht so, wie er jetzt ist, sondern wie er mal war, Ende der Sechziger. Das hättest du sehen sollen, Harry. Wenn du da überhaupt schon auf der Welt warst.«
»Ja, das ist mir mittlerweile auch klar geworden.«
Sie zeigte auf die gerahmten Fotos an der Wand hinter Ben.
»All die Musiker, die hier waren. Crosby, Stills, Nash und wie heißt noch mal der letzte?«
Harry lächelte erneut.
»The Mamas and the Papas«, fuhr sie fort. »Carole King. James Taylor. Joni Mitchell.« Sie zog die Nase hoch. »Sah noch aus wie ein Schulmädchen und hörte sich auch so an, hatte aber mit jedem was laufen. Sogar mit Leonard, er hat hier einen Monat lang mit ihr gewohnt. Eine Nacht durfte ich ihn mir aber ausleihen.«
»Leonard Cohen?«
»Klar. Ein feiner, netter Mann. Er hat mir beigebracht, wie man reimt. Und dass die meisten Leute den Fehler machen, mit der einen guten Zeile anzufangen, die sie haben, und dann nur noch fragwürdigen Mist dranhängen. Der Trick besteht darin, das weniger Gute an den Anfang zu setzen, da bemerkt es noch niemand. Fängt man gleich mit der guten Zeile an: ›Your hair on the pillow like a sleepy golden storm‹, und ergänzt dann, damit es sich reimt, eine banalere Zeile wie ›We made love in the morning, our kisses deep and warm‹, macht man alles kaputt. Tauscht man die Reihenfolge und schreibt: ›We made love in the morning, our kisses deep and warm, your hair on the pillow like a sleepy golden storm‹, ist das viel organischer und eleganter. Wir glauben ja, dass der Dichter in derselben Reihenfolge denkt, in der er schreibt. Wir glauben, dass das, was passiert, eine Folge dessen ist, was vorher passiert ist, und nicht umgekehrt.«
»Hm, und du meinst, dass das, was passiert, eine Folge dessen ist, was passieren wird?«
»Genau, Harry. Kapierst du das?«
»Ich bin mir nicht sicher. Hast du ein Beispiel?«
»Ja, klar.« Sie trank aus. Es musste ihm etwas an ihrem Ton aufgefallen sein, denn er zog eine Augenbraue hoch und scannte rasch das Lokal.
»Jetzt, hier, in der Gegenwart, erfährst du, dass ich Schulden wegen eines Filmprojekts habe«, sagte sie und schaute durch das schmutzige Fenster mit den halb runtergezogenen Rollos nach draußen, zum staubigen Parkplatz vor der Bar. »Und das ist kein Zufall, sondern eine Konsequenz dessen, was geschehen wird. Da draußen steht nämlich ein weißer Camaro neben meinem Auto.«
»Und drin sitzen zwei Männer«, sagte er. »Der steht da schon seit zwanzig Minuten.«
Sie nickte. Was Harrys Beruf anging, hatte sie richtiggelegen, das hatte er ihr gerade bestätigt.
»Dieser Wagen stand heute schon vor meinem Haus, weiter oben im Tal«, sagte sie. »Das hat mich nicht weiter überrascht, sie haben mich ja gewarnt, dass sie mir Geldeintreiber auf den Hals hetzen würden. Und sicher keine legalen. Um die Wahrheit zu sagen, die Schulden habe ich nicht bei einer Bank. Wenn ich jetzt raus zu meinem Auto gehe, werde ich wahrscheinlich einiges zu hören bekommen. Ich nehme aber an, dass sie sich vorerst mit Warnungen und Drohungen begnügen werden.«
»Hm. Und warum erzählst du mir das?«
»Weil du Polizist bist.«
Wieder diese hochgezogene Augenbraue. »Bin ich das?«
»Mein Vater war Polizist, irgendwie erkennt man euch wo auch immer auf dieser Welt. Die Sache ist die: Ich hätte gerne, dass du mir beistehst. Sollte jemand laut werden und mich bedrohen, wäre es toll, wenn du rauskämst und … ja, wie ein Polizist aussiehst, damit sie abhauen. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass nichts passiert, es würde mir aber trotzdem etwas mehr Sicherheit geben, wenn ich wüsste, dass jemand ein Auge auf mich hat.«
Harry musterte sie. Er sagte: »Okay.« Mehr nicht.
Lucille war überrascht. Hatte er sich zu leicht überreden lassen? Andererseits, sein Blick war fest und ruhig, sie schien ihm vertrauen zu können. Sie hatte auch Adonis vertraut. Und dem Regisseur und dem Produzenten. Eigentlich allen.
»Ich gehe jetzt«, sagte sie.
Harry Hole hielt das Glas in der Hand. Lauschte dem kaum hörbaren Knistern der schmelzenden Eiswürfel. Trank nicht. Er war pleite und am Ende des Weges angekommen. Er musste diesen Drink in die Länge ziehen. Sein Blick ruhte auf einem der Fotos hinter dem Tresen. Es zeigte den Lieblingsautor seiner Jugend, Charles Bukowski, vor dem Creatures. Ben hatte gesagt, das Foto sei in den Siebzigern aufgenommen worden. Bukowski hatte den Arm um einen Freund gelegt. Sie schienen vor einem Sonnenaufgang zu stehen, beide in Hawaiihemden, mit glasigem Blick, winzigen Pupillen und einem triumphierenden Grinsen, als hätten sie gerade nach einer überaus strapaziösen Tour den Nordpol erreicht.
Harry senkte den Blick und starrte auf die Kreditkarte, die Ben ihm zurückgegeben hatte.
Leer. Ausgeleert. Alles weg. Mission accomplished. Genau darum war es ihm gegangen. Er wollte trinken, bis nichts mehr da war. Kein Geld, keine Tage, keine Zukunft. Blieb nur noch die Frage, ob er genug Mumm oder die Feigheit besaß, auch den Rest durchzuziehen. In der Pension lag in seinem Zimmer unter der Matratze eine alte Beretta. Er hatte sie für fünfundzwanzig Dollar von den Obdachlosen gekauft, die unten in der Skid Row in blauen Zelten hausten. Im Magazin waren drei Kugeln. Er griff nach der Kreditkarte. Drehte sich um und sah aus dem Fenster. Die alte Frau ging über den Parkplatz. Wie klein sie war. Wie grazil und zerbrechlich sie wirkte und wie stark. Beige Hose und eine dazu passende kurze Jacke. Der geschmackvolle, minimalistische Stil erinnerte ihn irgendwie an die Achtziger. So kam sie jeden Morgen in die Bar. Ihr großer Auftritt. Für ein Publikum aus zwei bis acht Trinkern.
»Lucille is here!«, rief dann Ben, bevor er, ohne ein Wort von ihr, ihr übliches Gift mischte. Whisky sour.
Aber nicht die Art, wie sie den Raum betrat, erinnerte ihn an seine Mutter. An seine Mutter, die im Radiumhospital gestorben war, als er fünfzehn war, an das erste Schussloch in seinem Herzen. Es war Lucilles milder, fröhlicher und gleichzeitig trauriger Blick. Der einer guten, aber hoffnungslos verlorenen Seele. Ihre mitfühlende Art, wie sie sich nach der Gesundheit erkundigte, dem Liebesleben und der Familie, dass sie Harry am anderen Ende des Raumes unbehelligt hatte sitzen lassen. Seine Mutter war der stille Leuchtturm der Familie gewesen, das Nervenzentrum, das die Fäden so diskret in der Hand hielt, dass man leicht auf die Idee kommen konnte, dass eigentlich Vater das Sagen gehabt hatte. Mutter war der sichere Hafen gewesen, die feste Umarmung, das pure Verständnis. Und weil er sie über alles geliebt hatte, war sie seine Achillesferse. Wie damals in der zweiten Klasse, als es vorsichtig an der Klassenzimmertür geklopft hatte und sie plötzlich mit dem zu Hause vergessenen Pausenbrot dastand. Bei ihrem Anblick war gleich ein Strahlen über sein Gesicht gegangen, doch dann hatte er das Lachen seiner Klassenkameraden gehört und war zu ihr nach draußen marschiert und hatte ihr wütend erklärt, wie peinlich sie sei, er brauche kein Essen. Sie hatte ihn nur traurig angelächelt, ihm seine Brote gegeben und ihm über die Wange gestreichelt. Sie war gegangen und hatte es nie wieder erwähnt. Natürlich hatte sie es verstanden, wie sie immer alles verstand. Als er am Abend ins Bett ging, hatte auch er verstanden. Er hatte sich nicht wegen ihr unwohl gefühlt, sondern weil alle seine Liebe gesehen hatten. Seine Verletzbarkeit. In den folgenden Jahren hatte er sich ein paarmal vorgenommen, sich zu entschuldigen, aber auch das hatte sich falsch angefühlt.
Eine Staubwolke wirbelte über den Parkplatz und verhüllte Lucille für einen Augenblick. Sie hielt ihre Sonnenbrille fest. Dann ging die Tür des weißen Camaro auf, und ein Mann mit Sonnenbrille und rotem Piqué-Shirt stieg aus. Er versperrte Lucille den Weg.
Harry rechnete mit einem Wortwechsel, doch der Mann machte einen Schritt nach vorne, packte Lucille am Arm und zog sie in Richtung Camaro. Ihre Absätze gruben sich in den Kies. In diesem Moment bemerkte Harry auch, dass der Camaro kein amerikanisches Kennzeichen hatte. Sofort rutschte er vom Barhocker, lief zur Tür, stieß sie mit dem Ellenbogen auf und wäre beinahe die zwei Stufen hinuntergestolpert, weil die Sonne ihn so blendete. Er war alles andere als nüchtern, das spürte er. Während er die Autos anpeilte, gewöhnten seine Augen sich langsam an das Licht. Auf der anderen Seite der Straße, die sich die grünen Hügel hochzog, konnte er ein wenig einladendes Geschäft ausmachen. Er fokussierte seinen Blick auf den Mann und Lucille.
»Police!«, rief er. »Let her go!«
»Please stay out of this, sir«, erwiderte der Mann.
Harry schloss daraus, dass sein Gegenüber denselben Background wie er haben musste, nur Polizisten bleiben in solchen Situationen höflich. Harry wusste auch, dass ein körperliches Eingreifen unvermeidbar war, und Regel Nummer eins war dabei denkbar einfach. Nur wer zuerst und mit maximaler Härte angreift, trägt den Sieg davon. Deshalb wurde er nicht langsamer. Der Mann musste Harrys Absicht durchschaut haben, denn er ließ Lucille los, griff hinter sich und zog etwas hervor. In seinen Händen glänzte eine Waffe, die Harry sogleich als eine Glock 17 identifizierte. Sie war auf ihn gerichtet.
Harry wurde langsamer, ging aber weiter auf den Mann zu. Sein Gegenüber kniff ein Auge zu und zielte. Als er sagte: »Halten Sie sich raus, Sir. Verschwinden Sie!«, war das wegen eines vorbeifahrenden Pick-ups kaum zu verstehen.
Harry ging weiter. Er hatte immer noch die Kreditkarte in der rechten Hand. Sollte es so enden? Auf einem staubigen Parkplatz in einem fremden Land, im grellen Sonnenlicht, bankrott und leicht angetrunken, während er zu tun versuchte, was ihm bei seiner Mutter nicht vergönnt gewesen war, bei niemandem, der ihm jemals nahegestanden hatte?
Er blinzelte und schloss die Finger fest um die Kreditkarte, eine Meißelfaust.
Der Titel des Leonard-Cohen-Songs, den sie falsch zitiert hatte, schwirrte in seinem Kopf herum: »Hey, That’s No Way to Say Goodbye«.
Doch, verdammt, das war es.
KAPITEL 1
Freitag.
Es war acht Uhr, eine halbe Stunde zuvor war die Septembersonne über Oslo untergegangen, höchste Zeit für einen Dreijährigen, ins Bett zu gehen.
Katrine Bratt flüsterte seufzend ins Telefon. »Kannst du nicht schlafen, Schatz?«
»Oma singt nich richtig«, sagte die Kinderstimme und schniefte. »Wo bist du?«
»Ich musste zur Arbeit, Schatz, aber ich komme ganz bald nach Hause. Soll Mama für dich singen?«
»Ja.«
»Aber dann musst du auch die Augen zumachen.«
»Ja.«
»›Blåmann‹?«
»Ja.«
Katrine begann mit leiser, tiefer Stimme das Lied zu singen.
Blåmann, Blåmann, Böckchen mein, denk doch an dein Kindelein.
Sie hatte nicht die leiseste Ahnung, warum Kinder seit inzwischen mehr als hundert Jahren unbedingt von einer Geschichte in den Schlaf gelullt werden wollten, in der ein Junge Angst hat, weil Blåmann, seine Lieblingsgeiß, nicht von der Weide zurückkommt, da der Bär sie gerissen hat.
Trotz allem hörte sie bereits nach der ersten Strophe, dass Gerts Atem gleichmäßiger und tiefer wurde, und nach der dritten das Flüstern ihrer Schwiegermutter durch das Telefon.
»Er schläft jetzt.«
»Danke«, sagte Katrine, die schon so lange in der Hocke saß, dass sie sich mit einer Hand auf dem Boden aufstützen musste. »Ich komme, so schnell ich kann.«
»Nimm dir die Zeit, die du brauchst, Liebes. Und ich danke dir, dass du uns hier haben willst. Weißt du, er sieht Bjørn so ähnlich, wenn er schläft.«
Katrine schluckte. Wie immer, wenn sie das hörte, brachte sie keinen Ton heraus. Nicht weil sie Bjørn nicht vermisste, und auch nicht, weil sie sich nicht freute, wenn Bjørns Eltern ihn in Gert wiedererkannten. Sondern weil es schlicht und einfach nicht stimmte.
Sie konzentrierte sich auf das, was vor ihr lag.
»Ziemlich heftig für ein Schlaflied«, sagte Sung-min Larsen, der sich neben sie gehockt hatte. »Vielleicht bist du jetzt tot?«
»Ich weiß, er will aber immer nur dieses Lied hören«, sagte Katrine.
»Tja, und dann kriegt er es«, sagte ihr Kollege lächelnd.
Katrine nickte. »Hast du jemals darüber nachgedacht, dass wir als Kinder uneingeschränkte Liebe von unseren Eltern erwarten, ohne irgendetwas zurückzugeben? Dass wir eigentlich Parasiten sind? Und dann werden wir groß, und die Dinge verändern sich total. Wann genau kommt eigentlich der Punkt, an dem wir den Glauben daran verlieren, bedingungslos geliebt zu werden, nur weil wir die sind, die wir sind?«
»Wann sie den Glauben verloren hat, meinst du?«
»Ja.«
Sie starrten auf den Leichnam der jungen Frau vor ihnen auf dem Waldboden. Hose und Slip waren bis zu den Knöcheln heruntergezogen, der Reißverschluss der dünnen Daunenjacke war bis oben zu. Das in den Sternenhimmel starrende Gesicht kreideweiß im Licht der Scheinwerfer, die die Kriminaltechniker unter den Bäumen aufgestellt hatten. Die Schminke verlaufen und wieder angetrocknet. Die blond gefärbten Haare klebten an einer Gesichtshälfte. Die Lippen waren mit Silikon aufgespritzt, und falsche Wimpern bedeckten das Auge, das, in den Schädel gesunken, gebrochen an ihnen vorbeistarrte. Und die Wimpern bedeckten auch die leere Augenhöhle daneben. Vielleicht hatten sie es all den schwer abbaubaren Kunststoffen zu verdanken, dass der Leichnam trotz allem noch so gut erhalten war.
»Ich gehe davon aus, dass das Susanne Andersen ist«, sagte Sung-min.
»Ich auch«, antwortete Katrine.
Die beiden Ermittler kamen aus unterschiedlichen Abteilungen, sie vom Dezernat für Gewaltverbrechen der Osloer Polizei und er von Kripos, dem nationalen Kriminalamt. Susanne Andersen, sechsundzwanzig Jahre, wurde seit siebzehn Tagen vermisst und war zuletzt lebend von der Überwachungskamera der Bahnstation Skullerud eingefangen worden. Zu Fuß gut zwanzig Minuten von dem Ort entfernt, an dem sie sich jetzt befanden. Die einzige Spur der zweiten vermissten Frau, Bertine Bertilsen, siebenundzwanzig Jahre, war ihr Auto, das auf einem Wanderparkplatz am Grefsenkollen, am anderen Ende der Stadt, parkte. Die Frau vor ihnen hatte blonde Haare, was mit den Bildern der Überwachungskamera von Susanne übereinstimmte. Bertine sollte nach Aussage von Angehörigen und Freunden aktuell brünett sein. Außerdem waren auf dem nackten Unterkörper keine Tattoos. Bertine hatte angeblich ein Tattoo mit dem Louis-Vuitton-Logo auf einem Knöchel.
Der September war bislang relativ kühl und trocken gewesen, und die Verfärbungen der Haut des Leichnams – blau, lila, gelb, braun – deuteten darauf hin, dass sie tatsächlich seit bald drei Wochen hier liegen konnte. Auch der Geruch des Gases, das sich im Körper gebildet hatte und das durch alle Öffnungen entwich, passte dazu. Ebenso die Stelle mit den dünnen weißen Härchen unter den Nasenlöchern: Pilze. In der großen Wunde am Hals krabbelten blind gelbliche Fliegenlarven. Katrine hatte das schon so oft gesehen, dass es ihr nichts mehr ausmachte. Schmeißfliegen waren laut Harry so treu wie die Fans von Liverpool. Ganz unabhängig von Uhrzeit, Ort, Wetter und Windrichtung tauchten sie innerhalb einer Stunde auf, angelockt vom Geruch des Dimethyltrisulfids, den der Körper mit Eintritt des Todes abgibt. Die weiblichen Fliegen legen ihre Eier ab, und ein paar Tage später schlüpfen die Larven und beginnen, sich am verwesenden Fleisch zu laben. Sie verpuppen sich, die Puppen werden zu Fliegen, die dann wieder nach Totem suchen, in das sie ihre Eier legen können. Nach einem Monat haben sie ihr Leben zu Ende gelebt und sterben. Das ist der Kreislauf. Ganz ähnlich dem unseren, dachte Katrine. Oder wenigstens dem meinen.
Katrine sah sich um. In Weiß gekleidete Kriminaltechniker huschten lautlos wie Gespenster zwischen den Bäumen hindurch und warfen, sobald die Blitzlichter ihrer Kameras aufleuchteten, bedrohliche Schatten. Der Wald war groß. Die Østmarka zog sich zig Kilometer weit bis an die schwedische Grenze. Ein Jogger hatte die Leiche gefunden. Oder, genauer gesagt, der Hund des Joggers. Das Tier war ohne Leine auf einem schmalen Pfad im Wald gelaufen und dann irgendwann verschwunden. Es war bereits dunkel gewesen, und der Jogger – er war mit Stirnlampe unterwegs gewesen – war dem Hund gefolgt und hatte ihn gerufen und ihn schließlich schwanzwedelnd neben der Leiche entdeckt. Wobei das mit dem wedelnden Schwanz nicht erwähnt worden war, Katrine stellte es sich aber so vor.
»Susanne Andersen«, sagte sie leise, ohne zu wissen, zu wem. Vielleicht zu der Toten, als wollte sie sie trösten und ihr versichern, dass sie nun endlich gefunden und identifiziert worden war.
Die Todesursache schien auf der Hand zu liegen. Der Schnitt quer über Susanne Andersens schmalen Hals erinnerte an ein bösartiges Grinsen. Das meiste Blut hatten vermutlich die Maden, diverse andere Insekten und vielleicht auch andere Tiere vertilgt, trotzdem machte Katrine noch Spritzer am Heidekraut und an einem der Baumstämme aus.
»Die ist hier vor Ort getötet worden«, sagte sie.
»Sieht so aus«, erwiderte Sung-min. »Glaubst du, dass sie vergewaltigt worden ist? Oder dass sich jemand an dem Leichnam vergangen hat?«
»Post mortem«, sagte Katrine und leuchtete mit der Taschenlampe auf Susannes Hände. »Keine abgebrochenen Nägel, nicht die Spur eines Kampfes. Ich werde die Rechtsmedizin bitten, sich den Leichnam noch am Wochenende anzuschauen, mal sehen, was die sagen.«
»Obduktion?«
»Den Bericht kriegen wir frühestens Montag.«
Sung-min seufzte. »Tja, dann ist es sicher nur eine Frage der Zeit, bis wir Bertine Bertilsen vergewaltigt und mit durchgeschnittener Kehle irgendwo am Grefsenkollen finden.«
Katrine nickte. Sung-min und sie hatten sich im Laufe des letzten Jahres besser kennengelernt. Er galt als bester Ermittler des Kriminalamts, und viele Leute dachten, dass er eines Tages Ole Winter als Leiter der Ermittlungsabteilung der Kripos beerben würde, sollte der jemals aufhören, und dass die Abteilung damit den deutlich besseren Chef bekommen würde. Möglich war das. Es gab aber auch Kollegen, die nicht so begeistert wären, wenn an der Spitze des obersten Ermittlungsorgans des Landes ein Schwuler stünde, der als Adoptivkind aus Südkorea nach Norwegen gekommen war und sich wie jemand aus der englischen Oberschicht kleidete. Seine klassische Tweedjacke und die handgenähten Lederschuhe standen in deutlichem Kontrast zu Katrines dünner Patagonia-Daunenjacke und den Goretex-Joggingschuhen. Bjørn hatte sie immer eine »Gorpcore« genannt, und inzwischen wusste sie, dass ihr Outfit tatsächlich ein internationaler Trend war, bei Menschen, die abends wie fürs Hochgebirge gekleidet ausgingen. Sie selbst passte sich damit lediglich an ihr Leben als alleinerziehende Mutter eines kleinen Kindes an. Ihr unauffälliger, praktischer Kleidungsstil konnte aber auch damit zu tun haben, dass sie nicht mehr das junge, rebellische Ermittlertalent, sondern mittlerweile die Chefin des Dezernats war.
»Was glaubst du, womit haben wir es hier zu tun?«, fragte Sung-min.
Sie wusste, dass er dasselbe dachte wie sie. Und dass weder er noch sie die Absicht hatten, es laut auszusprechen. Noch nicht. Katrine räusperte sich.
»Erst mal müssen wir uns auf das konzentrieren, was wir haben, und herausfinden, was geschehen ist.«
»Einverstanden.«
Katrine hoffte, dass sie dieses Wort in der nächsten Zeit noch öfter vom Kriminalamt hören würde. Natürlich war sie froh über die Hilfe, die sie bekam. Nachdem Bertine Bertilsen exakt eine Woche nach Susanne und unter auffallend ähnlichen Umständen verschwunden war, hatte sich Kripos bereit erklärt, an den Fällen mitzuarbeiten.
Beide Frauen waren an einem Dienstagabend unterwegs gewesen, ohne dass jemand wusste, wohin sie wollten, und beide waren danach nie wieder gesehen worden. Außerdem gab es noch eine andere Verbindung zwischen den beiden Frauen, weshalb die Polizei nach Bertilsens Verschwinden nicht mehr davon ausging, dass Susanne irgendeinen Unfall gehabt oder sich das Leben genommen haben könnte.
»Okay, dann machen wir das so«, sagte Katrine und kam aus der Hocke hoch. »Ich sage dem Chef Bescheid.«
Sie musste eine Weile auf der Stelle treten, ihre Beine waren eingeschlafen. Sie schaltete die Taschenlampe ihres Handys ein, um sicherzugehen, wenigstens einigermaßen in der Spur zu bleiben, die sie auf dem Weg zum Tatort hinterlassen hatten. Außerhalb der Absperrung, die zwischen den Bäumen aufgespannt worden war, tippte sie die vier Buchstaben ein, unter denen sie die Kriminalchefin im Handy gespeichert hatte. Nach dem dritten Klingeln hörte sie die Stimme von Bodil Melling.
»Bratt hier. Tut mir leid, dass ich so spät noch anrufe, aber es sieht so aus, als hätten wir eine der beiden vermissten Frauen gefunden. Ermordet, mit durchgeschnittener Kehle, die Hauptschlagader wurde getroffen, vermutlich vergewaltigt oder geschändet. Es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Susanne Andersen.«
»Das tut mir leid«, sagte Melling. Sie sagte es tonlos, und Katrine sah im selben Moment Mellings ausdrucksloses Gesicht vor sich, die beige Kleidung und die temperamentlose Körpersprache. Bestimmt führte sie ein konfliktfreies Familienleben mit uninspiriertem ehelichem Sex. Das Einzige, was die frisch ernannte Kriminalchefin interessierte, war das Büro des Polizeipräsidenten, das bald frei wurde. Es war nicht so, dass Melling nicht kompetent war. Katrine fand sie einfach nur unglaublich langweilig. Defensiv. Feige.
»Berufen Sie eine Pressekonferenz ein?«, fragte Melling.
»Okay? Wollen Sie dann …?«
»Nein, solange das Opfer noch nicht eindeutig identifiziert ist, machen Sie das bitte.«
»Ich würde das dann gemeinsam mit dem Kriminalamt machen. Die hatten auch Kollegen am Tatort.«
»Ja, in Ordnung. Wenn das alles ist, ich habe Gäste.«
In der Pause, die folgte, hörte Katrine leise Gespräche im Hintergrund. Es klang nach einer launigen Diskussion, nach einem Gespräch, bei dem sich alle einig waren und der eine nur bestätigte oder vertiefte, was der andere gesagt hatte. Social bonding. Genau so hatte Bodil Melling es am liebsten. Sie wäre garantiert irritiert, würde Katrine noch einmal aufgreifen, was sie bereits angesprochen hatte: dass Bertine ebenfalls vermisst wurde und der Verdacht bestand, dass zwei Frauen von demselben Mann getötet worden sein konnten. Es würde sie nicht weiterbringen, Melling hatte sich klar dazu geäußert und jede Diskussion darüber abgelehnt. Katrine wusste das ganz genau.
»Nur noch eine Sache«, sagte sie, wartete einen Moment und holte tief Luft.
Die Kriminalchefin kam ihr zuvor.
»Die Antwort ist Nein, Bratt.«
»Aber er ist der einzige Spezialist, den wir für so etwas haben. Und der beste.«
»Und der schlimmste. Außerdem haben wir ihn nicht mehr. Gott sei Dank!«
»Die Presse wird wissen wollen, wo er ist, fragen, warum wir ihn nicht …«
»Dann sagen Sie die Wahrheit und antworten Sie, dass wir nicht wissen, wo er ist. In Anbetracht der Tatsache, was mit seiner Frau passiert ist, dazu seine labile Natur und die Drogen, sehe ich wirklich nicht, wie er uns bei einer Mordermittlung unterstützen könnte.«
»Ich glaube, ich weiß, wie ich ihn finden kann.«
»Vergessen Sie es, Bratt. Wenn Sie auf alte Helden setzen, sobald es anstrengend wird, ist das eine Demütigung für all diejenigen, die für Sie im Dezernat arbeiten. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie es mit dem Selbstwertgefühl und der Motivation Ihres Teams aussieht, wenn Sie denen sagen, dass Sie diese total abgewrackte Gestalt um Hilfe bitten wollen? Das ist kein guter Führungsstil, Bratt.«
»Okay«, sagte Katrine und schluckte.
»Gut, ich weiß es zu schätzen, dass Sie das einsehen. Gibt es sonst noch etwas?«
Katrine dachte nach. Es war also doch möglich, Melling zu provozieren und sie zu zwingen, Farbe zu bekennen. Gut. Sie richtete ihren Blick auf den Mond, der über den Baumwipfeln stand. Gestern Abend hatte Arne, der junge Mann, den sie nun seit bald vier Wochen datete, ihr erzählt, dass es in zwei Wochen eine komplette Mondfinsternis geben würde, einen sogenannten Blutmond, und dass sie das feiern müssten. Katrine hatte keine Ahnung, was ein Blutmond war, aber allem Anschein nach gab es so etwas nur alle zwei oder drei Jahre. Arne war so gespannt darauf, dass sie es nicht übers Herz brachte, ihm zu sagen, dass sie nicht so weit im Voraus planen sollten, da sie sich ja kaum kannten. Katrine war schon immer konfliktscheu gewesen. Vielleicht hatte sie das von ihrem Vater, einem Polizisten aus Bergen, der mehr Feinde gehabt hatte, als es dort Regentage gab. Mittlerweile hatte sie aber gelernt, zu erkennen, welche Konflikte lohnend waren, und anders als bei einer Auseinandersetzung mit einem Mann, von dem sie nicht wusste, ob sie eine gemeinsame Zukunft haben würden, musste sie sich diesem Konflikt stellen. Früher oder später.
»Nur noch eine Sache«, sagte Katrine. »Ist es in Ordnung, wenn ich das auf der Pressekonferenz sage, sollte jemand fragen? Oder den Eltern der nächsten jungen Frau, die getötet wird?«
»Was sagen?«
»Dass die Osloer Polizei die Hilfe eines Mannes ablehnt, der bereits drei Serienmörder hier in dieser Stadt hinter Schloss und Riegel gebracht hat. Weil wir der Ansicht sind, damit einzelne Kollegen zu kränken.«
Es entstand eine lange Pause, auch das Gespräch im Hintergrund von Melling schien verstummt zu sein. Schließlich räusperte Bodil Melling sich.
»Wissen Sie was, Katrine? Sie arbeiten schon lange und sehr intensiv an diesem Fall. Machen Sie die Pressekonferenz, schlafen Sie sich am Wochenende aus, und am Montag reden wir dann miteinander.«
Sie legten auf, und Katrine rief in der Rechtsmedizin an. Statt den offiziellen Dienstweg zu gehen, kontaktierte sie Alexandra Sturdza. Die junge Obduktionstechnikerin hatte weder Mann noch Kinder und legte auch keinen sonderlichen Wert auf geregelte Arbeitszeiten. Und ganz richtig, Sturdza meldete sich und sagte zu, dass sie sich die Leiche im Laufe des nächsten Tages mit einem Kollegen anschauen würde.
Katrine drehte sich noch einmal um und sah zu der Toten. Vielleicht lag es daran, dass sie es in dieser von Männern dominierten Welt aus eigener Kraft geschafft hatte, jedenfalls hatte sie die Verachtung, die sie gegenüber Frauen empfand, die sich freiwillig von Männern abhängig machten, nie ganz beiseiteschieben können. Was Susanne und Bertine verband, war nicht nur die Tatsache, dass sie auf Kosten von Männern lebten, sondern dass sie sich den dreißig Jahre älteren Immobilienmakler Markus Røed geteilt hatten. Ihr Leben, ihre Existenz beruhte auf der anderer Menschen, sie ließen sich aushalten von Männern mit Geld und Jobs, die sie selbst nicht hatten. Als Gegenleistung boten sie ihre Körper, ihre Jugend, ihre Schönheit dar. Und ermöglichten ihrem Auserwählten – je nachdem, wie exponiert die Beziehung war –, dass er sich am Neid der anderen Männer laben konnte. Im Gegensatz zu Kindern mussten Frauen wie Susanne und Bertine mit der Gewissheit leben, dass die Liebe an Bedingungen geknüpft war. Früher oder später würde ihr Wirt sie fallen lassen, sodass sie gezwungen sein würden, einen neuen Mann zu finden, den sie ausnutzen konnten oder von dem sie ausgenutzt wurden – das lag im Auge des Betrachters.
War das Liebe? Oder besser gesagt: War auch das Liebe? Warum nicht? Wenn der Gedanke auch verflucht deprimierend war.
Zwischen den Bäumen in Richtung Weg entdeckte Katrine das Blaulicht des Rettungswagens, der ohne Sirene gekommen war. Sie dachte an Harry Hole. Im April hatte sie ein Lebenszeichen erhalten, eine Postkarte mit einem Foto von Venice Beach, abgestempelt in Los Angeles. Das Signal eines Sonars von einem U-Boot aus der Tiefe des Meeres. Der Text war recht kurz gewesen: »Schick Geld.« Ein Spaß, von dem sie nicht wusste, ob er nicht doch ernst gemeint war. Seither herrschte Funkstille.
Absolute Funkstille.
Sie erinnerte sich mit einem Mal an die letzte Strophe, die ihr eben nicht eingefallen war:
Blåmann, Blåmann, komm jetzt bald,
bleib nicht in dem finstren Wald.
Blåmann, Blåmann, darfst nicht tot sein,
bist doch das liebe Böckchen mein.
KAPITEL 2
Freitag. Wert.
Die Pressekonferenz fand wie üblich im Parolesaal des Polizeipräsidiums statt. Die Uhr an der Wand zeigte drei Minuten vor zehn. Mona Daa, Kriminalreporterin bei der Zeitung VG, hatte bereits Platz genommen und wartete mit den anderen darauf, dass die Vertreter der Polizei das Podium betraten. Der Medienansturm war mit mehr als zwanzig Journalisten für einen Freitagabend ziemlich groß. Sie hatte kurz mit ihrem Fotografen diskutiert, ob ein Doppelmord auch doppelt so gute Verkaufszahlen brachte oder ob auch hier das Ertragsgesetz galt. Ihr Fotograf meinte, wichtiger als die Quantität sei die Qualität: Das Opfer sei jung, norwegischer Abstammung und überdurchschnittlich attraktiv. Allein deshalb würden sie mehr Klicks bekommen, als wenn ein wegen Drogenmissbrauch vorbestraftes Pärchen von Mitte vierzig ermordet worden wäre. Oder zwei – ja vielleicht sogar drei – Einwandererkinder aus dem Straßengangmilieu.
Mona Daa konnte dem nur zustimmen. Und vorläufig war sowieso nur eine der beiden vermissten jungen Frauen mit Sicherheit tot. Realistisch gesehen war es aber wohl nur noch eine Frage der Zeit, bevor man sicher wusste, dass auch die andere Frau dasselbe Schicksal erlitten hatte. Und beide waren jung, norwegischer Abstammung und attraktiv. Besser ging es also eigentlich nicht. Trotzdem wusste sie nicht so genau, was sie davon halten sollte. War das Mitgefühl für junge, unschuldige Opfer, die keine Chance hatten, wirklich größer? Oder ging es um die üblichen Dinge, die auch sonst zu Klicks führten: Sex, Geld und ein Leben, wie die Leser es sich selbst wünschten.
Apropos sich selbst wünschen, was andere haben. Sie musterte einen Mann Mitte dreißig in der Reihe vor ihr. Terry Våge vom Dagbladet trug das klassische Hipster-Flanellhemd und Gene Hackmans Pork Pie aus French Connection. Wenn sie doch nur seine Quellen hätte. Seit Beginn dieses Falls hatte er eine Kopflänge vor allen anderen gelegen. So hatte Våge als Erster darüber berichtet, dass Susanne Andersen und Bertine Bertilsen auf demselben Fest gewesen waren. Und er hatte eine Quelle zitiert, nach der Markus Røed der »Sugardaddy« der beiden jungen Frauen gewesen war. Mona ärgerte das, schließlich waren sie Konkurrenten. Abgesehen davon ging ihr seine bloße Anwesenheit auf den Geist. Als hörte er ihre Gedanken, drehte er sich um, sah sie direkt an und legte breit grinsend den Finger an die Krempe seines idiotischen Huts.
»Er mag dich«, sagte der Fotograf.
»Ich weiß«, erwiderte sie.
Våges Interesse an Mona hatte mit seinem für alle überraschenden Comeback als Kriminalreporter begonnen. Sie hatte den großen Fehler gemacht, auf einem Seminar – ausgerechnet über Presseethik – nett zu ihm zu sein. Da die anderen Journalisten Våge scheuten wie der Teufel das Weihwasser, hatte er ihr Verhalten als Einladung gedeutet. Danach hatte er sich mehrmals bei ihr gemeldet und um Tipps oder Ratschläge gebeten. Als wäre sie interessiert daran, für einen Konkurrenten die Mentorin zu spielen oder überhaupt mit einer Person wie Terry Våge Umgang zu haben. Schließlich wussten alle, dass die Gerüchte, die über ihn kursierten, zumindest teilweise wahr waren. Aber je abweisender sie zu ihm gewesen war, desto aufdringlicher war er geworden. Am Telefon, in den sozialen Medien, ja sogar im Biergarten war er wie aus dem Nichts aufgetaucht. Natürlich hatte es wie immer eine ganze Weile gedauert, bis sie begriffen hatte, dass er sich wirklich für sie interessierte. Mona war bei den Männern nie die erste Wahl. Dafür sorgten ihr gedrungener Körperbau, ihr breites Gesicht und ihre traurigen Haare – wie ihre Mutter immer so liebevoll gesagt hatte. Und der angeborene Hüftschaden, der sie wie ein Krebs laufen ließ. Ob sie mit Krafttraining angefangen hatte, um das alles zu kompensieren, wussten allenfalls die Götter. Inzwischen war ihr Körper noch gedrungener, dafür stemmte sie jetzt hundertzwanzig Kilo und hatte den dritten Platz bei den nationalen Bodybuildingmeisterschaften errungen. Und weil sie auf die harte Tour gelernt hatte, dass man nichts geschenkt bekam, war sie immer charmanter, humorvoller und tougher geworden, sodass sie mittlerweile jedes Püppchen in den Schatten gestellt und den inoffiziellen Thron als Kriminalprinzessin erobert hatte – und Anders. Von diesen beiden Dingen war Anders ihr wichtiger. Wenigstens ein bisschen. Aber egal. Auch wenn das Interesse, das ihr andere Männer wie dieser Våge entgegenbrachten, für sie neu und schmeichelhaft war, hatte Mona keine Lust, es weiterzuverfolgen. Sie glaubte, Våge gegenüber Klartext geredet zu haben – wenn auch nicht mit Worten. Aber er schien nur das mitzubekommen, was er mitbekommen wollte. Manchmal, wenn sie seine großen, immer starrenden Augen sah, fragte sie sich, ob er irgendwas genommen hatte oder nicht ganz richtig im Kopf war. Eines Abends war er in einer Kneipe aufgetaucht und hatte ihr, als Anders auf der Toilette war, leise, aber doch gut hörbar zugeraunt: »Du gehörst mir.« Sie hatte so getan, als hätte sie ihn nicht bemerkt, aber er war mit einem selbstsicheren Grinsen einfach in ihrer Nähe geblieben, als teilten sie von nun an dieses süße Geheimnis. Der Teufel sollte ihn holen. Sie hatte echt keinen Bock auf Drama, deshalb hatte sie Anders auch nichts gesagt. Wobei Anders damit klargekommen wäre, das wusste sie. Was bildete dieser Våge sich eigentlich ein? Dass ihr Interesse an ihm wuchs, weil er als Kriminalreporter aus der Poleposition startete? Dass dem so war, stand außer Frage. Also ja, wenn sie sich etwas wünschte, das andere hatten, dann, wieder an erster Stelle zu stehen und nicht Teil des Rudels zu sein, das Terry Våge hinterherhechelte.
»Wo kriegt er die Informationen her? Was glaubst du?«, flüsterte sie dem Fotografen zu.
Er zuckte mit den Schultern. »Vielleicht erfindet er sie wieder.«
Mona schüttelte den Kopf. »Nein, was er schreibt, hat Hand und Fuß.«
Markus Røed und dessen Anwalt Johan Krohn hatten nicht einmal versucht, Våges Artikel anzufechten, was Bestätigung genug war.
Aber Våge war nicht immer das Alphamännchen unter den Kriminalreportern gewesen.
Die alte Geschichte klebte noch immer an ihm, und daran würde sich wahrscheinlich auch niemals etwas ändern. Damals war es um Genie gegangen, einen retro glam rock act à la Suzi Quatro, für diejenigen, die sich an sie erinnerten. Die Sache lag jetzt fünf oder sechs Jahre zurück, und Våge hatte sich Lügengeschichten über Genie ausgedacht und sie drucken lassen, aber das Schlimmste war, dass er ihr nach einem Fest Rohypnol verabreicht und dann angeblich versucht hatte, mit ihr zu schlafen. In dieser Zeit hatte er für eine große Gratiszeitung über Musik geschrieben. Er hatte sich Hals über Kopf in die Teenagerin verliebt, war aber trotz seiner regelmäßigen begeisterten Lobeshymnen ein ums andere Mal von ihr abgewiesen worden. Trotzdem war es ihm immer wieder gelungen, auf ihren Konzerten und den nachfolgenden After-Show-Partys aufzutauchen. Bis zu dem Abend, an dem er den Gerüchten zufolge etwas in ihren Drink gekippt und sie dann in sein Zimmer im Hotel getragen hatte, wo auch die Band untergekommen war. Nur dass die Musiker kapiert hatten, was dort vor sich ging, und in sein Hotelzimmer geplatzt waren, als er Genie bereits aufs Bett gelegt und damit begonnen hatte, sie langsam auszuziehen. Sie hatten Terry Våge so gründlich zusammengeschlagen, dass er einen Schädelbruch erlitten und mehrere Monate im Krankenhaus gelegen hatte. Die Band und Genie waren offensichtlich der Meinung gewesen, ihn damit genug gestraft zu haben, oder sie wollten nicht riskieren, selbst zur Verantwortung gezogen zu werden. Auf jeden Fall war der Vorfall von keiner der beiden Seiten angezeigt worden. Mit den guten Besprechungen war es danach aber vorbei. Neben schrecklichen Verrissen über all ihre musikalischen Unternehmungen schrieb Terry Våge jetzt über Genies Untreue und ihren Drogenmissbrauch. Er kam ständig angeblichen Plagiaten auf die Spur und behauptete, dass sie ihre Band unterbezahlte und sich mit falschen Angaben Konzertzuschüsse erschlich. Als für ein Dutzend dieser Anschuldigungen vor dem Presserat Beschwerde eingelegt wurde, kam schnell heraus, dass Våge einen Großteil der Geschichten schlichtweg erfunden hatte. Er wurde entlassen und galt in den folgenden fünf Jahren als Persona non grata in der norwegischen Presselandschaft. Wie er es geschafft hatte, wieder Fuß zu fassen, war allen ein Rätsel. Andererseits war auch das vielleicht zu erklären. Er hatte kapiert, dass er als Musikjournalist ein für alle Mal erledigt war, und stattdessen einen Kriminalblog begonnen, der eine immer größere Anhängerschaft gefunden hatte. Schließlich hatte man bei der Zeitung Dagbladet entschieden, dass man einem jungen Journalisten kein Berufsverbot erteilen dürfe, nur weil er zu Beginn seiner Karriere mal einen Fehler gemacht habe. Sie hatten ihn als Freelancer eingestellt – einen Freelancer, der gerade mehr Zeilen bekam als alle anderen, fest angestellten Journalisten der Zeitung.
Våge drehte sich erst von Mona weg, als die Polizei den Saal betrat und die Plätze oben auf dem Podium einnahm. Zwei waren von der Osloer Polizei, Katrine Bratt – Hauptkommissarin im Dezernat für Gewaltverbrechen – und Pressesprecher Kedzierski, ein Mann mit einer Dylan-Mähne. Die beiden anderen waren vom Kriminalamt, Ole Winter, der Ermittlungsleiter, der etwas von einem Terrier hatte, und der immer perfekt gekleidete und frisierte Sung-min Larsen. Die Zusammenarbeit von Gewaltdezernat, in diesem Vergleich der Volvo, und Kriminalamt, dementsprechend der Ferrari, schien bereits beschlossene Sache zu sein.
Die meisten Journalisten reckten ihre Handys in die Höhe, um die Pressekonferenz zu filmen, während Mona Daa sich handschriftliche Notizen machte und das Fotografieren ihrem Kollegen überließ.
Wie erwartet erfuhren sie nur, dass die Leiche in der Østmarka gefunden worden war, einer Wandergegend in der Nähe der Haltestelle Skullerud, und dass die Tote als die vermisste Susanne Andersen identifiziert werden konnte. Die Polizei ermittelte wegen Mord, konnte derzeit aber noch keine Details zu Todesursache, Tathergang, Verdächtigen und so weiter liefern.
Es folgte das übliche Spielchen. Es hagelte Fragen der Journalisten, und vor allem Katrine Bratt antwortete stereotyp mit »Kein Kommentar« oder »Darauf können wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Antwort geben«.
Mona Daa gähnte. Anders und sie wollten zum Start ins Wochenende eigentlich noch essen gehen, aber das konnten sie jetzt vergessen. Sie machte sich zu dem, was gesagt wurde, Notizen, hatte aber das Gefühl, das alles schon einmal gehört zu haben.
Vielleicht fühlte Terry Våge dasselbe. Es sah so aus, als notierte er sich nichts, und auch sein Handy war aus. Er saß einfach nur entspannt auf seinem Stuhl und beobachtete alles mit einem selbstzufriedenen, beinahe triumphierenden Lächeln, als hätte er längst die Antworten auf alles, was ihn interessierte. Auch den anderen schien langsam der Eifer abhandenzukommen. Als Pressesprecher Kedzierski Luft holen wollte, um die Pressekonferenz zu beenden, reckte Mona ihren Bleistift in die Höhe.
»Ja? VG«, sagte Kedzierski. Seine Miene gab Mona klar zu verstehen, dass sie sich kurzfassen sollte. Schließlich wartete das Wochenende.
»Haben Sie das Gefühl, ausreichend kompetent zu sein, sollte sich herausstellen, dass der Täter noch einmal töten wird, dass wir es also mit einem …«
Katrine Bratt beugte sich vor und fiel ihr ins Wort:
»Wir haben, wie gesagt, noch keine Anhaltspunkte dafür, dass es einen Zusammenhang zwischen diesem Todesfall und eventuellen anderen kriminellen Handlungen gibt. Und was die gesammelte Kompetenz von Gewaltdezernat und Kriminalamt angeht, wage ich zu behaupten, dass sie in Anbetracht dessen, was wir aktuell über den Fall wissen, ausreicht.«
Mona notierte sich die Formulierung der Dezernatsleiterin: was wir aktuell wissen. Und dass Sung-min Larsen auf dem Stuhl neben ihr weder genickt noch anderweitig zu erkennen gegeben hatte, was er in Sachen Kompetenz dachte.
Die Pressekonferenz wurde beendet, und Mona und die anderen traten raus in den milden Herbstabend.
»Was glaubst du?«, fragte der Fotograf.
»Ich glaube, dass sie froh sind, eine Leiche zu haben«, antwortete Mona.
»Hast du froh gesagt?«
»Ja. Susanne Andersen und Bertine Bertilsen sind schon zwei oder drei Wochen tot. Die Polizei weiß das, abgesehen von dem Fest bei Røed hat sie aber nicht die geringste Spur. Also, ja, ich glaube, sie sind froh, wenigstens mit einer Leiche ins Wochenende zu gehen und darüber zu weiteren Erkenntnissen zu gelangen.«
»Mann, Mann, Mann, du bist ganz schön kalt, Daa.«
Mona sah ihn überrascht an. Dachte nach und ließ sich seine Worte auf der Zunge zergehen.
»Danke«, sagte sie.
Um Viertel nach elf hatte Johan Krohn in der Thomas Heftyes gate endlich einen Parkplatz für seinen Lexus UX 300e gefunden. Kurz darauf stand er vor dem Haus, in das sein Mandant Markus Røed ihn bestellt hatte. Der fünfzig Jahre alte Anwalt galt unter Kollegen als einer der vier besten Verteidiger in Oslo. Wegen seiner Präsenz in den Medien hielten die meisten ihn aber für die Nummer eins. Da er mit wenigen Ausnahmen prominenter als seine Mandanten war, machte er eigentlich keine Hausbesuche. Seine Klienten kamen in die Kanzlei in der Rosenkrantz’ gate, und das in der Regel zu den normalen Bürozeiten. Wobei das mit den Hausbesuchen so eine Sache war, denn dort, wo er jetzt stand, wohnte Røed eigentlich gar nicht. Tatsächlich wohnte er in einem zweihundertsechzig Quadratmeter großen Penthouse in der obersten Etage eines der neuen Gebäude in der Oslobucht.
Wie telefonisch eine halbe Stunde zuvor instruiert, drückte Krohn auf die Klingel mit dem Namen von Røeds Gesellschaft, Barbell Immobilien.
»Johan?«, ertönte Markus Røeds Stimme. Er klang etwas atemlos. »Vierter Stock.«
Der Öffner summte, und Krohn drückte die Tür auf.
Der Fahrstuhl sah derart klapprig aus, dass er die Treppe nahm. Breite Eichenstufen und ein Geländer, das eher an Gaudí als an eine ältere, exklusive norwegische Stadtvilla erinnerte. Die Tür im vierten Stock stand offen. Von drinnen kamen Geräusche, die nach Krieg klangen, was sich als richtig herausstellte, als er das Wohnzimmer betrat und das blaue Licht sah. Vor einem großen Fernsehbildschirm, der mindestens hundert Zoll messen musste, standen drei Männer. Sie wandten ihm den Rücken zu. Der eindeutig größte von ihnen, der Mann in der Mitte, trug eine VR-Brille und hielt einen Controller in den Händen. Die beiden anderen, sie mochten etwa Mitte zwanzig sein, betrachteten den Bildschirm, um zu sehen, was der Mann mit der VR-Brille sah.
Darauf zu erkennen war ein Schützengraben aus dem Ersten Weltkrieg, falls Krohn die Helme der deutschen Soldaten richtig deutete, die auf sie zustürzten und auf die der Mann mit der Spielkonsole das Feuer eröffnet hatte.
»Yeah!«, rief einer der jungen Männer, als der Kopf des letzten Deutschen im Helm explodierte und der Soldat zu Boden ging.
Der große nahm die VR-Brille ab und drehte sich zu Krohn um.
»Das wär dann schon mal erledigt«, sagte er zufrieden grinsend. Markus Røed war ein für sein Alter attraktiver Mann. Das Gesicht war breit, der Blick spitzbübisch, die immer gebräunte Haut glatt und die nach hinten gekämmten, schwarz glänzenden Haare dicht wie bei einem Zwanzigjährigen. Er hatte ein paar Kilos zu viel, war aber so groß, dass sein Bauch noch als passabel durchging. Als Erstes fielen die leuchtenden, lebhaften Augen auf, die etwas derart Energisches hatten, dass die meisten Kunden erst seinem Charme erlagen, sich dann manipuliert fühlten und Markus Røed schließlich einfach nur leid waren. Bis dahin hatte er aber längst bekommen, was er wollte, sodass es ihm egal war, wenn sie sich von ihm abwandten. Røeds Energielevel war ebenso schwankend wie seine Laune. Krohn nahm an, dass beides mit dem weißen Pulver zu tun hatte, von dem er noch Spuren unter einem von Røeds Nasenlöchern ausmachen konnte. Johan Krohn war sich all dessen bewusst, er nahm es einfach hin. Nicht weil Røed darauf bestanden hatte, ihm den anderthalbfachen Satz seines sonst üblichen Honorars zu zahlen, um sich, wie er gesagt hatte, Krohns ungeteilte Aufmerksamkeit, seine Loyalität und unbändigen Willen zu sichern, alle gesetzten Ziele auch zu erreichen. Sondern weil Røed sein Traummandant war: ein Mann, der in der Öffentlichkeit stand, ein Milliardär mit einem derart schwierigen Image, dass Krohn neben seinem Mandanten paradoxerweise eher mutig und prinzipientreu wirkte als opportunistisch. Dafür musste er im Gegenzug ertragen, dass er – solange diese Sache ungeklärt war – an einem Freitagabend einbestellt wurde.
Die zwei jüngeren Männer verließen den Raum, nachdem Røed ihnen ein Zeichen gegeben hatte.
»Kennst du War Remains, Johan? Nicht? Ein verdammt gutes VR-Spiel, aber du kannst da keinen erschießen, wie bei dem hier. Das hat mir der Entwickler geschickt, damit ich investiere …« Røed nickte in Richtung Fernseher, nahm eine Karaffe und schenkte Cognac in zwei Kristallgläser. »Das Spiel versucht, die Magie von War Remains zu kopieren, einem zusätzlich aber die Möglichkeit zu geben – nun sagen wir –, den Lauf der Geschichte zu beeinflussen. Denn das ist es doch, was wir wollen, nicht wahr?«
»Ich bin mit dem Auto da«, sagte Krohn und wehrte mit der Hand ab, als Røed ihm ein Glas reichen wollte.
Røed sah Krohn einen Augenblick lang an, als verstünde er den Einwand nicht. Dann nieste er kräftig, ließ sich in einen Barcelona-Ledersessel fallen und stellte beide Gläser vor sich auf den Tisch.
»Wessen Wohnung ist das?«, fragte Krohn und nahm in einem der anderen Sessel Platz. Sofort bereute er die Frage. Als Anwalt war es in der Regel besser, so wenig wie möglich über seine Mandanten zu wissen.
»Meine«, sagte Røed. »Ich nutze sie … du weißt schon … wenn ich mich mal zurückziehen möchte.«
Markus Røeds Schulterzucken und sein verschmitztes Lächeln erzählten Krohn den Rest. Er hatte schon andere Mandanten mit ähnlichen Wohnungen gehabt. Und während eines außerehelichen Abenteuers, das glücklicherweise mit der Erkenntnis geendet hatte, dass er einiges zu verlieren hatte, hatte er selbst einmal erwogen, sich eine, wie ein Kollege gesagt hatte, Junggesellenbude für Männer, die keine Junggesellen mehr sind, zu kaufen.
»Was passiert jetzt?«, fragte Røed.
»Susanne ist identifiziert worden, und es ist mittlerweile klar, dass sie ermordet wurde. Die Ermittlungen gehen damit in eine neue Phase. Du musst darauf vorbereitet sein, dass sie dich wieder zu einem Verhör bitten.«
»Dann werde ich noch mehr in der Öffentlichkeit stehen?«
»Außer die Polizei findet am Tatort oder bei der Leiche etwas, das dich entlastet. Darauf sollten wir hoffen.«
»Ich dachte mir schon, dass du so etwas sagen würdest. Aber ich kann nicht länger still dasitzen und einfach nur hoffen, Johan. Barbell Immobilien sind in den letzten vierzehn Tagen schon drei große Deals geplatzt. Wegen irgendwelcher fadenscheiniger Argumente, dass man auf ein höheres Angebot warte, und so weiter. Keiner wagt es, mir ins Gesicht zu sagen, dass das alles mit diesen Artikeln im Dagbladet über mich und die jungen Frauen zu tun hat. Sie wollen nicht mit einem möglichen Mörder in Verbindung gebracht werden, oder sie haben Angst, dass ich im Gefängnis lande und Barbell Immobilien den Bach runtergeht. Wenn ich einfach so dasitze und darauf hoffe, dass diese unterbezahlten Polizeischlafmützen ihre Arbeit machen, ist meine Firma möglicherweise bankrott, bevor sie etwas finden, das mich entlastet. Wir müssen proaktiv handeln, Johan. Wir müssen der Welt zeigen, dass ich unschuldig bin. Oder zumindest muss erkennbar sein, wie sehr mir daran gelegen ist, dass die Wahrheit ans Licht kommt.«
»Wenn du meinst.«
»Wir müssen eigene Ermittler anheuern. Die besten. Und idealerweise den Mörder finden. Auf jeden Fall muss deutlich werden, dass ich bestrebt bin, für Aufklärung zu sorgen.«
Johan Krohn nickte. »Lass mich mal den Advocatus Diaboli spielen, no pun intended.«
»Schieß los«, sagte Røed und nieste.
»Zum einen arbeiten die besten Ermittler für das Kriminalamt, weil sie dort besser bezahlt werden als im Dezernat für Gewaltverbrechen. Selbst wenn die bereit wären, eine sichere Karriere für einen kurzen Auftrag in den Wind zu schießen, hätten sie eine Kündigungsfrist von drei Monaten plus Schweigepflicht, was diese aktuellen Vermisstenfälle angeht. Was sie praktisch für uns unbrauchbar machen würde. Zum anderen wäre eine solche Ermittlung der bestellte Auftrag eines Milliardärs, und damit würdest du dir einen Bärendienst erweisen, denn selbst wenn es deinen Ermittlern gelingen sollte, irgendwelche Fakten zu präsentieren, die dich reinwaschen, würden diese Ergebnisse sofort angezweifelt werden, und das wäre nicht der Fall, wenn die Polizei zu diesen Ermittlungsergebnissen kommen würde.«
»Ah.« Røed lächelte und wischte sich die Nase mit einem Papiertaschentuch ab. »Ich mag es, dass jemand mein Geld wert ist. Eine sehr gute Analyse der Problemlage. Und jetzt beweis mir bitte, dass du der Beste bist, sag mir, wie ich diese Probleme lösen kann.«
Johan Krohn richtete sich in seinem Sessel auf. »Danke für das Vertrauen. Aber das ist wirklich eine knifflige Sache.«
»Weil?«
»Es gibt da vielleicht tatsächlich jemanden, der uns möglicherweise helfen kann. Jemanden, der früher schon hervorragende Arbeit geleistet hat.«
»Aber?«
»Er ist nicht mehr bei der Polizei.«
»Nach allem, was du gesagt hast, sollte das doch ein Vorteil sein.«
»Nur dass er aus den falschen Gründen nicht mehr bei der Polizei ist.«
»Und die wären?«
»Wo soll ich anfangen. Illoyalität. Grobe Dienstvergehen. Trunkenheit, er ist Alkoholiker, Drogenmissbrauch. Er ist schuld am Tod von mindestens einem Kollegen, wurde aber nie belangt. Kurz gesagt, er hat vermutlich mehr Kriminelles auf dem Kerbholz als die meisten Kriminellen, die er eingebuchtet hat. Und dann soll es auch noch die Hölle sein, mit ihm zusammenzuarbeiten.«
»Nicht schlecht. Und warum erwähnst du ihn trotzdem?«
»Weil er der Beste ist. Und weil er auch aus einem anderen Grund sehr nützlich sein könnte.«
»Wie meinst du das?«
»Durch all die Fälle, die er gelöst hat, ist er auch öffentlich bekannt. Vermutlich als einziger Ermittler. Und er gilt als kompromisslos, als ein Mann mit einer Scheißegal-Integrität. Das mag übertrieben sein, aber die Menschen lieben solche Narrative. Bei diesem Image würde wohl kaum der Verdacht aufkommen, dass seine Ermittlungen gekauft und bezahlt sind.«
»Du bist wirklich jeden Penny wert, Johan Krohn.« Røed grinste. »Den brauchen wir!«
»Das Problem ist …«
»Nein! Biete einfach mehr, bis er Ja sagt.«
»… dass niemand zu wissen scheint, wo er sich gerade aufhält.«
Røed nahm das Glas in die Hand, trank aber nicht, sondern starrte unzufrieden in die Flüssigkeit. »Was meinst du mit ›gerade‹?«
»Manchmal treffe ich jobbedingt Katrine Bratt, die Leiterin des Dezernats, in dem er gearbeitet hat. Als ich mich einmal nach ihm erkundigt habe, hat sie gesagt, dass sein letztes Lebenszeichen aus einer verdammt großen Stadt gekommen sei. Sie wusste aber weder, wo er in dieser Stadt lebt, noch, was er da so treibt. Sie hörte sich nicht sonderlich optimistisch an, was diesen Mann angeht, um es mal so zu sagen.«
»Moment mal. Jetzt mach keinen Rückzieher, wo du mir den Typ gerade erst so angepriesen hast, Johan! Wir brauchen diesen Mann, das spüre ich. Also finde ihn.«
Krohn seufzte. Sein Ehrgeiz hatte ihn mal wieder mit voller Fahrt in die Zeig-mir-dass-du-der-Beste-bist-Falle tappen lassen, die Markus Røed vermutlich jeden zweiten Tag aufstellte. Und mit dem Fuß im Fangeisen gab es kein Zurück mehr. Er würde ein paar Telefonate führen müssen. In Gedanken ging er den Zeitunterschied durch. Okay, sicher war es das Beste, sofort loszulegen.
KAPITEL 3
Samstag
Alexandra Sturdza wusch sich routiniert und gründlich die Hände, als sollte sie einen lebenden Menschen und keine Leiche untersuchen, während sie im Spiegel über dem Waschbecken ihr Gesicht betrachtete. Ihre Gesichtszüge waren hart, ihre Haut von Akne gezeichnet. Die streng nach hinten gekämmten und zu einem Dutt gefassten Haare waren rabenschwarz. Sie würde bald die ersten grauen Strähnen entdecken. Ihre rumänische Mutter war schon mit Mitte dreißig grau geworden. Norwegische Männer fanden ihre braunen Augen feurig – was sie besonders dann waren, wenn einer von ihnen ihren kaum hörbaren Akzent nachzumachen versuchte. Wenn jemand sich über ihr Heimatland lustig machte, was nicht so selten vorkam, erwähnte sie immer, dass sie aus Timişoara kam, der Stadt in Europa, die 1884 als erste eine elektrische Straßenbeleuchtung hatte. Ganze zwei Generationen vor Oslo. Nachdem sie als Zwanzigjährige nach Norwegen gekommen war, hatte sie innerhalb von sechs Monaten die Sprache gelernt und parallel drei Jobs gehabt. Während ihres Chemiestudiums an der NTNU hatte sie einen dieser drei Jobs geschmissen, und jetzt schrieb sie parallel zu ihrer Arbeit am Rechtsmedizinischen Institut ihre Doktorarbeit über DNA-Analyse. Manchmal, allerdings nicht oft, fragte sie sich, was Männer an ihr anzog. Ihr Gesicht konnte es nicht sein und sicher auch nicht ihre direkte, manchmal raue Art. Auch nicht ihr Intellekt und ihr Lebenslauf, auf die meisten Männer wirkte das eher bedrohlich als anmachend. Sie seufzte. Ein Mann hatte einmal gesagt, ihr Körper sei wie eine Mischung aus Tiger und Lamborghini. Schon komisch, wie ein derart geschmackloser Kommentar falsch und okay klingen konnte, ja sogar wohltuend, je nachdem, von wem er kam. Sie drehte den Wasserhahn zu und ging in den Obduktionssaal.