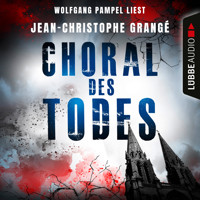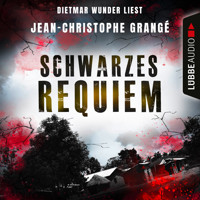20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tropen
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine Stadt in Flammen. Ein Mörder auf Mission. Während der Pariser Studentenproteste wird die brutal zugerichtete Leiche einer jungen Frau gefunden. Arrangiert in einer Yogapose. Ihr Freund Hervé und sein Halbbruder Mersch, ein Polizist, werden in die Ermittlungen verwickelt. Da taucht eine zweite Leiche auf: wieder in einer Yogapose, wieder eine Freundin von Hervé. Will ihm jemand eine blutige Botschaft senden? Die Spur des Mörders führt um die halbe Welt bis nach Indien. Doch die schockierende Wahrheit, die Hervé dort findet, reicht noch viel weiter. Paris, 1968: Die Straßen brennen, die staatliche Ordnung scheint ausgehebelt. Mitten in diesem Chaos findet der ebenso kluge wie wütende Student Hervé die Leiche seiner Freundin Suzanne. Sie hängt grausam ermordet in einer Yogapose von einem Balken in ihrer Wohnung. Hervé bittet seinen Halbbruder und Polizisten Mersch um Hilfe. Gemeinsam stoßen sie mit Nicole, einer Freundin des Opfers, auf eine Spur, die sie tief in die spirituellen Bewegungen Indiens führt. Doch als eine weitere Freundin von Hervé ermordet und in einer Yogapose arrangiert wird, ahnen die drei: Der Mörder hat es auf Hervé selbst abgesehen. Nur warum? Eine erbarmungslose Jagd um den Erdball beginnt, an deren Ende sich das Böse unter einer Maske aus Glaube und Macht offenbart. »Eine ebenso blutige wie nervenzerreißende Verfolgungsjagd.« Paris Match
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 766
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Jean-Christophe Grangé
Blutrotes Karma
Thriller
Aus dem Französischen von Ina Böhme
Tropen
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Tropen
www.tropen.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Rouge Karma«
© 2023 by Editions Albin Michel, Paris
Für die deutsche Ausgabe
© 2024 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte sowie die Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i.S.v. § 44b UrhG vorbehalten
Cover: Zero-Media.net, München
unter Verwendung eines Fotos von © Cynthia Russo/Arcangel Images, Farbeffekt: FinePic®, München
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-50248-0
E-Book ISBN 978-3-608-12374-6
I
Die Aufständischen
1
Wie ein olympischer Diskuswerfer tauchte Hervé Jouhandeau aus dem Nebel auf, in seiner Hand ein Pflasterstein. Manchmal hatte er keine Hemmungen, sich mit einem antiken Athleten zu vergleichen.
Sein tränenverschleierter Blick fiel auf den kaum einhundert Meter entfernten Polizeikordon. Helme mit Zieraufsatz, gegürtete Regenmäntel und Schilde, die wie Mülleimerdeckel aussahen …
In einer Tränengaswolke blieb er stehen, straffte den Körper, hob seinen rechten Arm und legte sich den Pflasterstein auf die Schulter.
Ein Stadionheld.
»Los, Hervé!«
»Mach sie alle!«
»Voll an den Kopf!«
Ganz allein stand der junge Mann auf der von Abfällen übersäten Fahrbahn und strahlte. Er war der Erbe einer ganzen Reihe von Aufständen: 1789, 1832, 1848, die Pariser Kommune … Die Franzosen hatten die Revolution im Blut, ihre Geschichte stand im Zeichen von Gewalt und ausgeprägtem Anspruchsdenken. Und Hervé war ihr neuer Held!
Er ließ den Arm kreisen und zögerte den Angriff so lange wie möglich hinaus. Gleich kriegt ihr eins auf die Rübe. Er fühlte sich leicht wie sein Pflasterstein, groß wie das Hurrageschrei in seinem Rücken, bedrohlich wie der Krawall hier, in der Rue de Lyon.
Einen Augenblick später glaubte er zu hören, wie sein Geschoss auf einen Helm prallte. Volltreffer. Ein bogenförmiger Wurf, der die ersten Reihen ausgespart und weiter hinten sein Ziel gefunden hatte: den Kopf eines gesichtslosen Bullen.
Hahaha! Es war Gewalt ohne Sinn und Verstand. Die seltsame Genugtuung, alles kaputtzumachen, einfach so, aus reinem Vergnügen. Und die kindliche Freude daran, voll ins Schwarze getroffen zu haben, wie beim Büchsenwerfen … Hinter ihm Jubel. Hervé bekam Gänsehaut. Vor zwei Monaten, im März 1968, hatte der New Yorker Künstler Andy Warhol geschrieben: »In Zukunft wird jeder für fünfzehn Minuten berühmt sein.« Seine Viertelstunde war zweifellos gekommen.
Für den Bruchteil einer Sekunde blieb er reglos stehen. Es war stickig, giftige Dämpfe hingen in der Luft. Der Boden war von losen Pflastersteinen, brennendem Abfall und Wasserpfützen übersät – alles, wirklich alles roch nach Weltuntergang. This is the end, beautiful friend …
Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Unter einem Regen aus ploppenden »Kartoffelschleudern« und heulenden Granaten drehte sich Hervé um und eilte auf den Hügel von Bauschutt, aufgetürmten Gemüsekisten und Baumschutzgittern zu, der die Straße versperrte. Er kletterte auf den Hügel, schürfte sich das Knie auf und sauste auf der anderen Seite wieder hinunter. Applaus.
Unter seiner dicken Pulloverschicht, die ihn vor den Schlagstöcken schützen sollte, kam er vor Hitze beinahe um. Begeisterungsrufe. Er konnte nicht mehr klar denken: Wo war er hier eigentlich? Welcher Tag war heute? Mit all den Demonstrationen, Streiks und Vollversammlungen flogen die Tage nur so dahin, lösten sich die Kalenderblätter wie die Samen flockiger Pusteblumen … Seit Anfang des Monats war es wirklich schwierig, sich zu orientieren.
Ach ja, richtig: Heute, am 24. Mai 1968, hatte um 19 Uhr an der Gare de Lyon wieder eine Versammlung stattgefunden. Wer sie organisiert hatte, war nicht ganz klar. Vermutlich die »Bewegung 22. März«, außerdem der Studentenverband UNEF (natürlich) und die Marxisten-Leninisten. Thema des Tages war das Aufenthaltsverbot für Daniel Cohn-Bendit, der nach seinem sensationellen Auftakt an der Spitze des Aufstands nach Deutschland gereist war, um wieder zu Kräften zu kommen. Es hieß, seine Auszeit sei von Paris-Match finanziert worden, als Gegenleistung für ein paar Fotos. Das soll mal einer verstehen …
Die Behörden hatten die Gunst der Stunde genutzt, um ihn zur Persona non grata auf französischem Boden zu erklären. Ganz schlechte Idee. Es war ein Tiefschlag gewesen, der Öl ins Feuer gegossen hatte. Sofort war die nächste Demonstration angekündigt und von Arbeiterscharen und Filmstars unterstützt worden, um Cohn-Bendits Rückkehr nach Frankreich zu fordern. Aber warum an der Gare de Lyon? Ein Rätsel.
Ob Schicksalsschlag oder strategischer Angriff: Noch am selben Abend hatte Charles de Gaulle eine Radioansprache gehalten. Um 20 Uhr standen die Demonstranten vor dem Uhrenturm und lauschten ihrem alten Präsidenten. Zittrige Stimme, monotone Sprechweise: Es war die Rede eines Besiegten. De Gaulle schlug eine Volksabstimmung vor, die über seinen Rücktritt entscheiden sollte. Die Antwort von der Straße kam prompt. Unzählige Menschen holten ihre Taschentücher hervor und grölten: »Adieu, de Gaulle!«
Dann machte sich eine gewisse Unentschlossenheit breit. Keiner kannte sich rechts der Seine besonders gut aus. Sollten sie hierbleiben? Ins Quartier Latin zurückkehren? Nach Hause gehen? Eigentlich hätten sie ihre Versammlung brav auflösen müssen, aber seit einigen Wochen war niemand mehr brav in Paris. Die Franzosen hatten sich auf ihre Identität zurückbesonnen.
Die Menschenmasse ergoss sich in die Rue de Lyon und skandierte: »RÜCKTRITT, DE GAULLE!«, »COHN-BENDIT NACH FRANKREICH!«, »WIR SIND ALLE DEUTSCHE JUDEN!«
Hervé ging an der Spitze. Er hätte nicht sagen können, wie viele heute Abend marschierten, aber sie waren ein einziger riesiger Sprechchor. Zehntausend, zwanzigtausend, dreißigtausend Menschen vielleicht … Ein Meer von Gesichtern, Transparenten und Schlachtrufen, das wie glühende Lava auf die Bastille zuströmte.
Der Triumphmarsch war keine fünfhundert Meter weit gekommen, als die Gendarmerie ihn stoppte. Nun ging es weder vor noch zurück.
Ein Stück weiter vorn warteten auf der Place de la Bastille Polizeiwagen, Löschfahrzeuge, Bulldozer … Die Sicherheitskräfte würden kurzen Prozess mit den Demonstranten machen. Trotzdem war die Stimmung gut. Kein bisschen beeindruckt, diese Studierenden. Mit Spitzhacken, Spaten und Schaufeln, die sie wer weiß woher hatten, hebelten sie im Nu die ersten Pflastersteine aus der Straße, kippten Autos um und türmten Gemüsekisten auf. Der Müll, der sich in Paris allerorts angehäuft hatte, seit die Müllabfuhr streikte, nährte das Feuer. Auf die Barrikaden, Genossen! Die Polizeibeamten rührten sich nicht. Sie warteten auf Anweisungen.
Da folgte Hervé seinem Impuls und eröffnete den Ball …
Die ersten Verletzten traten den Rückzug an. Aufgeschürfte Gesichter, gebrochene Knochen … Einer wimmerte: »Mein Auge, mein Auge …«, ein anderer spuckte rötlichen Schleim. Hervé schaute nach oben. Demonstranten saßen auf den Dächern und lösten Ziegel, sogar Schornsteine. Um jedes Durchkommen zu verhindern, feuerten die Polizisten von den Bahngleisen gegenüber nicht nur Tränengas-, sondern auch Splittergranaten. Ja, heute Abend waren sich beide Seiten einig: Es musste Blut fließen …
»Die sind doch krank!«
Trivard sah erschrocken aus. Trivard war Hervés bester Kumpel, ein schlaksiger Kerl mit schwarzen Locken. Wenn er wie jetzt die Augen aufriss, schienen sie ihm fast aus dem Kopf zu springen. Er trug stets einen Dufflecoat, der ihm viel zu groß war. Er verstand nichts von den Postulaten der Studierenden, und genauso wenig konnte er mit den Forderungen der Arbeiter anfangen.
»Jetzt ist es echt so weit!«
Die Bemerkung war von Desmortiers gekommen, dem Klügsten im Dreierbunde. Ein stämmiger, in Kampfjacke gekleideter Bursche mit Boxernase und großen, stahlblauen Augen. Er hatte eine sanfte Stimme, aber eine unverblümte Ausdrucksweise. Er sammelte Plakate, die im Atelier populaire der Kunstakademie gedruckt wurden, verbrachte seine Nachmittage auf den Vollversammlungen im Audimax der Sorbonne und hatte den Kopf voller leninistischer, trotzkistischer, maoistischer und situationistischer Theorien. Keiner verstand, wovon er sprach – am wenigsten er selbst.
Hervé nickte müde. Seine Euphorie war schon wieder abgeflaut. Ein tolles Team waren sie … Drei Trottel, die unter dem Vorwand des Demonstrierens fröhlich Pflastersteine durch die Gegend warfen.
»Was machen wir jetzt?«, fragte ihn Trivard, der dem Glauben aufsaß, Hervé sei ihr Anführer.
»Wir müssen aufs linke Ufer zurück!«, entgegnete Desmortiers.
»Wir sitzen aber doch hier fest!«, stöhnte Trivard.
Beim geringsten Anlass breitete er seine Arme aus und flatterte mit seinen Raglanärmeln, die aussahen wie riesige Fledermausflügel.
Hervé dachte an die einfachste Lösung: nach Hause gehen und Gute Nacht, die Herrschaften …
In diesem Augenblick färbte sich alles rot.
»Angriff!«
Der Ruf hallte entlang der Barrikade wider wie ein tausendfaches Echo.
»ANGRIFF!«
Die Sicherheitskräfte feuerten eine rote Leuchtpistole ab, bevor sie in die Offensive gingen. Allgemeine Panik. Alle Studenten wichen gleichzeitig zurück. Hervé war fasziniert von dem radikalen Kurswechsel. Ein bloßes Zischen am Himmel, und die, die gerade noch Helden gewesen waren, verwandelten sich in davonlaufende Angsthasen. Die Stampede hatte etwas Abstoßendes. Das sollte die Revolution sein?
Anstatt sich dem Rückzug anzuschließen, kletterte Hervé auf einen Mauervorsprung und legte sich flach auf den Bauch. Er wollte die Eskalation sehen. Die Angreifer – rötlich schimmernde Helme, enganliegende Regenmäntel, gezückte Schlagstöcke – bewegten sich im Sturmschritt vorwärts, brachten den Boden und die Nerven zum Zittern. Was für ein Spektakel!
Hervé hatte gelernt, sie auseinanderzuhalten: die Polizei in ihren Khakijacken und langweiligen Faltenhosen, die Gendarmerie, die von Kopf bis Fuß in dunkles Tintenblau getaucht war, und die CRS mit ihren Fliegerbrillen und den viel zu schweren Schilden.
Trotzdem fand er sie großartig. Diese Art von Rausch mussten alle Soldaten der Welt erlebt haben. Die französische Polizei reihte sich unter die alten Haudegen der napoleonischen Garde ein, unter die legendären Frontsoldaten des Ersten Weltkriegs.
»Was ist, kommst du?«, brüllte Trivard.
Hervé schob sein Tuch wieder über die Nase und schloss zu den beiden Freunden auf, die in Richtung Gare de Lyon türmten.
»Nein, hier entlang!«, bestimmte Hervé.
Wenn sie die Straße links nahmen, konnten sie die Place de la Bastille vermeiden. Hervé kannte die Gegend wie seine Westentasche. Er lebte seit seiner Geburt bei seiner Großmutter an der Porte de Vincennes, und jeden Donnerstag fuhr er zum Lux-Bastille, um sich einen Film anzusehen.
Bald war es wieder dunkel und ruhig um sie herum. Sie liefen hinunter zum Port de l’Arsenal, an den vertäuten Booten vorbei, und setzten sich erschöpft an den Kanal. Dort ließen sie die Beine über dem Wasser baumeln und sprachen nicht mehr, rangen nur noch nach Atem und verfielen in eine sonderbare Schwermut.
Das Plätschern der Wellen gegen die Bootsrümpfe und das Klappern der Wanten waren wie aus einer anderen Welt, der Lärm der Straßenkämpfe wie ein ferner Traum.
Hervé ließ den Rücken auf das feuchte Pflaster sinken. Er zündete sich eine Disque Bleu an und schloss die Augen. Nach dem Eifer des Gefechts musste er wieder daran denken, wie belanglos das ganze Theater doch war. Eines war sicher: Die aktuellen Ereignisse würden als riesige Farce in die Geschichte eingehen.
2
Angefangen hatte alles ein Jahr zuvor auf dem Campus der Universität Paris-Nanterre. Der Grund: Den Jungen war der Zutritt zu den Schlafsälen der Mädchen verwehrt worden. Die Lächerlichkeit dieser »großen Sache« hatte den Ton angegeben, und die Dinge sollten nicht wieder ins Lot kommen.
März 1968. Aus Protest gegen den Vietnamkrieg schlägt ein Kommando junger Leute die Schaufenster des Firmensitzes von American Express ein. Die Randalierer werden festgenommen. So weit nichts Ungewöhnliches. Da einer von ihnen jedoch in Nanterre studiert, besetzt eine Handvoll Studierender aus Protest das Verwaltungsgebäude der Fakultät und gründet die »Bewegung 22. März«. Ihr Anführer ist ein durchaus sympathisches Großmaul: Daniel Cohn-Bendit.
»Befreit unsere Genossen!«, so lautete die Parole. Der erste Schritt auf dem Weg zu einer Logik, die Schule machen sollte: Man wollte zwar alles kaputtmachen, aber unter keinen Umständen die Konsequenzen tragen.
Die Behörden hatten beide Augen zugedrückt. Die Vandalen waren freigelassen, die Fakultätsbesetzung vergessen worden. Doch die »Wütenden« hatten sich damit nicht zufriedengegeben. Graffiti an den Wänden, Störungen der Vorlesungen, Megafongegröle … Hervé ballte die Fäuste in der Tasche: Die Hartnäckigkeit, mit der die Studierenden ohne echte Forderungen die öffentliche Ordnung gestört hatten, immer in der unausgesprochenen Überzeugung, »Revolutionäre« zu sein, ärgerte ihn zutiefst. Nun denn.
Anfang Mai hatte der völlig entnervte Dekan die Universität geschlossen. Was war da los? Diesen Machtmissbrauch konnten die Rebellen nicht einfach so hinnehmen. Dieselben Leute, die den Lehrbetrieb gestört hatten, ertrugen die Vorstellung nicht, dass selbiger eingestellt wurde: Hatten sie doch jetzt keinen Tummelplatz mehr.
Im Nu waren sie in den Ehrenhof der Sorbonne gezogen, um auch dort ihre Anklagepunkte zu äußern. Niemand hatte ihnen zugehört, doch am späten Nachmittag hatte der Dekan, weitaus ungeduldiger als sein Kollege in Nanterre, die Polizei gerufen, um diese Grünschnäbel loszuwerden.
Rauswurf. Feststellung der Identitäten. Beim Anblick der polizeilichen Maßnahme hatten sich die Studierenden und Gymnasiasten der Gegend, die zu der Zeit auf dem Nachhauseweg waren, spontan zusammengeschlossen und denselben Refrain skandiert: »Befreit unsere Genossen!«
Handfeste Straßenkämpfe, herausgehebelte Pflastersteine, brennende Fahrzeuge. Die unerwartete Gewaltbereitschaft hatte die Sicherheitskräfte überfordert. Sie hatten Verstärkung gerufen. Die Schlachten hatten bis spät in die Nacht angehalten. Es hatte Verletzte auf beiden Seiten und natürlich Festnahmen gegeben.
Das Feuer war entfacht. Es musste nur noch genährt werden. Am 6. Mai wurden Daniel Cohn-Bendit und einige seiner Mitstreiter wegen des Radaus, den sie in Nanterre veranstaltet hatten, vor den Disziplinarausschuss der Sorbonne gestellt. Wieder ein Skandal. Und wieder kam es zu Demonstrationen und Straßenkämpfen.
Die Aufständischen hatten sogar noch mehr zu bieten. Am 10. Mai wurde denen, die eine Woche zuvor festgenommen worden waren, der Prozess gemacht. Die meisten kamen frei, aber manche wurden zu harten Strafen verurteilt: zwei Monate Gefängnis. Das genügte, um erneut alle auf die Straße zu spülen. Die Sorbonne ist dicht? Wir machen das ganze Stadtviertel dicht!
Sie teilten sich auf, errichteten Barrikaden. Hervé geriet in den Strudel der Ereignisse. Er erinnerte sich an die seltsame Begeisterung, mit der er die Rue Le Goff und die Rue Gay-Lussac verwüstet hatte, an die kriegerische und gleichzeitig euphorische Atmosphäre. Natürlich gab es blutige Nasen und verletzte Kommilitonen, aber das Hochgefühl überwog …
In jener Nacht wurde Hervé beinahe verhaftet. Er lief weg, kletterte über die Barrikaden und rannte weiter. Über die Rue Saint-Jacques konnte er entkommen. Am nächsten Tag bot die Umgebung der Sorbonne ein Bild der völligen Zerstörung. Die Aufständischen waren zufrieden. Keiner erinnerte sich daran, dass ihre Gewalt einen einzigen Ursprung gehabt hatte: die Verurteilung von ein paar Clowns, die das Stadtviertel ja vorher schon demoliert hatten.
Hervé verstand die Kettenreaktion zwar nicht, ließ sich aber mitreißen. Zumal sich die Studierenden und die Gesellschaft seltsam einig waren. Die breite Masse unterstützte die Forderungen der Jugend. Welche das waren? Keiner wusste es.
Die nächste Überraschung war, dass die Medien von den »Ereignissen« nur die Polizeigewalt aufgriffen. Kein Wort darüber, dass eigentlich die Studierenden den Ärger suchten. Nichts über die Verwüstungen, die die Protestierenden anrichteten. Stattdessen herrschte eine Art stillschweigende Übereinkunft darüber, dass die Studierenden unschuldig waren und man sie in Ruhe lassen sollte.
Hervés Problem war, dass er Geschichte studierte. Er hatte sich mit den Aufständen der Vergangenheit beschäftigt. Eine Macht zu stürzen, hieß scharfe Munition abzubekommen, verhaftet, gefoltert und hingerichtet zu werden. Und dazu war man erst imstande, wenn man keine Wahl mehr hatte, wenn man Hunger litt und die Unterdrückung wirklich unerträglich war.
Deshalb war er zwar bereit, ein paar Pflastersteine zu werfen, aber mit den Opfern der Kommune zu wetteifern, an Castros Machtübernahme oder die chinesische Kulturrevolution anzuknüpfen, das kam nicht infrage. Die Scharmützel auf dem Boulevard Michel auf eine Stufe zu stellen mit den echten Tragödien, die Tausende Tote gefordert hatten, war geradezu skandalös.
Als Premierminister Georges Pompidou am 11. Mai von einer Afghanistanreise zurückgekehrt war, hatte er sofort beschwichtigende Maßnahmen ergriffen: Wiedereröffnung der Sorbonne, Freilassung der Studierenden … Doch es war bereits zu spät. Die Arbeiter waren in den Streik getreten und besetzten die Fabriken. Ein paar Tage später folgten die Angestellten, die Beamten und Freiberufler. Frankreich war gelähmt, und das Schlimmste war: Es gab kein Benzin mehr!
Der Arbeitskampf war für Hervé legitimer. Aber, um ganz ehrlich zu sein, auch der interessierte ihn nicht. Noch weniger sogar. Lohnerhöhungen, Arbeitszeiten, Gewerkschaften und der ganze Kram waren ihm piepegal. Darin unterschied er sich wenig von den Akademikersöhnchen, die im Fieber des Populismus behaupteten, die Arbeiter zu verteidigen, aber kaum in der Lage gewesen wären, mit ihnen auch nur mittagzuessen.
In diesen chaotischen Zeiten ging Hervé gern spazieren. Wer lachen wollte, flanierte am besten durch die Sorbonne, wo einen der Gipfel der unfreiwilligen Komik erwartete. Seit ihrer Wiedereröffnung wurde dort behauptet, die Universität verwalte sich jetzt selbst. Komitees, Ausschüsse und Vollversammlungen organisierten den Lehrbetrieb. Es gab eine Krankenstation, eine Kinderkrippe, einen Ordnungsdienst … Auch fürs Essen war gesorgt, es wurde Geld eingetrieben, es wurden Vorräte angelegt …
Vor allem aber wurde gekämpft.
Im Ehrenhof waren Stände aufgebaut worden, an denen es Flugblätter, Zeitungen oder Debatten gab. Maoisten, Trotzkisten, Marxisten-Leninisten, Situationisten und Anarchisten: Alle waren sie da. Der schiere Irrsinn ließ Hervé innerlich lachen. Schon die Ereignisse (Demonstrationen, Straßenkämpfe) waren nicht leicht verdaulich, aber das Drumherum (Gedankengut, Theorien, Kommentare) war geradezu unerträglich.
Er wusste nicht, was diese Aktivisten studierten, aber eins war sicher: Geschichte war es nicht. Warum sonst ließen sie sich von Lenin inspirieren, der so viel Blut an den Händen hatte? Oder von Che Guevara, der als Held gefeiert wurde, obwohl er einen ziemlich nervösen Finger am Abzug gehabt haben soll? Oder von der chinesischen Kulturrevolution, über die keiner, wirklich keiner die Wahrheit wusste?
»So. Wollen wir los?«
Desmortiers war aufgestanden. Ihn, den Fanatiker, der für Streitereien brannte, langweilte der Waffenstillstand am Kanal.
»Wohin?«, fragte Trivard und steckte sich eine Gauloise an.
»Ans linke Ufer. Da geht’s bestimmt ab.«
Sie machten sich auf den Weg in Richtung Quai Henri-IV. Im nächsten Augenblick wurden sie von einer Gruppe Aufständischer überholt, die mit Eisenstangen und Steinschleudern auf den Boulevard Bourdon zurannten.
»Was ist los?«, schrie Desmortiers.
»Alle zur Börse! Der Kapitalismus ist tot!«
Desmortiers, der wie ein jungfräulicher Boxer aussah, schien die Antwort wie ein Schlag zu treffen: Es war so offensichtlich! Trivard dagegen schlug die Hände vors Gesicht.
Die Börse …, dachte Hervé. Ja, warum nicht?
3
Hervé Jouhandeaus Aussehen täuschte. Groß, schlank und blond, wie er war, erinnerte seine gesamte Erscheinung an den »Grand Duduche«, diese populäre Comicfigur von Cabu, nur ohne Brille. Er war zweiundzwanzig Jahre alt und eigentlich ganz hübsch, nur etwas hager. Er selbst hasste sein Äußeres. Zum Glück verliehen ihm seine Mick-Jagger-Lippen, wie er fand, eine gewisse Sinnlichkeit.
Hervé war ein Beau. Die richtige Kleidung war für ihn eine Frage von Leben und Tod. Baudelaire hatte einmal gesagt, ein wahrer Dandy müsse vor dem Spiegel schlafen. Hervé war der Meinung, ein wahrer Dandy dürfe überhaupt nicht schlafen. Die Eleganz lag nicht nur in jeder Jackenfalte, sondern auch in jedem Augenblick: Es galt, immer wachsam zu sein.
Allerdings beschränkte sich seine Garderobe auf eine einfache Cordjacke, ein paar Oxfordhemden, eine ausgebeulte Jeans mit aufgerissenen Knien und ein Paar Londoner Clarks. Der Teufel steckte im Detail. Ein Ring hier, ein Halstuch da … Er wollte die Kenner ansprechen, die Stilbewussten auf dem Campus.
Der Campus … Die Unwägbarkeit der Einschreibung hatte ihn an die neue Fakultät in Nanterre verbannt, obwohl er ja an der Porte de Vincennes wohnte. Jeden Morgen musste er sich der Metrolinie 1 aussetzen, um völlig erschöpft sein Ziel zu erreichen: den Bahnhof La Folie, Complexe universitaire.
Paris-Nanterre war damals etwas Besonderes. Ein Gebäudekomplex, der innerhalb kürzester Zeit auf einem ehemaligen Militärgelände unweit des größten Armenviertels des Pariser Umlands errichtet worden war. Dieses Brasília im Westentaschenformat empfing paradoxerweise die gesamte Hautevolee des Pariser Westens, mitten im sozialen Brennpunkt.
Hervé, der aus einfachen Verhältnissen stammte, fiel es nicht leicht, sich in die Welt der reichen Sprösslinge zu integrieren. Sie waren für Jura oder Wirtschaft eingeschrieben, während er Geschichte und Philosophie studierte. Er verachtete diese Grünschnäbel in Mokassins, insgeheim aber beneidete er sie.
Fassen wir also zusammen: Hervé Jouhandeau war ein langer, schmaler Kerl, der sein halbes Leben in der Metro verbrachte und, ähnlich wie ein Taucher seine Sauerstoffflasche, zwei Geisteswissenschaften auf dem Buckel trug. So weit alles klar?
Das alles war gelogen.
Oder zumindest nicht ganz richtig.
Das Studium war für Hervé nur ein Hobby oder eine lästige Pflicht, jedenfalls etwas, was ihn nicht gerade begeisterte. Trotz hervorragender Leistungen blickte er mit Gleichgültigkeit, ja Verachtung auf die Welt der Professoren, der Studierenden und der Vorlesungen.
Natürlich war Hervé ein kluger Kopf, vielleicht sogar ein Ausnahmetalent. Sein Scharfsinn machte ihn besonders, anders und auch ein wenig unheimlich. Nicht zu vergleichen mit dem Intellekt der anderen Studierenden, die bei jeder neuen Idee zappelig wurden wie die Kugel in einer Trillerpfeife, oder mit den Professoren, die im Gegensatz dazu starr, verstaubt und muffig wirkten.
Was ihn stattdessen beschäftigte?
Die Mädchen.
Sein Steckenpferd war die Leidenschaft. Dabei war er weder Playboy noch Schürzenjäger. Eher ein Goldgräber, ein Pionier auf unbekanntem Terrain. Hervé suchte die große Liebe. Die wahre Liebe, die ewige Liebe, in Alexandrinern und Leuchtbuchstaben …
Im Jahr 1968, als alle jungen Männer einen Vulkan in der Unterhose hatten, war das urkomisch. Aber niemand kann aus seiner Haut. Hervé setzte seine Suche trotz zahlreicher Abfuhren fort. Ehrlich gesagt, erfolgreich war er nie. Aber anstatt ihn zur Verzweiflung zu bringen, beflügelten ihn seine Rückschläge und stärkten seinen Pioniergeist. Ein Konquistador der Liebe …
Manchmal kamen ihm dennoch Zweifel. Insbesondere, wenn er die echten Verführer sah, die ein Mädchen nach dem anderen eroberten. Die meisten waren dumm, oberflächlich und langweilig. Warum kamen sie so gut an? Und weshalb wollte er unbedingt so sein wie sie?
Nicht zu vergessen der Verdacht, der daraus folgte: Wer an Idioten Gefallen fand, konnte selbst keine Leuchte sein. Hervé war in einem Teufelskreis gefangen: Er, das Ass, der Überflieger, strebte danach, ein Depp zu werden, um dämliche Mädchen zu verführen.
Was folgte daraus?
Nichts folgte daraus.
Er wollte seinen Platz an der Sonne. Er gierte danach, sehnte sich danach, malte sich das Glück in den schönsten Farben aus. Er hatte keine Angst, den ganzen Nachmittag zu verträumen und dabei auf dem Plattenspieler »A Whiter Shade of Pale« von Procol Harum oder »Nights in White Satin« von The Moody Blues zu hören. Gar kein Problem. Er verlor sich in seinen Schwärmereien, und das war gut. Es war groß. Sein Credo: In der Melancholie liegt das Glück.
Jedes Mal, wenn er unverrichteter Dinge von einer Party kam – einer Fete, wie man damals sagte –, fragte er sich: Wo ist meine jugendliche Leichtigkeit geblieben? Meine Unbekümmertheit? Mein Optimismus? Eines Abends war er nach abermals erfolgloser Jagd in Tränen ausgebrochen. In jener Nacht hatte er im Schatten einer Toreinfahrt gesessen und wirklich darüber nachgedacht, dem Ganzen ein Ende zu bereiten …
Am nächsten Tag war er wieder voll einsatzbereit gewesen.
Natürlich hatte er schon alles probiert, was enthemmend wirkte: Alkohol, Cannabis … Die Wirkung war jedes Mal erschreckend gewesen. Alkohol vertrug er nicht. Haschischkonsum hatte bei ihm nur Unwohlsein und Übelkeit zur Folge. Das Wichtigste fehlte ihm ohnehin: Unbeschwertheit. Er war eine tragische Figur. Daran ließ sich nichts ändern.
Seine Rettung, die Kraft, die ihn bislang vor dem Schlimmsten bewahrt hatte, war die Musik. Die Zeiten waren weder politisch noch lethargisch: Sie waren rockig. Man musste sich allerdings einigen. Es gab richtigen und falschen, guten und schlechten, britischen und französischen Rock. Vergesst die Beatmusik, die Radiosendung »Salut les copains« und anderen Pipifax. Scheißt sogar auf die Beatles und die Beach Boys mit ihren Mädchenstimmen.
Hervé hörte Rock, echten, harten Rock: The Rolling Stones, The Kinks, The Yardbirds und so weiter. Kreischende E-Gitarren, raue Riffs und elektronische Verzerrungen, die einem durch Mark und Bein gingen. Dies war das Einzige, was ihn glücklich machte.
Als ihm seine Großmutter einen Teppaz gekauft hatte, einen Plattenspieler mit eingebauten Lautsprechern und Röhrenverstärker, hatte er wie ein Zelebrant die Vinylscheibe auf dem Plattenteller platziert. Er hatte noch das anfängliche Knistern im Ohr. Zitternd hatte er dagestanden und die rotierende schwarze Scheibe angestarrt …
Und plötzlich das Riff.
»All Day and All of the Night« von den Kinks.
So etwas hatte Hervé noch nie gehört. Und noch nie gefühlt. Er spürte Vergnügen, natürlich, und Ergriffenheit, aber nicht nur. Dies war der Sound einer neuen Welt. Einer Welt, in der sich die Tragik seiner Jugend, seine Angst und seine Unzufriedenheit in höchsten Genuss auflösten. Er hatte sein Gegengift gefunden. Die Klangexplosion setzte eine Kraft frei, die alles, was ihn schmerzte oder sorgte (Wut, Furcht, Schüchternheit), in Energie, Lust und Heiterkeit verwandelte. In einen Schüttelkrampf, der seinen ganzen Körper erfasste, ihn sein ganzes Leid ausschwitzen und die göttliche Erleuchtung empfangen ließ.
Als der Song zu Ende war, spielte er ihn wieder und immer wieder. Er war wie eine Droge, eine Quelle in der Wüste, eine Frau in der Nacht … Er schwelgte in den schroffen,orgiastischen Gitarrenakkorden, die einem die Seele zerkratzten, in Ray Davies’ schleppender, nasaler Stimme, im Schlagzeug, das einem in die Rippen stieß …
Da konnten seine Kumpels noch so viele Revolutionen anzetteln, die Mädchen ihm noch so viel vor die Füße spucken: Das wahre Leben fand auf seinem Plattenspieler statt. Wie ein ferner Planet rotierte dort eine Welt in Wallung. Erinnert euch: In jenem Jahr brachten die Kinks »All Day and All of the Night« und »You Really Got Me« heraus. Ein Jahr später nahmen die Stones »(I Can’t Get No) Satisfaction« auf.
Die Geschichte weiß sich an große Ereignisse wie diese zu erinnern.
Was die anderen angeht: Wen interessiert’s …
4
Das Trio erreichte die Rue Saint-Antoine, die bald in die Rue de Rivoli überging. Überall Müll und Scherben. Kein Licht in den Fenstern. Es herrschte eine Atmosphäre der Angst, die an Ausgangssperre und Krieg erinnerte.
Die tödliche Stille wurde hin und wieder von plötzlichen Geräuschen zerrissen, von Polizeibussen mit heulenden Sirenen oder lauthals singenden Studenten, die Transparente unterm Arm trugen.
Auf der Place du Châtelet sahen sie einige hundert Meter vor sich die Anzeichen eines weiteren Straßenkampfs. Brandgeruch, flüchtige Schatten, vereinzelte Glutnester: Am Louvre ging es heiß her.
Ohne nachzudenken beschleunigten sie ihren Schritt, als würden sie jetzt, sofort, an dieser Stelle gebraucht. Die Studenten hatten bereits eine Barrikade errichtet. Die Bullen standen davor, blockierten den Verkehr und besetzten den halben Louvre-Vorplatz.
Es war eine inzwischen vertraute Szene. Die Aufständischen hatten eine Kette gebildet, um sich Pflastersteine und andere Trümmerteile weiterzureichen und damit ihre Straßensperre zu verstärken. Andere rissen Baumschutzgitter aus. Man konnte Cordjacken, Trenchcoats und Blousons erkennen, die im Schein der Flammen und Laternen glänzten. Etwas weiter entfernt, zu ihrer Linken, die orangefarbenen Streifen auf der knittrigen Regenkleidung der CRS. Hinter ihnen einsatzbereite Wasserwerfer und Bulldozer …
Hervé seufzte. Er fühlte sich außerstande, wieder die nötige Energie aufzubringen. Desmortiers und Trivaud dagegen halfen bereits den Kameraden. Er machte einen Bogen um die Barrikade und ging durch die Arkaden der Rue de Rivoli in die Rue de l’Oratoire. Dort setzte er sich in den Schatten der Statue von Admiral de Coligny, zündete sich eine neue Disque Bleu an und begann, seine Tagträume vom Port de l’Arsenal weiterzuspinnen.
Das war Hervé … Paris stand in Flammen, das Ende der Welt nahte, und er richtete den Blick nach innen und rauchte in aller Ruhe am Fuße eines Bärtigen mit Halskrause, den er immer für Heinrich IV. gehalten hatte.
Im Grunde tat er genau das am liebsten: an einem abgelegenen Plätzchen zu fernem Schlachtgetöse die Gedanken schweifen lassen. Es erinnerte ihn an das wohlige Gefühl, in seinem Kinderzimmer einzuschlafen, während seine Großmutter mit den Nachbarn zu Abend aß. Er hatte es geliebt, das gedämpfte Stimmengewirr, das ihn in den Schlaf gewiegt hatte.
Genau heute Abend wollte er sich auf seine Auserwählten konzentrieren.
Es waren drei.
Er hatte sie während der Unruhen am 10. Mai kennengelernt und auf den Demonstrationen und Vollversammlungen wiedergesehen. Ohne weiter ins Detail zu gehen: Hervé hatte sich in alle drei auf einmal verliebt. Wenn schon, denn schon.
Die Zweite, Cécile, war ernst, so zielstrebig wie ihre Schleudertechnik und so glänzend wie die Sicherheitsnadel an ihrem Kilt. Hervé mochte die Gespräche mit ihr, eine Oase der Vernunft inmitten einer Wüste von Stumpfsinnigkeit. Ihr rundes, von einem noch runderen Dutt überragtes Gesicht ließ sie wie eine Matrjoschka aussehen, die aus dem Stegreif Michelet oder Saint-Simon zitieren konnte.
Die Dritte … ah, die Dritte. Nicole war die Prinzessin unter den Favoritinnen. Eine wohlhabende, buddhistische Rothaarige, die über ein sehr heißes, sehr mächtiges kleines Reich herrschte, dessen König ihr Vater war, ein herausragender Chirurg am Hôtel-Dieu. Was sie auch tat oder sagte, immer stand sie auf den Schultern dieses großen Mannes. Davon abgesehen erwog sie, in die Politik zu gehen, und träumte einstweilen von orientalischer Spiritualität, während ihr die Männer zu Füßen lagen.
»Verdammt, was machst du hier? Wir haben dich überall gesucht!«
Vor ihm stand Desmortiers, sein Gesicht war rabenschwarz.
»Was ist los?«, brummte Hervé und schnipste seine Kippe auf den Boden.
»Herrje, wir wollen zur Börse, das ist los!«
Hervé zögerte erneut. Er konnte zu Fuß nach Hause gehen, um in Ruhe über seine drei Mädchen nachzudenken. Darüber, wie er sich ihnen am besten annäherte, um ihnen eine Liebeserklärung zu machen, um –
Desmortiers versetzte ihm, der immer noch auf dem Boden saß, einen freundschaftlichen Tritt:
»Auf geht’s, dalli, dalli! Die CRS ziehen sich schon zurück. Wir müssen uns beeilen!«
5
Sie liefen die Rue de l’Oratoire hinauf und bogen links ab in die Rue Saint-Honoré. Erneut legten sich Stille und Dunkelheit über sie. Vor den Gärten des Palais-Royal begegneten sie einigen Polizisten, die aber weder CRS noch Gendarmen waren, sondern einfaches Wachpersonal, das sich vor den schlecht beleuchteten Toren die Beine in den Bauch stand. Offenbar gab es in der Gegend viele Ministerien und Verwaltungsgebäude. Es roch nach alten Gemäuern, nach steifen Abgeordneten, nach endlos verhandelten Gesetzen und Verordnungen …
»Hier entlang!«
Trivard hatte immer einen Stadtplan in der Tasche. Keiner von den dreien kannte sich hier aus, nicht einmal Hervé, der die Grands Boulevards schon öfter nach Horrorfilmen abgesucht hatte.
Sie bogen erst nach links ab, dann drehten sie wieder um. Trivard hatte sich verlaufen. Ihre Revolution musste wirklich komisch aussehen. Mehr Groucho als Karl Marx …
Hervé hatte trotzdem seinen Spaß. Das Stadtviertel hatte den Glanz des vergangenen Jahrhunderts nicht verloren. Die überdachten Passagen, die altmodischen Kabaretts … Mit ein bisschen Fantasie fühlte man sich in die Zeit von Gustave Flaubert und Guy de Maupassant zurückversetzt, von Théâtre-Lyrique und Zylinderträgern … Davon übriggeblieben war nur ein staubiger Geschmack, aber auch etwas Tröstliches, Gemütliches. Wünschen Sie eine Droschke?
Rue Vivienne. Keine Menschenseele. Kein Licht. Vor zwei Wochen hatten hier noch alle am Fenster gestanden und den Studenten Butterbrote herausgereicht. Davon war jetzt nichts mehr zu sehen. Bloß nicht übertreiben, sonst hatten die Bürger schnell die Schnauze voll.
»Wir sind gleich da!«
In den verwaisten Straßen hallte erneut Lärm über den Dächern wider. Sie beschleunigten ihre Schritte und spürten, wie ihnen das Adrenalin durch die Adern schoss. Als sie dann in die Rue du Quatre-Septembre stürzten, sahen sie die wunderbare Bestätigung ihrer Überlegenheit. Heute Abend würde ein studentischer Wirbelsturm über das Großkapital hinwegfegen.
Tausende von Demonstranten umzingelten die Pariser Börse, die mit ihren Säulengängen wie ein griechischer Tempel aussah. Hervé fühlte sich an eine Horde tobender Heiden erinnert, die sich bereitmachten, die Statuen ihrer Götzen zu stürzen.
Und selbst in diesem Moment glaubte er nicht daran.
Natürlich, er war jung. Er hatte noch nicht viel erlebt. Aber er studierte schon lange genug Geschichte, um zu wissen, dass die Proteste zum Scheitern verurteilt waren. Der Mensch kämpft nicht für andere, noch nicht einmal für ein höheres Ziel. Er will nur sein Stück vom Kuchen. So sehr er auch davon träumt, die Welt zu verändern, es gelingt ihm ja noch nicht einmal, sich selbst zu verändern. Im Grunde seines Wesens ist er Kapitalist. Für ihn nur das Beste, für die anderen die Krümel. Das ist allgemein bekannt. Wozu also die linke Heuchelei?
Gemeinsam mit Trivard und Desmortiers stürzte sich Hervé in die Menge. Megafondurchsagen gingen im Lärm unter, eine unsichtbare Kraft ließ die Menschenmasse wie eine gewaltige Brandung hin und her wogen. Alle hatten sie den Blick auf das verflixte Gebäude geheftet, dessen Größe, Erhabenheit und Autorität sie provozierte.
Die drei Freunde drängten sich bis zu den Toren des Tempels vor. Nun standen sie einer Kette von Muskelprotzen gegenüber, den Sicherheitskräften der UNEF oder der PSU.
Plötzlich: Hektik. Hervé macht sich fast in die Hose. Es gibt keinen Ausweg. Jetzt werden sie ersticken oder zu Tode gequetscht. Die Masse drängt nach rechts, dann nach links, dann nach vorn. Die Kette von Sicherheitskräften zerreißt. Die Angreifer klettern auf die Zäune. Applaus. Hervé stolpert, steht wieder auf. Die Zäune geben nach. Sie stürmen die Freitreppe hinauf.
Oben angekommen, setzen ein paar behelmte Rowdys einen Balken als Rammbock gegen die verschlossenen Tore ein. Jetzt ist es also so weit. Es ist nicht einmal mehr ein Krieg, sondern eine mittelalterliche Belagerung, eine antike Erstürmung. Ein Getöse brandet auf und vermischt sich mit dem Ächzen der Türangeln. Hervé hat das Gefühl, von einem Erdbeben, einem Vulkanausbruch fortgerissen zu werden.
Auf einmal steht er im Palais Brongniart. Die Aufständischen schwärmen aus. Das Echo ihrer Schritte hallt tausendfach von den Wänden wider. Es wuselt nur so unter dem Gewölbebogen; es wird gerannt, gebrüllt, blindwütig zerstört.
Hervé hat Trivard und Desmortiers verloren, die schon auf dem Weg zum Herz der Maschine sein müssen: zum Börsensaal, dorthin, wo die Orders ausgeführt werden, wo die Summen täglich in die Höhe schießen wie Geysire. Papiere segeln durch die Luft, Stühle fliegen durch den Raum. Sakrileg. Schändung. Ketzerei. Der Tempel wird entweiht. Der Gott des Geldes wird gestürzt.
Hervé ist fasziniert. Er rührt sich nicht mehr. Er denkt an die Meisterwerke von Jacques-Louis David, Nicolas Poussin, Jean-Léon Gérôme, Frank Frazetta. Gleiches Chaos, gleiche Opulenz, gleiche Ästhetik.
Es werden Tische umgeworfen, Tafeln abgerissen, Stühle, Schreibtische, Papiere gestapelt … Dann: Feuer. In den beißenden Flammen knacken die Telefonkabinen.
Hervé weicht erschrocken zurück. Bloß raus hier. Bloß weg von dieser blinden Gewalt. An einer Fassade im 5. Arrondissement hat er gelesen: »Die Revolution muss ein Fest sein.« Die schlechte Nachricht: Das Fest ist vorbei. Hier riecht es nur noch nach Hass und Mordlust.
Er macht auf dem Absatz kehrt und verschwindet im Lärm der Nacht.
6
»Was sind das für Dinger?«
»Motorsägen.«
»Was machen wir damit?«
»Bäume fällen.«
»Bäume?«
»Ja. Auf dem Boulevard Saint-Michel müssen so viele Platanen wie möglich dran glauben, capito?«
Jean-Louis Mersch musterte die fünf Männer, die einen Halbkreis um ihn bildeten. Das waren weder Studierende noch Arbeiter. Das waren echte Ganoven, prinzipienlose Randalierer, die sich unter die Aufständischen gemischt hatten und nur eins wollten: sich mit den Bullen anlegen, klauen, und sich dann einen schönen Lenz machen.
Jean-Louis, vierunddreißig Jahre alt und Boss dieser Räuberbande, hatte für sein Projekt »Radikale Destabilisierung der Macht« die besten Partner gesucht. Er war an den Ordnungsdienst der UNEF herangetreten: zu brav. Er hatte die Katangais kontaktiert, ein paar Nichtsnutze, die rund um die Uhr drauf waren und eigentlich die Sorbonne bewachen sollten, stattdessen aber die Studierenden erpressten: zu blöde.
Also hatte er die Kabylen, kurz KBL, angeheuert. Die nannten sich so, weil ihr Chef behauptete, in Algerien gewesen zu sein, was Mersch sehr gewundert hätte, da er in Algerien gewesen war, und zwar nicht nur kurz.
Die KBL dealten Haschisch und andere Substanzen auf den Gängen der Sorbonne, mehr nicht. Jean-Louis hatte gleich erkannt, dass sie bestechlich waren. Er hatte ihnen ein bisschen Stoff abgekauft, den sie sich von der »offenen« Krankenstation der Sorbonne besorgt hatten.
»Die Alte Welt muss weg«, sagte er. »Nicht nur ihr Gedankengut, sondern auch ihre Grundlage, ihre Symbolik. Um was Neues aufzubauen, müssen wir alles zerstören.«
Die KBL kicherten. Einer von ihnen spuckte auf den Boden. Ein anderer zündete sich eine Zigarette an. Ein dritter ließ die Finger knacken. Mit Politik hatten sie nichts am Hut.
Sie standen an einem dunklen Eck in der Rue des Fossés-Saint-Jacques, wo Mersch die Kasten-Ente geparkt hatte, die er am Vortag gestohlen hatte. Ziemlich riskant zwar, aber die Motorsägen wogen je zwölf Kilo. Sie hätten unmöglich mit solchen Brocken unterm Arm durchs 5. Arrondissement spazieren können.
Er nahm eines der Geräte von der Ladefläche und hielt es ins Licht einer Straßenlaterne.
»Stihl Contras. Motorleistung: sechs PS. Siebentausend Umdrehungen pro Minute. Hobelzahnkette. Das Ding säbelt dir eine hundertjährige Eiche in weniger als sieben Minuten um.«
Die Randalierer beugten sich vor, um das Ungetüm besser sehen zu können.
»Was wir brauchen«, sagte einer schließlich, »sind echte Waffen. Wir sind doch keine Holzfäller.«
»Nur Geduld. Alles zu seiner Zeit«, log Jean-Louis.
Er spürte seinen ungeladenen Colt 45 in den Lenden. Der beißende Geruch von Kordit stieg ihm in die Nase. Eine olfaktorische Halluzination. Er war daran gewöhnt – und das Amphetamin, das er gerade noch gezogen hatte, machte es auch nicht besser.
»Du kannst also welche besorgen?«, drängte ein anderer.
»Wie gesagt, ich arbeite dran. Aber wenn wir diese Linie überschreiten, gibt’s kein Zurück mehr.«
»Nur Schwuchteln machen ’nen Rückzieher.«
Die KBL glucksten. Jean-Louis seufzte und drückte einem der Kerle die erste Motorsäge in die Hand. Dem nächsten die zweite. Insgesamt fünf.
»Jetzt lauft ihr zum Boulevard Saint-Michel und mäht dort alles nieder, was ihr erwischt. Passt aber auf, dass ihr keinen Baum auf die Birne kriegt.«
Erneutes Gelächter. Auch die KBL hatten heute Abend offenbar Cannabis und Amphetamine konsumiert. Für die soldatische Tüchtigkeit würden sie wohl ein zweites Mal ranmüssen.
»Los, haut ab. Macht mir ordentlich Rabatz.«
Schwer bepackt zogen die Männer ab. Jean-Louis blickte ihnen nach, dann machte er sich auf den Weg. Ehe er zu seiner Truppe zurückkehrte, wollte er sich umsehen. Er glaubte inzwischen, der ganze Krawall sei allein sein Werk.
Unter der Lederjacke trug er ein Funkgerät, das auf die Frequenz der Polizei eingestellt war. Das Ding, sein Talisman, ermöglichte es ihm, die Bewegungen der CRS und der anderen Ordnungshüter genau zu verfolgen. Auf der Place Edmond-Rostand tobte der Kampf, ebenso weiter nördlich auf der Place de la Sorbonne. Weitere Auseinandersetzungen fanden auf der anderen Seite des Blocks statt.
Den Kopf eingezogen, das Ohr immer am rauschenden Empfänger, huschte er in den Schatten einer Unterführung. Wie ein Hund – oder besser gesagt: wie die Silhouette eines Hundes – schlich er die Mauern entlang.
In der Rue Le Goff herrschte ohrenbetäubender Lärm. Mersch lächelte: Die Straßenschlachten hatten eine neue Dimension erreicht. Studierende, Arbeiter und Rowdys wollten die Stadt tatsächlich zerstören, und es fehlte nicht viel, bis die gereizten, erschöpften Bullen ihre Waffen zogen. Genau das erhoffte er sich. Ein ordentliches Gemetzel.
Er schob sich ein Tuch über die Nase und riskierte einen Blick in die Rue Soufflot. Pflastersteine, Schraubenbolzen und Molotowcocktails flogen durch die stinkende Luft. Schlägereien vor jedem Haus. Bewusstlose Studenten. Polizisten, die unaufhörlich auf die Angreifer eindroschen. Ein scheußlicher Anblick – aber der Preis, den sie zahlen mussten, um wirklich etwas zu verändern.
Er griff nach den Handgranaten in seiner Jacke und schleuderte eine in Richtung der Polizisten, dann noch eine in Richtung der Studenten. So gab es keinen Grund zur Eifersucht. Es waren F-1-Granaten, prallvoll mit TNT: hohe Sprengkraft. Damit konnte man Trommelfelle zum Platzen bringen, Hände abreißen und den Leuten sogar die Kopfhaut abziehen.
Dann rannte er davon, schlängelte sich durch eine Reihe Fernbusse und stieß erneut auf Behelmte und Protestierende. Niemand schenkte ihm Beachtung.
Die Rue Victor-Cousin sah aus wie ein einziger Schützengraben. Er hatte noch keine drei Schritte getan, da stolperte er über das nächste Bataillon: Reservisten auf der Place de la Sorbonne, die ihre Waffen polierten und nur darauf warteten, zum Sturm auf den Boulevard Saint-Michel anzusetzen.
Jean-Louis konnte gerade noch in einem Nebeneingang der Universität verschwinden, die seit der Besetzung durch die Studierenden Tag und Nacht geöffnet hatte. Auf einmal stand er in einem stockdunklen marmornen Gang. Die Kronleuchter verbreiteten ein schummriges Licht, kaum heller als Kerzenschein.
Kerzenschein … Jean-Louis hatte den Eindruck, in eine von Müll übersäte Kathedrale einzudringen. Scheiße. Er selbst hatte nicht studiert, und Bildungsstätten wie diese riefen Beklemmung in ihm hervor, aber die Sorbonne in diesem Zustand zu sehen, widerte ihn an.
Durch den Gang. Auf den Bänken lagen Studierende und pennten. Sie mussten einen tiefen Schlaf haben. Auf dem Boden Verpackungsmüll, Kleidungsstücke und Gemüsekisten. An den Wänden hingen Plakate mit den Konterfeien diverser Krimineller – Che Guevara, Hồ Chí Minh – oder manipulativer Diktatoren – Mao. Verdammte Idioten …
Zuvor hatte er sich den Grundriss der Sorbonne besorgt und ihn auswendig gelernt. Er wusste, dass er gerade an der Kapelle vorbei durch die Galerie Jean Gerson ging. An deren Ende würde er auf die Rue Saint-Jacques stoßen. Und sich vergewissern, dass auch dort die Fetzen flogen.
Vor Tür Nr. 54 (er wusste nicht, was die Zahl zu bedeuten hatte) stand er Auge in Auge Lenin gegenüber, der wer weiß warum dort angeschlagen war. »Das Volk braucht keine Freiheit, denn Freiheit ist eine Form der bürgerlichen Diktatur.« Ein eiskalter Schauer lief ihm über den Rücken. Er sagte sich, dass er auch nicht besser war als dieser Fanatiker. Das war der Preis dafür, dass die Ordnung wirklich ins Wanken geriet.
Im Norden wurde gekämpft, im Süden wurde gekämpft. Zahlreiche Polizisten eilten unablässig auf und ab, wodurch sie die beiden neuralgischen Punkte des nächtlichen Gefechts miteinander verbanden. Während die Granaten heulten und die Pflastersteine flogen, legten das Lycée Louis-le-Grand und das Collège de France auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine stählerne Gleichgültigkeit an den Tag. Die Jugend muss ja schließlich was erleben …
Er ging in Richtung Rue des Écoles, als unter seiner Jacke eine Stimme knisterte.
Er griff nach seinem Funkgerät und drehte den Ton auf:
»LEITSTELLE, BITTE KOMMEN! LEITSTELLE, BITTE KOMMEN! FEUER IN DER LANDESPOLIZEI! WIR SITZEN HIER FEST! WIR VERBRENNEN!«
Es waren die Jungs aus dem Polizeipräsidium im 5. Arrondissement.
Eine Grillparty bei den Bullen.
Verdammt, das musste er sehen!
7
Es war unmöglich, zur Place du Panthéon zu gelangen. Er kehrte um und stellte fest, dass auch die Rue des Écoles versperrt war. Er lief die Fassade des Collège de France entlang und bog in die Impasse Chartière ein, die zwar eine Sackgasse war und nirgendwohin führte, aber die Rue du Cimetière-Saint-Benoist kreuzte, welche vorn und hinten durch Gittertore versperrt war.
Mühelos kletterte Mersch über das Tor. Na ja, fast mühelos … Er schwitzte sich halbtot in seiner Jacke, das Funkgerät baumelte ihm um den Hals wie eine Kuhglocke, und seine Knarre klemmte ihm zwischen den Hinterbacken. Unelegant purzelte er auf die andere Seite. Vom anderen Ende des Durchgangs hallte der Tumult zu ihm herüber. Er hatte das Gefühl, durch ein Aquarium zu schwimmen.
Am Ende der Sackgasse hielt er sich an einer Regenrinne fest und kletterte auf das Zinkdach des Gebäudes. Nun musste er nur noch geschickt den Schornsteinen und Fernsehantennen ausweichen. Kein Problem. Paris lag ihm zu Füßen.
Die Topologie der Stadt im Hinterkopf, fand er die Gasse, die er gesucht hatte, und glitt an einer Weinrebe wieder zu Boden. Wilder Wein! Das kleine Sträßchen versetzte einen mitten ins 17. Jahrhundert. Genau das brauchte er jetzt, um bis zur Rue de la Montagne-Sainte-Geneviève zu gelangen, die ihrerseits im 13. Jahrhundert entstanden war.
Schließlich tauchte vor ihm das Polizeipräsidium auf. Und ein regelrechter Fall von Lynchjustiz. Die Rebellen hatten die Fassade in Brand gesteckt und bewarfen die Ausgänge mit Steinen, um die Bullen an der Flucht zu hindern. Kein Streifenwagen in Sicht und weit und breit kein Polizeicorps, das die Opfer hätte retten können.
»Mann, was macht ihr da?«, brüllte er in die Menge.
Anstatt einer Antwort bekam er Gelächter zu hören, dann Sprüche wie »Bullen am Spieß« oder »Brathähnchen«, die wohl lustig sein sollten. Mersch betrachtete die Silhouetten der Protestler, die sich dunkel gegen das rote Flammenmeer abzeichneten. Sie schwangen ihre Wurfgeschosse und wieherten beim Anblick der Männer, die drinnen verschmorten.
Mersch hatte eine Gabe. Andere würden sagen: eine Schwachstelle. Er kannte keine Zweifel, traf Entscheidungen blitzschnell und bereute sie im Nachhinein nicht. Blut: ja. Steak: nein.
Über ihm, im ersten Stock, brannte Licht. Die Büttel mussten nach oben geflüchtet sein. Mersch umrundete das Freudenfeuer und gelangte zum Hintergebäude. Veranda. Tür. Treppe. Er ging direkt ins zweite Stockwerk und öffnete das Fensterchen, das im Treppenhaus als Notausgang diente.
Es führte auf das Dach des Polizeipräsidiums. Die Teerpappe würde sehr bald schmelzen. In der Dachschräge waren Luken eingelassen. Mersch sprang ohne zu zögern, fiel auf die Knie und hangelte sich, an den First geklammert, zur ersten Luke. Der Teer war bereits kochend heiß. Die Polizisten versuchten die Scheibe einzuschlagen, doch das Glas war natürlich gepanzert und das Fenster von außen verriegelt. Sie waren Gefangene in ihrem eigenen Hauptquartier.
Während er den Steinen auswich, die wie Meteoriten durch den Nachthimmel schnitten, trat Mersch mehrmals gegen das Vorhängeschloss, das die Fensterflügel zusammenhielt.
Endlich sprang es auf. Mit einem Handgriff klappte Mersch das Fenster auf. Aus dem Korridor quoll Rauch, gefolgt von den Köpfen verängstigter Beamter. Er reichte ihnen die Hand. Eins, zwei, drei, vier arme Wichte kamen hustend, tränend und schluchzend zum Vorschein.
»Danke, Kumpel«, sagte einer der Überlebenden. »Wir schulden dir was, und zwar nicht wenig. Wer bist du überhaupt?«
»Niemand.«
»Das heißt?«
Mersch puffte ihm in die Rippen und grinste:
»Vergiss es.«
Mit diesen Worten holte er sein Funkgerät hervor und überreichte es dem Polizisten, der verrußt war wie ein Schornsteinfeger.
»Damit kannst du die Leitstelle kontaktieren. Die Frequenz ist schon eingestellt. Ruf die Feuerwehr, damit sie den Brand löschen und die Arschlöcher da unten wegschaffen.«
Mersch hatte seinen Satz noch nicht beendet, da war er auch schon in den dichten Rauchschwaden verschwunden, die die Dächer umwölkten, und hatte die benommenen Männer, deren Augen wie Flipperkugeln glühten, allein zurückgelassen.
8
»Was ist denn mit Ihnen passiert?«
Nach seiner Seiltänzernummer war Jean-Louis Mersch zur Rue Monge geeilt. In unmittelbarer Nähe der Arena von Lutetia hatte er ein Lokal gefunden, das noch geöffnet hatte. Ein Wunder.
Die Fenster des Bistros waren mit Decken verhängt, und Jean-Louis’ Gedanken schweiften zu dem Film Zwei Mann, ein Schwein und die Nacht von Paris, in dem Jean Gabin in einer Spelunke seine berühmte Schimpfkanonade loslässt: »Diese armseligen Schweine …«
»Kommen Sie aus dem Quartier Latin?«
Der Wirt musterte das verrußte Gesicht seines Gastes.
»Mhm, bin in die Demo geraten«, antwortete Jean-Louis nüchtern.
»Junge, Junge, die haben Sie ja ganz schön zugerichtet. Brennt’s da oder was?«
»Auch nicht mehr als sonst«, wich er aus.
»Junge, Junge«, wiederholte der Bistrobetreiber wenig einfallsreich. »Wollen Sie was trinken?«
»Einen Whiskey.«
»Am Tresen?«
»Nein, ich setze mich auf die Bank da drüben. Wo ist das Klo?«
»Hinten links.«
Mersch rutschte über das Sägemehl, das auf dem Boden verstreut lag, durch den leeren Raum. Er musterte sich im Spiegel über dem Waschbecken. Weder hübsch noch hässlich, aber insgesamt nicht übel. Ein Gewirr von Gesichtszügen, Falten und Muskeln unter einer Lockenmähne, die ihm in die Augen hing. Allein schon dieser eigenwillige, ablehnende Blick. Geh weiter, hier gibt’s nichts zu sehen …
Mit seinem Dreitagebart und dem aufgestellten Kragen sah er immer aus, als käme er direkt aus dem Knast – und wäre bereit, auch wieder dorthin zurückzukehren. Wie ein Ganove, zwielichtig, angsteinflößend – aber merkwürdigerweise auch anziehend, das war ihm bewusst.
Schlagartig erbrach er sich ins Waschbecken. Ach, gar nicht so viel. Er hatte schon seit – ja, seit wann eigentlich? – nichts mehr gegessen. Ein bisschen Wasser über die Augenlider, die Wangenknochen, das Zahnfleisch. Solche brenzligen Situationen hielten ihn am Leben. So war es schon in der Wüste gewesen …
Er war noch dabei, sich abzutrocknen, als ihm unwillkürlich eine Flut von Erinnerungen erneut den Magen umdrehte. Brennende Dörfer, zerschmetterte Kinderschädel, Vergewaltigungen, Elektrostöcke, die den Leuten in den Rachen eingeführt wurden, damit sie »auspackten« … Damals. Noch ein bisschen Wasser, als könnte das Grauen einfach so abgewaschen werden …
Er taumelte zurück und machte den Tisch ausfindig, an dem ihn sein Whiskey erwartete. Er leerte ihn in einem Zug, schauderte und spannte die Muskeln an, um sein Zittern zu unterdrücken. Er machte sich auf eine weitere Salve von Flashbacks aus dem Krieg gefasst, auf bunt zusammengewürfelte Fragmente, die ihm die Haare zu Berge stehen ließen.
Sein Gedächtnis zauberte ihm seine Mutter aus dem Hut.
Mersch hatte keine Kindheitserinnerungen. Erinnerungen waren etwas für Schwächlinge. Sagen wir so: Er hatte eine Mutter. Eine ganz besondere Mutter. Sie war besessen von Gott, Mitglied einer katholischen Wohltätigkeitsorganisation und von derart viel Nächstenliebe erfüllt (vor allem zu Gott), dass sie niemanden an sich heranließ. Ihr Herz war so hart und spröde wie Feuerstein. Ihr wirklichkeitsfremdes Wohlwollen war abstrakt und unheimlich.
Gott sei ihr gnädig, all das war die Schuld eines Mannes. Einer kurzen Affäre, eines Mistkerls, der sie so gewissenhaft gequält hatte, dass er innerhalb weniger Jahre (vielleicht sogar weniger Monate) ihre Seele zerschunden hatte. Nach Jean-Louis’ Geburt war er verschwunden. Übriggeblieben war, wie das Etikett auf einem Ladenhüter, nur sein Familienname.
JL (wie er gern genannt wurde) wusste rein gar nichts über seinen Vater. Ein Tabu. Ein rotes Tuch. Einmal glaubte er herausgefunden zu haben, dass er Polizist war. Ein andermal Zauberer. Aber immer, wenn er gewagt hatte, eine Frage zu stellen, hatte es geheißen, sein Vater sei tot. Oder in einer Anstalt. Oder weit weg. Irgendwann hatte er aufgegeben.
Jean-Louis war früh ins Internat gesteckt worden. Die Jesuiten hatten seiner Mutter einen guten Preis gemacht, zum Dank für die Dienste, die sie dem Herrn geleistet hatte. Er hatte seine Schulzeit auf dem Land verbracht, wo genau, wusste er nicht mehr.
Woran er sich überhaupt erinnerte? Da gab es nicht viel. Der Geruch von kaltem Bruchstein vielleicht, und von faulem Holz. Eine Art materielle Härte, eine organische Vertrautheit, die einem an der Haut klebte wie ein nasses Kleidungsstück. An den Wochenenden hatte er nicht nach Paris heimfahren wollen: Lieber in den leeren Schlafsälen zurückbleiben, als die Kirchenlieder seiner Mutter zu ertragen, das Spendensammeln an den Haustüren, diese permanente Demütigung …
»Noch einen!«
Er hatte immer noch Asche im Mund. Den Geschmack von Ruß.
Noch ein Glas, wieder auf ex.
Nach dem Abitur der Wehrdienst. Ziemlich ungewöhnlich, seine Militärzeit: Fünf Jahre nichts als Hitze und Sand in den Gebirgsketten des Atlas, des Aurès, der Kabylei. Die Schüsse der MAS-36 hatten seine Seele geschmiedet. Sollte Mersch sich je Illusionen über die Natur des Menschen gemacht haben, waren sie in diesen Jahren für immer zerstört worden.
Über die damalige Zeit kursierte eine Lebensweisheit: »Wenn du von Algerien erzählst, bist du nicht dabei gewesen.« Es gab keine Heldentaten, keine schönen Momente. Stattdessen menschliche Gräuel in sämtlichen Schattierungen. Die Menschheit war nicht mehr zu retten. Immerhin, Jean-Louis hatte ein paar Tapferkeitsmedaillen gesammelt.
Die Medaillen waren ihm mittlerweile alle abhandengekommen, aber die schmutzigen Erinnerungen, die damit einhergingen, ließen sich nicht so einfach auslöschen. Der Typ in der Meskiana-Ebene beispielsweise, der seine Gefangenen mit dem Panzer überrollt hatte. Oder der andere im Palais Klein in der Altstadt von Algier, der seine Soldaten, zwanzigjährige Bübchen, gezwungen hatte, die Frauen zu vergewaltigen, »damit das Fleisch zart wird«. Die Männer hatte man sich anders vorgeknöpft. Moumousse war gerufen worden, ein Deutscher Schäferhund von sechzig Kilo. Diejenigen mit etwas mehr Humor als die anderen nannten ihn »Unteroffizier« und führten einen militärischen Gruß aus, ehe der Köter sich um die Häftlinge kümmerte.
Abermals winkte Mersch den Kellner heran.
»Lassen Sie die Flasche hier.«
Die Flasche …
Im Truppenlager Ksar Ettir bei Oum Alène hatte ein Unteroffizier einen Gefangenen gezwungen, sich nackt auf einen Flaschenhals zu setzen, dann hatte er sich gegen dessen Schultern gestemmt, bis ihm das Glas im Anus zersprungen war.
Geschlagen, besser gesagt: gebrochen war Jean-Louis von der verbrannten Erde zurückgekehrt. Allerdings hatte er wider Erwarten eine Leidenschaft für Politik entwickelt, vor allem für den Sozialismus. Er, der das Individuum verabscheute, war bestrebt, die Menschheit als Ganzes zu retten. Und die Linke, da gab es nichts zu rütteln, war die einzige Lösung. Die Zukunft Frankreichs und sogar der ganzen Welt. Aber Vorsicht: Es musste eine besonnene und vernünftige Linke sein, stabil und ausgewogen.
Die Erleuchtung war ihm auf einem Kongress gekommen, wo Pierre Mendès France eine Rede gehalten hatte. Er, und nur er, konnte Frankreich führen. PMF war ein Antipolitiker, die Rechtschaffenheit in Person, ein Paradebeispiel für Offenheit und Redlichkeit.
Mersch hatte einen einfachen Plan: de Gaulle stürzen und Mendès France auf den Thron setzen. Mitterrand? Um den zu entlarven, musste man sich nur seine Vichy-Vergangenheit oder den albern inszenierten Anschlag auf der Avenue de l’Observatoire in Erinnerung rufen.
Seit den ersten Demonstrationen hatte sich Mersch also einem radikalen Destabilisierungsprojekt gewidmet. Im Nu hatte er die Studenten zu Widerstandskämpfern ausgebildet, ihnen Angriffstaktiken eingeflüstert und technische Ratschläge erteilt, wodurch sich die Situation immer weiter zugespitzt hatte. Mersch war ein Soldat. Er heizte die Stimmung an. Er konnte diese jungen Pappnasen in Tötungsmaschinen verwandeln.
Es musste allerdings schnell gehen. Wieder Lenin: »Die Zeit wartet nicht.« Noch konnte de Gaulle sich organisieren, noch konnte Pompidou mit den Gewerkschaftern verhandeln. Heute Nacht oder nie. Morgen würden die von den brutalen Auseinandersetzungen genervten Franzosen eine neue Regierung fordern. Dann würden die Sozialisten gewählt werden und Mendès, Ehrenmann und Friedensstifter, die Dinge in die Hand nehmen.
Noch einen Whiskey. Zusammen mit den Amphetaminen wurde das langsam zu viel. Aber es ging nun einmal nicht anders. Ohne Aufputschmittel hatte sich niemand je erhoben … Er sagte sich, dass er die Polizisten vielleicht hätte verbrennen lassen sollen, das hätte die Öffentlichkeit wachgerüttelt.
Ein Blick auf die Armbanduhr: Es war nach Mitternacht. Er steckte die Flasche in die Hosentasche und brach auf.
Wie bei dem Hüpfspiel: zurück auf »Hölle«.
9
Die KBL waren nicht untätig gewesen.
Gefällte Bäume versperrten den Boulevard Saint-Michel. Man hätte meinen können, eine Naturkatastrophe sei über die Stadt hereingebrochen. Jean-Louis lachte in sein Tuch, das er vor dem Gesicht trug. Zwar trübte der Alkohol sehr seine Wahrnehmung und seinen analytischen Scharfsinn, aber man musste kein Kirchenlicht sein, um zu kapieren, dass heute Nacht eine Grenze überschritten worden war.
Auf der Place Edmond-Rostand wurde noch gekämpft. Von seinem Standort aus konnte er die Fortschritte seiner »Schüler« begutachten. Das Kreischen der Motorsägen erfüllte die Nacht, die anhaltenden dumpfen Geräusche der Spaten und Schaufeln setzten den Kontrapunkt. Weiter so, Jungs! Die Polizisten dagegen hörten gar nicht mehr auf, ihre Tränengasgranaten zu werfen. Jean-Louis hatte den KBL gezeigt, wie sie die Explosionen abschwächen konnten, indem sie die Granaten in Pfützen stießen und einen Mülleimerdeckel darauf drückten.
Und Pfützen gab es reichlich. Wasserwerfer spritzten den Boulevard wie riesige Besenwagen ab. Die Fontänen trieben die Meute auseinander, doch die Studenten rotteten sich sofort wieder zusammen und zielten mit ihren Steinschleudern auf die Fahrer. Jean-Louis kniff die Augen zusammen und sah weiter unten, in der Rue de Médicis, etwas aufblitzen. Geflutete Schaltschränke, die knisterten und explodierten. In den schickeren Stadtteilen dürfte die Stromversorgung jetzt zu wünschen übrig lassen …
Es war immer von Pflastersteinen die Rede, was aber in Wirklichkeit überwog und den Ort dieses Armageddon bestimmte, war der Feuerregen. Unaufhörlich explodierende Molotowcocktails verbreiteten einen Geruch nach verbranntem Benzin – gut geschüttelte Wodkagläschen, die sich Schluck für Schluck über den Asphalt ergossen …
Du musst näher ran. Er war bereits von Schlacke überzogen, sein Haar schmierig von den Ausdünstungen geschmolzenen Gummis, seine Augen wie Scheinwerfer. Er leerte seine Flasche und ging ein paar Schritte. Betrunken, vom Kern der Gewalt unwiderstehlich angezogen, spürte er etwas Vertrautes, einen unheilvollen Pas de deux zwischen den einzelnen Aufständischen und dem Tod.
Im Truppenlager Ksar Ettir hatte er Ende der Fünfzigerjahre eine Bauchfellentzündung erlitten. Die einzige Erinnerung, die er davon noch hatte, war das Wundröhrchen an seinem Körper, aus dem der Eiter abgelaufen war. Dieser Mai 1968 erinnerte ihn an die entzündliche Absonderung von damals – Verdruss, Hass, Wut, all das ergoss sich auf die Straßen wie ein Wundsekret …
In der Rue de Médicis, die dem Gitterzaun des Jardin du Luxembourg folgte, schlug eine Granate neben ihm ein. Er konnte sich gerade noch auf den Boden werfen und sich einrollen. Die Explosion ließ den Asphalt erzittern, setzte aber kein Gas frei. Auch das war ein Zeichen. Man wollte die Studierenden nicht mehr zum Weinen bringen, sondern ihnen die Trommelfelle zerfetzen, die Hände abreißen …
Mersch stand wieder auf. Verwundete, die sich krümmten. Große weiße Augen blickten aus schwarzen Gesichtern. Sie erinnerten ihn an die Bilder von Hiroshima. Wer würde sich um die Kids kümmern? Ein paar Medizinstudenten hatten einen Notdienst auf die Beine gestellt, aber es war unmöglich, von der Sorbonne aus in die Rue de Médicis zu gelangen …
In diesem Augenblick tauchte auf der Höhe des Théâtre de l’Odéon eine Kasten-Ente mit roten Kreuzen auf den Türen auf. Der Wagen wendete und fuhr dann im Rückwärtsgang so dicht wie möglich an die Verletzten heran.
Jean-Louis eilte auf die beiden Männer in den weißen Kitteln zu, die jetzt ausstiegen.
»Kann ich euch helfen?«
Die Sanitäter antworteten nicht. Sie packten einen bewusstlosen Studenten unter den Armen und schleiften ihn über den nassen Boden.
Jean-Louis runzelte die Stirn. Diese Macker mit den Bürstenfrisuren waren über dreißig, ihr Format mit den Schlaksen, die durch die Hörsäle spukten, nicht zu vergleichen. Und ihre Gesichter erst …
Die Gerüchte über falsche Krankenwagen kamen ihm wieder in den Sinn. Man munkelte, die Männer vom SAC, de Gaulles Geheimpolizei, verfuhren nach dieser Masche, um Studierende zu entführen und in der Rue de Solférino zu verprügeln.
»Lasst mich doch bitte helfen«, beharrte Mersch.
»Hau ab.«
»Wie bitte?«
»Hau ab, hab ich gesagt!«
Die Typen ließen den Studenten los und pflanzten sich vor JL auf. Er warf einen Blick ins Wageninnere. Im Rückspiegel erkannte er den Fahrer: Pierre Santoni, Ex-OAS-Kämpfer, ehemaliger Zuhälter und zwielichtiger Polyp, seit vielen Jahren Mitglied des SAC.
Als bei einem der Spitzel eine Luger unter dem Kittel hervorblitzte, hatte Mersch seinen Colt 45 bereits auf ihn gerichtet. Mit der linken Hand packte er den zweiten Angreifer und stieß ihn gegen den ersten. Kurzes Getaumel. Den Kolben mit beiden Händen fest umklammert, zielte Mersch auf den Kopf des Typen ohne Deckung, während der andere sich hinter der Kasten-Ente versteckte.
Mersch kauerte nieder. Er streckte den Arm aus, stützte den Ellbogen aufs Pflaster und zielte auf die Beine. Der Mann brach zusammen, wenige Zentimeter neben Jean-Louis schlug sein Schädel auf dem Boden auf. Er drückte erneut ab, einmal, zweimal, die linke Hand schützend vors Gesicht gehalten, um keine Knochensplitter abzubekommen.
Als er wieder aufstand, brauste der Citroën schon mit klackernden Hecktüren davon. Mersch legte auf Santonis Nacken an, doch ein Wasserstrahl machte ihn blind. Er steckte die Waffe gerade wieder zurück, da brach eine Kavalkade los. Alles, was er sah, war ein auf ihn zu galoppierendes CRS-Bataillon. Er konnte noch den Arm heben, dann bekam er auch schon eins mit dem Schlagstock übergebraten.
Auf dem überschwemmten Boden liegend, rollte er sich ein und schlang die Arme um den Kopf. Er dachte an die beiden Toten in unmittelbarer Nähe. Unter ständigen Hieben kroch er ein Stück weiter. Er hatte zwar kein Problem damit, eine Tracht Prügel zu beziehen, wollte aber nicht des Mordes beschuldigt werden.
Dann nutzte er eine kurze Gefechtspause, um die Hand in seine Jacke zu schieben und seinen Dienstausweis zu zücken.
Die CRS erstarrten.
»Du … du bist Polizist?«, wollte ein Mann mit Fliegerbrille wissen.
»Wonach sieht’s denn aus, du Leuchte?«
Taumelnd kam Mersch wieder auf die Beine und wischte sich die blutverschmierte Stirn ab.
»Verzieht euch, bevor ich euch wegen Tätlichkeiten gegen einen Beamten im Dienst verklage.«
Die Haudegen stahlen sich davon. Mersch lehnte sich gegen den Gitterzaun des Jardin du Luxembourg. In seinem Körper hallten Schüsse wider. Das Blut peitschte ihm ins Gesicht und pochte ihm in der Kehle.
Er starrte auf die Leichen in ihren Magentapfützen.
Er hatte zwei Menschen getötet.
Er war wieder in Algerien.
10
»Ich habe dich die ganze Nacht gesucht!«
»Ich war nicht richtig auf dem Damm. Bin zu Hause geblieben.«
»Du hast echt was verpasst! Das war krasser als am 10. Mai.«
Nicole Bernard kramte eine Gauloise mit Filter hervor und zündete sie in aller Ruhe an. Cécile nervte sie mit ihren Vorwürfen. Am Samstag, den 25. Mai spazierten die beiden jungen Frauen in aller Frühe durch die Rue de Vaugirard. Bei dem herben, aber großartigen Geschmack des ersten Zugs schloss Nicole die Augen.
Es stimmte, sie hatte die »zweite Nacht der Barrikaden« verpasst, wie es heute Morgen schon im Radio geheißen hatte. Sie war nicht krank gewesen, konnte Cécile aber unmöglich die Wahrheit erzählen. Wie ein braves Schulmädchen hatte sie die halbe Nacht den Vortrag geübt, den sie heute halten wollte.
Nicole war sozusagen einer der Stars jener Maitage. Eine der wenigen Frauen, die ein Wörtchen mitzureden hatten. Dreiundzwanzig Jahre alt, Magister in Philosophie, aus bürgerlicher Familie, was sie sorgfältig verheimlichte, und mit einer großen Klappe gesegnet, die sie noch sorgfältiger pflegte. Seit der Unibesetzung hatten sich ihre »historischen« Redebeiträge auf den Vollversammlungen der Sorbonne vervielfacht. Ihr Renommee hatte sich über den Flurfunk herumgesprochen. Als letzte Bestätigung hatte eine Besetzungskommission ihr angeboten, heute über ein Thema ihrer Wahl zu referieren. Sie war zweifellos auf dem besten Weg, in die Geschichte einzugehen.