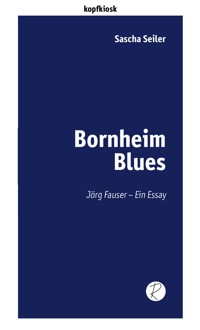
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Andreas Reiffer
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: edition kopfkiosk
- Sprache: Deutsch
Nicht nur Jörg Fausers ungewöhnlicher und früher Tod in der Nacht nach seinem 43. Geburtstag ist Stoff von Mythenbildung, auch sein bewegtes Leben und seine facettenreiche literarische Karriere sind in der deutschsprachigen Literatur einzigartig. Fauser, der stets ein Außenseiter im literarischen Betrieb war, hinterließ ein umfangreiches Werk, bestehend aus Romanen, Kurzgeschichten, Gedichten und unzähligen journalistischen Texten. Dieser Band möchte keineswegs eine Biografie Fausers sein, sondern einen – durchaus subjektiven – Blick auf sein Werk und dessen Wirkung auf die Literaturgeschichte der BRD werfen, bei gleichzeitiger Kontextualisierung mit dem künstlerischen und sozialen Klima der 60er, 70er und 80er Jahre. Dabei wirft Sascha Seiler auch einen Blick auf die scheinbaren Nischenprodukte von Fausers Kunst, etwa auf seine Songtexte oder seine öffentlichen Auftritte. Denn dem Phänomen Fauser – ein Autor, der selbst am Rand der Kulturszene und auch der Gesellschaft stand – lässt es sich am besten von ebendiesen Rändern her nähern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bornheim Blues
Jörg Fauser – Ein Essay
von Sascha Seiler
Korrekturen: Martin Willems
Die edition kopfkiosk wird gestaltet und herausgegeben von Andreas Reiffer | Bd. 09
1. Auflage 2024, identisch mit der Printausgabe © Verlag Andreas Reiffer
ISBN 978-3-910335-43-1
Verlag Andreas Reiffer, Hauptstr. 16 b, D-38527 Meine
www.verlag-reiffer.de
Für Rahel, Samuel und Levi
Vorbemerkung
Die Zitate aus Jörg Fausers Werk entstammen den verschiedenen Werkausgaben (Rogner & Bernhard, Alexander Verlag, Diogenes) und folgen keinem streng wissenschaftlichen Schema, sondern eher dem Gefühl, welche Edition dem jeweiligen Werk am besten gerecht wird.
Obwohl Bornheim Blues kein wissenschaftlicher Text sein soll, wurde bei reinen Zitaten aus Fausers Werk sowie aus der Sekundärliteratur oder ergänzenden Texten die Quelle jeweils angegeben. Da es sich um einen (zudem oft subjektiven) Essay handelt, wurden darüber hinaus Hinweise oder Paraphrasen zwar im Haupttext erwähnt, aber nicht anhand einer Endnote gesondert nachgewiesen.
Einleitung
Die Tempo-Jahre
Eine deutsche Biografie
Als ich Ende 1989 am Kiosk ein Exemplar der mir bislang nur leidlich bekannten Zeitschrift TEMPO erblickt hatte, in der auf der Titelseite ein Artikel über die »besten Platten, Filme und Bücher der 80er Jahre« angekündigt wurde, griff ich als alter Listenliebhaber ohne größeres Nachdenken zu. Im Alter von 17 Jahren und in einem Zeitalter vor dem Internet konnten solche Listen tatsächlich noch lebensverändernde Wirkung entfalten. Man erfuhr aus ihnen von Werken, deren Namen man noch nie gehört hatte, wobei das Plattenranking am Ende des Jahrzehnts, und somit zu Beginn der von Simon Reynolds Jahrzehnte später im gleichnamigen Buch ausgerufenen Retromania, bereits damals Allgemeingut war. Doch Rankings im Bereich der Literatur, sozusagen populäre Kanons jenseits von Wissenschaft und mit einer starken Betonung auf journalistischen Geschmacksfaktoren, waren seinerzeit eher selten anzutreffen. Und auch wenn der so genannte Zeitgeist-Faktor das Magazin TEMPO bisweilen eher unangenehm geprägt hat, so wurde diese Top 100, zumal die oberen Positionen, für mich in den nächsten Jahren ein Wegweiser durch die sich vor mir entfaltenden Weiten der Literatur.
Es offenbarte sich eine Welt, die sich jenseits althergebrachter Leselisten der gymnasialen Oberstufe (die heute noch schlimmer sind als damals, aber das ist eine andere Geschichte) bewegte; ein mit Sicherheit auch geschmäcklerischer Kosmos, der aber etwas berücksichtigte, was die Schule (und leider auch viel zu oft, wie ich später erfahren sollte, die Universität) vollends ignorierte: Die Kontextualisierung. Werke wirken nicht nur aufgrund ihrer Ausstrahlung als hermetisches, formvollendetes Kunstwerk, sondern als Zeichen ihrer Zeit, als historische oder soziokulturelle Marker, die entweder jenen Zeitgeist repräsentieren oder reflektieren – oder diesen mitunter auch konterkarieren, was beides zu einer weitaus befriedigenderen Lektüre führen kann als das oben aufgeführte hermetische Jahrhundertwerk.
Und in solchen Fragen war TEMPO wegweisend und brachte letztlich auch zahlreiche Journalistinnen und Journalisten hervor, die heute durchaus als Feuilletonlegenden bezeichnet werden können, unter anderem Claudius Seidl, Christoph Dallach und natürlich auch den großen Schweizer Schriftsteller Christian Kracht, der als junger Reporter bei TEMPO angefangen hat.
Genau diese Themen (sowie die Romane Krachts oder die kulturanalytischen Texte Dallachs) würde ich später als Literaturwissenschaftler jahrzehntelang verfolgen, doch zunächst stand ich etwas ratlos vor besagten TEMPO-Listen1. Auch aus heutiger Sicht ist die Plattenliste durchaus nachvollziehbar (Purple Rain, Remain In Light, The Queen Is Dead), die Filmliste etwas dem Zeitgeist geschuldet (Blade Runner, E.T., American Gigolo), weil er die Leere der 80er repräsentiert. Doch war es die Bücherliste, die mein kulturelles Rezeptionsverhalten nachhaltig beeinflusst hat.
Auf Platz Eins jener wegweisenden Liste thronte Irre von Rainald Goetz, dessen Lektüre sich für mich als anstrengend, aber prägend erwiesen hat; ein völlig neuer Zugang zur Literatur. Dieser blieb mir vom zweiten Platz, Elfriede Jelineks Die Klavierspielerin, zwar aufgrund seiner Sperrigkeit verwehrt, dafür erwies sich auch die Wahl des dritten Platzes, Salman Rushdies Die Satanischen Verse, nachträglich als kulturhistorischer, wenn auch nicht unbedingt ästhetischer, Treffer, der mir interessante Lektürestunden bescherte.
Interessant an der Liste waren aber vor allem die Texte, die, von den langen Essays zu den ersten drei Plätzen abgesehen, in kurzen, prägnanten Sentenzen die Essenz der Bedeutung des jeweiligen Werkes herausstrichen. Auf Platz 12 (immerhin mit Abbildung des Buchcovers, das die Nahaufnahme eines halbseiden wirkenden Mannes mit coolem Blick und gespiegelter Sonnenbrille zeigte) fand sich schließlich ein Buch, das aus der Liste herausstach, beschrieben mit den folgenden Zeilen:
Der kleine Gauner Blum gerät ans große Kokain. Die Jagd geht los, der Schnee verloren, doch Blum hält durch. Fauser liebte die Trinkhallenhelden, die Vorstadtdesperados. Er ist tot. Vor zwei Jahren starb er auf der Autobahn. Er war zu Fuß unterwegs.2
Die Geschichte des Romans scheint gemäß dieser wenigen, lakonischen Zeilen unspektakulär. Ein Krimi um einen unbedarften Kokain-Dealer und seine schiefgelaufenen Drogengeschäfte. Deutlich interessanter ist hierbei natürlich die kurze, aber prägnante Beschreibung des Endes einer Schriftstellerbiografie: Die unwahrscheinlichen Todesumstände des Autors scheinen wichtiger als das, was er in diesem, seinem erfolgreichsten Buch tatsächlich geschrieben hat. Gleichzeitig wird die Gleichsetzung dieses Schriftstellers mit seinen Figuren und Geschichten evoziert. Ein Mann, der die »Trinkhallenhelden« (was soll das überhaupt sein, fragte ich mich damals) und »Vorstadtdesperados« liebt, und gleichzeitig, mutmaßlich in nicht ganz nüchternem Zustand, selbst zu Fuß auf Autobahnen spazieren geht, und dort von einem, wie sich herausstellte, LKW erfasst wird, muss einfach interessante Sachen zu erzählen haben.
Eine solche Schriftstellerbiografie weckt generell mitunter großes Interesse, und der Verweis auf die Außenseiterfiguren, welche die Texte des Autors augenscheinlich bevölkern, weist bereits auf seine Ausnahmestellung in der deutschsprachigen Literatur jener Zeit hin, als die Ausläufer der sogenannten Neuen Innerlichkeit in Gestalt von Schriftstellern wie Botho Strauß oder Bodo Morshäuser noch überall zu spüren waren.
Die noch recht strikte Trennung zwischen E- und U-Literatur, gegen die sich ja vor allem Rolf Dieter Brinkmann in den 1960er Jahren (wenn man sich die 80er anschaut, augenscheinlich ohne nachhaltigen Erfolg) gewehrt hat, beherrschte durchaus noch das deutsche Verständnis von Literatur. Wenn einer wie Fauser Krimis schrieb, die sich dann auch annehmbar verkauften, der aber seine Schriftstellerlaufbahn mit experimenteller Prosa begonnen hat, in den 1970er Jahren vom amerikanischen Underground geprägte Lyrik und Storys voll hartem sozialen Realismus verfasste und sich vor allem einen Namen als ein Kulturjournalist gemacht hat, der in die dunklen, vergessenen Ecken schaut, dann mussten diese Krimis doch etwas Besonderes haben.
Tatsächlich haben sich Romane wie Der Schneemann oder Das Schlangenmaul ästhetisch langsam aus ihm herausgehäutet, und das war ein ungewöhnlicher, vom deutschen Feuilleton kaum nachzuvollziehender Weg. Zumal diese Krimis auch keine Formexperimente waren, wie sie etwa Paul Auster 1985 mehr oder weniger zeitgleich mit seinen von postmoderner Theorie unterfütterten Romanen der New York Trilogy veröffentlicht hat, sondern eine deutsche Variante der Hardboiled-Krimis eines Raymond Chandler oder Dashiell Hammett – so wie zuvor Fausers Erzählungen und Gedichte ihm zeitweilig den Ruf eines deutschen Charles Bukowski eingebracht haben.
»Einen Schriftsteller, der nicht gelesen wird, halte ich für eine pathetische und sinnlose Figur«, sagte Fauser einst, und mit seinen Kriminalromanen hat er sich davor bewahrt, genau zu jener Figur zu werden, ohne sich selbst untreu zu werden.
Aber dazu später, denn all das geht natürlich nicht aus dem TEMPO-Artikel hervor. Zunächst ging es darum, in jenen Zeiten ohne Internet mehr über diesen Jörg Fauser zu erfahren. Da bot es sich an, dass auf einem Kaufhaus-Wühltisch ein Mängelexemplar von einem anderen Fauser-Krimi mit dem Aufsehen erregenden Titel Das Schlangenmaul angeboten wurde. Die Lektüre enttäuschte mich maßlos und sorgte fast schon für das Ende meiner Beschäftigung mit Jörg Fauser: Ein (so sah ich das zumindest damals) zwar spannender, reißerisch geschriebener, auch sehr kurzweiliger Kriminalroman, allerdings voller klischeetriefender Figuren und Dialoge – ich hatte in meiner Teenager-Zeit Krimis regelrecht verschlungen und war auf diesem Gebiet noch recht versiert – und (das sehe ich auch heute noch so) einem völlig falsch konstruierten Finale, das eher an einen misslungenen Hollywood-Film erinnerte als an das Buch eines Autors, dessen Vorgängerroman das zwölftwichtigste Buch der 1980er Jahre sein sollte.3
Hier hätte meine Beschäftigung mit Jörg Fauser wie bereits erwähnt fast ein Ende gefunden, aber wie es der Zufall so wollte, fand ich in der Stadtbücherei Ludwigshafen (die ich in der Regel nicht oft frequentierte, ich habe in meinem Leben vielleicht drei Bücher gelesen, die ich mir geliehen und nicht gekauft hatte) ein Exemplar eines anderen Fauser-Romans namens Rohstoff.
Es gibt ja diese einschneidenden Erinnerungen an den ersten Kontakt mit kulturellen Phänomenen, die einen später ein Leben lang prägen und beschäftigen. Man erinnert sich schließlich meistens daran, wann, wo und wie man seine Lieblingsplatten zum ersten Mal gehört oder unter welchen Umständen man einen wegweisenden (oder vielleicht auch verstörenden) Film erstmals gesehen hat. So geht es mir mit der Lektüre von Rohstoff.
Aufgrund einer Knieverletzung konnte ich länger nicht am Sportunterricht teilnehmen, musste mich aber jedes Mal auf die Tribüne der Turnhalle setzen und zuschauen. Also fing ich während dieser Stunden an, dieses aus der Bücherei entliehene Buch von Fauser zu lesen, und obwohl ich Rohstoff in den folgenden dreißig Jahren noch mehrere Male wiedergelesen habe, sehe ich bei den anfänglichen Beschreibungen des Junkie-Viertels Tophane, mit denen der Roman beginnt, immer wieder jene miefige 80er-Jahre Turnhalle vor mir, in der ich diese für mich so wegweisenden Zeilen gelesen habe. Eine ungewöhnliche Verbindung, ja, aber sie zeigt, wie einprägsam dieser Roman für mich war. Zumal Rohstoff so vieles ist: Zunächst Junkie-Abenteuer-Roman, verwandelt er sich schnell zu einer exemplarischen deutschen Biografie der 60er und 70er Jahre, aber auch zu einer sehr individuellen Schriftstellerbiografie, als auch zu einer zynischen Auseinandersetzung mit dem deutschen Kulturbetrieb, schließlich zu einem Schlüsselroman über eine bestimmte Strömung der deutschen Literatur, zu der ich später promovieren sollte.
Anfang der 1990er Jahre gab es ja noch den Zweitausendeins-Versand sowie die dazugehörigen Läden in ausgesuchten deutschen Großstädten. Im legendären Merkheft, dem Katalog des Versands, wurde die vom exklusiv bei Zweitausendeins publizierenden Verlag Rogner & Bernhard im Jahr 1990 veröffentlichte, von einem gewissen Carl Weissner herausgegebene Gesamtausgabe der Werke Jörg Fausers angeboten, die ich mir zu Weihnachten wünschte.
Die acht Bände plus einem dünnen Zusatzband, der aus einem Interview des Autors mit dem »Studenten« (scheinbar musste man diese Information eigens hervorheben) Ralf Firle bestand, waren alleine aufgrund ihrer stilsicheren Aufmachung schon ihr Geld wert. Neun Understatement suggerierende graue Papptaschenbücher, auf die ein jeweils unterschiedliches Polaroid aufgeklebt war. Die Fotografien fassten die Themen Fausers ganz gut zusammen: Nächtliche Großstadtaufnahmen, Frauenbeine, und so weiter. Es waren zweckmäßig, jedoch schön gestaltete Bücher, die wenige Jahre später noch mal – im klassischen Zweitausendeins-Stil – in zwei Hardcover-Sammelbänden in ähnlichem Design zusammengebunden und mit einem weiteren Band ergänzt wurden, der bislang in der Ausgabe nicht enthaltende Texte enthielt und den einladenden Titel Das leise, lachende Nein trug. 2005 begann der kleine Berliner Alexander Verlag eine Gesamtausgabe herauszubringen, die als letzten Band erstmals als Fragment den unvollendeten letzten Roman Die Tournee präsentierte. Die Bände enthielten aufschlussreiche Vorworte prominenter Fauser-Leser.
Wenige Jahre später gab schließlich mit dem Schweizer Diogenes Verlag ein größerer Publikumsverlag Fausers Werk in einer weiteren Gesamtausgabe heraus, zunächst nur als Taschenbuch-Nachdrucke. Es folgte daraus allerdings die seit 2020 erscheinende, wieder anders geordnete Hardcover-Ausgabe aus dem gleichen Haus, wieder angereichert mit neuen, eigens geschriebenen Vorworten anderer Fauser-Experten und Prominenten, die auch etwas meist autobiografisches zum Autor zu sagen haben. Das macht, großzügig gezählt, ganze fünf (nach konservativer Zählung drei) Werkausgaben für einen Autor aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der beileibe nicht zum Mainstream gezählt werden kann. Zum Vergleich: Vom 1975 verstorbenen und sich in ähnlichen Rezeptionssphären bewegenden Rolf Dieter Brinkmann gibt es keine einzige, auch wenn dies mit Sicherheit auch an der schwierigen Situation in Bezug auf dessen Nachlassverwaltung liegen mag.
Wenn aber, wie oben erwähnt, Kulturschaffende in der neuesten Werkausgabe vornehmlich ihre eigenen Entdeckungsgeschichten und Leseerfahrungen zum Besten geben, anstatt in gewohnter Manier literaturwissenschaftliche, feuilletonistische oder kulturkritische Anmerkungen bzw. literaturhistorische Einordnungen vorzunehmen, so lässt dies im Zusammenhang der besonderen Stellung dieses Autors durchaus aufhorchen.
Der Journalist und Lyriker Björn Kuhligk findet 1995 erste Fauser-Gedichte in einer Lyrik-Anthologie, bevor er bei einer Lesung in einem Antiquariat über ein Exemplar von Trotzki, Goethe und das Glück stolpert, das ihm der Antiquar nur für den damals für Kuhligk horrenden Preis von 30 DM überlassen will, denn »das ist Fauser, Erstausgabe« und es öffnet sich ihm eine neue Welt.
Der aus Ostdeutschland stammende Schriftsteller Clemens Meyer, im entfernten ästhetischen Sinne einer der Erben Fausers, begegnet dem Werk des ihm zuvor unbekannten Autors erst 2007 und wundert sich, warum dieser während seines Studiums am Literaturinstitut Leipzig mit keiner Silbe erwähnt worden sei.
Und nicht zuletzt ich selbst habe beim Abschließen meiner literaturhistorischen Dissertation über die Geschichte der deutschen Popliteratur (damals, 2005, ein kaum beackertes Feld) das geplante Fauser-Kapitel auf Anraten meines Betreuers gekippt, weil die Arbeit sonst »zu lang« geworden wäre, sodass die deutsche Pop-Geschichtsschreibung noch eine Weile ohne Fauser auskommen musste.
Allem Anschein nach hat jeder, der oder die mit diesem besonderen Autor in seinem Leben konfrontiert wurde, seine eigene Fauser-Leserbiografie, die sich alle darin ähneln, dass man es mit einem Autor zu tun hat, dem man sich stets von den Rändern des Kulturbetriebs nähert, hat er doch selbst an diesen – wie auch analog an den Rändern der Gesellschaft – gelebt und gewirkt.
Fauser ist ein Autor, der aus einer Außenseiterperspektive auf die Gesellschaft, vor allem aber auch auf seine Generation blickt, die so prägend werden würde für die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland: Die so genannten »68er«. Und er hat im Laufe seines Schriftstellerlebens diesen Status behalten, ihn tatsächlich sogar in mitunter plakativer Manier verteidigt. Fauser konnte und wollte kein Teil einer Generation sein, teilte aber gleichsam deren kulturelle Einflüsse und Vorlieben, aus denen er jedoch auf schmerzhaft konsequente Weise etwas anderes formte.
Was liegt also näher als der, durchaus subjektiv gefärbte, Versuch, sich einem Autor zu nähern, der aus dem gesellschaftlichen und literarischen Raster (nicht nur) seiner Zeit fällt, obwohl er sich durchaus immer wieder in den Sphären des Mainstreams bewegt hat. Wobei es ihm gelang, auch dies als subversive Aktion zu verkaufen; denn, wie er selbst in Interviews süffisant bemerkte, sah er sich nicht zuletzt als »Geschäftsmann«. Dabei soll kein Anspruch auf Vollständigkeit erweckt werden, aber auch nicht der Zwang, das Porträt Fausers durchweg originell zu gestalten, denn Vieles ist allgemein bekannt, anderes dafür vielleicht weniger. Und schon gar nicht will der vorliegende Essay eine Art Biografie (die gibt es schon in Form des unbedingt empfehlenswerten, gerade neu aufgelegten und überarbeiteten Buches Rebell im Cola Hinterland von Matthias Penzel und Ambros Waibel) oder Werkgeschichte (die noch zu schreiben ist) sein, sondern eine Annäherung an Mensch und Werk, geboren aus einer fast lebenslangen Faszination. Das muss reichen.
Auf dem Autor-Scooter
Der Kakadu in der Wohnküche
Im September 1984 hat Jörg Fauser den prominentesten Fernsehauftritt seiner Schriftstellerkarriere. Interviewt von Hellmuth Karasek und Jürgen Tomm sitzt er mit entspannter Miene in der kurzlebigen (und fragwürdig betitelten) TV-Sendung Autor-Scooter und fühlt sich sichtlich wohl dabei, nach seinem desaströs geendeten Auftritt beim Ingeborg-Bachmann-Festival in Klagenfurt, seine eigene Sicht auf die Situation der deutschen Literatur allgemein und seiner eigenen Texte insbesondere mitteilen zu können. Fauser erinnert dabei in seinem beigen Anzug und der schlecht sitzenden Krawatte an einen etwas schmierigen Versicherungsvertreter, scheint dabei jedoch gesegnet mit einem gesunden Selbstbewusstsein, das durchaus bisweilen an Arroganz grenzt. Er genießt es, dieses bieder anmutende Bild nach außen zu tragen und gleichzeitig Sentenzen über das – seiner Meinung nach fehlgeleitete – Kunstverständnis seiner Kollegen und der Literaturkritik im Allgemeinen zu fällen.
Vor allem ein Satz sticht dabei gerade in Hinblick auf die Poetologie Fausers, wenn man dies einmal mit einem literaturwissenschaftlichen Terminus belegen darf, auf:
Was mich stört an unseren Gegenwartsbelletristen – wenn sie wenigstens was erlebt hätten! Ich meine, sie haben die kleine Liebesgeschichte und den Kakadu in der Wohnküche, und der Mann ist mal weggelaufen, oder man kriegt keinen Job als Lehrer mehr. Das ist ein bisschen wenig.4
Die jungen Gegenwartsautorinnen und -autoren haben also, so Fauser, nichts erlebt, sondern ergehen sich in ihren bürgerlichen Wehwehchen, die sie dann plötzlich zu großer Literatur hochschreiben wollen. Eine sehr polemische, wenn auch nicht gänzlich unangemessene Sicht auf die deutsche Literatur der fortschreitenden 80er Jahre, die sich in der Folge der Neuen Innerlichkeit um Autoren wie Peter Handke oder Botho Strauß zu etwas entwickelt hatte, das vom Fauser’schen Duktus des »Erlebens« in der Tat meilenweit entfernt scheint. Wohlmeinend betrachtet ist es vor allem das Verständnis des Verbs »erleben«, welches Fauser und viele seiner Zeitgenossen voneinander trennt, auch wenn sie eine ähnliche kulturelle Prägung erfahren haben, die man gemeinhin mit dem Erbe der 68er umschreiben könnte.
Dieses eigenständige Erleben war ihm lebenslang ein Anliegen; auch in seiner Rezension der Tagebücher des Alkoholikers und Junkies Hans Fricks verwendet Fauser in einem Porträt des Autors eine ähnliche Sentenz: »Frick war dort, und er kann darüber schreiben.«5 Anders als die meisten deutschen Gegenwartsautoren, denn »auch beim Schreiben bleiben diese Autoren sich als Deutsche treu und dem Rasen fern, wie die Kommunalverwaltung und die Vernunft das fordern«6. Und er legt noch nach:





























