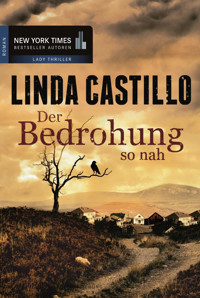9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kate Burkholder ermittelt
- Sprache: Deutsch
Wenn das Böse im Verborgenen lauert Der fesselnde Thriller von Spiegel-Bestsellerautorin Linda Castillo führt Polizeichefin Kate Burkholder in eine isolierte und verschwiegene Amisch-Gemeinde im Bundesstaat New York, in der der Schrecken zu Hause ist. Die junge Rachel Esh wird tot im Wald gefunden. Sie war fünfzehn und erfror jämmerlich. Offenbar wollte sie weg von zu Hause. Böse Gerüchte machen die Runde über diese isolierte Amisch-Gemeinde im Bundesstaat New York. Aber niemand will offen sprechen. Deshalb bittet der örtliche Sheriff Kate Burkholder um Hilfe. Allein und auf sich selbst gestellt, soll sie herausfinden, was sich dort wirklich abspielt. Kate gibt sich als trauernde Witwe aus und taucht ein in eine Welt, die voller Verbrechen und Grausamkeit ist. Und in dieser Welt steht ihr der gefährlichste Kampf noch bevor: Sie muss ihr eigenes Leben retten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Linda Castillo
Böse Seelen
Thriller
Über dieses Buch
Die junge Rachel Esh wird tot im Wald gefunden. Sie war fünfzehn und erfror jämmerlich. Offenbar wollte sie weg von zu Hause. Böse Gerüchte machen die Runde über diese isolierte Amisch-Gemeinde im Bundesstaat New York. Aber niemand will offen sprechen. Deshalb bittet der örtliche Sheriff Kate Burkholder um Hilfe. Allein und auf sich selbst gestellt, soll sie herausfinden, was sich dort wirklich abspielt. Kate gibt sich als trauernde Witwe aus und taucht ein in eine Welt, die voller Verbrechen und Grausamkeit ist. In dieser Welt muss sie den gefährlichsten Kampf ihres Lebens bestehen: Sie muss ihr eigenes Leben retten.
Der achte Fall für Polizeichefin Kate Burkholder führt sie in eine abgelegene Amisch-Gemeinde im Staate New York, in der das Verbrechen im Verborgenen lauert.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Linda Castillo wurde in Dayton/Ohio geboren und arbeitete lange Jahre als Finanzmanagerin, bevor sie mit dem Schreiben anfing. Ihre Thriller, die in einer Amisch-Gemeinde in Ohio spielen, sind internationale Mega-Erfolge, die immer auch auf der SPIEGEL-Bestenliste zu finden sind. Die Autorin lebt mit ihrem Mann auf einer Ranch in Texas.
Inhalt
[Widmung]
[Motto]
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
Dank
Für meine Leser
Wohl dem Mann, der nicht auf dem Weg der Sünder geht.
Die Bibel, Psalm 1,1
Prolog
Sie wartete bis drei Uhr morgens. Den Versuch, zu schlafen, hatte sie längst aufgegeben. Seit fünf Stunden wälzte sie sich mit angstvoll pochendem Herzen in den schweißnassen Bettlaken. Ihre Gedanken kreisten um alles, was schiefgehen konnte. Als sie schließlich zu aufgewühlt war, um noch länger liegen zu bleiben, schob sie die Decke beiseite, stand auf und zog das Nachthemd aus.
Sie kniete vor dem Bett und holte die ordentlich gefalteten Kleidungsstücke hervor, die sie darunter versteckt hatte: lange Unterwäsche, Jeans, Sweater, zwei Paar Socken, warme Handschuhe, Wollmütze. Sie hatte Wochen gebraucht, um diese paar Sachen zusammenzutragen, und ihre Flucht sogar zweimal verschieben müssen. Zum ersten Mal im Leben hatte sie gestohlen. Und sie hatte Menschen belogen, die sie liebte. Aber jetzt besaß sie genug warme Sachen, um für das kalte Wetter gewappnet zu sein. Alles andere lag in Gottes Hand.
Zitternd zog sie im Dunkeln die Kleider an. Eigentlich brauchte sie auch dicke Winterstiefel, aber dafür hatte das Geld nicht gereicht, und zum Stehlen waren sie zu groß. Also mussten ihre gefütterten Gummistiefel genügen. Sie steckte die Handschuhe in die Tasche und lauschte, um sicherzugehen, dass sonst niemand im Haus wach war. Aber außer dem Rascheln ihrer Kleidung und ihrem schnellen Atem war nichts zu hören.
Zuletzt zog sie ihr Handy unter der Matratze hervor. Sie ließ es nie an, das war zu riskant – Mobiltelefone waren laut Ordnung strikt verboten. Ein Verstoß dagegen würde umgehend hart bestraft. Hoffentlich reichte der Akku für den einen Anruf, den sie unbedingt machen musste.
Sie schob das Handy in die Gesäßtasche und schlich in Strümpfen zur Schlafzimmertür. Als sich diese ohne jedes Knarren öffnen ließ, huschte ein Lächeln über ihr Gesicht. Was ein bisschen Schmalz bei so alten Scharnieren bewirkte, war erstaunlich. Und sie machte sich erneut klar, dass es die Achtlosigkeit gegenüber den kleinen Dingen war, die einen in Schwierigkeiten brachte. Und den falschen Leuten zu vertrauen.
Das würde ihr nicht passieren. Sie vertraute niemandem, schon lange nicht mehr. Manchmal traute sie nicht mal sich selbst. Dieses Vorhaben hatte sie wochenlang geplant, jedes Detail tausendmal durchgespielt. Sie hatte sich die unzähligen Dinge vergegenwärtigt, die schiefgehen konnten, und ihren Plan entsprechend angepasst. Auch das Gelingen hatte sie sich ausgemalt und niemals aus den Augen verloren, was es für sie bedeuten würde. Das hatte sie weiterleben lassen, als alles andere verloren war.
Freiheit.
Leise schlich sie hinaus in den Flur, wo nur wenige Meter entfernt hinter drei Schlafzimmertüren die Gefahr lauerte, entdeckt zu werden. Es gab hier weder Fenster noch Licht, doch auf die Dunkelheit war sie vorbereitet, hatte sich jeden Schritt eingeprägt und kannte den Weg so gut wie ihr eigenes Gesicht. Nur drei Schritte, und sie war an der Treppe, umfasste das harte, glatte Geländer. Alle Sinne aufs Äußerste geschärft, schlich sie die Stufen hinab und trat über die vierte hinweg, die wegen eines gelockerten Nagels knarrte.
Unten an der Treppe blieb sie stehen und lauschte erneut. Der petroleumbetriebene Kühlschrank brummte, und die Uhr über dem Ofen tickte, aber beides wurde fast von den Schreien der Angst in ihrem Kopf übertönt. Ihre Knie zitterten, ihre Hände waren schweißnass und flatterten unruhig. Doch Angst konnte sie sich nicht leisten. Angst lenkte ab, und Ablenkung führte zu Fehlern. Lieber Gott, sie durfte das hier jetzt nicht vermasseln. Sie atmete tief ein und langsam aus, um sich zu beruhigen, doch es half nichts. Der kalte Hauch der Panik saß ihr fest im Nacken.
Weiter vorn zeichnete sich im Dunkeln schwach das Rechteck der Küchentür ab. Aber kein flackernder Lichtschein, um diese Zeit war niemand wach. Zu ihrer Rechten fiel trübes Licht durch das vordere Fenster ins Wohnzimmer. Sogar der Dreiviertelmond war Teil ihrer sorgfältigen Planung gewesen, nur dass der Himmel bedeckt sein könnte, hatte sie nicht bedacht. Aber das würde sie jetzt nicht aufhalten.
Sie überquerte den Holzboden geräuschlos wie ein Gespenst. Weiter durch die Küche, wo die Kälte des Linoleums sogar durch zwei Paar Socken drang. Dann stand sie im Vorraum. Hier war es noch kälter, denn er wurde nie beheizt, und durch den Spalt unter der Außentür wehte eisige Luft herein. Ihr Mantel – nicht dick genug, aber einen besseren hatte sie nicht – hing am Haken. Die Stiefel standen neben dem Flechtteppich, wo sie sie nach dem Ausmisten der Ställe hingestellt hatte. Sie schlüpfte hinein, konnte sogar den Pferdemist noch riechen. Dann zog sie den Mantel an, machte ihn mit zittrigen Fingern zu, nahm die Handschuhe aus der Tasche und streifte sie über. Jetzt schwitzte sie. Beim Griff nach dem Türknauf grinste die Angst sie höhnisch an, bedeutete ihr, sie schaffe das nie. Als sie auch diese Tür geräuschlos öffnete, lächelte sie nicht.
Draußen schneite es heftig, für einen kurzen Moment packte sie blankes Entsetzen. Damit hätte sie rechnen müssen. Bestimmt würde sie Fußspuren hinterlassen. Doch als sie die Verandatreppe hinunterging, wurde ihr klar, dass der viele Schnee ihre Spuren zudecken würde. Auch die schlechte Sicht wäre von Vorteil. Falls zufällig jemand aufwachte und aus dem Fenster schaute, würde man sie nicht sehen können. Noch ein Geschenk Gottes.
Sie kicherte hysterisch, rannte über den verschneiten Hof, mühsam mit den Gummistiefeln, aber vollkommen lautlos. Atemwölkchen vor ihrem Mund. Schneeflocken piekten ihr ins Gesicht wie spitze kleine Schnäbel. Am Schuppen vorbei, unter der Wäscheleine hindurch. Die Umrisse der großen Scheune zwanzig Meter weiter links. Sie bog nach rechts ab, machte wohlweislich einen Bogen um die Pferde, die in Erwartung von Futter laut wiehern würden. Vorbei an dem Eisenpfosten, der die Gartengrenze markierte, und dem Ahornbaum am Rande des Hofs.
Sie erreichte den Zaun, kletterte geschickt wie eine Turnerin darüber und landete auf der anderen Seite auf den Füßen. Durch den Schneeschleier hindurch sah sie am Ende der Weide die gesprenkelt wirkende Wand aus Bäumen, und ein tiefes Gefühl von Freiheit durchströmte sie. Sie lief los. Gefrorene Grasbüschel knirschten unter ihren Füßen, der Wind schlug ihr ins Gesicht, brannte in ihren Augen und zerrte an Mantel und Mütze. Aber sie wusste genau, wo das Schlupfloch des Wildpfades war, der in den Wald führte und den sie über viele Wochen lang passierbar gemacht hatte. Die Mistkerle hätten besser aufpassen sollen, womit sie sich nachmittags beschäftigte …
Der Wald schluckte sie, nahm sie in sich auf. Nach ein paar Metern wurde auch der Wind schwächer, durchdrang die Baumreihen nicht mehr. Um sie herum klirrte Schneegraupel, aber sonst herrschte himmlische Stille. Sie rannte hundert Meter, wich einem umgefallenen Baumstamm aus.
Auf der Lichtung blieb sie stehen, beugte sich vornüber und stützte die Hände auf die Knie, verschnaufte einen Moment. Sie hatte Zeit. Nur noch zwei Meilen, da vorne am See vorbei, dann am Hochsitz rechts und noch eine Meile bis zur Straße. Den gefährlichsten Teil ihres Plans hatte sie geschafft.
Euphorie überkam sie, und sie lachte laut auf, was in der Dunkelheit inmitten des Schnees irrsinnig klang. »Ich hab’s geschafft«, sagte sie keuchend. »Ich hab’s geschafft. Ich hab’s geschafft.«
Sie richtete sich auf, wischte sich mit dem Ärmel über die Nase und blickte zurück. Niemand folgte ihr, kein Mensch weit und breit.
»Ich hab gewonnen«, flüsterte sie. »Ihr Mistkerle.«
Etwas langsamer lief sie nun den Pfad entlang, fand schnell ihren Rhythmus. Schnee traktierte ihre Wangen, tat ihren Augen weh, doch das machte ihr nichts aus. Zwischen Bäumen hindurch, von Hochstimmung angetrieben und dem Ziel so nahe, dass sie den süßen Duft der Freiheit schon roch. Ein neues Leben. Eine Zukunft.
Sie erreichte den See, eine weiße Fläche zu ihrer Rechten. Wie Diamanten glitzerte der Schnee auf dem Eis. Der Pfad führte weitere fünfzig Meter am Ufer entlang. Auf der anderen Seite noch eine Baumreihe. Obwohl ihre Muskeln schmerzten und ihre Lungen brannten, lief sie schneller. Einen Fuß vor den anderen. Rannte jetzt, der Schmerz kein Problem. Weiter, beeil dich.
Auf einmal Fußspuren. Sie blieb wie angewurzelt stehen, starrte sie keuchend an, bestürzt und ungläubig. Alarmglocken schrillten in ihrem Kopf, Panik ergriff sie.
Unmöglich, dachte sie.
Ihr Blick folgte den Spuren nach links, in den Wald. Noch nicht vom Schnee bedeckt. Frisch. Aber wer war mitten in der Nacht hier draußen? Im Grunde kannte sie die Antwort schon, pures Adrenalin flutete jetzt durch ihren Körper.
Tausend Möglichkeiten schossen ihr durch den Kopf. Weiter und noch schneller den Pfad entlangrennen, ihnen davonlaufen. Den Weg verlassen und im Wald verschwinden, sie im Gewirr der Bäume abschütteln. Oder über den See laufen und ihnen im Wald auf der anderen Seite entkommen. Doch Letzteres war sicher keine gute Idee. Denn trotz der Kälte heute Nacht war es vergangene Woche fast zehn Grad gewesen, und sie könnte nicht sicher sein, dass das Eis sie trug.
Eine Gestalt trat aus dem Wald heraus auf den Pfad. Ein bleiches Phantom mit dunklen Löchern, da wo die Augen waren. Hut und Drillichjacke voller Schnee. Und dann erkannte sie ihn. Eigentlich hätte sie erleichtert sein müssen, doch ihr Herz raste noch immer, und ihre Beine zitterten wie Espenlaub.
»Du hast mich zu Tode erschreckt!«, stieß sie aus.
Ein vertrautes Grinsen. »Tut mir leid.«
»Was machst du hier?«
»Ich konnte nicht schlafen.« Er wandte den Blick von ihr ab. »Ich konnte dich nicht gehen lassen, ohne auf Wiedersehen zu sagen.« Er machte einen Schritt auf sie zu.
Instinktiv wollte sie ihn auf Distanz halten, aber sie ignorierte ihr Gefühl. Von ihm drohte keine Gefahr, sagte sie sich. Sie war einfach nur paranoid. »Ich hab doch gesagt, ich ruf dich an.«
»Du weißt so gut wie ich, dass du das nicht tun wirst.«
Sie wollte widersprechen, aber dazu war keine Zeit. Sie versuchte, das mulmige Gefühl abzuschütteln, das sie beschlich, und klammerte sich an den letzten Rest eines Vertrauens, das wieder und wieder enttäuscht worden war. Aber da war etwas in diesen vertrauten Augen, was sie noch nie gesehen hatte.
»Ich muss gehen«, flüsterte sie. »Tut mir leid.«
»Ich liebe dich.« Er machte einen weiteren Schritt auf sie zu, war jetzt nahe genug, um sie zu berühren. Zu nah. »Bitte, geh nicht weg.«
Plötzliche Entschlossenheit, kurzes Bedauern, dann wirbelte sie herum, glitt die Uferböschung hinunter und rannte, so schnell sie konnte, über den See.
»Warte!«
Sie durfte nicht langsamer werden. Nach ein paar Metern rutschte sie aus, fiel auf den Bauch, Schnee in Gesicht und Mund. Das Eis knarzte von der Wucht des Aufpralls. Im Nu war sie wieder auf den Beinen, rannte weitere fünfzig Meter, die Arme angewinkelt, die Stiefel rutschten auf dem glatten Eis. Ein Blick zurück zum Ufer, doch da war niemand. Wo war er?
Sie lief weiter über den See, aber nicht mehr ganz so schnell. Das Eis knarrte unter ihren Füßen, sie war schon fast in der Mitte, es war nicht mehr weit.
Ein grauenerregendes Knack! hallte über das Eis. Wasser schwappte auf ihre Stiefelspitzen, spülte Schneematsch um ihre Füße. Sie hatte einen Fehler gemacht. Das Eis brach. Eine Falltür, die ihre Füße schluckte und sie nach unten zog. Die plötzliche Kälte brannte wie Feuer auf ihrer Haut. Sie riss die Arme auseinander, schlug mit den Händen aufs Eis, doch sie sank tiefer in die eisige Dunkelheit. Wasser schlug ihr ins Gesicht, Kälte presste die Luft aus ihren Lungen.
Dunkelheit und Panik und Unterwasserstille. Instinktiv trat sie mit den Füßen, paddelte mit den Händen. Sie war eine gute Schwimmerin, hatte im letzten Sommer den See ein Dutzend Mal durchschwommen. Sie tauchte wieder auf, schnappte nach Luft, doch die Brust war zu eng, die Kälte unerbittlich.
Keuchend griff sie mit der Hand nach dem scharfkantigen Eisrand und versuchte, sich aus dem Wasser zu ziehen, doch kaum waren ihre Schultern an der Oberfläche, brach das Eis ab, und sie tauchte wieder unter. Ihre Stiefel waren randvoll mit Wasser, und sie streifte mit dem rechten Fuß den linken Stiefel ab, der samt Socke in die Tiefe sank. Ein Fuß nackt. Ihr ganzer Körper bebte vor Kälte. Aber sie konnte es immer noch schaffen …
Sie trat heftig Wasser, packte den Rand des Eises erneut und versuchte, sich herauszuziehen. Wieder brach er ab, und sie sank nach unten. Nein, dachte sie. Nein! Ein neuer Versuch. Diesmal hielt das Eis. Sie zog sich hoch, und ein Schrei kam aus ihrem Mund. Aber ihr Mantel war mit Wasser vollgesogen, sie hatte nicht genug Kraft, sich selbst herauszuziehen.
»Nein …«, wollte sie laut schreien, doch sie brachte nicht mehr als ein jämmerliches Maunzen zustande.
Und zum ersten Mal dachte sie daran, ihren Plan aufzugeben. Doch die Vorstellung, zu versagen, machte sie wütend. Sollte sie nach all den Vorbereitungen, der Hoffnung und Planung, bei der sie jedes Detail einkalkuliert hatte, in dem widerlich stinkenden See ertrinken wie ein dummes Tier, das sich auf zu dünnes Eis gewagt hatte?
»Nein!« Sie wollte mit der Faust aufs Eis schlagen, aber ihr Arm ruderte nur schwach. Sie packte die Kante des Eises und klammerte sich daran, zitternd und zähneklappernd. Ihre Kräfte schwanden rasend schnell.
Durch das Schneetreiben hindurch erkannte sie eine Gestalt. Zwanzig Meter weiter stand sie da und beobachtete sie. Sie wollte etwas sagen, doch sie brachte keinen Ton heraus. Sie hob die Hand, eine gefrorene Kralle im Dunkel der Nacht. Fassungslos begriff sie, was ihr gerade passierte. Dass ihr Leben auf diese Weise enden würde. Nach allem, was sie durchgemacht hatte, und so nah am Ziel. Und niemand würde es je erfahren …
Erschöpfung zerrte an ihr, lockte mit einem Ort, an dem es warm und weich und tröstlich war. Wie einfach es doch wäre, das Eis loszulassen und aufzugeben. Den Albtraum ein für alle Mal zu beenden.
Ihre Finger rutschten ab, sie sank nach unten, Wasser in Mund und Nase, der Körper ein einziges Zucken und zu schwach, um zu kämpfen. Sie tauchte wieder auf, hustend und spuckend, den erdigen Geschmack von Matsch im Mund. Sie sah die Gestalt an, nicht länger eine Bedrohung, sondern ihre einzige Chance, zu überleben.
»Hilf mir«, flüsterte sie.
Die Gestalt legte sich bäuchlings aufs Eis, schob einen Ast über die schneebedeckte Oberfläche. »Pack ihn«, sagte die Stimme. »Pack ihn und halt dich fest.«
Hoffnung. Eine brennende Kerze, die dem Sturm tapfer widerstand. Sie griff nach dem Ast mit Händen, die nicht mehr ihr gehörten. Sie fühlte sie nicht, doch sie sah, dass sie sich um das Holz legten.
Anfangs brach das Eis noch unter ihr weg, doch dann hielt es. Sie schloss die Augen und klammerte sich an den Ast. Ihr Mantel scharrte über die gefrorene Oberfläche, dann lag sie auf dem Eis, den Ast weiter in den Händen, unfähig, ihn loszulassen. Ihr Körper zitterte unkontrolliert, die Kälte biss wie Raubtierzähne in ihr Fleisch. Ihre Haare gefroren schon, klebten ihr wie Stoffstreifen im Gesicht.
Starke Hände schoben sich unter ihre Arme und zogen sie ans Ufer. Als sie die Augen öffnete, sah sie kahle schwarze Äste über sich.
Aus dem nächtlichen Himmel fiel Schnee herab. Ihre Füße hatten Furchen im Schnee hinterlassen. Und sie fragte sich: Wie soll ich nur ohne meine Stiefel weglaufen?
1. Kapitel
Im Nordosten von Ohio setzt die Dämmerung Ende Januar früh und unvermittelt ein. Es ist noch nicht einmal fünf Uhr nachmittags, und doch sind die Wälder nördlich der Hogpath Road schon voller Schatten. Ich sitze am Steuer meines Dienstwagens, einem Explorer, und habe den Polizeifunk an, der so gut wie keinen Laut von sich gibt. Ungeduldig erwarte ich das Ende meiner Schicht, was untypisch für mich ist. Es schneit, und die Maisstängel auf dem Feld links von mir wirken wie eine Armee dürrer Minischneemänner. Es ist der erste Schnee in diesem bisher milden Winter, was sich jedoch mit dem Tiefdruckgebiet, das gerade auf dem Weg von Kanada zu uns ist, schnell ändern wird. Am Morgen werden mein kleines Polizeirevier und ich uns bestimmt um ein paar Unfälle kümmern müssen, hoffentlich keine schlimmen.
Ich heiße Kate Burkholder und bin Polizeichefin in Painters Mill, Ohio, einer Stadt mit etwas über fünftausenddreihundert Einwohnern. Die Hälfte davon sind Amische, einschließlich meiner Familie. Ich selbst habe die Glaubensgemeinschaft mit achtzehn verlassen, was gar nicht einfach war, da ich nichts anderes kannte als das schlichte Leben. Nach einem katastrophalen ersten Jahr in der nahe gelegenen Stadt Columbus habe ich meinen Highschool-Abschluss nachgeholt und dann einen Teilzeitjob als Telefonistin in einer kleinen Polizeiwache bekommen. Die Abende verbrachte ich am City College, das ich mit einem Diplom in Strafrecht abschloss. Ein Jahr später graduierte ich an der Polizeiakademie und wurde danach Streifenpolizistin. In den darauffolgenden sechs Jahren bestand ich als jüngste Frau die Detective-Prüfung und arbeitete mich bis zur Mordkommission hoch.
Als meine Mamm ein paar Jahre später starb, kehrte ich zurück nach Painters Mill, wo ich aufgewachsen bin und wo meine amische Familie lebt, zu der ich aber kaum Kontakt hatte. Der Polizeichef war in den Ruhestand getreten, und der Gemeinderat und der Bürgermeister boten mir aufgrund meiner Erfahrungen im Polizeidienst und meiner Kenntnis der amischen Kultur die Stelle an. Sie wollten jemanden haben, der die kulturelle Kluft zu den Amischen überbrückt, was sich direkt auf die wirtschaftliche Situation der Stadt auswirkt. Da es mich schon seit einiger Zeit zurück zu meinen Wurzeln gezogen hatte, sagte ich nach gründlicher Überlegung zu und habe seither die Entscheidung nie bereut.
Die meisten Amischen haben mir meine Jugendsünden vergeben und erwidern lächelnd meinen Gruß, obwohl ich jetzt eine Englische bin. Doch einige Familien der Alten Ordnung und der Swartzentruber reden noch immer nicht mit mir. Selbst wenn ich sie in meiner Muttersprache auf Pennsilfaanisch Deitsch begrüße, wenden sie sich ab und tun so, als hätten sie mich nicht gesehen. Ich nehme das nicht persönlich. Diesen Teil meiner »Wiedereinbürgerung« begreife ich als fortlaufenden Prozess.
Meine eigene Familie hat sich anfangs nicht viel anders verhalten. Nach meinem Weggang haben mein Bruder und meine Schwester kaum mit mir gesprochen. Getreu dem anabaptistischen Grundsatz, die Sünder auszugrenzen, hatten sie mich so gut wie verstoßen. Auch heute sind wir nicht so innig miteinander verbunden wie früher, und wahrscheinlich werden wir nie wieder eine so enge Bindung haben wie als Kinder. Doch es gibt Fortschritte. Meine Geschwister laden mich zu sich nach Hause ein und essen gemeinsam mit mir, eine positive Entwicklung, die hoffentlich so weitergeht.
Ich bin in Gedanken schon zu Hause auf der Farm und sitze mit dem Mann meines Herzens, John Tomasetti, gemütlich beim Abendessen. Er ist auch im Polizeidienst tätig, und zwar als Agent beim Ohio Bureau of Criminal Investigation, kurz BCI. Ich liebe ihn und bin ziemlich sicher, dass er für mich das Gleiche empfindet. Wie alle Menschen haben wir im Laufe der Zeit einige Hürden überwinden müssen, hauptsächlich wegen unserer Vergangenheit, die bei uns beiden schwierig war. Aber er ist das Beste, was mir je passiert ist, und wenn ich an die Zukunft denke, bin ich froh, ihn an meiner Seite zu haben.
Ich fahre achtzig Stundenkilometer mit eingeschalteten Scheinwerfern. Die Scheibenwischer kämpfen tapfer gegen den Schnee an, als auf dem Hügel an der Kreuzung der County Road 13 wie aus dem Nichts vor mir ein Buggy auftaucht. Ich reiße das Lenkrad nach links und trete voll auf die Bremse, der Explorer schlingert, und ich lenke dagegen. Eine Sekunde lang befürchte ich, hinten auf den Buggy zu knallen, doch dann greifen die Räder wieder, und mein Wagen kommt auf dem Schotterstreifen der Gegenfahrbahn zum Stehen.
Das Lenkrad weiter fest umklammert, bleibe ich einen Moment sitzen und warte, dass mein Adrenalinpegel sinkt. Mehrere Gedanken gehen mir gleichzeitig durch den Kopf. Ich habe den Buggy erst gesehen, als ich schon viel zu dicht hinter ihm war. Der Unfall wäre meine Schuld gewesen. Wahrscheinlich wären alle Insassen verletzt worden – oder schlimmer.
Durch das Fenster auf der Beifahrerseite sehe ich, dass das Pferd stehen bleibt. Ich mache mein Blaulicht an und setze zurück, so dass ich hinter dem Buggy stehe und ihn vor nahenden Fahrzeugen schützen kann. Mit der MagLite in der Hand steige ich aus und sehe sofort, dass der Buggy weder eine Laterne noch ein reflektierendes Schild hat.
Der Fahrer steigt jetzt auch aus, und ich senke den Strahl der Taschenlampe, um ihn nicht zu blenden. Es ist ein Mann, ein Meter achtzig groß, Mitte dreißig. Schwarze Jacke, schwarzer flachkrempiger Hut. Der ebenfalls schwarze Bart reicht ihm bis zum Bauch und sieht aus wie Stahlwolle. Seine Kleidung sowie die Tatsache, dass sein Buggy keine Windschutzscheibe hat, sagen mir, dass er ein Swartzentruber-Amisch ist. Ich habe ihn schon früher in der Stadt gesehen, aber noch nie mit ihm gesprochen und kenne seinen Namen nicht.
»Guder Ohvet«, sage ich. Guten Abend.
Er blinzelt, ist überrascht, dass ich Pennsylvaniadeutsch spreche, und erwidert den Gruß.
Ich beuge mich vor und leuchte in den Buggy. Hinten sitzen zusammengedrängt eine etwa dreißig Jahre alte Frau, ebenfalls schwarz gekleidet, und sechs Kinder im Alter von eins bis zehn Jahren, über den Beinen zwei Häkeldecken. Die Frau hält ein Baby im Arm, und mir dreht sich der Magen um bei der Vorstellung, wie das hätte ausgehen können.
»And wie bischt du heit?«, frage ich die Frau. Wie geht es dir?
Sie senkt den Blick.
»Miah sin zimmlich gut«, antwortet der Mann. Uns geht es ganz gut.
Wenn ich in meiner Funktion als Polizistin mit Amischen zu tun habe, besonders mit jenen der Alten Ordnung und der Swartzentruber, bemühe ich mich immer, ihnen erst einmal die Befangenheit zu nehmen, bevor ich meiner Dienstpflicht nachkomme. Ich lächele die Frau an, richte meine Worte aber an den Mann. »Sis kald heit.« Es ist kalt heute.
»Ja.«
»Wie heißen Sie, Sir?«
»Elam Shetler.«
»Haben Sie einen Ausweis, Mr Shetler?«
Er schüttelt den Kopf. »Wir sind Swartzentruber«, sagt er, als mache das jede weitere Erklärung überflüssig.
Was bei mir zutrifft. Amische fahren nicht Auto und brauchen somit auch keinen Führerschein. Für längere Strecken mieten sie einen Fahrer. Trotzdem beantragen die meisten eine Kennkarte, die auch von der Führerscheinstelle ausgestellt wird. Aber das gilt nicht für die Swartzentruber, weil ihr Glaube es ihnen verbietet, sich fotografieren zu lassen.
»Mr Shetler, als ich über den Hügel gekommen bin, habe ich Ihren Buggy nicht gesehen.« Ich zeige auf seine Pferdekutsche. »Und mir ist aufgefallen, dass Sie weder ein Licht noch ein reflektierendes Schild daran haben.«
»Schmuckwerk«, murmelt er auf Pennsylvaniadeutsch.
»Um ein Haar wäre ich Ihnen hintendrauf gefahren.« Ich zeige mit dem Kopf zu seiner Frau und den Kindern. »Es hätte schlimm ausgehen können.«
»Ich vertraue auf Gott und nicht auf irgendein Schild von den Englischen.«
»Ich fashtay.« Ich verstehe. »Aber es ist gesetzlich vorgeschrieben, Mr Shetler.«
»Gott beschützt uns.«
»Vielleicht hätte der liebe Gott es aber gern, dass Ihr Buggy ein Schild mit dem Aufdruck ›Langsam fahrendes Vehikel‹ hat und dadurch Ihrer Familie ein langes und glückliches Leben beschieden wäre.«
Einen Moment lang weiß er nicht, was er dazu sagen soll. Dann bricht er in schallendes Lachen aus. »Nix as baeffzes.« Das ist bloß Geschwätz.
»Das Gesetz in Ohio verlangt ein reflektierendes Schild an langsamen Fahrzeugen.« Ich senke die Stimme. »Ich habe den Buggy gesehen, in dem Paul Borntrager und seine Kinder umgekommen sind, Mr Shetler. Es war ein furchtbarer Anblick. Ich möchte nicht, dass Ihnen und Ihrer Familie das Gleiche passiert.«
Der Gesichtsausdruck des Mannes verrät mir, dass meine Worte auf taube Ohren treffen. Sein Entschluss steht fest, und er würde sich weder von mir noch von sonst jemandem umstimmen lassen. Ich überlege gerade, ob ich ihm einen Strafzettel verpassen soll, als mein Handy an der Hüfte vibriert. Beim Blick aufs Display erkenne ich Tomasettis Nummer.
Ich beschließe, ihn später zurückzurufen, und widme mich weiter Shetler. »Wenn ich Sie noch einmal ohne das vorgeschriebene Schild auf der Straße sehe«, sage ich, »muss ich Ihnen einen Strafzettel ausstellen. Sie werden eine Ordnungsstrafe zahlen müssen. Haben Sie das verstanden?«
»Wir sind dann wohl fertig hier.« Er dreht sich um und klettert in den Buggy.
Ich stehe auf dem Seitenstreifen, lausche dem Klirren des Pferdegeschirrs und dem Klappern der Hufe und sehe dabei zu, wie er den Buggy zurück auf die asphaltierte Straße lenkt und weiterfährt.
Schneeflocken landen sanft auf meinen Schultern, und die Maisstängel flüstern, es gut sein zu lassen. »Blödmann«, murmele ich.
Ich sitze gerade wieder hinterm Lenkrad, als der Autofunk knisternd zum Leben erwacht. »Chief?«, ertönt die Stimme von Jodie, die die zweite Schicht in der Telefonzentrale arbeitet.
Ich nehme den Hörer ab. »Was gibt’s?«
»Sie haben Besuch auf dem Revier.«
»Besuch?« Sofort habe ich meine Schwester und meinen Bruder vor Augen, wie sie im Empfangsbereich sitzen, sich deplatziert fühlen und warten, dass ich komme.
»Wer ist es?«
»Agent Tomasetti, noch ein Anzugträger vom BCI und ein Agent aus New York.«
Mir fällt wieder ein, dass Tomasetti vor ein paar Tagen erzählt hat, der Deputy Superintendent wolle mit mir über eine Ermittlung reden. Aber es gab noch keinen Termin, und er wusste keine Einzelheiten. Schon merkwürdig, dass sie an einem verschneiten Nachmittag nach Dienstschluss kommen, ohne mir vorher Bescheid zu geben. Aber noch merkwürdiger ist, dass einer der Männer aus New York kommt.
»Wissen Sie, worum es geht?«, frage ich.
»Keine Ahnung, aber es scheint was Ernstes zu sein, Chief.« Sie senkt die Stimme zu einem Flüstern. »Als wäre was Großes im Gange.«
»Sagen Sie ihnen, dass ich in zehn Minuten da bin.« Kopfschüttelnd kämpfe ich gegen den Unmut an, der in mir hochsteigt, fahre zum Revier und hoffe, dass Elam Shetler und seine Familie sicher nach Hause kommen.
Als ich am Revier eintreffe, stehen neben meinem reservierten Platz Tomasettis Tahoe und ein nicht gekennzeichneter brauner Ford Crown Victoria – ein Zivilfahrzeug der Polizei – mit einem New Yorker Nummernschild. Beide Wagen sind mit einer dünnen Schneeschicht bedeckt. Ich parke und laufe ins Haus, wo mein Blick sofort auf Jodie fällt. Sie sitzt am Schreibtisch mit der Telefonanlage, hat die Augen geschlossen und trommelt mit den Händen im Takt zu Adeles Rolling in the Deep.
Normalerweise wird ihre flippige Art auf dem Revier durchaus geschätzt, aber da jetzt offizieller Besuch im Haus ist, hält sich meine Freude in Grenzen. Ich bin auf halbem Weg zu ihrem Schreibtisch, als sie die Augen öffnet. Bei meinem Anblick schreckt sie zusammen und macht schnell das Radio aus. »Hey, Chief.«
Ich nehme die Telefonnachrichten aus meinem Fach. »Wissen Sie, wo die Besucher sind?«
»Agent Tomasetti zeigt ihnen gerade die Gefängniszelle im Keller –«
»Wir sind hier«, ruft Tomasetti vom Flur herüber.
Er trägt noch den anthrazitgrauen Anzug und die lila Krawatte von heute früh und hat sein Dienstgesicht aufgesetzt. Da er mir kein Lächeln schenkt, weiß ich, dass er und die beiden Männer, die jetzt hinter ihm auftauchen, nicht hier sind, um im Keller unsere Gefängniszelle zu besichtigen.
»Hi … Agent Tomasetti.« Eine lächerlich förmliche Begrüßung angesichts der Tatsache, dass wir seit über einem Jahr zusammenleben.
»Hi.« Er macht zwei Schritte auf mich zu und hält mir die Hand hin. »Tut mir leid, dass wir dich unangemeldet hier überfallen.«
»Kein Problem. Ich war sowieso auf dem Weg hierher.«
»Für morgen sind in New York starke Schneefälle angekündigt«, erklärt er. »Betancourt, der Ermittler, will noch heute Abend zurückfahren, solange die Straßen einigermaßen befahrbar sind.«
»Das wird eine lange Fahrt.« Ich wende mich den zwei Männern zu, die gerade neben Tomasetti stehen geblieben sind. Ich kenne keinen von beiden, doch sie haben das typische Auftreten von Polizisten: übertrieben durchdringender Blick, Anzug von der Stange, düsterer Gesichtsausdruck, der keinerlei Gefühl oder Stimmung verrät. Und sie mustern mich etwas zu genau, also insgesamt ein Verhalten, das ich nur allzu gut kenne. Unter dem Jackett des größeren Mannes ist ein ledernes Schulterholster erkennbar.
Tomasetti stellt uns vor. »Deputy Superintendent Lawrence Bates vom BCI.« Er deutet auf den hochgewachsenen, schlaksigen Mann mit dem kantigen, zerknautschten Gesicht, wahrscheinlich von vielen Jahren auf dem Golfplatz; blaue Augen hinter rechteckigen Brillengläsern, Geheimratsecken auf dem Vormarsch. Den leichten Zigarettengeruch versucht er mit Kaugummi und Rasierwasser zu kaschieren.
Ich reiche ihm die Hand. »Es freut mich, Sie kennenzulernen, Deputy Superintendent Bates.«
Das Grinsen, mit dem er die förmliche Anrede zurückweist, straft sein seriöses Auftreten Lügen. »Bitte, nennen Sie mich Larry.« Er drückt meine Hand kurz und fest. »Ich streite alle Geschichten ab, die Tomasetti über mich erzählt hat.«
Ich grinse ebenfalls. »Das will ich doch hoffen.«
Tomasetti deutet auf den anderen Mann. Er ist etwa genauso alt wie Bates und sieht in dem konservativen grauen Anzug mit weißem Hemd und roter Krawatte eher wie ein FBI-Agent aus als wie ein Bundespolizist. Er ist kaum größer als ich, aber offenkundig ein Muskelpaket und hat das passende Gesicht dazu. Seine dunklen, leicht blutunterlaufenen Augen, die schweren Lider und der Dreitagebart zeugen von einem langen Tag.
»Das ist Frank Betancourt, Chefermittler der BCI-Abteilung der New York State Police.«
Beim Händeschütteln spüre ich Schwielen an seiner Hand, die sicher davon rühren, dass er im Fitnessclub ziemlich viel Zeit mit Gewichtheben verbringt. Er sieht mir direkt in die Augen, weicht meinem Blick nicht aus.
»Sie sind weit weg von zu Hause«, bemerke ich.
»Das ist um diese Jahreszeit gar nicht so schlecht.« Er lächelt kurz, wird jedoch sofort wieder ernst.
Schweigen tritt ein. Es ist unangenehm, wenn niemand etwas sagt. Aber nach der Begrüßung wollen sie offensichtlich schnell zur Sache kommen.
Bates reibt die Hände aneinander. »Haben Sie ein paar Minuten Zeit für uns, Chief Burkholder? In Upstate New York gibt es gerade eine Entwicklung, über die wir gern mit Ihnen sprechen möchten.«
Aus dem Augenwinkel sehe ich, dass Tomasetti ein finsteres Gesicht macht.
»Wir können in meinem Büro reden.« Ich zeige auf die Tür und gehe voraus. »Möchte jemand einen Kaffee?«
Alle drei Männer verneinen. Offensichtlich wissen sie, dass Polizeireviere und guter Kaffee ein Widerspruch in sich sind. Tomasetti und Bates nehmen auf den Besucherstühlen neben dem Schreibtisch Platz, Betancourt steht anscheinend lieber und lehnt nahe der Tür an der Wand.
Ich ziehe die Jacke aus, hänge sie an den Haken beim Fenster und setze mich. »Wir haben nicht oft Besuch vom BCI oder von der New York State Police«, beginne ich.
»Tomasetti hat erzählt, Sie waren einmal amisch«, sagt Bates.
»Richtig. Ich bin hier in Painters Mill geboren, meine Eltern waren Amische. Mit achtzehn bin ich von zu Hause weggegangen.«
»Sie sprechen Deutsch?«
»Ja, Pennsylvaniadeutsch.« Jetzt verspüre ich einen Anflug von Verdruss. Sie lassen mich im Ungewissen, wollen etwas von mir, haben aber Angst, zu viel zu verraten, weil ich dann vielleicht ablehnen würde. Mir wäre es lieber, sie würden nicht um den heißen Brei herumreden und gleich zur Sache kommen. »Was genau kann ich für Sie tun?«
Bates sieht mich über seine Brille hinweg an. »Vor ein paar Monaten hat Jim Walker, der Sheriff oben in St. Lawrence County, wegen Problemen innerhalb einer amischen Gemeinde die State Police um Amtshilfe gebeten.« Er zeigt auf Betancourt. »Der Fall wurde Frank übertragen, und er hat mit Jim zusammengearbeitet. Vor zwei Wochen hatte Jim einen Herzinfarkt. Er ist krankgeschrieben, und die Sache wurde vorübergehend auf Eis gelegt. Aber vor drei Tagen hat sich die Lage wieder zugespitzt, als ein amisches Mädchen wenige Meilen von ihrem Zuhause im Wald erfroren aufgefunden wurde.
Die Amisch-Gemeinde dort erstreckt sich über zwei Countys, St. Lawrence und Franklin. Wir haben mit dem Sheriffbüro in Franklin County Kontakt aufgenommen und mit Sheriff Dan Suggs zusammengearbeitet. Aber allen war ziemlich schnell klar, dass keine der Behörden imstande ist, die Sache aufzuklären.«
Normalerweise hat die State Police ein recht anständiges Budget zur Verfügung und reichlich Möglichkeiten, Polizeireviere in kleineren Städten zu unterstützen. Aber in diesem Fall braucht der Sheriff für seine Ermittlungen weder Polizeilabore noch Datenbanken, und mir ist klar, worauf sie hinauswollen.
»Wir kennen ein paar der Fälle, in denen Sie hier in Painters Mill ermittelt haben, Chief Burkholder«, sagt Bates. »Das war eindrucksvolle Polizeiarbeit.« Er nickt in Richtung Tomasetti. »Ich habe mit John über Ihre spezifische Kompetenz gesprochen und dachte, Sie könnten uns bei der Sache vielleicht helfen.«
Bates zeigt auf Betancourt. »Da Tomasetti und ich hier im Prinzip nur Dekoration sind, überlasse ich jetzt Frank das Wort.«
Betancourt kommt sofort zur Sache. »Am einundzwanzigsten Januar fanden zwei Jäger im Wald die Leiche der fünfzehn Jahre alten Rachel Esh nur wenige Meilen von ihrem Zuhause entfernt.«
Er hat einen völlig anderen Stil als Bates, der eine Unterhaltung gern mit einem Witz oder mit Small Talk beginnt und damit eher an einen Politiker als an einen Polizisten erinnert. Der Chefermittler ist dagegen hoch konzentriert und redet nicht lange um den heißen Brei rum. Wahrscheinlich scheut er auch nicht davor zurück, Leuten auf die Füße zu treten.
»Was war die Todesursache?«, frage ich.
»Laut Autopsie starb sie an Unterkühlung. In der Nacht gab es einen Schneesturm, und aus irgendeinem Grund war sie draußen und ist erfroren. Der ärztliche Leichenbeschauer hat eine toxikologische Untersuchung gemacht und festgestellt, dass sie zum Todeszeitpunkt Spuren von Oxycontin im Blut hatte.«
»Dass ein amisches Mädchen so starke Schmerzmittel nimmt, ist schon seltsam«, sage ich. »Geht der Sheriff von einem Verbrechen aus?«
»Irgendwoher muss sie das Medikament ja bekommen haben«, Betancourt beugt sich vor. »Aber noch verblüffender ist, dass sie vor kurzem schwanger war.«
»Sie war schwanger?« Ich sehe von einem Mann zum anderen. »Wie meinen Sie das?«
»Bei der Autopsie wurde fötales Gewebe gefunden.«
»Eine Fehlgeburt?«, frage ich.
»Die Leute in der Rechtsmedizin glauben, dass sie eine Abtreibung hatte.«
»Ist in New York das Einverständnis der Eltern erforderlich?«, frage ich.
Betancourt schüttelt den Kopf. »Nein.«
»Hatte sie einen Freund?«, fragt Tomasetti. »Hat jemand mit ihm gesprochen?«
»Wir haben mit vielen Leuten gesprochen, auch mit ihren Eltern, aber keiner weiß, mit wem sie zusammen war. Nicht ein einziger Name ist gefallen«, erklärt Betancourt frustriert. »Niemand hat sie je mit einem Jungen gesehen. Sie hat nie über jemanden gesprochen. Die Familie, bei der sie gewohnt hat, behauptet, dass sie keinen Freund hatte.«
»Sie hat nicht bei ihren Eltern gelebt?«, frage ich.
Wieder schüttelt Betancourt den Kopf. »Offensichtlich hatte sie mit denen Probleme und ist zu einer anderen Familie gezogen, das sind auch Amische. Im Grunde scheint niemand auch nur die geringste Ahnung zu haben, was das Mädchen so getrieben hat.«
»Oder sie reden nicht darüber.« Ich denke kurz nach. »Wurde sie als vermisst gemeldet?«
Erneutes Kopfschütteln. »Die Familie, bei der sie gewohnt hat, ist davon ausgegangen, dass sie wieder zu ihren Eltern zurück ist. Das kam offensichtlich schon einmal vor, deshalb hat wohl keiner überprüft, ob das stimmt.«
»Meistens ziehen Amische es vor, ihre Probleme selbst zu lösen«, sage ich. »Wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, werden Außenstehende nicht involviert – und dazu gehört natürlich auch die Polizei –, was immer das auch für Folgen hat.«
»Interessant ist auch«, sagt Betancourt, »dass das Mädchen keine amischen Kleider anhatte.«
»Das muss nicht unbedingt etwas bedeuten.« Er sieht mich verwundert an. »Wenn sie fünfzehn war«, erkläre ich, »hat sie wahrscheinlich gerade ihre Rumspringa begonnen. Das ist die Zeit, in der amische Teenager die Regeln der Ordnung nicht befolgen müssen, bis sie durch ihre Taufe dann Mitglied der Gemeinde Gottes werden. Die Erwachsenen drücken mehr oder weniger beide Augen zu.« Ich überlege. »Aber was hat sie bei dem Wetter im Wald gemacht?«
»Keiner weiß, ob sie dort freiwillig war oder ob jemand sie da hingebracht und abgelegt hat«, erwidert Betancourt. »Sheriff Suggs meint, die Amischen da oben seien nicht gerade mitteilsam«, sagt Bates. »Die Zusammenarbeit sei gleich null.«
»Was hat der Leichenbeschauer über die Todesursache gesagt?«, fragt Tomasetti.
»Unbestimmt«, antwortet Bates.
Betancourt nickt. »Jim gefällt das gar nicht, und mir ehrlich gesagt auch nicht. Es handelt sich hier um ein fünfzehn Jahre altes Mädchen, das Oxycontin genommen hat, schwanger war, wohl abgetrieben hat und im Wald erfroren ist. Und kein Mensch sagt irgendwas.«
»Ab welchem Alter ist man in New York mündig?«, frage ich.
»Siebzehn«, antwortete Betancourt. »Es gibt zwar eine sogenannte Romeo-und-Julia-Regelung, wenn Minderjährige mit einem unter sechzehn, aber über vierzehn Jahre alten Partner sexuellen Kontakt haben. Aber falls der Typ, der sie geschwängert hat, mehr als vier Jahre älter ist als unser Mädchen, kriegen wir ihn wegen Geschlechtsverkehrs mit einer Minderjährigen dran.«
»Wissen die Eltern von der Abtreibung?«, frage ich.
»Die wussten nicht mal, dass sie schwanger war.«
Tomasetti zuckt die Schultern. »Wurde in den örtlichen Krankenhäusern nachgefragt?«
Betancourt und Bates tauschen Blicke. »Die Abtreibung wurde nicht in einer Klinik vorgenommen.«
»Also von einem Engelmacher?«, frage ich.
»Wahrscheinlich«, erwidert Bates. »Keine Anzeichen einer Infektion oder dergleichen, aber – und ich spreche hier als Laie – anscheinend hatte sie innere Verletzungen. Nichts Lebensbedrohliches, aber doch feststellbar.« Seufzend zeigt er auf seinen Kollegen. »Das haben wir also alles rausgefunden, und dann bekommt der Sheriff Besuch von einer Nachbarin.«
Alle Blicke richten sich auf Betancourt, der ausgesprochen ernst dreinschaut. »Ein paar Tage nach Auffinden des Mädchens rief eine Nachbarin bei unserem derzeit krankgeschriebenen Kollegen Jim Walker zu Hause an. Sie hatte vom Tod des Mädchens gehört und sagte, Rachel hätte ihr erst vor ein paar Wochen erzählt, dass in der amischen Gemeinde ›schlimme Dinge‹ passieren.«
»Was für schlimme Dinge?«, fragte ich.
»Als die Nachbarin nachgefragt hat, hat das Mädchen dichtgemacht und kein Wort mehr gesagt. Aber sie vermutete, sie habe irgendeinen Missbrauch gemeint und aus Angst nichts weiter sagen wollen. Anscheinend grassieren dort eine Menge Gerüchte.«
Tomasetti richtet sich im Stuhl auf. »Was für Gerüchte?«
»Bei denen es einem eiskalt den Rücken runterläuft.« Betancourt zieht ein Smartphone aus der Innentasche seines Jacketts. »Sheriff Suggs weiß wesentlich mehr darüber als ich. Ist es okay, wenn ich ihn anrufe und auf Lautsprecher stelle?« Er wartet unsere Antwort nicht ab und scrollt durch seine Kontaktliste. »Dan wollte eigentlich mitkommen, konnte aber nicht weg. Er steht jedoch telefonisch zur Verfügung.«
»Sicher.« Ich schiebe ein paar Aktenmappen beiseite, um Platz für sein Telefon zu machen, und er legt es auf den Schreibtisch.
Der Sheriff meldet sich nach dem vierten Klingeln mit einem kernigen: »Ja.«
»Ich hab das Telefon auf Lautsprecher gestellt, Dan. Ich bin hier in Painters Mill, Ohio, und Chief Burkholder ist bei mir.« Er nickt mir kurz zu, dann erwähnt er noch Bates und Tomasetti. »Ich hab sie über die Situation bei euch in Roaring Springs informiert. Können Sie ein paar Einzelheiten beisteuern?«
»Im Wesentlichen sind es nur Gerüchte.« Ein kratzendes Geräusch ertönt, weil der Sheriff wohl sein Telefon verschiebt. »Zunächst mal ein paar Hintergrundinformationen, um einige der Lücken zu füllen und das Ganze in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Also, vor ungefähr zwölf Jahren sind ein paar amische Familien aus Geauga County in Ohio in die ländliche Gegend nahe Roaring Springs gezogen.«
»Geauga County ist nicht weit weg von Painters Mill«, lasse ich ihn wissen.
»Wir hier in Upstate New York sind übrigens nicht weit entfernt von Malone, zwanzig Meilen vor der kanadischen Grenze.« Er stößt einen Seufzer aus. »Über die Jahre haben sich zahlreiche amische Familien hier angesiedelt und gut in die Gemeinde integriert. Sie waren gute Bürger, gute Nachbarn und, ehrlich gesagt, war ihre Anwesenheit auch gut für die Stadt. Einige der hiesigen Händler sind irgendwann mit den Amischen ins Geschäft gekommen und haben ihre Ware verkauft, angefangen von Eiern über Quilts bis hin zu Möbeln. Die Leute fuhren viele Meilen hierher nach Roaring Springs, um solche Sachen zu kaufen. Touristen kamen. Das alles hat sich vor drei Jahren geändert, als der Bischof starb und die Gemeinde einen amischen Prediger namens Eli Schrock wählte.«
»Der Name sagt mir nichts«, bemerke ich.
»Gerüchten zufolge fanden Schrock und einige seiner Anhänger, dass der frühere Bischof die Regeln der Ordnung nicht strikt genug befolgt habe, und das änderte sich dann. Ich habe gehört, er betreibe die Trennung zwischen Amischen und Englischen. Die meisten Amischen kamen nicht mehr in die Stadt, hörten auf, ihre Waren hier zu verkaufen. Im Grunde blieben sie von heute auf morgen einfach weg.« Er stößt ein kurzes Lachen aus. »Dem Bürgermeister hat das nicht gefallen. Er hatte darauf gehofft, dass Roaring Springs für Touristen so attraktiv wie Lancaster County wird. Natürlich haben die Amischen keine Gesetze gebrochen und können für sich bleiben, wenn sie das wollen.
Seit aber Schrock die Führung übernommen hat, lebt die amische Gemeinde ziemlich zurückgezogen auf ihrem Terrain. Hin und wieder sehen wir ihre Buggys oder Heuwagen, aber sie verhalten sich ruhig und sind nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Keine Auseinandersetzungen mit Nachbarn oder so was. Ehrlich gesagt, wurden sie kaum mehr beachtet – bis man dann das tote Mädchen fand.«
»Wo hat das Mädchen gewohnt?«, frage ich.
Papierrascheln am anderen Ende. »Bei Abe und Mary Gingerich.«
»Wie schätzen Sie die beiden ein?«
»Ich hab lange mit ihnen gesprochen, als das Mädchen gefunden wurde. Es sind anständige Leute. Religiös, friedlich. Der Tod des Mädchens hat sie stark mitgenommen, aber ich hatte den Eindruck, wir Nicht-Amischen sind ihnen ziemlich egal.«
»Haben Sie irgendeine Idee, was dort vor sich geht, Sheriff Suggs?«, frage ich.
»Ich bin seit über sechzehn Jahren Sheriff in Franklin County und kenne die Gegend wie meine Westentasche. Aber um ehrlich zu sein, Chief, ich hab keine Ahnung, was da oben los ist.« Er stößt einen Seufzer aus. »Hören Sie, ich beurteile die Menschen nicht nach ihrer Kleidung und ihrem Glauben, und ganz bestimmt habe ich nichts gegen Amische. Aber hier in der Gegend ist allgemein bekannt, dass einige von ihnen eher seltsam sind.«
»Können Sie mir Beispiele dafür nennen?«
»Letzten Sommer kam ein etwa zehn Jahre alter amischer Junge mit seiner Mom in die Stadt. Der Kassiererin im Lebensmittelladen fiel auf, dass er blutunterlaufene Streifen an den Beinen hatte. Sie rief bei uns an und behauptete, es hätte wie Striemen einer Peitsche ausgesehen. Einer meiner Deputys ist hingefahren, aber keiner dort wollte mit ihm reden. Nicht einer hat sich dazu bereit erklärt. Also haben wir das Jugendamt eingeschaltet. Sie sind der Sache nachgegangen, konnten aber weder den Jungen noch die Familie ausfindig machen.
Und dann sind letztes Jahr zwei Anrufe bei uns eingegangen. Anonym. Eine Frau hat behauptet, Menschen würden dort gegen ihren Willen festgehalten. Wir konnten beide Anrufe zu einer Telefonzelle der Amischen zurückverfolgen, die an der Straße eine Meile von ihrer Siedlung entfernt steht. Ich bin selber hingefahren, aber wie schon bei dem Jungen, wollte niemand mit mir reden. Und die Anruferin oder sonst jemand, der die Anschuldigung hätte untermauern können, war auch nicht aufzutreiben.«
Betancourt schüttelt missbilligend den Kopf. »Erzähl ihnen von Schrock.«
»Eli Schrock ist der dortige Bischof, ein charismatischer Typ. Klug, eloquent, strenggläubig und in der Gemeinde hoch angesehen. Seine Anhänger sind nicht nur loyal, sie sind ihm treu ergeben.« Er hält inne. »Aber es gibt auch Gerüchte, dass einige von ihnen aus Angst vor ihm nichts sagen. Es heißt, dass er jeden bestraft, der sich nicht an die Regeln hält.«
»Um was für Strafen handelt es sich denn?«, will Tomasetti wissen.
»Einen Mann hat er angeblich drei oder vier Tage ohne Essen im Hühnerstall eingesperrt. Ein junger Mann soll mit der Pferdepeitsche geschlagen worden sein, und einer meiner Deputys hat gehört, dass mindestens eine Familie bei Nacht und Nebel geflohen ist. Aus Angst, von Schrock oder seinen absolut loyalen Anhängern daran gehindert zu werden, haben sie alles, was sie nicht tragen konnten, zurückgelassen.«
»Wurde jemals Anzeige erstattet?«, fragt Tomasetti.
»Auch hier wieder: Niemand will mit uns reden, niemand hat sich als Zeuge gemeldet«, sagt Suggs. »Nicht eine Menschenseele. Nach dem Tod des Mädchens haben meine Deputys und ich viel Zeit damit verbracht, irgendetwas aus den Leuten rauszukriegen, aber niemand hat auch nur eine einzige Frage beantwortet.«
»Wie sieht die Siedlung denn aus?«, frage ich.
»Dreihundertdreißig Hektar Farmland und Wald. Ein Fluss und einige Schluchten. Insgesamt ziemlich abgelegen und teilweise zerklüftet, aber im Sommer wunderschön. Als Schrock vor zwölf Jahren herkam, hat er das Land zu einem Spottpreis gekauft. Er ist in das alte Farmhaus gezogen und hat dort ganz unauffällig gelebt, bis dann der ehemalige Bischof gestorben ist.«
»Wie viele Leute wohnen dort?«, fragt Bates.
»Schätzungsweise ein Dutzend Familien. Die Amischen haben sich ein paar hübsche Häuser gebaut, natürlich ohne Strom. Und Scheunen. Sie besitzen ein bisschen Vieh, ein paar Pferde und Schweine. Sie bestellen die Felder, bauen Mais und Weizen an und ernten Heu. Ein paar Wohnwagen haben sie sich auch angeschafft. Die meisten Familien haben ihr eigenes Stück Land. Das weiß ich alles nur aus den Grundsteuerunterlagen. Es ist schwer, zuverlässige Informationen zu bekommen, weil es inzwischen so gut wie keinen Kontakt zwischen der Amisch-Gemeinde und dem Rest der Stadt gibt.«
Betancourts Blick wandert von Tomasetti zu Bates und schließlich zu mir. »Das Sheriffbüro macht sich Sorgen um die Kinder dort.«
»Ganz besonders, nachdem das Mädchen tot aufgefunden wurde«, sagt Suggs.
»Wie viele Kinder gibt es denn dort?«, frage ich.
»In der Siedlung leben mindestens vierzig Kinder unter achtzehn Jahren. Nach dem Tod von Rachel Esh haben wir zwei Sozialarbeiter vom Jugendamt hingeschickt. Sie haben keine Anzeichen von Misshandlungen, Verwahrlosung oder Missbrauch gefunden. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, dass sie nur gesehen haben, was sie sehen sollten.«
Tomasetti blickt Betancourt an. »Was erwarten Sie von Chief Burkholder?«, fragt er, sein Gesichtsausdruck ist wenig freundlich.
Betancourt erwidert ungerührt seinen Blick. Die Anspannung in meinem Nacken wächst.
»Ich glaube, die Kinder dort sind in Gefahr«, sagt der Ermittler. »Ich glaube, Schrock misshandelt seine Anhänger. Ich glaube, die Menschen dort haben Angst, mit uns zu reden, und wenn wir nicht herausfinden, was da vor sich geht, wird wieder jemand sterben oder einfach nur verschwinden, und wir wissen genauso wenig wie zuvor. Wir müssen jemanden hinschicken, der der Sache auf den Grund geht.«
»Undercover?«, fragt Tomasetti.
»Das wäre ideal«, antwortet Suggs. »Nur haben wir hier niemanden, der für so einen Einsatz geeignet wäre.«
»Ihr braucht jemanden, der die Kultur kennt, Einblick in die Religion hat und die Sprache spricht«, sagt Bates.
»Das heißt«, sage ich langsam, »wer immer dort ermittelt, muss sich als Amischer ausgeben und in die Gemeinschaft integrieren.«
»Richtig«, sagt Suggs.
Schweigen.
»Sie denken dabei an mich«, sage ich.
»Ich weiß, es ist eher ungewöhnlich –«, beginnt Betancourt.
»Und gefährlich«, unterbricht Tomasetti ihn. »Besonders wenn Schrock unberechenbar oder fanatisch oder beides ist.«
Betancourt fährt unbeirrt fort. »Wir würden Ihnen eine Tarnidentität verschaffen und einen Kommunikationsweg einrichten, um mit uns in Verbindung zu bleiben. Und natürlich würden wir alle Ausgaben übernehmen für Reise, Unterkunft … was immer Sie an Kleidung oder Sonstigem brauchen.«
»Und das County übernimmt während des Einsatzes Ihr Gehalt«, fügt Suggs hinzu. »Sie werden offiziell zu uns überstellt und arbeiten auf Vertragsbasis für Franklin County.«
»Sie haben den Background und die Erfahrung, Chief Burkholder.« Bates bemüht sein schönstes Lächeln. »Und Sie sind anscheinend die einzige Polizistin im ganzen Land, die fließend Pennsylvaniadeutsch spricht.«
2. Kapitel
Als die drei Männer mein Büro verlassen, ist es nach sechs Uhr abends. Ich hatte gehofft, Tomasetti würde bleiben, aber da Betancourt wieder direkt nach New York gefahren ist, musste er Bates ins BCI-Büro nach Richfield bringen. Aber wir werden weiter darüber reden, sobald ich zu Hause bin.
Er hatte sich zwar nichts anmerken lassen, aber dass ich auf unbestimmte Zeit in einer dubiosen amischen Gemeinde sechshundert Meilen weit weg verdeckt ermitteln soll, gefällt ihm garantiert nicht. Natürlich konnte er in Gegenwart seiner beiden Kollegen nichts sagen. Ich hatte angenommen, dass Bates von unserer Beziehung weiß oder es zumindest vermutet, aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Hätte Bates gewusst, dass Tomasetti und ich zusammenleben, hätte er ihn nicht an diesem Meeting teilnehmen lassen. Und wenn er Wind davon bekommt, wird Tomasetti umgehend versetzt, damit Painters Mill nicht länger in seine Zuständigkeit fällt. Denn in Bezug auf Liebesbeziehungen im Dienst hat das BCI – wie die meisten Polizeidienststellen, einschließlich meines kleinen Polizeireviers – strikte Regeln. Und das macht unsere sowieso schon komplizierte Situation ganz bestimmt nicht einfacher.
Während ich noch schnell die Einsatzberichte des heutigen Tages schreibe, bin ich mit den Gedanken schon woanders. Die Polizistin in mir fühlt sich geschmeichelt und findet die Vorstellung, verdeckt zu ermitteln, sogar reizvoll. Aber mir ist klar, dass meine lange Berufserfahrung – fast sieben Jahre Streife in Columbus, zwei Jahre bei der Mordkommission und seit vier Jahren Polizeichefin in Painters Mill – mich nicht automatisch für einen Undercovereinsatz qualifiziert.
Solche Aufgaben setzen bei einem Cop spezielle Charaktereigenschaften voraus, die mir teilweise fehlen. Über die Jahre habe ich mehrere Undercoverpolizisten kennengelernt, größtenteils im Rauschgiftdezernat. Die Arbeit ist gefährlich und intensiv. Man muss wochen- oder monatelang eine fremde Identität annehmen, sich Zugang zu manchmal feindseligen Organisationen oder Gruppen verschaffen und das Vertrauen der wichtigen Leute gewinnen. Man ist vollkommen auf sich gestellt, abgeschnitten von Freunden und Familie und dazu noch oft von Menschen umgeben, denen man nicht traut und die man nicht unbedingt mag.
Detectives, die solche Herausforderungen annehmen, sind meistens jung und männlich – Adrenalinjunkies, die gern an vorderster Front mitmischen. Extrovertiert, gute Lügner, voller Energie und, am wichtigsten, mit der angeborenen Fähigkeit ausgestattet, sich in einen anderen Menschen zu verwandeln. Sie würden es nie selber zugeben, aber viele von ihnen halten sich für unverwundbar. Ein paar der Drogenfahnder, die ich kannte, hatten sich so tief in den Sumpf begeben, dass sie am Ende selbst einen Entzug machen mussten.
Ich besitze keine dieser Eigenschaften. Vor ein paar Jahren hätte ich die Chance sofort ergriffen, wenn auch nur, um mir selbst zu beweisen, dass ich das kann. Aber jetzt habe ich ein Alter erreicht, in dem ich mir meiner beruflichen Fähigkeiten sicher bin. Ich fühle mich wohl in meiner Haut und bin mit dem, was ich erreicht habe, zufrieden. Ich mag mein Leben, wie es ist: stabil und berechenbar. Obwohl ich gerne Herausforderungen annehme, muss ich weder mir noch sonst jemandem etwas beweisen. Und ich bin keineswegs unverwundbar.
Außerdem gibt es da noch Tomasetti. Er weiß besser als jeder andere, dass keiner gefeit ist gegen das Unglück, auch die eigenen Angehörigen nicht. Ich muss auf seine Gefühle Rücksicht nehmen. Er hätte sicher Probleme damit, wenn ich mich auf den Job einließe. Vor fünf Jahren, als er noch bei der Polizei in Cleveland war, ermordete ein Killer namens Conn Vespian Tomasettis Frau und seine beiden Kinder kaltblütig. Tomasetti ist ein starker Mann, aber von einem solchen Verlust erholt sich niemand unbeschädigt. Was zur Folge hat, dass er übertrieben besorgt ist und manchmal sogar versucht, mich zu bevormunden. Ich lege Wert auf seine Meinung, denn er ist ein guter Cop, und was er denkt, ist mir wichtig. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich diesmal seinen Segen nicht bekommen werde.