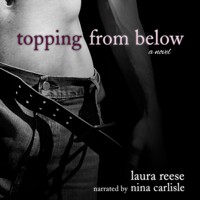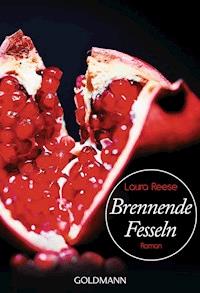
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Journalistin Nora Tibbs jagt den Mörder ihrer jüngeren Schwester Franny. Dabei stößt sie auf einen Abgrund aus Leidenschaft, Verlangen und qual. Als sie auf den mutmaßlichen Täter trifft, erliegt sie dessen unheimlicher Anziehungskraft – und spielt mit ihrem Leben …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 708
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Buch
Nora Tibbs ist eine erfolgreiche, attraktive Journalistin, die ihr Leben im Griff hat. Der Unterschied zu ihrer jüngeren Schwester, der schüchternen, verwundbaren Franny, könnte größer nicht sein. Eigentlich ist Franny für Nora immer eine Unbekannte geblieben. Erst als sie tot und grausam verstümmelt in ihrem Apartment gefunden wird, entdeckt Nora, welcher Abgrund hinter der unscheinbaren Fassade lauerte. Sie liest die Tagebücher ihrer Schwester und kommt einer leidenschaftlichen Affäre zwischen Franny und einem gewissen M. auf die Spur. Während die Ermittlungen der Polizei im Sand verlaufen, gibt Nora die Suche nach dem Täter nicht auf. Sie läßt sich mit dem Musikprofessor Michael ein – dem Mann, der M. und damit Frannys Mörder sein könnte. Doch statt einen kühlen Kopf zu bewahren, erliegt sie dessen bizarrer Anziehungskraft und wird zur Gefangenen einer so ungeheuren Leidenschaft, daß sie dafür bereitwillig ihr Leben riskiert …
Autorin
Laura Reese lebt in Davis, Kalifornien. Ihr Debütroman Brennende Fesseln löste wegen seines gewagten Inhalts in Amerika heftige Kontroversen aus, wurde in den teilweise hymnischen Kritiken als »Die Geschichte der O. der neunziger Jahre« bezeichnet und schaffte den Sprung auf die Bestsellerlisten.
Außerdem von der Autorin bei Goldmann erschienen:
Außer Atem. Roman
Inhaltsverzeichnis
Weil die Erziehung eine wichtige Rolle spielt,widme ich dieses Buchmeinen Eltern, Howard und Jane,und allen meinen Geschwistern,Howie, Ben, Mary und Janet.
Danksagung
Mein Dank gilt all denen, die mich unterstützt und ermutigt haben und dabei oft große Geduld bewiesen: meinem Lektor Charles Spicer, der das endgültige Manuskript intensiv mit mir durchgearbeitet hat und mein Bestes in etwas noch Besseres zu verwandeln wußte; meiner Agentin Barbara Lowenstein, die meine Arbeit trotz aller Mängel annahm, mich dann zwang, durch heuristische Türen zu gehen, und damit wundervolle Dinge bewirkte; ihrer Assistentin Nancy Yost, die mir wertvolle Tips und Anregungen zum ursprünglichen Manuskript gab und mich in die richtige Richtung lenkte; Mary Mackey, die an meine Arbeit glaubte und sie auf eine Weise beeinflußte, die ihr gar nicht bewußt ist; Mary Koompin-Williams, ihres Zeichens Coroner von Yolo County, und J. L., die meine vielen Fragen unermüdlich beantwortet haben; C. Michael Curtis, der mir Hoffnung machte und mit Ratschlägen zur Seite stand, als ich sie am meisten brauchte; und meinen ganz besonderen Freunden Gail McGovern, Charles Smith und, in memoriam, Bob Stovall – die alle drei auf ihre eigene, einzigartige Weise als Katalysatoren fungierten und mir durch ihre vorbehaltlose Unterstützung immer dann Zuversicht schenkten, wenn ich an meiner Arbeit zu zweifeln begann.
Mir ist, als hätte ich seinen Todeskampf durchlebt. Es ist wahr, er hatte den letzten Schritt getan, er war über den Rand getreten, während ich meinen zögernden Fuß zurückziehen durfte. Und darin liegt vielleicht der ganze Unterschied; vielleicht sind alle Weisheit und alle Wahrheit und alle Aufrichtigkeit einfach zusammengedrängt in jenem einen unfaßbaren Augenblick, da wir die Schwelle des Unsichtbaren überschreiten.
Josef Conrad,Herz der Finsternis
Und auch das… ist einer der finstersten Orte der Erde gewesen.
Joseph Conrad,Herz der Finsternis
Bevor ich beginne
Es fällt mir nicht leicht, diese Geschichte zu erzählen. Ich widme sie dem Andenken meiner Schwester, die vor nur zehn Monaten, im Frühling letzten Jahres, an einem trägen Tag, an dem die Eichelhäher heiser schrien und die Sonne warm und sanft vom Himmel schien, tot in ihrer Wohnung in Davis aufgefunden wurde, während draußen die knospenden Bäume ihre ersten Blüten öffneten. Es war ein herrlicher Tag, die Art von Frühlingstag, die eine Verheißung von reiner Unschuld und Neubeginn bereithält – einer der Tage, an denen der Sonnenschein die Stadt erstrahlen läßt. Aber während draußen der Frühling seinen Einstand gab, lag drinnen in der Wohnung meine liebe Schwester, Klebeband über dem Mund und um die nackten Hand- und Fußgelenke gewickelt. Sie war brutal mißhandelt und gequält worden, und ihre Leiche verrottete – zwei Wochen lang unbemerkt – in der Hitze eines Raumes, in dem das Heizungsthermostat auf zweiundzwanzig Grad eingestellt war. Dies ist ihre Geschichte und die Geschichte von Michael M., einem Musikprofessor an der Universität, der immer noch in Davis lebt und den ich für ihren Mörder halte.
Mein Name ist Nora Tibbs, und meine Schwester Frances war vierundzwanzig, als sie starb. Wir sind beide in Davis aufgewachsen, einer kleinen Universitätsstadt, fünfundzwanzig Kilometer westlich von Sacramento. Der Tod ist für mich nichts Neues. Ich hatte einen jüngeren Bruder, Billy, der im Alter von nur zwölf Jahren bei einem Wanderausflug tödlich verunglückte. Es war eine schwierige Zeit für uns alle. Billys Abwesenheit war so schmerzhaft, die Erinnerung an ihn noch in jedem Raum des Hauses lebendig. Meine Eltern sehnten sich nach einer Veränderung. Schließlich zogen sie mit Franny nach Montana. Ich war zehn Jahre älter als meine Schwester, und da ich gerade eine neue Stelle als Journalistin angetreten hatte, blieb ich zurück und zog nach Sacramento, an meinen Arbeitsort. Ein Jahr später waren meine Eltern tot. Sie waren bei einem Autounfall ums Leben gekommen, und Franny, damals erst vierzehn, kam nach Sacramento, um bei mir zu leben.
Wir waren einander überhaupt nicht ähnlich. Ich bin wie mein Vater groß und athletisch gebaut und trete recht bestimmt auf, wenn die Situation es verlangt. Franny dagegen war weich und rundlich und blaß. Ihr Haut war zart wie die eines Babys, und sie hatte etwas Gemütliches, Zerknautschtes an sich: Ihre Klamotten waren immer groß und weit, ihre langen braunen Haare ein Wirrwarr aus Locken. Sie war ungewöhnlich schüchtern und daher leicht zu übersehen. Ihre Stimme wurde immer leiser, wenn ihr jemand zu aufmerksam zuhörte, und auf Partys – den wenigen, zu denen ich sie mitschleppen konnte – neigte sie dazu, sich wie ein Chamäleon dem Hintergrund anzupassen, indem sie einfach mit der Einrichtung verschmolz. Wenn jemand versuchte, sie ein wenig aus der Reserve zu locken, und ihr dabei zu nahe kam, wurde sie plötzlich spröde und ausweichend, als hätte sie ihr ganzes Leben damit verbracht, nervös auf den Moment hinzuzittern, in dem ein Lehrer sie herauspicken und nach etwas fragen würde, das sie nicht beantworten konnte: In solchen Momenten trat ein Ausdruck des Unbehagens in ihre Augen, sie wandte den Blick ab und zog den Kopf ein; sie verschränkte die Arme über der Brust, als wolle sie sich selbst umarmen, und zog sich in ihr Inneres zurück.
Franny arbeitete in Sacramento als Dialyseschwester, was bedeutete, daß sie die meisten Arbeitstage mit Leuten verbrachte, die Nierenprobleme hatten. Sie schloß sie an Maschinen an, die sie am Leben erhielten, indem sie das Gift aus ihrem Blut herausfilterten. Es war kein Zufall, daß Franny Dialyseschwester wurde. Sechs Monate vor seinem Unfall erkrankte unser Bruder an Glomerulonephritis, einer Nierenentzündung, die bei ihm zu Nierenversagen führte. Er mußte zur Dialyse und kam auf eine Warteliste für eine Spenderniere. Nach Billys Tod faßte Franny den Entschluß, Dialyseschwester zu werden. Ich verstand ihre Motivation – sie und Billy waren nur ein Jahr auseinander gewesen und hatten einander sehr nahegestanden –, aber ihre Entschlossenheit wirkte fast schon besessen, als würde sie mehr von Schuld als von Liebe getrieben.
Trotzdem schien ihr die Arbeit zu liegen. Sie erwies sich – und das überraschte mich – als sehr kompetent. Jede Schüchternheit und Unsicherheit fiel von ihr ab. Sie huschte geschäftig im Büro herum, gab Medikamente aus, schloß einen Patienten an die Maschine an, maß bei einem anderen den Blutdruck, tröstete nebenbei einen dritten. Sie hatte alles unter Kontrolle. Wer Franny kannte, wußte, daß das kein Wort war, das die Leute normalerweise auf sie angewendet hätten. Aber ein paar Stunden später, sobald sie das Gefühl hatte, daß die Dinge sie zu überwältigen drohten, zog sie sich wie eine Schildkröte in ihren Panzer zurück.
Inzwischen war sie wieder nach Davis gezogen. Sacramento machte ihr angst – sie gewöhnte sich nie an die vielbefahrenen Freeways (die eigentlich gar nicht so hektisch sind, verglichen mit dem Verkehr in Los Angeles oder San Francisco), die Zeitungsberichte über Gewalttaten, Schießereien, gelegentliche Messerstechereien, Morde unter Bandenmitgliedern. Franny pendelte lieber zur Arbeit. Davis war ruhig, und abgesehen von ein, zwei Fahrraddiebstählen, gab es dort kaum Kriminalität. Sie mochte den Markt am Samstagvormittag im Central Park. Sie genoß es, mit ihrem Rad durch das Arboretum, die Baumschule auf dem Unigelände, zu fahren und am Putah Creek die Enten zu füttern. Bei dieser Gelegenheit lernte sie Michael M. kennen.
Meine Schwester führte auf ihrem Macintosh-Computer ein bruchstückhaftes Tagebuch, das sie »Franny’s File« nannte. Als ich es las, entdeckte ich, daß ich sie überhaupt nicht gekannt hatte. Sie schrieb über ihre Leidenschaften, über ihre Sehnsüchte und Sorgen. Sie schrieb über Michael M., über die Dinge, die er ihr antat, ihre Erniedrigung und Verzweiflung. Seine subtile, unterschwellige Schwärze sickert zwischen ihren Worten hindurch; trotzdem wirkt der Ton ihrer Tagebucheinträge naiv und unschuldig. Sie scheint nicht in der Lage gewesen zu sein, zwischen ihren eigenen Zeilen zu lesen und zu erkennen, wie krank M.s Phantasie war. Wie ein metastasenbildender Krebs manövrierte er sich in ihr Leben und machte sich daran, sie zu zerstören.
Die Polizei hat ihren Mörder noch nicht gefaßt, und obwohl die ermittelnden Beamten ihr Tagebuch gelesen haben, hat man M. laufenlassen. Aus Mangel an Beweisen, hieß es. Er habe kein Motiv, nichts, was ihn mit dem Verbrechen in Verbindung bringe. Das einzige, was das Tagebuch beweise, sagte ein Beamter nicht gerade taktvoll zu mir, sei, »daß Ihre Schwester in punkto Männer keine besondere Menschenkenntnis besaß«. Sie sind in eine Sackgasse geraten, aber ich habe vor, ihnen die Beweise zu liefern, die sie brauchen. Daß M. nicht angeklagt worden ist, heißt noch lange nicht, daß er die Tat nicht begangen hat. Jeder, der Frannys Tagebuch gelesen hätte – der gelesen hätte, was er ihr angetan hat –, würde verstehen, wieso er schuldig ist und wieso ich ihn nicht davonkommen lassen werde – nicht davonkommen lassen kann.
Ich habe immer geglaubt, daß die Menschen grundsätzlich gut sind, daß sie in einem Zustand der Gnade geboren werden, an dem nur ein unglückliches Umfeld etwas ändern kann. Ich habe immer geglaubt, daß das Böse – das ererbte, angeborene Böse – nicht existiert. Inzwischen bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich bin Journalistin, schreibe wissenschaftliche Artikel für den Sacramento Bee, und im Lauf der Jahre habe ich dabei folgendes gelernt: In der Debatte »Erbe versus Erziehung« erweist sich das Erbgut letztendlich als Sieger. Die Gehirnforschung gelangt zunehmend zu der Erkenntnis, daß die Gene eine viel größere Rolle für das menschliche Verhalten spielen, als bisher angenommen. Die Wissenschaftler spekulieren sogar, daß Gewalttätigkeit erblich ist und daß der männliche Teil unserer Spezies ein Gen in sich trägt, das ihn dazu drängt, sich aggressiv zu verhalten und eher den Krieg zu suchen als den Frieden. Männer benehmen sich einfach anders als Frauen, und nach Meinung verschiedener Wissenschaftler haben diese Verhaltensunterschiede biologische Wurzeln. An diesem Punkt sollte ich – nur, um Mißverständnisse zu vermeiden – vielleicht klarstellen, daß ich Männer mag, schon immer gemocht habe. Die Männer schlechtzumachen ist nicht mein Metier, und mein Ziel besteht nicht darin, aus einem höchst persönlichen Motiv heraus das gesamte männliche Geschlecht als bösartig darzustellen. Ich habe durchaus gute Beziehungen mit Männern gehabt.
Aber wenn es stimmt, daß Männer aufgrund ihrer Gene zu Gewalt und Aggression neigen, ist dann auch Bösartigkeit eine Frage der Biologie? Existiert das Böse als eine Art Normabweichung – vielleicht als Genmutation, als Folge eines schiefgegangenen Vererbungsprozesses? Existiert es in manchen Männern so ausgeprägt, daß es ein fester Bestandteil ihres Wesens ist? Die Antworten auf diese Fragen weiß ich nicht. Ich weiß nur, daß manche Männer, sei es durch ihre Erbanlagen, sei es durch ihre Erziehung, tatsächlich böse sind, und diese Geschichte, Frannys Geschichte, handelt von dem Leid, das ein solcher Mann verursacht hat.
Böse Menschen sind nicht an ihrer schwarzen Kleidung zu erkennen, und sie werfen auch keinen Halbschatten unheilvollen Dämmerlichts. Sie sind von den Leuten im Nebenhaus nicht zu unterscheiden. M. lehrt immer noch an der UCD, der University of California in Davis. Ich sehe ihn in Begleitung anderer Frauen, junger und alter. Er sagt etwas, und sie lächeln oder lachen. Er sieht harmlos aus, nicht wie ein Mensch, der eines Mordes fähig wäre. Trotzdem gelange ich, wenn ich das Tagebuch meiner Schwester lese, immer wieder zu der Erkenntnis, daß er ein böser Mann ist, ein Mann ohne Gewissen oder Seele. Er hat Franny zerstört, und zwar absichtlich und ohne Gewissensbisse. Sie war gefesselt und gefoltert worden, und trotzdem konnte der zuständige Gerichtsmediziner die genaue Todesursache nicht feststellen. Woran sie letztendlich gestorben ist, bleibt bis heute ein Rätsel.
Ich beginne diese Geschichte, ohne zu wissen, wie sie enden wird. Ich werde versuchen, mich an Frannys Tagebuch zu halten und die Ereignisse in der Reihenfolge aufzuzeichnen, in der sie sie in ihren Computer eingegeben hat. Aber in ihren Eintragungen gibt es große Lücken; sie hat Einzelheiten ausgelassen, Details, die ihren Mörder zur Strecke bringen würden. Das alles werde ich mir bei Michael M. holen müssen. Natürlich habe ich ihn schon gesehen, habe den Mann aus der Ferne beobachtet. Und bevor ich meine Geschichte beende, werde ich Kontakt mit ihm aufnehmen und ihn ziemlich gut kennenlernen.
Nach dem Tod meiner Schwester bin ich nach Davis zurückgekehrt. Da ich etwas Geld gespart hatte, war ich in der Lage, mich bei der Zeitung für längere Zeit beurlauben zu lassen; trotzdem schreibe ich noch gelegentlich als freie Mitarbeiterin einen Artikel für sie. Ich bin gerade dabei, im südlichen Teil der Stadt ein Haus zu mieten, in einem Viertel, das als Willowbank bekannt ist. M. lebt auch hier in Willowbank, im älteren Teil, wo die Häuser groß und weitläufig sind und die Bäume einen Baldachin über den Straßen bilden und während unserer heißen, trockenen Sommer angenehmen Schatten spenden; wo es keine Gehsteige gibt und kaum Zäune, abgesehen von ein paar niedrigen, freundlichen Holzzäunen, die mehr aus ästhetischen Gründen als zum Schutz errichtet wurden. Ich bin hierhergezogen, um näher bei M. zu sein, um mir selbst ein Bild von ihm zu machen.
Immer wieder lese ich Frannys Tagebuch. Es beginnt so hoffnungsvoll, mit einer subtilen Ironie, von der ich gar nicht wußte, daß sie sie besaß:
Ich habe das Gefühl, demnächst eine Reise anzutreten. Etwas Wundervolles und Aufregendes geschieht mit mir. Ich fühle mich wie ein neuer Mensch, und das verdanke ich alles Michael. Er sieht Dinge in mir, die noch nie zuvor ein Mensch gesehen hat; er läßt mich Dinge fühlen, die ich noch nie zuvor gefühlt habe. Ich bin dabei, mich zu verändern, soviel steht fest. Ich wünsche mir so sehr, aus meinem trägen, sicheren Leben herauszutreten und mich meinen Träumen zu stellen, meine Leidenschaften freizulassen. Ich möchte mich in Michaels Gewalt begeben, die Zügel ganz ihm überlassen. Gestern abend hat er versprochen, mir Orte zu zeigen, an denen ich noch nie gewesen bin. Ich habe zu ihm gesagt: »Die Galápagos-Inseln? Hawaii?«, aber ich wußte, daß er es nicht geographisch meinte. Oh, Michael! Ich habe nie gewagt, von jemandem wie dir zu träumen. Ich dachte, du wärst unerreichbar für mich, aber jetzt stelle ich fest, daß deine Fingerspitzen die meinen berühren.
Was für ein unschuldiger Anfang, voll nackter Hoffnung und Freude. Ihre Reise sollte nicht so unschuldig werden.
Sie begann wie ein Traum – Frannys Beschreibungen ihrer ersten sexuellen Begegnungen mit M. sind mit einem Romantizismus eingefärbt, der etwas fast Traumartiges, märchenhaft Idyllisches hat –, und sie endete als Alptraum, als langsamer Abstieg in das schwarze Herz eines bösen, sadistischen Mannes, als eine Reise in die Hölle, aus der es keine Rückkehr gab.
Deshalb widme ich diese Geschichte Franny, ihrem Andenken. Ich schreibe diese Geschichte, weil ich muß. Ich spüre, daß ich keine Wahl habe: Sie ist zu meiner eigenen Obsession geworden. Wie Conrads Marlow, wie Coleridges alter Seemann bin ich gezwungen, diese Geschichte zu erzählen. Ich lerne gerade, daß Schriftsteller sich ihre Obsessionen nicht aussuchen; die Obsessionen suchen sie aus. Ich erzähle Frannys Geschichte, weil sie selbst dazu nicht mehr in der Lage ist. Ich erzähle ihre Geschichte, um die Wahrheit zu enthüllen und M. zu entlarven – um das zu tun, wozu die Polizei nicht fähig war. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Menschen für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden, und M. muß die Verantwortung für die seinen übernehmen. Er hat Franny auf eine dunkle Reise mitgenommen, von der sie nie zurückgekehrt ist. Ich werde dieselbe Reise antreten, aber ich habe länger gelebt als meine Schwester, und selbst wenn ich nicht weiser bin als sie, bin ich doch wenigstens erfahrener. Diesmal wird die Reise anders enden, da bin ich mir sicher – für M. und für mich.
ERSTER TEIL
FRANNY
1
Am letzten Tag des Monats Oktober wurde Frances Tibbs, während sie über das Unigelände radelte, klar, daß sie zum ersten Mal in ihrem Leben verliebt war.
Zumindest glaubte sie, verliebt zu sein. Sie hatte es noch nicht laut ausgesprochen, die Worte noch nicht auf der Zunge getestet, aber es fühlte sich an wie Liebe: Alles erschien ihr frisch und neu und aufregend.
Plötzlich trat ein Mann vor Franny auf den Weg und erschreckte sie fast zu Tode. Sie zog die Bremsen und wich ihm aus, kam gerade noch an ihm vorbei. Er hatte sich einen Nylonstrumpf über den Kopf gezogen. In der Rechten trug er einen riesigen Revolver, vielleicht auch ein Gewehr oder eine Schrotflinte. Franny kannte den Unterschied nicht, aber bei genauerem Hinsehen fand sie, daß sie Waffe nicht besonders echt aussah. Sie war kleiner, als sie sich ein Gewehr vorstellte, und schien aus Plastik zu sein.
Plastik.
Eine Spielzeugwaffe. Es war Halloween, fiel ihr ein. Der Mann – jetzt sah sie, daß es nur ein College-Student war – war offenbar zufrieden mit dem Schrecken, den er ihr eingejagt hatte. Anzüglich grinsend schulterte er sein Gewehr und trottete weiter.
Mit dem Gefühl, sich zum Narren gemacht zu haben, stieg sie wieder auf ihr Rad und strampelte den Weg am nördlichen Arm des Putah Creek entlang. Hier, in seinem eingedämmten nördlichen Teil, führte der Flußarm nur wenig Wasser. Es war brackig, hatte eine ungute grüne Farbe und verströmte einen abgestandenen, modrigen Geruch, den sie nur zu gern hinter sich ließ. Hatte man erst einmal das oberste Ende des Flußarmes erreicht, wurde der Weg sehr angenehm. Zu beiden Seiten war er von Bäumen und dichter, dunkelgrüner Vegetation gesäumt, und die Luft war von erdigen, hölzernen Gerüchen erfüllt. Sie radelte in der Hoffnung hier heraus, ihren neuen Freund Michael zu treffen. Sie hätte nicht erklären können, was genau sie zu ihm hinzog. Sie wußte nur, daß sie ständig an ihn dachte und daß ihr ihr Leben irgendwie ein wenig heller vorkam, seit sie ihn getroffen hatte, als stünden ihr plötzlich mehr Möglichkeiten offen. In gewisser Weise erinnerte er sie an ihren Vater, einen geduldigen, ruhigen Mann, von dem sie gewußt hatte, daß er sie beschützen würde. Es war schon so lange her, daß ihre Eltern gestorben waren, und obwohl sie eine Schwester hatte, fühlte sie sich allein auf der Welt. Aber Michael hatte eine so einfühlsame Art, sie anzusehen, als könnte er mit einem einzigen Blick ihre ganze Geschichte erfassen. Es war ein schönes Gefühl.
Sie hatte eine Stelle erreicht, wo es abwärts ging, und beschleunigte. Radfahren war Teil ihres neuen Diätplans. Sie hatte mehrere Lieblingsstrecken: den Weg zwischen den Solarhäusern im Westteil von Davis hindurch, den Howard-Reese-Fahrradweg entlang des Russell Boulevard bis hinaus nach Cactus Corners und die Strecke, auf der sie sich gerade befand und die sie am häufigsten fuhr, den Weg, der am südlichen Rand des Unigeländes entlang des Putah Creek verlief. Der Pfad war schmal und schlängelte sich durch die Baumschule der Uni, eine waldige Enklave aus Büschen und Bäumen, hauptsächlich Mammutbäume, Koniferen und Eukalyptus. Franny liebte diesen Ort. Unter den Bäumen waren Picknicktische versteckt, auf dem Boden lagen Holzspäne und heruntergefallenes Laub, das sich allmählich zersetzte, und der Geruch, der in der Luft hing, war ein sehr alter; er erinnerte sie an frühere Zeiten. Es war der feuchte, humusschwere Geruch längst vergessener Orte und alter Zivilisationen, die unter unzähligen Schichten von Schutt und Verwesung begraben lagen.
Sie überquerte einen hölzernen Brückenbogen, um zu einem grasbewachsenen Hügel auf der anderen Seite des Flußarmes zu gelangen. Hier dehnte sich das Wasser zu einem breiten, trüben Teich aus. Ein guter Platz, um Enten zu beobachten. Zu dieser Tageszeit, am späten Nachmittag, war auf dem Campus wenig los, und sie hatte diesen Ort so ziemlich für sich allein. Sie stieg ab, setzte sich ins Gras und hing ihren Tagträumen nach. Sie hoffte, daß Michael vorbeikommen würde. Die Luft war kühl – aber nicht so kalt, wie sie in ein paar Wochen sein würde, wenn der Nebel sich über das Land senkte und einem bis in die Knochen kroch –, und der Himmel hatte eine Art schmuddelige Spülwasserfarbe, stumpf und grau. Ein leichter Wind kräuselte die Oberfläche des Wassers und raschelte durch die Baumwipfel. Hin und wieder ließ ein stärkerer Windstoß rötlichbraune Blätter durch die Luft flattern.
Franny schlang die Arme um die Knie, um sich warm zu halten. Der Rasen war gerade erst gemäht worden und verströmte noch den frischen, feuchtgrünen Geruch frisch gemähten Grases. Vor vielen Jahren, als sie noch ein Kind war, war ihr Vater mit ihr und Billy manchmal hierhergekommen. Ihre ältere Schwester Nora war damals schon im Teenageralter und nicht dazu zu bewegen, sie zu begleiten. Aber Franny und Billy liebten das Arboretum, und manchmal saßen sie einfach bloß da, wie in Trance, mit geschlossenen Augen, und saugten die Geräusche rundherum in sich auf. Oft hörten sie auch zu, wie ihr Vater, ein Experte für Umweltfragen, ihnen von der Beziehung des Menschen zur Natur erzählte. Es gebe ein evolutionäres Band, hatte er ihnen mehr als einmal erklärt, das sich im Laufe von Millionen Jahren entwickelt habe und die Menschen untrennbar mit ihrer Umgebung verbinde, mit der Erde, der Sonne, dem Himmel. Und tatsächlich: Hier draußen, wo nur das Rauschen des Windes in den Bäumen, das sporadische Geschnatter der Enten und hin und wieder das zischende Geräusch eines vorbeifahrenden Radfahrers zu hören war – hier draußen fühlte sie sich irgendwie ruhig, verwurzelt. Ob das die Anziehungskraft der Natur war oder die schützende Kraft ihrer liebevollen Erinnerungen an ihren Vater, wußte sie nicht. Inzwischen gehörte für sie beides untrennbar zusammen.
Zwei College-Studenten, ein Junge und ein Mädchen, gingen Arm in Arm über die Brücke und blieben in der Mitte stehen, um auf das Wasser hinabzublicken. Wehmütig beobachtete Franny ihre sorglosen, verträumt lächelnden Gesichter. Sie waren offensichtlich verliebt. Franny mußte ebenfalls lächeln. Sie hörte die beiden reden, konnte aber die einzelnen Worte nicht verstehen. Ihr Lachen stieg in die Baumwipfel hinauf.
Franny ließ ihren Blick weiter in Richtung Campus schweifen. Sie hielt nach Michael Ausschau. Vor drei Wochen hatte sie ihn hier kennengelernt. Sie hatte gerade altes Brot aus einer Tüte an die Enten verfüttert, als plötzlich jemand hinter ihr gesagt hatte: »Sie sind keine Studentin.«
Erschrocken war sie herumgefahren. Sie hatte Michael vorher noch nie gesehen. Er war groß, mit olivfarbener Haut und dunklem Haar, das an den Schläfen bereits ergraute. Aus den Falten in seinem Gesicht hatte sie geschlossen, daß er Ende Vierzig sein mußte. Er hatte etwas Wissendes, fast Zynisches an sich, als hätte er schon alles gesehen und getan. Er hatte beide Hände in den Hosentaschen und starrte sie mit unergründlicher Miene an, ohne zu blinzeln. Franny senkte den Kopf. Als sie wieder aufblickte, beobachtete er sie noch immer. Seine Augen wirken kalt und gefühllos, hatte sie damals gedacht, aber dann war langsam ein Lächeln auf seine Lippen getreten. Sie empfand es als unangenehm, so im Zentrum seiner Aufmerksamkeit zu stehen, und hatte das Gefühl, irgendwie begutachtet zu werden, als würde er gerade eine Entscheidung über sie fällen.
»Nein«, antwortete sie, »ich bin keine Studentin« und wurde rot, als hätte er sie bei irgend etwas Verbotenem ertappt, obwohl sie genau wußte, daß das nicht der Fall war. Sie wandte sich ab. Verlegen riß sie ein Stück Brot ab und warf es einer Ente hin. Fünf hatten sich vor ihr versammelt, Stockenten mit schimmernden grünen Köpfen, und nun rauften sie um das Brot. Sie warf ihnen den Rest hin und griff in die Tüte, um für Nachschub zu sorgen. Der Mann hatte sich nicht von der Stelle gerührt, und sie spürte, daß er sie immer noch beobachtete. Sein Blick verunsicherte sie.
»Sie sehen auch nicht aus wie eine Studentin«, sagte er schließlich, und Franny fragte sich, wieso nicht. Schließlich lag ihre Schulzeit noch nicht so lange zurück.
»Ich habe Sie schon öfter hier draußen im Gras liegen und die Enten füttern sehen. Sie kommen immer um diese Zeit und immer allein.«
Franny warf ihm einen schnellen, schrägen Blick zu, sagte aber nichts. Daß sie schon seit Wochen von jemandem beobachtet worden war, beunruhigte sie ein wenig. Wieder sah sie ihn an. Alles an ihm war scharf und klar gezeichnet: das kantige Kinn, die gerade, scharf geschnittene Nase, der schlanke, aber kräftige Körper. Er war nicht gerade das, was man einen schönen Mann nannte, aber er war beeindruckend. Zu beeindruckend. Sie wünschte, sie hätte etwas Häßliches an ihm entdecken können, irgend etwas, das ihn weniger einschüchternd gemacht hätte, vielleicht ein bißchen Fett um die Taille oder Hängebacken.
»Darf ich?« fragte er, und ohne eine Antwort abzuwarten, nahm er sie am Handgelenk und zog ihr die Scheibe Brot aus der Hand. Franny brachte kein Wort heraus, so sehr war sie von der Intimität dieser Geste überrascht. Sie sah zu, wie er die Enten mit ihrem Brot fütterte.
Er sagte: »Neuerdings schaue ich um diese Zeit immer hier heraus, weil ich hoffe, Sie zu finden. Wenn Sie nicht da sind, kommt mir mein Tag irgendwie unvollständig vor, als würde etwas fehlen.« Er wandte leicht das Gesicht und sah sie an. In seinen Augen funkelte eine Spur von Schalk. »Anscheinend gehören Sie schon zu meinem Tagesablauf wie meine morgendliche Tasse Kaffee.«
Franny hatte über seine Worte gelächelt. Mit Koffein war sie noch nie verglichen worden. Dann hatte er sich vorgestellt, und seit drei Wochen traf sie sich hier regelmäßig mit ihm. Er kam nicht jeden Tag. Manchmal blieb er mehrere Tage weg, bis sich ihr Magen angstvoll zusammenzog und sie sich zu fragen begann, ob sie ihn jemals wiedersehen würde. Aber dann tauchte er wieder auf und fing einfach zu reden an, ohne irgendein erklärendes Wort über seine lange Abwesenheit zu verlieren. Er hatte eine ruhige, entspannte Art, die es ihr leichtmachte, mit ihm zu reden, auch wenn sie das Reden eigentlich meistens ihm überließ. Im Gegensatz zu manchen anderen Menschen schien ihm das aber nichts auszumachen, und er drängte sie auch nicht, mehr aus sich herauszugehen. Er schien instinktiv zu wissen, daß sie schon von selbst kommen würde, wenn sie soweit war. Dafür war sie ihm dankbar – die meisten Leute gaben sie auf, bevor sie begann, sich in ihrer Gegenwart wohl zu fühlen –, und es dauerte nicht lange, bis sie sich eingestehen mußte, daß sie nicht wegen der sportlichen Betätigung zum Putah Creek radelte, sondern in der eindeutigen Absicht, ihn zu treffen. Wenn er nicht kam, war sie jedesmal enttäuscht.
Michael arbeitete als Musikprofessor an der Uni. Er war kultiviert und intelligent, ein Typ, von dem sie nicht geglaubt hätte, daß er sich je für sie interessieren würde. Nicht, daß sie einen bestimmten Typ hatte. Sie war mit einigen Männern zusammengewesen, aber es hatte nie funktioniert. Erst letzten Monat hatte Nora sie zu einer Party des Bee geschleppt, und sie hatte dort einen Mann kennengelernt. Er war Reporter wie Nora, hatte blondes Haar und eine so offene, natürliche Ausstrahlung, eine fast jungenhafte Unschuld, daß sie ihm instinktiv vertraut hatte. Er schien es ernst zu meinen, aber am nächsten Morgen – nachdem sie mit ihm geschlafen hatte – erklärte er ihr verlegen, er habe am Vorabend zuviel getrunken. Franny konnte niemandem einen Vorwurfmachen, höchstens sich selbst. Sie hatte noch nie so impulsiv gehandelt, nie mit einem Mann geschlafen, den sie gerade erst kennengelernt hatte. Sie war zu schnell gewesen, zu krampfhaft auf der Suche, hatte gehofft, daß der Sex – der nicht besonders gut war – zu größerer Vertrautheit führen würde. Was nicht der Fall war. Er lud sie zum Frühstück ins Food for Thought Café an der K Street ein, aber sie spürte die ganze Zeit, wie unbehaglich er sich fühlte. Er war zu höflich, zu eifrig bemüht: Er hatte einen Fehler gemacht und versuchte, mit Anstand aus der Sache herauszukommen. Sie sah das Unbehagen in seinen Augen, das Mitleid, die Unsicherheit. Hätte sie sich nicht selbst so elend gefühlt, hätte er ihr wahrscheinlich leid getan. Danach wartete sie mehrere Tage vergeblich auf seinen Anruf. Schließlich rief sie ihn an. Es war peinlich und erniedrigend. Vielleicht könnten sie trotzdem Freunde sein, hatte er in freundlichem Ton gesagt. Sie hatte sein gutgemeintes, aber halbherziges Angebot abgelehnt, indem sie einfach auflegte.
Michael würde so etwas nie tun, dachte sie jetzt. Michael. Er war doppelt so alt wie sie, achtundvierzig, das hatte sie inzwischen erfahren – nur sechs Jahre jünger, als ihr Vater gewesen wäre –, aber sie hatte sich noch nie bei einem Menschen so wohl gefühlt wie in seiner Gegenwart. Manchmal, wenn sie zu Hause war, phantasierte sie ein bißchen vor sich hin, gab Michael einen Platz in ihrem Leben, machte ihn zu ihrem Freund. Sie hatte keine Ahnung, was er von ihr dachte oder ob er überhaupt an sie dachte. Obwohl er immer nett zu ihr war und sie wirklich zu mögen schien, kam er ihr unerreichbar vor.
Sie hörte im Gras hinter sich Schritte rascheln und lächelte, weil sie wußte, daß es Michael war.
»Hallo, Franny.«
Beim Klang seiner Stimme drehte sie sich um. Es war immer, als tauche er aus dem Nichts auf und ertappe sie bei ihren Tagträumen. Sie lächelte ihn an. Er hatte etwas Sinnliches an sich, das sie nicht verstand, etwas Mächtiges, das sie wie eine Unterströmung mit sich zu reißen schien. Zugleich aber sprach aus seinen dunklen, kühlen Augen und dem beherrschten Ton seiner Stimme etwas Distanziertes, das in ihr den Wunsch weckte, die Arme auszustrecken und ihn an sich zu ziehen, obwohl sie genau wußte, daß sie das nie tun würde.
Er setzte sich neben sie ins Gras und lehnte sich auf die Ellbogen zurück, ohne auf die Kälte zu achten. Seine Kleidung, eine braune Hose und eine Jacke, deren Ärmel er bis zu den Ellbogen hinaufgeschoben hatte, wirkte lässig, aber er hatte immer etwas Formelles an sich, egal, was er trug. Er wirkte aufgeräumt, stets im reinen mit sich selbst, während Franny, die sich verfroren und ungepflegt fühlte, ein formloses Bündel sich bauschender Klamotten war: übergroßer Mantel, schwarze Jeans, Zopfpulli, Wollschal und Handschuhe.
Schweigend beobachtete er das junge Paar auf der Brücke. Sie wandten sich ab und gingen Hand in Hand davon.
»Junge Liebe«, sagte er mit einer Spur Sarkasmus in der Stimme. Franny sah ihn an, erwartete, daß er weitersprechen würde. Aber er schwieg.
»Ich finde die beiden irgendwie süß«, sagte sie schließlich leise.
Michael sah sie nachdenklich an. Sein Blick war durchdringend, als könnte er ihre Gedanken lesen. Verunsichert senkte sie den Kopf. Ein unerwarteter Windstoß ließ ihre Haare fliegen. Dann spürte sie plötzlich, wie er ganz leicht mit dem Handrücken über ihre Wange fuhr – das erste Mal, daß er sie berührte.
»Du hast recht, Franny«, sagte er. »Es kann sehr süß sein.« Dann fügte er hinzu: »Für dich war es nie so, oder?«
Bin ich so leicht zu durchschauen? fragte sie sich und spürte, wie ihr die Röte in die Wangen stieg. Es war ihr peinlich, daß er wußte, daß sie mit vierundzwanzig Jahren noch nie verliebt gewesen war, nie auch nur ansatzweise in Versuchung gewesen war, sich zu verlieben. Sie wollte ihm gerade antworten, ihm sagen, daß die Liebe für sie tatsächlich nie süß gewesen sei, als eine Frau vorbeikam, eine zierliche Person mit welligem schwarzem Haar, die Michael lächelnd begrüßte und im Vorbeigehen mit ihm flirtete. Sie war sehr hübsch, mit geschwungenen, sauber gezupften Augenbrauen und geschminkten Lippen, und sie trug ein enges weinrotes Leinenkostüm, das bei einer größeren Frau längst nicht so attraktiv ausgesehen hätte.
Franny spielte mit dem Gras. Sie riß einen Halm mit der Wurzel aus. »Sie ist hübsch«, sagte sie schließlich. Dann fügte sie hinzu: »Ich glaube, sie mag dich.«
Michael sah sie mit einem halben Lächeln an, und sie wurde rot, weil er erraten hatte, daß sie eifersüchtig war.
»Das spielt keine Rolle«, sagte er. »Ich bin nicht an ihr interessiert. Soll ich dir sagen, wie der Typ Frau aussieht, der mich interessiert?«
»Oh«, sagte Franny. »Ich weiß nicht …« Ihre Stimme verlor sich. Sie wußte nicht, ob sie ihn über andere Frauen reden hören wollte.
Michael lachte tief und freundlich. Er sagte: »Fahren wir zu mir. Ich glaube, es ist Zeit, daß ich mit dir schlafe.«
Franny blinzelte. In ihrer Phantasie passierte es nie auf diese Weise. Da sagte er niemals: »Ich glaube, es ist Zeit, daß ich mit dir schlafe.« Sie hatte etwas anderes erwartet, etwas Romantischeres.
Als sie ihm keine Antwort gab, stand er auf. »Komm«, sagte er. »Riskier es doch einfach.«
Franny hatte das Gefühl, noch nie etwas wirklich Gewagtes, Abenteuerliches getan zu haben. Letztendlich hatte sie nie etwas riskiert. Nora, ihre ältere Schwester, riskierte ständig etwas. Sie fuhr nach Nicaragua, während dort der Krieg tobte. Sie fuhr ganz allein, mit Rucksack. Und im Urlaub war sie einmal zum Wildwasser-Rafting an den Urabamba River in Peru gefahren. Franny konnte sich nicht vorstellen, durch die Welt zu ziehen und zum bloßen Vergnügen ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Vielleicht, dachte sie, ist es wirklich an der Zeit, etwas zu riskieren. Deshalb blickte sie zu ihm auf und sagte das einzige, was ihr einfiel: »Okay.«
Michael verstaute Frannys Rad im Kofferraum seines Wagens, und sie fuhren zu seinem Haus in Willowbank, im südlichen Teil von Davis. Dort waren alle Häuser groß und alt, die meisten sehr gepflegt, mit efeuüberwucherten Eingängen, weiten Rasenflächen und vielen alten Bäumen. Michaels Haus war ein Stück zurückgesetzt, ein weitläufiges Gebäude im Ranch-Stil, dessen Vorderseite von Glyzinien verhüllt wurde. Drinnen wirkte das Haus frisch renoviert: glänzende Plankenböden aus robuster Eiche, Oberlichter in Küche und Diele, eine keramikgeflieste Küchentheke und im Wohnzimmer eine Glasfront, die vom Boden bis zur Decke reichte. Alles wirkte klar, aber lässig, genau wie Michael selbst.
Nervös ging sie durch sein Haus. Es war in warmen, satten Farben gehalten, hauptsächlich erdigen Brauntönen. Eigentlich hätte das eine beruhigende Wirkung auf sie haben müssen, aber dem war nicht so. Sie fühlte sich seltsam fehl am Platz, irgendwie linkisch, wie eine Ente in einer Nobelboutique: Sie gehörte nicht hierher.
Michael beobachtete sie, während sie sein Haus begutachtete. Erst nahm er ihr den Mantel ab, dann den Schal, schließlich die Handschuhe. Franny kam es so vor, als würde er sie schälen, Schicht um Schicht. Er machte ihr einen Drink, ohne zu fragen, ob sie überhaupt einen wollte, und reichte ihn ihr mit den Worten: »Trink das. Ich glaube, du brauchst etwas, das dich ein bißchen entspannt.«
Normalerweise trank sie keinen Alkohol – sie mochte den Geschmack nicht –, aber diesmal machte sie wie ein Kind genau das, was ihr gesagt wurde. Er führte sie zur Couch, und sie setzten sich. Er sprach mit ihr, wie er es auf dem Campus auch immer getan hatte: beruhigend und leise, als wollte er sie mit seinen Worten liebkosen. Sie mußte an die Worte ihres Vaters denken, die genauso beruhigend gewesen waren, und schließlich entspannte sie sich; allerdings war sie sich nicht sicher, ob es wirklich an Michaels Stimme lag, daß sie ruhiger wurde, oder an den stummen Worten ihres Vaters oder dem Alkohol. Schließlich küßte Michael sie; sein Kuß war zärtlich, nicht so betrunken und träge wie die Küsse des letzten Mannes, mit dem sie zusammengewesen war, dem Reporter des Bee. Michaels Kuß war sanft und warm und ausgesprochen erotisch – genauso, wie sie es sich erhofft hatte.
Er führte sie ins Schlafzimmer und hängte seine Jacke über einen Stuhl. Der große, hohe Raum mit der gewölbten Decke wirkte hell und luftig. Die Wände waren in blassen Blau- und Grautönen tapeziert, die Möbel hell, modern und bequem. Das Prunkstück des Raumes war ein riesiges Vierpfostenbett. Die Vorhänge waren offen, und durch das Fenster konnte Franny hinaus in den Garten sehen, wo ein riesiger schwarzer Hund über den Rasen trottete.
Michael beobachtete Franny, die steif im Türrahmen stand. »Schau nicht so grimmig«, sagte er. »Es wird dir gefallen.«
»Tut mir leid«, sagte sie und versuchte ein kurzes Lächeln. Sie schaltete das Licht aus. Draußen war es noch nicht richtig dunkel, und selbst ohne Licht war jeder Gegenstand im Zimmer deutlich zu erkennen. Sie fragte sich, wie sie es ins Bett und unter die Decke schaffen sollte, ohne daß er sie sah. Sie war nicht direkt fett – sie war das, was manche Leute mollig nannten. Rubenesk. Egal, wie man es nannte, sie wollte es nicht zeigen. Michael hatte breite Schultern und war normal gebaut. Fett war an ihm keines zu entdecken. Erneut beäugte sie das Bett und überlegte, wie sie es wohl am besten anstellte. Nervös biß sie auf ihrer Unterlippe herum.
Michael trat auf sie zu und nahm sie in die Arme. »Du solltest deinen Blick sehen, Franny. Sag mir, was los ist.«
»Ich habe nicht viel Erfahrung in solchen Dingen«, sagte sie.
Er lächelte sie an. »Das ist mir durchaus bewußt.«
Er zog ihr den Pulli über den Kopf, und sie hatte das Gefühl, sich entschuldigen zu müssen. »Ich weiß, daß ich ein paar Pfund abnehmen muß«, sagte sie.
Michael lachte sanft. Er küßte sie auf den Hals und flüsterte: »Ich werde dir geben, was du willst, Franny.« Und sie fragte sich, was das war. Was wollte sie überhaupt? Dann zog er sie ganz aus, massierte ihren üppigen Körper, knetete ihn wie Brotteig, sanft und warm. Zuerst war ihr das peinlich – er wollte nicht zulassen, daß sie sich unter der Decke versteckte –, aber dann verlor sie sich unter der Berührung seiner geschickten Hände. Ihre Figur schien ihm tatsächlich nichts auszumachen. Er drehte sie hierhin und dorthin, arrangierte ihre Arme und Beine, als wäre sie eine Schaufensterpuppe, saugte und zog an ihren schweren Brüsten, steckte seine Finger in jede ihrer Körperöffnungen, experimentierte und massierte an ihr herum, bis sie tief in sich etwas spürte wie die Anziehungskraft der Natur, die sie nachmittags am Putah Creek gespürt hatte, nur daß das hier stärker war, dringender, und er zwang sie, sich ihm zu öffnen, tauchte seine Zunge tief in sie hinein, saugte an ihr, bis sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben dem urzeitlichen Drängen in ihrem Inneren ergab. Es war ein wundersames Gefühl der Erleichterung, beängstigend und grandios zugleich. Und irgendwann, an einem Punkt jenseits der Sprache, erfaßte sie plötzlich, was sie wirklich wollte: jemanden, zu dem sie gehörte, einen Freund, einen Vater, einen Geliebten.
2
Sue Deever, die unter Altersdiabetes litt, saß auf einem malvenfarben gepolsterten Ruhesessel neben einer Dialysemaschine und wartete darauf, von Franny angeschlossen zu werden. Sie war eine rundliche Frau Anfang Fünfzig, der beide Beine amputiert worden waren. Franny arbeitete seit zwei Jahren an der Dialyseklinik der Uni, und sie hatte den langsamen Verfall von Mrs. Deever miterlebt. Sie war die Mutter einer Jugendfreundin von Franny. Als Franny die Arbeit in der Klinik antrat, hatte sie Mrs. Deever jahrelang nicht gesehen gehabt und war über ihr Aussehen sehr erschrocken. Mrs. Deevers rechtes Bein war vier Jahre zuvor amputiert worden, das linke folgte, kurz nachdem Franny in der Klinik anfing. Sie konnte nur noch verschwommen sehen, ihre Nerven waren geschädigt, ihre Leber funktionierte nach vielen Jahren exzessiven Alkoholkonsums nicht mehr richtig. Dasselbe galt für ihre Nieren, weshalb sie regelmäßig zur Dialyse mußte. Sie lebte in einem Pflegeheim in Davis und kam dreimal die Woche zur Behandlung in die Klinik. Sie war eine liebe Frau, und es machte Franny traurig, sie in diesem Zustand zu sehen.
Die Klinik befand sich in Sacramento, in einem medizinischen Komplex an der Ecke Alhambra und Stockton. Das Wartezimmer hatte große Ähnlichkeit mit jedem anderen Arztwartezimmer: eine Reihe niedriger Stühle und ein kleiner Tisch mit einem Fächer aus Zeitschriften. Aber um das Wartezimmer zu verlassen, mußten die Patienten durch eine Tür gehen, die ihnen jeweils mit einem Summton geöffnet wurde. Ein enger Gang und eine weitere Tür führten in das Vorzimmer – mehrere Stühle, ein Waschbecken, eine rollstuhlgerecht in den Boden eingelassene Waage –, von wo aus man schließlich in den Hauptbehandlungsraum gelangte, einen großen Saal, der in einem weichen, beruhigenden Pastellton gestrichen war. In der Mitte des mit Linoleum ausgelegten Raumes befanden sich zwei Überwachungsstationen, und entlang der Wände standen achtzehn große Ruhesessel, die wie bequeme Liegestühle aussahen. Neben jedem Stuhl war eine Dialyseeinheit installiert. Es war früh am Morgen, und das Personal hatte alle Hände voll zu tun. Sämtliche Stühle waren besetzt, einige Leute waren schon an ihre künstlichen Nieren angeschlossen, andere warteten noch darauf. Die meisten Patienten waren alt und ausgemergelt. Ihre Organe waren so weit geschädigt, daß eine Heilung nicht mehr möglich war. Für die Arbeit am Patienten waren hauptsächlich Techniker zuständig, aber heute war jemand ausgefallen, und Franny mußte drei Patienten übernehmen, darunter auch Mrs. Deever.
Mrs. Deever war bereits gewogen worden, man hatte ihre Temperatur gemessen und ihren Arm mit einem Hautdesinfektionsmittel abgerieben. Franny maß ihren Blutdruck, hörte ihre Lungen und ihr Herz ab und trug hin und wieder etwas in das Überwachungsblatt ein, das auf ihrem Klemmbrett befestigt war. Sie blickte auf. Ihr Blick wanderte über Mrs. Deevers Sessel hinweg. Die Fensterreihe in der gegenüberliegenden Wand war mit Jalousien verdunkelt. Draußen scheuchte ein scharfer Nordwind die Wolken über den Himmel. Als Franny auf dem Weg zur Arbeit den Yolo Causeway überquert hatte, hatte sich der Wind mit voller Wucht gegen ihren Wagen gestemmt, und in der Ferne hatte sie die schneebedeckten Gipfel der Sierra Nevada aufragen sehen. Vielleicht konnte sie Michael dazu bringen, am Wochenende mit ihr hinzufahren.
»Ganz schön kalt heute, was?« meinte Mrs. Deever, während sie Franny beobachtete. »Ich wette, du bist in Gedanken bei deinem neuen Freund.«
Franny sah zu ihr hinunter und lächelte. Mrs. Deever hatte schulterlanges, strohfarbenes Haar, das sie nach jedem Waschen auf Wickler drehte, obwohl die Spitzen bereits dünn und brüchig wurden. Und sie trug wie immer Make-up: einen knallroten Lippenstift, Puder, um ihre fleckige Haut abzudecken, sorgfältig aufgetragenen Lidschatten und Wimperntusche. Sie war eine Frau, die versuchte, sich nicht unterkriegen zu lassen, auch wenn ihr Körper nicht mehr mitspielte. Ihr Gesicht wirkte trotz der Hamsterbacken und des schweren Doppelkinns offen und freundlich. Franny und sie waren einander im Lauf der letzten zwei Jahre sehr nahegekommen, und Franny sah sie nicht nur hier, sondern besuchte sie auch regelmäßig im Pflegeheim. Mrs. Deever, deren eigene Kinder beide in einem anderen Bundesstaat lebten, legte eine fast mütterliche Sorge um Franny an den Tag. Voller Mitgefühl hörte sie zu, wenn Franny ein Problem hatte, und erteilte ihr gute Ratschläge, egal, ob Franny sie darum bat oder nicht. Franny wußte, daß ihre enge Beziehung auf ihrer beider Einsamkeit beruhte, aber das spielte keine Rolle. Mrs. Deevers Gegenwart erinnerte sie daran, wie sehr sie ihre eigene Mutter vermißte; und sie wußte, daß Mrs. Deever ihre Kinder vermißte.
»Sie haben recht«, antwortete Franny lächelnd. »Ich habe gerade an ihn gedacht.« Über ihrem blauen Kittel trug sie eine Plastikschürze. Zusätzlich hatte sie einen transparenten Gesichtsschutz und Gummihandschuhe übergezogen. Diese Ausstattung trugen alle Techniker und Schwestern, um sich beim Anschließen der Patienten vor Blutspritzern zu schützen. Franny öffnete den Shunt an Mrs. Deevers Unterarm, eine künstliche Verbindung zwischen Arterie und Vene. Die meisten Patienten hatten so einen Shunt am Arm, aber einige, von denen im Moment niemand da war, vertrugen keinen normalen Shunt und mußten sich einen sogenannten zentralen Venenkatheter in die Subklavia-Vene unterhalb des Schlüsselbeins legen lassen. Franny befestigte zwei Nadeln in dem Shunt und verband dann den Schlauch, der von den Nadeln wegführte, mit der Dialysemaschine, die das arterielle Blut herauspumpen, filtern und dann durch die Vene zurückleiten würde.
»Hat er dich letztes Wochenende schön ausgeführt?« fragte Mrs. Deever.
»Ja«, antwortete Franny. »Wir sind ins Napa Valley gefahren und haben dort übernachtet.«
»Napa? Wart ihr bei einer Weinprobe?«
Franny nickte. »Wir waren in mehreren Weinkellereien. Ich kann mich gar nicht mehr an alle Namen erinnern. Und zum Abendessen hat er mich in ein wirklich schönes französisches Restaurant ausgeführt. Das Essen war phantastisch.« Sie maß erneut den Blutdruck ihrer Patientin. Während die Behandlung lief, machte sie das regelmäßig jede halbe Stunde. Nebenbei erzählte sie Mrs. Deever alles über den Ausflug, fügte so viele Details wie möglich hinzu, berichtete von der bezaubernden Frühstückspension, in der sie am Samstag abend übernachtet hatten, von den Weingläsern, die er ihr als Andenken gekauft hatte, vom intensiven Geruch des reifenden Weins.
Natürlich war das alles gelogen. Franny wäre es peinlich gewesen zuzugeben, daß Michael sie nie irgendwohin ausführte. Sie trafen sich nun schon fast einen Monat, aber er war noch nie mit ihr ausgegangen. Er hatte an der UCD mit seinen Kursen und Studenten viel zu tun und arbeitete darüber hinaus an seiner eigenen Musik und verschiedenen Aufsätzen. Bei alldem schien ihm kaum Zeit für Franny zu bleiben. Sie sah ein, daß er ein vielbeschäftigter Mann war, und sie wollte auch nicht klagen, aber sie hätte sich gewünscht, gelegentlich von ihm ausgeführt zu werden, vielleicht ins Kino oder zum Essen. Wenn sie sich trafen, dann meistens in seinem Haus. In der Regel rief er sie ziemlich spät am Abend an und lud sie ein, zu ihm herüberzukommen – als wäre sie ihm gerade erst eingefallen.
»Klingt nach einem guten Fang«, stellte Mrs. Deever fest. »Den würde ich mir an deiner Stelle warmhalten.« Sie sagte das, als hätte Franny viele Männer, unter denen sie auswählen könnte, viele, die sie sich warmhalten könnte. Franny warf einen Blick auf ihre anderen Patienten, um zu prüfen, wie es ihnen ging.
Mit einem Seufzer rollte Mrs. Deever ihren Kopf langsam von einer Seite zur anderen und schloß die Augen. Sie hob die Hand und strich leicht über ihren Nacken. Franny wollte gerade gehen, als Mrs. Deever die Augen wieder aufschlug und mit müder Stimme weitersprach.
»Mein Frank war kein so guter Fang. Er hat mir das Leben immer schwergemacht. Ich weiß nicht, warum manche Männer so sind. Er hat mir das Vertrauen in die Männer genommen. Nach ihm mochte ich es mit keinem anderen mehr versuchen.« Sie schloß erneut die Augen und war innerhalb einer Minute eingeschlafen.
Franny mußte daran denken, wie sie nach der Schule oft mit Jenny, Mrs. Deevers Tochter, nach Hause gegangen war. Jennys Vater war immer unterwegs gewesen, auf irgendwelchen dubiosen Reisen, und Mrs. Deever hatte sich währenddessen mit einer Flasche bei Laune gehalten. Wenn Franny und Jenny in Jennys Zimmer spielten, kam Mrs. Deever oft mit einem Teller Kekse hereingeplatzt. Manchmal kam sie auch einfach so, ohne alles. Sie brauchte nur einen Vorwand, um zu ihnen kommen zu können. Dann tanzte sie mit einem viel zu krampfhaften Lächeln ins Zimmer und störte sie beim Spielen. Damals war sie schön, eine kurvenreiche Frau mit großem Busen, langen, lackierten Nägeln, goldenem Haar und Schmuck, der bei jeder Bewegung klirrte und glitzerte, was die beiden zehnjährigen Mädchen sehr faszinierte. Mit übereinandergeschlagenen Beinen saß sie dann auf dem Fußende von Jennys Bett, wippte abwesend mit dem Fuß, rauchte ein Zigarette und nippte an ihrem bernsteinfarbenen Drink – sie hatte praktisch immer einen Drink mit klirrenden Eiswürfeln in der Hand, der, wie die Mädchen wußten, aus der Hausbar stammte –, und sie plapperte dummes Zeug vor sich hin und lachte zu laut über Dinge, die eigentlich gar nicht lustig waren. Franny fand es traurig, wie Jennys Mutter sich aufführte, und Jenny empfand das wohl auch so, denn sie zog es vor, bei Franny zu Hause zu spielen. Als die Mädchen in die High-School kamen, war Mrs. Deever bereits geschieden. Sie war die meiste Zeit krank, und Jenny lud Franny nicht mehr zu sich nach Hause ein. Sie und Jenny waren nach wie vor befreundet, aber Jenny kam jetzt immer zu Franny, und sie schien Frannys Mutter zunehmend als ihre eigene zu betrachten. Ständig suchte sie ihre Nähe, umarmte sie ohne ersichtlichen Grund. Sie ersetzte ihre eigene Mutter durch eine andere, als handelte es sich um eine fehlerhafte Ware, etwas, das man reklamieren und gegen ein besseres Modell eintauschen konnte. Seltsam, wie sich die Dinge manchmal entwickeln, dachte Franny jetzt. Als sie Kinder waren, brauchte Jenny Frannys Mutter, aber jetzt brauchte Franny die von Jenny.
Franny sah nach ihren beiden anderen Patienten. Sie maß ihren Blutdruck, fragte sie, wie sie sich fühlten, notierte die Daten auf ihren Überwachungsbogen. Dann drehte sie eine Runde durch den Raum, um bei den Technikern nach dem Rechten zu sehen. Alles ging seinen gewohnten, ruhigen Gang: Sämtliche Patienten waren angeschlossen, und neben ihnen surrten die Maschinen leise vor sich hin. Die Techniker, die pastellfarbene oder weiße Kittel trugen, überwachten gelassen ihre Patienten. Da alle bestens zurechtkamen, beschloß Franny, eine kleine Pause einzulegen, solange es noch so ruhig war. Sie ging erst auf die Toilette und dann in die Cafeteria, wo sie sich einen Schokoriegel aus einem Automaten holte. Ihre Diät zeigte keinen Erfolg, aber Michael schien das nichts auszumachen. Nachmittags drehte sie immer noch ihre Runden mit dem Rad, bemüht, weiterhin so zu tun, als versuche sie abzunehmen, aber das Radfahren machte ihr nicht mehr so viel Spaß wie früher. Michael war sehr beschäftigt und hatte keine Zeit mehr, sich mit ihr am Putah Creek zu treffen. Sie vermißte ihre langen Gespräche und die Spaziergänge durch die Baumschule. Natürlich redeten sie immer noch viel miteinander, aber irgendwie war es nicht mehr dasselbe.
Während Franny an ihrem Schokoriegel knabberte, kam sie zu dem Schluß, daß sie sich das alles nur einbildete und Probleme sah, wo gar keine existierten. Es war ja nicht so, daß sie gleich ins Bett sprangen, sobald sie bei ihm eintraf. Sie redeten sehr wohl miteinander, eine ganze Menge sogar, und er hatte schon mehrmals für sie gekocht. Sie sahen zusammen fern, und sie blieb immer über Nacht, wenn sie ihn besuchte. Michael war lieb und aufmerksam, wenn sie zusammen waren. Bloß, weil er sich nicht mehr am Putah Creek mit ihr traf und nie mit ihr ausging – sie sollte es ihm eigentlich nicht verübeln, daß er so lange arbeitete. Sie beschloß, ihn in seinem Uni-Büro anzurufen und zu fragen, ob sie ihn am Abend besuchen könne. Er nahm schon beim ersten Klingeln ab.
»Ja«, meldete er sich in scharfem Ton. Er klang verärgert.
Franny wünschte, sie hätte ihn nicht angerufen. »Ich bin’s«, sagte sie. »Habe ich einen schlechten Zeitpunkt erwischt?«
»Ehrlich gesagt, ja. Ich komme zu spät in mein Seminar.«
»Tut mir leid. Ich rufe dich später noch mal an.«
Er seufzte ungeduldig. »Franny«, sagte er, riß sich dann aber am Riemen. Er seufzte noch einmal und schwieg einen Moment. Dann nahm er einen zweiten Anlauf. Diesmal klang seine Stimme nicht ganz so barsch. »Du hast mich wirklich in einem ungünstigen Moment erwischt«, sagte er. »Worum geht’s denn?«
»Ich dachte, wir könnten vielleicht den Abend zusammen verbringen. Eventuell irgendwo essen gehen.« Sie hörte, wie er mit den Fingern auf den Schreibtisch trommelte.
»Ich muß lange arbeiten«, sagte er. Dann folgte eine kurze Pause. Das Trommeln hörte auf. »Komm um neun zu mir. Und noch was, Franny.«
»Ja?«
»Zieh heute abend deine Krankenhaussachen an. Aber nicht die Hose. Eine richtige Schwesternuniform. Weißer Kittel, weiße Schuhe, weiße Strümpfe, Haube, Stethoskop, die komplette Ausrüstung. Ich habe eine Überraschung für dich.« Nach diesen Worten legte er abrupt auf.
Franny legte ebenfalls auf und lächelte. Michael hielt ständig neue Überraschungen für sie bereit. Der letzte Monat hatte ihr in so mancher Hinsicht die Augen geöffnet. Sie wünschte, sie hätte eine gute Freundin, der sie das alles anvertrauen könnte. Der Mensch, der ihr am nächsten stand, war Mrs. Deever, und mit ihr über Sex zu reden, konnte sie sich nicht vorstellen. Sie dachte an ihre Schwester: Nora kannte sich mit diesen Dingen bestimmt aus. Sie nahm erneut den Hörer ab und wählte die Nummer des Sacramento Bee. Dann legte sie auf, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Sie war zu dem Schluß gekommen, daß sie doch nicht mit Nora über dieses Thema reden wollte. Das war alles viel zu persönlich.
Als sie später im Bett lagen, kuschelte Franny sich eng an Michael. Sie war hellwach, aber er atmete tief. Er lag auf dem Rücken und schien schon fast zu schlafen. Sie hatten an diesem Abend eine Variante seiner Krankenschwester-Arzt-Phantasie durchgespielt. Schauplatz war der Eßzimmertisch, der als Behandlungstisch fungierte. Er hatte ihr gesagt, daß sie sich, wenn sie ihren Job behalten wolle, nicht nur um die Bedürfnisse seiner Patienten, sondern auch um die seinen kümmern müsse. Er trug einen weißen Arztkittel und Gummihandschuhe, und sie mußte ihn Herr Doktor nennen. Er hatte ein rotes Samttuch auseinandergeschlagen, das eine Sammlung von Instrumenten aus schimmerndem Edelstahl enthielt. Das war für Franny völlig neu gewesen. Bevor sie Michael kennenlernte, hatte sie nicht gewußt, daß es Leute gab, die ihre Phantasien tatsächlich auslebten. Er hatte sie zum Tisch geführt und mit seinen Instrumenten untersucht. Während er vorsichtig an ihr herumstocherte, hatte er sie immer wieder zum Mitspielen animiert. Hinterher bekam sie ihre Belohnung: Er berührte sie so, wie sie es mochte, und spielte mit ihr, bis sie kam. Er forderte sie auf, die Augen zu schließen und seiner Phantasie nachzugeben, diese Phantasie zu ihrer eigenen zu machen; und die ganze Zeit über sprach er in einem energischen, überzeugenden Ton mit ihr, drängte sie weiter, zog sie mit seinen Worten fort, und selbst in dem Augenblick, als sie kam, hatte sie das ungute Gefühl, daß er sie nur vorbereitete, auf etwas anderes einstimmte.
Sie lauschte Michaels tiefen, ruhigen Atemzügen, beobachtete, wie seine Brust sich hob und senkte. Durch die hauchdünnen Vorhänge fiel Mondlicht in den Raum. Ein Baum, der sich im Wind wiegte und seine Äste emporreckte wie ein Bettler seine Arme, warf bleiche, gespenstische Schatten in den dunklen Raum. Sie spielte mit dem schwarzen Haar auf seiner Brust, bis es ihm lästig wurde und er ihre Hand festhielt. Sie wollte ihm etwas sagen, wußte aber nicht recht, wie sie anfangen sollte. Auf einen Ellenbogen gestützt, betrachtete sie sein Profil, das durch das kantige Kinn selbst in entspanntem Zustand entschlossen wirkte. Sie liebte dieses Kinn.
»Ich bin nicht sicher, ob du das hören willst«, begann sie zögernd. »Wahrscheinlich nicht. Ich weiß, daß du nicht dasselbe empfindest wie ich, aber ich möchte einfach, daß du weißt, was ich für dich empfinde.« Sie hörte sich selbst über die Worte stolpern. »Die Sache ist die: Ich glaube, ich bin gerade dabei, mich in dich zu verlieben.«
Sie kaute auf einem Fingernagel herum, wartete auf seine Antwort. Sie wußte, daß er zugehört hatte, weil sein Atem plötzlich anders ging. Aber er schwieg.
»Beunruhigt dich das?« fragte sie schließlich. »Wäre es dir lieber, ich hätte nichts gesagt?«
Langsam streckte er die Hand nach der Nachttischlampe aus und schaltete sie an. Das Licht war grell und hart. In der unbarmherzigen Realität eines erleuchteten Zimmers wirkte ihre Liebeserklärung nackt und verletzlich wie eine winzige Spinne, die auf einer freien Fläche überrascht worden war. Am liebsten hätte sie sich unter der Bettdecke verkrochen.
»O Franny«, sagte er und rollte sich auf die Seite, so daß er ihr ins Gesicht sehen konnte. Er schob die Decke bis zu ihren Knien herunter und setzte sie dem brutalen Licht aus, obwohl er wußte, daß sie sich dabei unbehaglich fühlte. Sie wurde steif, bemühte sich dann aber, sich zu entspannen. Er ließ seinen Blick über ihre milchweiße Fülle gleiten, die fleischigen Oberschenkel und Hüften, den runden Bauch, die großen, schwere Brüste, die so rund und weich waren. Lächelnd streichelte er ihr über die Wange und ließ seine Hand dann auf ihre Brust fallen. Er rieb die rosige Brustwarze, die den Farbton einer staubigen Damaszenerrose hatte, bis sie hart wurde, umfaßte dann die ganze Brust, umkreiste sie mit Daumen und Fingern und hielt sich daran fest, als wäre es ein Türknauf. Eine seltsame Art, meine Brust zu berühren, dachte sie.
»Liebe, süße Franny«, sagte er. »Es ist lange, lange her, daß ich das letzte Mal verliebt war. Natürlich freue ich mich, daß du mir erzählt hast, was du empfindest. Es schmeichelt mir, daß du dich in mich verliebt hast.« Er sprach leise und hielt dabei weiterhin ihre Brust umklammert. »Ich verliebe mich nicht leicht, aber ich bin froh, der Empfänger deiner Liebe zu sein.« Nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: »Du weißt doch, was das heißt?«
Franny schüttelte den Kopf.
»Es heißt« – mit einem Lächeln drückte er ihre Brust, versetzte ihr eine kleine, schmerzhafte Drehung –, »daß du jetzt offiziell meine Freundin bist, und das gibt mir die Hoheitsrechte über deinen Körper. Es verleiht mir einen Besitzanspruch auf dich. Dein Körper gehört jetzt mir, und ich kann damit machen, was ich will.«
Franny lachte. Seine Freundin, seine Freundin: Sie liebte den Klang dieser Worte. Sie konnte sich nicht erinnern, jemals so glücklich gewesen zu sein. Im Moment erwiderte er ihre Liebe nicht, aber das würde schon noch kommen. Wichtig war nur, daß sie ihm etwas bedeutete … daß sie ihm tatsächlich etwas bedeutete. Er hatte gesagt, daß er ihren Körper als sein Eigentum betrachtete. In Zukunft würde er sie beschützen wie früher ihr Vater.
Sie kuschelte sich noch enger an ihn. Ein zufriedenes Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus. In neckendem Ton fragte sie: »Und was gedenkst du mit meinem Körper zu tun?«
Er fuhr mit der Zunge über ihre Brustwarze und sah sie dann augenzwinkernd an. »Alles zu seiner Zeit«, antwortete er.
3
Der Himmel hing voll großer, langsam dahinziehender dunkler Wolken. In unregelmäßigen Abständen platschten riesige, traurige Regentropfen wie Tränen des Bedauerns auf Frannys Windschutzscheibe. Sie haßte es, bei schlechtem Wetter zu fahren. Gerade als sie den Scheibenwischer einschaltete, begannen die Tropfen schneller und heftiger zu fallen und verwandelten die Straße innerhalb von Sekunden in eine verschwommene, postimpressionistische Landschaft aus verschmierten Fahrbahnmarkierungen, nassem Asphalt und vorüberfahrenden Autos, die schnittig wie Seehunde an ihr vorbeiglitten. Sie war mit Nora im Radisson Hotel zum Essen verabredet. Sie versuchten, sich wenigstens einmal im Monat zu treffen, und meistens lief es auf einen Chin-Chin-Salat im Radisson hinaus. Sie waren sich einig, daß es in ganz Sacramento keinen besseren chinesischen Hühnersalat gab.
Franny bog in den Parkplatz des Hotels ein. Mit seiner graubraunen Farbe und den Stuckverzierungen wirkte das Radisson von außen wie ein modernes Kloster. Sie fuhr zur Vorderseite des Gebäudes, aber alle freien Parkplätze in der Nähe des Eingangs waren für Kleinwagen gedacht. Franny fuhr einen alten schwarzen Cadillac mit Heckflossen. Der Wagen stammte aus den Fünfzigern, verschlang Unmengen Benzin und hatte gigantische Ausmaße, aber sie liebte ihn. Sie hatte eine besondere Beziehung zu dem Auto, als wäre es ein lieber alter Freund. Und wie bei einem alten Freund kümmerte sie sich liebevoll um seine Bedürfnisse, wusch und wachste ihn, polierte die Chromteile, saugte das Wageninnere und überprüfte regelmäßig den Luftdruck in den Reifen. Sie fuhr den Wagen seit ihrer High-School-Zeit. Damals hatte sie noch bei Nora gewohnt, und als sie das erste Mal mit dem Wagen vorgefahren war, hatte ihre Schwester ihn als Monstrum bezeichnet, als Schandfleck und Plage für die Umwelt. Aber Franny, sonst so sanftmütig, hatte sich geweigert, ihn wieder zu verkaufen. Sie wußte nicht genau, warum, aber sie liebte diesen Wagen.
Der Cadillac glitt über den Parkplatz, schnittig und lautlos wie ein im Wasser kreisender Hai. Schließlich fand sie eine große Parklücke an der Rückseite des Hauses. Der Wagen kam mit einem dumpfen Geräusch zum Stehen. Sie suchte auf dem Rücksitz nach ihrem Schirm, aber er war nicht da. Also schlüpfte sie in ihren Mantel, zog ihn so weit hoch, daß er ein provisorisches Zelt über ihrem Kopf bildete, und sprintete die lange Auffahrt hinauf, die zum Hauptgebäude des Hotels führte. Als sie den Eingang erreichte, blieb sie vor der Doppeltür
Die O riginalausgabe erschien unter dem Titel »Topping from Below« bei St. Martin’s Press, New York
15. Auflage Deutsche Erstausgabe 12/96
Copyright © der Originalausgabe 1995 by Laura Reese All rights reserved
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1996 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Umschlaggestaltung: Design Team München Umschlagfoto: Barnaby Hall Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Redaktion: Ge / Susanne Wallbaum Herstellung: Str. Made in Germany
eISBN 978-3-641-09852-0
www.goldmann-verlag.de
www.randomhouse.de
Leseprobe