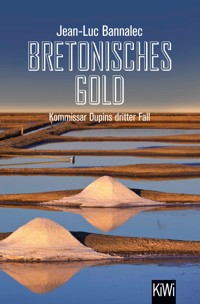10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Dupin ermittelt
- Sprache: Deutsch
Ein mysteriöser Mord im sagenumwobenen Artus-Wald – Commissaire Dupin ermittelt im Herzen der Bretagne Der Wald von Brocéliande mit seinen malerischen Seen und Schlössern ist das letzte verbliebene Feenreich – glaubt man den Bretonen. Unzählige Legenden sind hier verortet, auch die von König Artus und seiner Tafelrunde. Welche Gegend wäre geeigneter für den längst überfälligen Betriebsausflug von Kommissar Dupin und seinem Team in diesen bretonischen Spätsommertagen? Doch ein ermordeter Artus-Forscher macht dem Kommissar einen Strich durch die Rechnung. Gegen seinen Willen wird Dupin zum Sonderermittler ernannt in einem brutalen Fall, der schon bald weitere Opfer fordert. Was wissen die versammelten Wissenschaftler über die jüngsten Ausgrabungen? Wie stehen sie zu den Plänen, Teile des Waldes in einen Vergnügungspark umzuwandeln? Und warum rückt keiner von ihnen mit der Sprache raus? Selbst Nolwenn, Dupins sonst so unerschütterliche Assistentin, ist in Sorge – und das will wirklich etwas heißen. Im siebten Fall der erfolgreichen Bretagne-Krimireihe von Jean-Luc Bannalec taucht Commissaire Dupin in die geheimnisvolle Welt der Artus-Sage ein. »Bretonische Geheimnisse« – ein spannender Krimi voller Lokalkolorit, nicht nur für Frankreich-Fans. Jean-Luc Bannalec bietet mit seinen spannenden Krimis um Kommissar Dupin aus der Bretagne die perfekte Wahl für die Urlaubslektüre: Mit intelligentem Humor und einem Sinn für das regionale Flair entfacht er das Gefühl, die salzige Atlantikluft der Bretagne zu riechen. Die Krimi-Bestseller aus der Bretagne sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Bretonische Verhältnisse - Bretonische Brandung - Bretonisches Gold - Bretonischer Stolz - Bretonische Flut - Bretonisches Leuchten - Bretonische Geheimnisse - Bretonisches Vermächtnis - Bretonische Spezialitäten - Bretonische Idylle - Bretonische Nächte - Bretonischer Ruhm - Bretonische Sehnsucht - Bretonische VersuchungenDie Bücher erzählen eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Jean-Luc Bannalec
Bretonische Geheimnisse
Kommissar Dupins siebter Fall
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Jean-Luc Bannalec
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Jean-Luc Bannalec
Jean-Luc Bannalec ist ein Pseudonym; der Autor ist in Deutschland und im südlichen Finistère zu Hause. Die ersten sechs Bände der Krimireihe mit Kommissar Dupin, »Bretonische Verhältnisse«, »Bretonische Brandung«, »Bretonisches Gold«, »Bretonischer Stolz«, »Bretonische Flut« und »Bretonisches Leuchten«, wurden für das Fernsehen verfilmt und in zahlreiche Sprachen übersetzt. 2016 wurde Jean-Luc Bannalec von der Region Bretagne mit dem Titel »Mécène de Bretagne« ausgezeichnet.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
»Der neue Roman von Jean-Luc Bannalec über die bretonischen Geheimnisse ist ein Renner!« Westdeutsche Zeitung
»Ob es sich für König Artus heute noch zu kämpfen lohnt, besonders im mystischen Wald von Brocéliande, fragt dieser Krimi beiläufig. Und findet eine Antwort, die jeden Sagenfreund beglückt.« FAZ
»Nicht nur Artusforscher werden ihre Freude daran haben.« Kölner Stadt-Anzeiger Bücher-Magazin
»erzählerisch besonders gut gelungen, dieser Krimi besitzt neben viel bretonischem Lokalkolorit auch Tempo und Dramatik« Südwest Presse
»zieht […] die Leser nicht nur mit seinen Ermittlungen in den Bann, sondern versetzt sie vor allem auch durch seine wunderbaren Landschaftsbeschreibungen direkt dorthin.« Siegener Zeitung
»Bannalec […] erzählt den wahrscheinlich spannendsten Fall der noch jungen Reihe.« Ruhr Nachrichten
Hinweis für E-Reader-Leserinnen und Leser
Wenn Sie sich die Karte in Farbe und zoombar ansehen möchten, dann geben Sie bitte die folgende Internetadresse im Browser Ihres Computers oder Smartphones ein:
https://www.kiwi-verlag.de/magazin/extras/die-karten-zu-bretonische-geheimnisse
Hinweis für Leserinnen und Leser auf dem Smartphone/Tablet oder am Computer
Sie möchten sich die Karte zoombar anschauen? Dann tippen bzw. klicken Sie bitte auf die Abbildung. Es öffnet sich ein neues Fenster mit der entsprechenden Website-Ansicht.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Der erste Tag
Der zweite Tag
Ein paar Wochen später
à L.
à mon ami Helge
Un dañier bezañ bev
D’an deiz a hirlv!
Heutzutage am Leben zu sein,
ist überaus gefährlich!
BRETONISCHES SPRICHWORT
Der erste Tag
»Val sans retour! Wir sind da, Chef. – Das Tal ohne Wiederkehr.«
Die Augen von Inspektor Riwal leuchteten. Er strahlte über das ganze Gesicht.
Kommissar Georges Dupin und sein kleines Team vom Commissariat de Police Concarneau waren gut durchgekommen, sie hatten nur etwas mehr als eine Stunde gebraucht. Dupin war gefahren, wie gewöhnlich in unbekümmerter Missachtung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit. Sein kantiger Citroën mochte betagt sein, aber er war immer noch äußerst agil, zweimal hatte es freundlich aufgeblitzt. Riwal und Kadeg, seine beiden Inspektoren, saßen auf der Rückbank, Nolwenn, seine unentbehrliche Assistentin, neben ihm auf dem sesselartigen Beifahrersitz.
Dupin hatte Nolwenns »grandioser Idee«, einen bedauerlicherweise unabwendbaren dienstlichen Abstecher des Kommissars in den Forêt de Brocéliande mit einem »Betriebsausflug« zu verbinden, zunächst reserviert gegenübergestanden. Doch Nolwenn war entschieden gewesen. Sogar Kadeg, der prinzipiell an allem etwas auszusetzen hatte, fand die Idee »hervorragend«. Der letzte Betriebsausflug, hatte Nolwenn streng festgestellt, lag »bereits über zwei Jahre zurück«, damals war es an die äußerste Nordwestküste gegangen, und, wenn Dupin ehrlich war, sehr nett gewesen. Sein Missbehagen hatte eher mit der dienstlichen Verpflichtung zu tun, die er sich bei seinem letzten Fall im Frühsommer dieses Jahres eingehandelt hatte, als er mit seinem alten Pariser Polizeifreund Jean Odinot einen Deal eingegangen war. Odinot hatte Dupin in einer polizeilichen »Grauzone« mit wichtigen Informationen versorgt und Dupin sich dafür bereit erklärt, für Odinot einer Sache im Zusammenhang mit einem ungeklärten Fall der Pariser Polizei nachzugehen. Dupin wollte sich nicht drücken. Seinen Teil des Deals zu erfüllen war für ihn Ehrensache, und für Jean Odinot hätte er so einiges auch ohne Deal getan. Nein, das Problem war nicht Odinot, das Problem war die Pariser Polizei. Dupin hatte sich nach seinem »Ausscheiden« damals, seiner »Suspendierung« aufgrund einer schweren und unglücklicherweise sehr öffentlichen Beleidigung des Bürgermeisters, geschworen, in seinem gesamten Leben nie wieder etwas mit der Pariser Polizei zu tun zu haben. Odinots Bemerkung gestern, als sie noch einmal telefoniert hatten, dass es »eine völlig absurde Sache« sei, der sie da nachgingen, hatte ebenso wenig zur Motivation beigetragen.
»Brocéliande!« Nolwenn hatte aus der Provianttüte, die sie alle mehrere Tage in der Wildnis großzügig versorgt hätte, ein schmales Büchlein hervorgeholt. »Brocéliande! Welch überaus kostbare Erinnerung in einem einzigen Wort! Das gesamte mittelalterliche Europa sprach es nur mit tiefster Verehrung aus. Das letzte verbliebene Feenreich. Genau hier spielen sich einige der wundervollsten Schöpfungen der Fantasie ab, die je die Herzen der Menschen bewegt haben.«
Tatsächlich war es Dupins erster Ausflug in den Forêt de Brocéliande – Forêt de Paimpont, wie er etwas prosaischer hieß –, den größten Wald der Bretagne. Den größten und vor allem: den berühmtesten. Nicht bloß der Bretagne, sondern, natürlich, ganz Frankreichs und ganz Europas. Unbestritten war er das fantastische Herz der Bretagne. Der mythischste aller mythischen Orte. Die Legende aller Legenden. Was bei der Legendendichte der Bretagne einiges hieß. Dupin hatte sich darauf eingestellt, dass Riwal und Nolwenn sich bei diesem Ausflug als noch eifrigere Reiseführer als sonst verstehen und alles kundig kommentieren würden. Und sich eiserne Gelassenheit geschworen.
»Am besten, wir parken an der Église du Graal. Das ist der ideale Ausgangspunkt.« Nolwenn deutete nach links.
Alles hier verwies auf Spektakuläres. Auf Schildern am Straßenrand war zu lesen gewesen: die Kirche des Grals, der See von Lancelot, die Freitreppe Merlins, das Grab des Riesen …
»7700 Hektar Wald!« Riwal hatte den Sicherheitsgurt gelöst und sich zu ihnen nach vorn gebeugt. »Wald und Heideland, voller Teiche und Seen. Der stolze Rest des mächtigen Waldes, der zu gallischen Zeiten die gesamte Bretagne bedeckte. Er besitzt die Form eines schlafenden Drachen. Aus der Luft genau zu erkennen! Die triviale Deutung des Namens macht aus Broce den Forêt und aus Liande die Lande, die Heideflächen. Aber die wahre Wortbedeutung führt über das Keltische: die Festung der anderen Welt.«
Riwal setzte kurz ab, nur um noch nachdrücklicher anzuheben:
»Unzählige keltisch-bretonische Legenden spielen hier, verrückteste Geschichten aus mehreren Jahrtausenden. Zu höchstem Ruhm aber gelangte der Wald durch König Artus und seine Tafelrunde. Und Sie wissen ja«, eine rein rhetorische Finesse, um die Aufmerksamkeit zu steigern, »Artus besitzt für uns Bretonen eine immense Bedeutung! Er verkörpert insbesondere eines: den Widerstand! Eine unserer stolzesten Tugenden«, Riwals Pathos spitzte sich noch zu, »der Kern unseres Wesens. Eine Widerständigkeit im Einstehen für die höchsten Ideale, die Prinzipien von Artus’ Herrschaft: Gleichheit, Brüderlichkeit, Güte. – Wir Bretonen waren es, die unbeirrbar an die Wiederkehr von Artus glaubten, die ihm unverbrüchlich die Treue gehalten haben!«
»Man weiß ja nicht einmal«, murmelte Kadeg, der gleichmütig aus dem Fenster guckte, »ob es Artus überhaupt je gegeben hat.«
Riwal ließ sich nicht in Verlegenheit bringen:
»Die Legende selbst und ihre gewaltige Wirkung sind auf jeden Fall wahr!« Ein typisch Riwal’scher Satz. »Die Kraft und Macht seiner Aura! Außerdem mehren sich die wissenschaftlichen Hinweise, dass hinter den fantastischen Geschichten doch eine reale Figur steht.«
Nolwenn schaltete sich ein: »Und ein ganzer Reigen von Erzählungen der Artus-Welt wird in diesem Wald verortet.«
Tréhorenteuc hieß das winzige Dorf im sogenannten Val sans retour, dem Tal ohne Wiederkehr, am westlichen Rand des Waldes. Links des Sträßchens lagen ein paar einzelne Häuser, rechts ein gemähtes Feld. Dupin konnte die Kirche bereits sehen, auch den Friedhof schräg dahinter. Ohne Zweifel: ein bezaubernder kleiner Ort mit viel Flair. Die letzte Viertelstunde Fahrt nach dem Verlassen der Route Nationale hatte sie durch Landschaften geführt, wie Dupin sie mochte. Sanft hügelig, grün in allen Nuancen, harmonische Felder, von alten Steinmauern gesäumt, Wiesen, wilde Wäldchen, geschwungene Sträßchen und hübsche Dörfer. Eine ganz eigene Mischung aus Kultur und Natur. Das bretonische Inland: das »Argoat«.
Riwal schob den Kopf erneut zwischen die Vordersitze. »In der ersten französischen Übertragung von Geoffroy of Monmouths epochaler Historia Regum Britanniae Mitte des 12. Jahrhunderts wird der Abenteuerwald der Artus-Welt eindeutig in der Bretagne verortet. Der Begründer der Artusromane ist Chrétien de Troyes, der von 1135 bis 1188 lebte. Er kam aus der Champagne …«
»Nicht schlecht! Gute Voraussetzung für erstklassige Fantasien!«
Kadeg mimte den Witzbold.
Riwal fuhr umso entschlossener fort:
»Chrétien nahm die Berichte aus der Historia auf«, Riwal hatte das Wort Berichte deutlich betont, »ebenso aber uralte keltische Erzählungen. Die zahlreichen, zunächst nur mündlich überlieferten Geschichten von Artus und seiner Tafelrunde. – Von Chrétien liegen fünf Romane vor. Und sie liegen«, Dupin wusste bedauerlicherweise, was folgen würde, »seit zwei Wochen auch auf Ihrem Schreibtisch, Chef.«
Der Kommissar starrte bemüht geradeaus. Er hatte die dicken Bände gesehen, sie aber noch kein Mal in die Hand genommen.
»Wie auch immer«, fuhr Riwal fort, »auf Chrétien folgten weitere Nach- und Neudichtungen höchsten literarischen Ranges sowie zahllose populäre Bearbeitungen des Stoffs. Sie müssen sich die ganze Artus-Literatur wie ein wild wucherndes Frühlingsbeet vorstellen. Überall sprießt es, kreuz und quer. Es ist«, jetzt verlor sich Riwal vollends ins Schwärmerische, »ein ewiges Erzählen, der Stoff ist unerschöpflich, er wird immer wieder neu gefasst, niemals wird es enden.«
»Halten Sie einfach hier rechts am Straßenrand«, ging Nolwenn dazwischen. »Das ist perfekt.«
»Was ich Ihnen ebenfalls auf den Schreibtisch gelegt habe, ist eine Ausgabe des berühmten Lancelot-Gral-Zyklus. Der zu den wichtigsten Artus-Bearbeitungen zählt. Besonders viele der Begebenheiten sind hier im Wald angesiedelt. Geschichten vom jungen Artus, von Merlin, dem größten Zauberer aller Zeiten, von der Fee Viviane, Artus’ Halbschwester Morgan, Lancelot und Iwein, dem Löwenritter. Man muss …«
»Wir sind da.«
Dupin hatte den Citroën hinter einem anderen Wagen zum Stehen gebracht. Zur Kirche waren es keine zwanzig Meter mehr. Er stellte den Motor ab, öffnete die Tür und stieg aus. Die anderen folgten.
Er blieb stehen, atmete tief ein.
Auch hier im Inneren der Bretagne war das Wetter fabelhaft. Der Wald lag ziemlich genau in der Mitte zwischen der Nord- und Südküste, der Bucht von Biskaya und dem Ärmelkanal, zwischen Vannes und Saint-Malo. Nicht selten regierten hier die Wolken. Heute jedoch war es anders. Ein phänomenaler Tag. Es war Mitte August, eine eigentümliche Zeit: Sommer mit melancholischen Untertönen. Wenn das Wetter jetzt umschlug, gewaltige, düstere Wolkenungetüme den Himmel entlangrasten, es regnete und stürmte und, anders als noch vor zwei Wochen, plötzlich die ersten Blätter von den Bäumen geweht wurden, rieb man sich verdutzt die Augen. Mit einem Mal war die Stimmung eine andere. Das Licht war milder, weicher, samtig golden, sogar über Mittag. Man konnte den Tag genau bestimmen, an dem sich plötzlich alles veränderte. Nicht, dass es danach keine Sommertage mehr gäbe, natürlich gab es sie, sogar bis Ende Oktober – Sommerwärme und sogar Hitze, aber auch sie war anders als zuvor. Allerdings war heute vom Herbst nicht mal ansatzweise etwas zu spüren. Auf beachtliche 27 Grad war das Thermometer in Concarneau geklettert, als sie um kurz nach eins losgefahren waren. Noch brannte die Sonne mit aller Kraft. Der Himmel war stechend klar. Von einem satten, prächtigen Blau.
»Gehen wir noch mal den Plan für heute durch.« Nolwenn sprühte vor Energie. Sie hatten sich hinter dem Wagen versammelt, am Kofferraum mit den Taschen und Tagesrucksäcken. »Die Inspektoren und ich setzen uns jetzt erst einmal zu Marie Line ins Maison des Sources«, selbstverständlich kannte Nolwenn auch hier Gott und die Welt. Sie schaute auf die Uhr. »Sie haben jetzt gleich Ihre Verabredung, Monsieur le Commissaire, und stoßen im Anschluss wieder zu uns«, sie runzelte die Stirn. »Später als vier sollte es nicht werden.«
Dupin hatte sich mit Fabien Cadiou – dem Mann, den er für Odinot befragen sollte – um 14 Uhr 30 verabredet, er hoffte nicht, dass es eineinhalb Stunden dauern würde.
»Bei Marie Line können wir uns mit Karten, Büchern und allem anderen eindecken, was wir brauchen. Zudem noch eine Kleinigkeit essen, herzhafte und süße Köstlichkeiten«, Nolwenn hatte schon die letzten Tage vom Maison des Sources erzählt, einem kleinen Café mit angeschlossenem Buchladen und Galerie.
»Ich vermute, Sie werden nach Ihrem Termin einen café trinken wollen. – Danach brechen wir zu unserer heutigen Exkursion auf. Erste Station: der Heilige Gral«, sie zeigte mit dem Kopf in Richtung Kirche, »anschließend das Tal ohne Wiederkehr, das man auch Gefährliches Tal oder Tal der falschen Liebenden nennt.«
»Das Entscheidende im Tal«, Riwal dämpfte seine Stimme effektvoll, und der Ausdruck auf seinem Gesicht wandelte sich, »ist nicht, was man sieht«, eine Pause, »sondern was man fühlt.«
»Unverschämt! Uns einfach den Strand zu klauen!« Kadeg warf die Zeitung, die er auf der Fahrt gelesen hatte, griesgrämig in den Kofferraum. Mit seiner Entrüstung hatte er Riwals pathetischen Satz gänzlich um seine Wirkung gebracht.
»Ich finde, wir sollten Anzeige erstatten.«
Niemand reagierte. Seit einer Woche waren die bretonischen Zeitungen voll davon: Die Korsen – eigentlich wohlgelitten in der Bretagne – hatten für eine prachtvolle Korsika-Werbebroschüre, welche die einzigartige Schönheit der korsischen Mittelmeerküste zeigen sollte, unverfrorenerweise Fotos eines bretonischen Strandes verwendet. Die Bretonen hatten fürchterlich geschimpft, ja – doch im Innersten erfüllte sie der Vorgang mit Stolz. Das Mittelmeer warb mit Bildern der Bretagne! Weil bretonische Strände die mediterransten waren!
»Gegen sieben, halb acht«, Nolwenn überging souverän Kadegs Zwischenbemerkung, »fahren wir zum Hotel. Für halb neun ist der Tisch reserviert.«
Nolwenn hatte lange mit Riwal über die Hotelwahl diskutiert, schließlich hatten sie das Grée des Landes in La Gacilly ausgewählt, vor allem natürlich, weil sie das Restaurant ausprobieren wollten, das in höchsten Tönen gepriesen wurde. Für gute Franzosen, wie es natürlich auch die Bretonen waren – in diesem Punkt zumindest –, war die Auswahl des Restaurants das Wichtigste. Damit begann bei Planungen grundsätzlich alles.
»Das Haus von Fabien Cadiou liegt nicht weit vom Maison des Sources, Chef. Drei Minuten von hier, mehr nicht. Wir gehen ein Stück zusammen, dann biegen Sie ab. Allons-y!«
Riwal war losmarschiert. Angemessen präpariert. Outdoorkleidung und Schuhe, mit denen man den Montblanc hätte besteigen können, auch der blaue Rucksack passte dazu. Kadeg trug Jeans, T-Shirt und eine dünne Jacke in militärischem Grün. Ein großes S für Salomon an der Schulter, Kadegs Lieblingsmarke. Nolwenn sah blendend aus wie immer.
Riwal drehte sich zu Dupin um: »Ich hatte es Ihnen schon gesagt, Chef: Fabien Cadiou ist eine absolute Koryphäe! Er gehört zu den weltweit führenden Artus-Forschern.«
Dupin ging nicht darauf ein. Dass Cadiou mit Artus zu tun hatte, hatte er verdrängt.
»Haben Sie daran gedacht, ein veganes Menü für mich zu bestellen, Nolwenn?«, fragte in diesem Moment Kadeg.
Der Inspektor und seine Frau – die Kampfsportlehrerin aus Lorient – waren neuerdings zum Veganismus konvertiert. Dupin hatte an sich gar nichts dagegen; was ihn und alle anderen jedoch Nerven kostete und regelmäßig zur Weißglut brachte, war das Übereifrige an Kadegs Bekenntnis. Bei Kadeg wurde alles zur Mission.
»Für mich gibt es heute Abend ein dickes Schneckenfrikassee mit Petersilienbutter«, Riwal lief noch immer voraus, er sprach ohne eine Spur von Ironie oder Provokation, »und dann ein Carré d’agneau in einer Kruste von Kräutern und Nüssen des Waldes.« Natürlich war die aktuelle Speisekarte vorab genauestens studiert worden. Man meinte beinahe, ein leises Schmatzen zu hören.
Dann herrschte eine Weile Stille.
»Und morgen«, löste Nolwenn sie auf, »sieht der Tag dann so aus: Wir besuchen die Fontaine de Barenton, die berühmte Quelle mit dem Wunderwasser, dann Paimpont, gewissermaßen das Zentrum des Waldes, dann …«
Riwal war abrupt stehen geblieben. »Sie müssen jetzt hier lang, Chef«, er deutete auf einen breiten Schotterweg, der rechts von der Straße abging. »Ungefähr dreihundert Meter. Das alte Manoir liegt direkt am Waldrand. – Das Maison des Sources befindet sich«, der Inspektor drehte sich mit einer knappen Kopfbewegung zu den Häusern, »fast direkt vor uns. Da vorne rechts. Sie können es nicht verfehlen.«
Dupin sah eine hüfthohe Steinmauer, dahinter dichte Stockrosen und ein sehr altes rötliches Steinhaus.
»Rosa Granit«, entfuhr es dem Kommissar. Seit seinen Ferien an der Côte de Granit Rose achtete er besonders auf alles Gestein.
Riwals Antwort kam prompt:
»Schiefer, wenn ich Sie korrigieren darf, Chef! – Roter Schiefer. Kein Granit. Das Gestein des Waldes ist der Schiefer. Grauer und roter. – Auch das Tal ohne Wiederkehr, in dem sich der eine oder andere bereits verloren hat, ist in rotem Schiefer gekerbt. Sein außergewöhnlich hoher Eisengehalt führt zur Verwirrung der Kompasse – und der menschlichen Sinne«, eine quasi naturwissenschaftliche Feststellung. »Wissen Sie auch, warum der Schiefer rot ist?«
Dupin schüttelte seufzend den Kopf.
»Sieben Feen«, legte Riwal auch schon los, »lebten mit ihren Schätzen versteckt unter dem See. Sie hatten einander geschworen, sich niemals den Menschen zu zeigen. Die jüngste brach den Schwur und offenbarte sich einem jungen Mann, der den See entlangritt. Ihre Schwestern beschlossen, ihn zu töten, um zu verhindern, dass sie entdeckt wurden. Die jüngste geriet daraufhin in solche Wut, dass sie ihren sechs Schwestern im Schlaf die Kehlen durchschnitt, aus ihrem Blut einen Zaubertrank bereitete und den jungen Mann wieder zum Leben erweckte. Man sagt, dass das Blut der ermordeten Schwestern sieben Tage vom Schiefer aufgesogen wurde und ihm die rote Farbe verlieh.«
Dupin verließ die asphaltierte Straße. Er war nicht in der Laune, die Geschichte zu kommentieren.
»Dann bis gleich.«
»Wie gesagt: spätestens um vier, Monsieur le Commissaire«, rief Nolwenn.
»Allerspätestens«, murmelte Dupin und beschleunigte seinen Gang. Der Schotter unter seinen Füßen knirschte.
Der Weg führte um ein hohes Lorbeergebüsch. Und mit einem Mal war der Blick frei. Da lag er, der berühmte Wald. Auf flachen, sanft geschwungenen Hügelkuppen. Imposant, dicht, undurchdringlich, schwer. Trotzig auch. Ein dunkler Hauch umwehte ihn, nicht direkt abweisend, aber auch nicht freundlich. Er schien alles Licht zu schlucken. Die zum Wald leicht ansteigenden Wiesen und Felder hingegen lagen im hellen Sonnenlicht. Das Gras ein grelles, fast blendendes Grün. Sie gehörten eindeutig der gewöhnlichen Welt an, waren real, ganz diesseitig. Was man von dem Wald, wenn man ihn so sah, nicht mit Sicherheit hätte sagen können.
Dupin schüttelte den Kopf. »Blödsinn«, sagte er laut. Wahrscheinlich hatte er einfach schon zu viele Geschichten über den großen Zauberwald gehört.
Es war ein Wald. Nur ein Wald. Mehr nicht.
Wenig später stand Dupin vor dem alten Manoir.
Rötlicher Schiefer, große, elegante Blöcke, mächtig aufragend, drei Etagen, ein spitzes dunkelgraues Dach. Kompakt gebaut. Sodass es beinahe etwas Turmartiges besaß.
Es war, wie Riwal gesagt hatte: Das Haus lag genau auf der Grenze. Die eine Hälfte lag auf der Wiese, die andere ragte in den Wald.
Dupin ging links am Haus vorbei, erst spät sah man einen großzügigen rechteckigen Hof auf der hinteren Seite. Er war von einer hohen, nachlässig verfugten Steinmauer eingefasst. Es roch schwer, erdig, holzig, feucht. Und es wirkte auf einmal deutlich kühler.
Die Mauer vermittelte etwas Wehrhaftes. Als gälte es, sicherzugehen, dass nichts aus dem Wald eindringen konnte. Aus der Wildnis, die nur einen Meter entfernt begann. Ohne Zweifel würde es dort allerhand wilde Tiere geben. Wildschweine, Steinmarder, Dachse, Schleiereulen, Otter, Biber, die in diesem Zauberwald womöglich außergewöhnliche Dimensionen erreichten. Bestimmt gab es auch seltene, hohe Giftpflanzen, in denen man sich verfangen konnte.
Dupin sah einen Holzschuppen in der hinteren Ecke. Einen dunklen, an den Seiten beeindruckend verdreckten Citroën-Geländewagen daneben. Die Bäume wuchsen unbändig über die Mauer in den Hof hinein. Die Sonne musste im Zenit stehen, um den Hof überhaupt zu erreichen. Nur dann würde es hier richtig hell.
Dupin wandte sich zu den breiten Steinstufen, die zu der hölzernen Eingangstür des Manoirs führten. Ein schlichtes Messingschild unter einem Klingelknopf: »Blanche Cadiou – Dr. Fabien Cadiou«. Darunter ein zweites Schild, größer: »Brocéliande: Le Parc de l’Imagination illimitée«.
Der Wald schluckte nicht nur Licht, sondern anscheinend auch den Lärm der Welt. Es war mucksmäuschenstill.
Dupin drückte den Knopf. Schaute sich dabei um. Rechts vom Eingang stand ein blauer Tisch auf dem Schotter, fünf Stühle darum, aus Stahl, das gleiche Blau wie der Tisch. Sie sahen neu aus. Auf dem Tisch ein komisches Ding. Ein Gefäß vielleicht, in seltsamer Form.
Dupin klingelte erneut. Wartete. Warf einen Blick auf die Uhr. 14 Uhr 34. Er war pünktlich. Mittwoch, halb drei, bei Fabien Cadiou zu Hause, hatte die Verabredung gelautet.
Dupin klingelte ein drittes Mal. Lange.
Dann entfernte er sich ein paar Schritte vom Haus.
»Hallo?« Er blickte an dem Manoir empor. Drei Fenster pro Etage. Eines auf der zweiten und eines auf der dritten standen offen. »Monsieur Cadiou? Hier Commissaire Dupin.« Dupin ließ einen Moment verstreichen. »Commissariat de Police Concarneau. Wir sind verabredet!«
Seine Worte waren noch nicht ganz verhallt, als er plötzlich ein seltsames Geräusch hörte und sich jäh umwandte. Eine Art Schaben, Kratzen. Sein Blick fiel auf etwas Weißes, das oben auf der Mauer entlanghuschte, weitgehend von Blattwerk verdeckt.
Im nächsten Moment war es verschwunden. Als hätte es sich in Luft aufgelöst.
Eine Katze?
»Verdammt!«, entfuhr es Dupin. Wo war dieser Cadiou?
Der Kommissar spürte, wie müde er war. Er brauchte einen café. Zwei. Claire und er hatten gestern Nacht bis halb drei Kartons ausgepackt. Viele, viele Kartons. Sein Leben, ihr Leben, alles in Kartons. Unten im Wohnzimmer des neuen Hauses, das sie im Sommer zusammen gemietet hatten. Ein gemeinsames Zuhause. In atemberaubender Lage, einen Steinwurf nur vom kleinen Stadtstrand Plage Mine entfernt. Mit Blick aufs Meer, auf die weite Bucht. Zwei Flaschen Weißwein hatten sie im Laufe des Abends geöffnet und geleert. Ständig hatten sie die Gläser hinter einem Karton suchen müssen, und Claire hatte zu jedem Gegenstand, den sie auspackte, eine Geschichte erzählt. – Dupin überkam ein Lächeln. Zwischendurch, es war schon dunkel gewesen, waren sie kurz schwimmen gewesen. Unfassbare 21 Grad hatte das Wasser. Der ganze Sommer, so schien es, war im Atlantik gespeichert. Sie würden noch einige Wochen schwimmen können, auch morgen wieder. Aber zuerst waren noch Dutzende Kartons auszupacken. Dupin hatte geplant, am morgigen Nachmittag wieder zu Hause zu sein.
Er gab sich einen Ruck und lief weiter um das Haus.
»Monsieur Cadiou? Hallo? Sind Sie da?«
Ein zweiter Eingang. Ein Seiteneingang, ebenerdig, keine Treppenstufen. An der Mauer davor eine Holzkonstruktion zum Wäschetrocknen.
Die Tür stand einen Spaltbreit offen.
Dupin öffnete sie kurzerhand ganz.
»Monsieur Cadiou?«
Rechts eine Treppe in den Keller; links ein sehr schmaler Flur, dann drei Stufen und eine Tür, die ebenfalls offen stand.
»Dupin hier – wir sind verab…«
Dupins Telefon. Er zog es aus der hinteren Jeanstasche.
»Ja?«
»Wo stecken Sie?« Die Stimme am anderen Ende klang noch unwirscher als seine eigene.
Verdammt! Dupin hatte nicht auf die Nummer geachtet. Was sich jedes Mal bitter rächte. Der Präfekt! Locmariaquer.
»Im Zauberwald. Der Betriebsausflug. Erinnern Sie sich?«
Von Dupins kleiner polizeilicher Aktion, eher dem persönlichen Gefallen für Jean Odinot, wusste der Präfekt natürlich nichts. Er hatte auch keinen blassen Schimmer davon, dass Dupin etwas mit der Aufklärung der kriminellen Geschehnisse an der rosa Granitküste in diesem Sommer zu tun gehabt hatte.
»Es gibt Ärger vor einigen Bäckereien in Concarneau.«
Dupin reagierte nicht.
»Die Butter! Es geht um die Butter! Horden aufgebrachter Menschen sind auf der Straße.«
Es gab einen Krieg zwischen Großhändlern, Handelsketten und Herstellern, es ging um die Preise. Nicht nur in der Bretagne, sondern in ganz Frankreich. Den dramatisch steigenden Export der französischen Butter, der attraktivere Gewinne einbrachte als der heimische Markt. In der Folge war Butter in den letzten Tagen rar geworden. So rar, dass sie vielen Bäckereien, Restaurants und kleinen Supermärkten ausgegangen war. In Zehntausenden Haushalten fehlte sie, eine allgemeine »Butterkrise« war ausgerufen worden, Frankreich war der unangefochtene Butterkonsum-Weltmeister (weit vor den Deutschen auf dem zweiten Platz). Aber natürlich traf es die Bretagne besonders hart, die Situation kam einem Ausnahmezustand gleich. Und hatte sich aberwitzig zugespitzt. Natürlich auch mit Unterstützung der Medien: Anfang der Woche war gemeldet worden, dass ein Mann aus Vannes ein halbes Pfund »demi-sel« für 250 Euro ins Internet gestellt hatte, und es war kein Einzelfall. Eine Ende-der-Welt-Stimmung hatte sich eingestellt: Baguette ohne Butter? Gar Crêpes? Ein Gâteau Breton? Lieber sterben!
»Die Kollegen werden damit fertigwerden, denke ich«, erwiderte Dupin gelassen.
»Es könnte sich jederzeit zu einer allgemeinen Unruhe auswachsen. 1789 hat nur Brot gefehlt!«
Es entsprach der allgemeinen Stimmung, wusste Dupin, es war nicht bloß die Hysterie des Präfekten.
»Wenn die Revolution ausbricht, sind wir zurück, Monsieur le Préfet. Sie können sich darauf verlassen.«
»Aber …«
»Wir sind gerade in der Gralskirche.« Kirche war ein gutes Argument. »Ich muss Schluss machen.«
Dupin legte auf. Notwehr. Er musste hier weiterkommen – und um vier im Maison des Sources sein. Wo er Kaffee bekommen würde. Und eigentlich wollte er davor auch noch Jean Odinot anrufen. Um alles direkt abzuschließen. Er war genervt.
»Monsieur Cadiou!« Dupin war wieder an der Tür, er rief noch einmal lauter als eben. Vor allem rief er ungeduldiger. »Ich bin hier unten.«
Mit diesen Worten lief er durch den schmalen Gang und nahm die Stufen.
»Hallo?«
Kurz darauf stand Dupin in einem großen Raum, der Küche und Wohnzimmer in einem war. Trotz des sonnigen Tages draußen herrschte hier Zwielicht.
Dennoch war er deutlich zu sehen, der Mann auf dem hellen Steinboden. In einer gewaltigen Blutlache.
Mit einem Satz kniete Dupin neben ihm.
»Hallo! Hallo! Monsieur? Hören Sie mich?«
Keine Reaktion.
Er fühlte am Hals nach dem Puls. Nichts. Auch die Körpertemperatur war niedriger als normal.
»So ein Scheiß.«
Im nächsten Moment stand Dupin wieder, das Handy in der Hand.
»Service d’Aide Médicale Urgente«, meldete sich die Stimme eines Mannes.
»Commissaire Dupin, Commissariat Concarneau. Ein niedergeschossener Mann. Tréhorenteuc. Im Manoir von Fabien Cadiou. Wenn Sie in den Ort fahren, dann …«
»Wir kommen aus Ploërmel, wir kennen uns aus. – Wie ist der Zustand? Vitalfunktionen?«
»Kein Puls, keine wahrnehmbare Atmung. Gesunkene Körpertemperatur. Tot vermutlich.«
»Wie viele Einschüsse und wo?«
»In der Magengegend«, Dupin hob vorsichtig das Polohemd an, es hatte sich mit Blut vollgesogen, »zwei. – Zwei Schusswunden.«
»Wir sind unterwegs.«
»Beeilen Sie sich!«
Dupin drückte die nächste Nummer. Nolwenn, Riwal und Kadeg würden gemütlich im Maison des Sources sitzen.
»Das ging ja schnell, Monsieur le Commissaire, sehr gut, wir …«
»Ein niedergeschossener Mann, Nolwenn. – Cadiou wahrscheinlich, in seinem Haus, ich habe ihn gerade gefunden. Tot, soweit ich das beurteilen kann.«
Dupin war dabei auf und ab gegangen. Er beobachtete den Mann am Boden aufmerksam.
»Sie scherzen, Monsieur le Commissaire.« Ihrem Tonfall war anzuhören, dass sie kein bisschen an Dupins Worten zweifelte.
»Ich habe die SAMU gerufen.«
»Haben Sie die Polizei verständigt? Sie sollten …«, ein Zögern, sie setzte noch einmal an, »ich denke …« Nach einer weiteren Pause war leise zu hören: »Das ist ja eine inoffizielle Mission hier. Sie tun einem Pariser Kollegen einen Gefallen, der Ihnen bei einem Fall geholfen hat, an dem Sie offiziell ebenso in keinster Weise beteiligt waren.«
Genauso war es.
»Ich denke mir was aus.« Dieses Mal hatte sie keine Pause gebraucht.
»Und was?«
»Es wird mir noch einfallen.«
Sie schien zu überlegen.
»Sie gehen davon aus, dass es Cadiou ist?«
»Ich … einen Moment.«
Cadiou war Artus-Forscher und Leiter irgendeiner Einrichtung hier. Dupin tippte auf seinem Handy und fand umgehend ein Foto.
»Er ist es. – Docteur Fabien Cadiou. – Directeur du Centre de l’Imaginaire Arthurien.«
»Wir kommen, Monsieur le Commissaire. – Wir sind auf dem Weg.«
Mit dem letzten Wort hatte Nolwenn das Gespräch beendet.
Durch eine Tür Richtung Haupteingang konnte Dupin einen Flur sehen. Dort würde sich die Treppe zu den oberen Stockwerken befinden.
Er ging auf die Tür zu, das Telefon erneut am Ohr. Es dauerte, bis Jean Odinot annahm.
»Und, wie war das Gesprä…«
»Jemand hat auf Cadiou geschossen. Ich habe ihn gerade gefunden, in seinem Haus. Höchstwahrscheinlich tot. Die Sanitäter werden gleich da sein.«
»Was? Cadiou ist tot?«
»Was ist das für eine Geschichte, um die es hier geht, Jean?«
Dupin war im ersten Stock angelangt und ging in ein Zimmer hinein. Offenbar ein Arbeitszimmer. Regale und Bücher bis zur Decke. Auf den ersten Blick war nichts Ungewöhnliches zu sehen. Eine natürliche Unordnung. Kein offensichtliches Zeichen von Fremdeinwirkung.
»Ich. Ich habe …«, Dupin hatte seinen Freund noch nie stammelnd erlebt, »keine Ahnung, was da vor sich geht. Georges, wir …«
»Erst einmal brauchen wir eine gute Geschichte, warum ich überhaupt hier bin. In ein paar Minuten werden die Gendarmerie und ein Kommissar aus Rennes auftauchen. Thierry Queméner vermutlich. Dann ist auch die Präfektur in Rennes mit dem Fall befasst.«
Dupin hatte nicht die geringste Lust auf all das, er fühlte sich keineswegs bemüßigt, irgendjemandem Rede und Antwort zu stehen. Aber genau das würde er tun müssen. In seinem letzten Fall war es kompliziert genug gewesen mit dem zuständigen Kommissar aus Trégastel; mit Mühe und Not hatte er einen Eklat vermieden. Und der Eklat wäre nicht einmal das Schlimmste gewesen, es wäre zu einer Beschwerde bei der Dienstaufsichtsbehörde gekommen, zu einem Verfahren höchstwahrscheinlich.
»Ich kümmere mich darum, Georges«, Odinot klang nun wieder gefasst.
»Was heißt das?«
Auch das zweite geräumige Zimmer, ein Schlafzimmer mit Doppelbett, wirkte auf den ersten Blick unauffällig. Im Bad nebenan war ebenfalls nichts Ungewöhnliches zu erkennen.
Dupin war schon auf der Treppe zum zweiten Stock.
»Lass das meine Sorge sein.«
Noch ein Arbeitszimmer. Drei Schreibtische, gegenüber der Tür und an den Wänden rechts und links. Penibel aufgeräumt. Noch ein Schlafzimmer und noch ein Bad, exakt die gleiche Zimmeraufteilung wie im ersten Stock.
»Hattest du noch mal mit Cadiou telefoniert, Georges?«
»Nachdem wir beide gestern gesprochen haben? Nein. Nur das eine Mal, letzte Woche. – Und du?«
»Nein. – Hast du irgendetwas Verdächtiges gesehen im Haus?«
»Ich schaue mich noch um. Nein.«
Dupin war im dritten Stock angekommen. In dem alles anders war. Die gesamte Etage war ein großer Raum. Zwei Sofas. Bunte Teppiche an den nackten Steinwänden. Eine alte Kommode. Sehr gemütlich, doch es sah nicht so aus, als hätte sich hier in letzter Zeit jemand aufgehalten. Überall dicke Staubschichten, auch auf dem Holzboden mit groben Dielen.
»Das ist gar nicht gut.« Einer von Jeans typischen Sätzen. »Odette Laurent wird nun erneut die Exhumierung ihres Mannes beantragen. Und der Richter wird dem stattgeben müssen.«
Dupin war bereits auf dem Weg nach unten.
Jean hatte die Sache, um die es bei Dupins Treffen mit Cadiou hätte gehen sollen, bei ihren beiden kürzeren Telefonaten nur vage skizziert.
Im frühen Sommer war ein Pariser Historiker, Gustave Laurent, während eines Forschungsaufenthalts in England gestorben. Herzinfarkt. Dummerweise handelte es sich bei dem verstorbenen Laurent um den Bruder des Innenministers. Und, noch schlimmer, Laurent war der Mann einer anscheinend krankhaft misstrauischen Frau gewesen. Die außerdem sehr umtriebig war. Und an keinen natürlichen Tod glaubte, obgleich es nicht den geringsten Hinweis auf etwas anderes als einen Herzinfarkt gab. Ihr Mann hatte offensichtlich schon länger an hohem Blutdruck gelitten, sein behandelnder Arzt war über die Nachricht seines Ablebens nicht wirklich überrascht gewesen. Dennoch hatte seine Frau ihren Schwager gedrängt und der den Polizeipräsidenten – und dieser wiederum Jean Odinot. Gustave Laurent war nicht alleine gereist, er war mit einer Gruppe Wissenschaftlern dort gewesen. Zu der auch Cadiou gehört hatte, zumindest zeitweise. Der wohl mit dem Verstorbenen befreundet gewesen war. Natürlich hatte die Polizei vor Ort mit allen gesprochen. Aber es war keine eingehende Untersuchung geworden. Worauf seine Witwe nun jedoch bestand. Ein gewisser Druck hatte sich aufgebaut. So war Jean und – in der Folge – auch Dupin zu dem Auftrag gekommen, Cadiou erneut auf den Zahn zu fühlen. Cadiou hatte sich dann auf Reisen befunden, sodass ein Treffen erst jetzt möglich geworden war. Niemand – außer der Witwe Laurent – hatte es eilig gehabt.
»Erzähl noch einmal alles, was du weißt. Alles, hörst du, ich …« Dupin brach ab. Was redete er da! »Lass! Vergiss es, Jean! Es ist nicht meine Untersuchung! Ich bin raus, noch bevor sie anfängt. Ist das klar?«
Dupin meinte es ernst.
»Ich rufe dich gleich zurück, Georges.«
Dupin wollte unbedingt noch etwas sagen – doch Jean hatte den Anruf beendet.
Dupin ging zurück ins Erdgeschoss. Wenig später stand er wieder neben Cadiou.
»So ein Scheiß.« Er fuhr sich heftig durch die Haare.
Es herrschte reges Treiben.
Nolwenn, Riwal und Kadeg waren als Erste eingetroffen, kurz darauf die Sanitäter, die Gendarmerie aus Ploërmel, die Gendarmerie aus Paimpont. Jeden Moment würden der Gerichtsmediziner und die Spurensicherung eintreffen, beide aus Rennes, wie auch Thierry Queméner, der zuständige Kommissar. Dupin kannte ihn, wenn auch nur flüchtig. Ein angenehmer Zeitgenosse – der gemütliche Typ, durchaus beleibt –, mittlerweile kurz vor der Rente. Immerhin, es hätte schlimmer kommen können. Dennoch, auch seine verträgliche Art würde Grenzen kennen. Das hier war sein Revier.
»Tot. Und nicht erst seit ein paar Minuten«, hatte die rasche Diagnose des jungen Sanitäters gelautet, der sich weigerte, Vermutungen über den genauen Todeszeitpunkt zu äußern. »Offensichtlich werden wir nicht mehr gebraucht«, hatte er noch angemerkt, und schon waren sie wieder weg gewesen.
Dupin hatte gegenüber den Gendarmen etwas von »Betriebsausflug« und »kuriosem Zufall« gemurmelt. Im Moment hatten sie andere Sorgen und stellten ihm keine weiteren Fragen.
Der Chef der Gendarmen, Colonel Aballain aus Paimpont, gab den Ton an. Er hatte die Kollegen eingeteilt und erste Aufgaben vergeben. Sodass die meisten nun auf dem Hof und dem Schotterweg, der zum Manoir führte, nach Reifen- und Fußspuren suchten. Die Gendarmen waren aufmerksam genug gewesen, an der Straße zu parken, nur die Sanitäter waren auf den Hof gefahren.
Riwal und Kadeg hatten angeboten mitzuhelfen – Dupin war es nicht recht gewesen, aber er hatte auch nicht einschreiten wollen.
Colonel Roland Aballain hatte Cadious Frau erreicht, für jeden Polizisten der fürchterlichste aller Momente. Sie hielt sich in Paimpont auf. Zwei Gendarmen waren auf dem Weg zu ihr.
Nolwenn und Dupin waren in den Hof gegangen, sie standen etwas abseits.
»Da uns keine überzeugende Lüge einfällt, Monsieur le Commissaire, rate ich in der Not zur Wahrheit. Zumindest teilweise.« Eine eigenwillige Position, fand Dupin. »Verschweigen Sie Ihre illegalen Ermittlungen in Trégastel, aber erzählen Sie wahrheitsgetreu, dass Sie Ihr Pariser Freund Inspecteur général Jean Odinot um einen Gefallen gebeten hat. Nämlich für ihn mit Fabien Cadiou zu sprechen. – Blöd«, Nolwenn klang mit einem Mal etwas vorwurfsvoll, »dass es immer gleich Tote geben muss, wenn Sie irgendwo auftauchen.«
»Ich denke, dass …«
Dupin brach ab.
Thierry Queméner war um die Ecke des Hauses gebogen und kam auf sie zu.
Dupin ging ihm entgegen, es wäre nicht verkehrt, sich maximal freundlich zu geben. Und sich dann möglichst schnell von hier zu verabschieden. Er würde sich an Nolwenns Rat halten. Was für gewöhnlich ohnehin das Beste war. Vielleicht käme er so irgendwie doch glimpflich aus der Geschichte raus.
»Commissaire Queméner«, mit jovialem Tonfall streckte Dupin die Hand zur Begrüßung aus, »ich …«
Dupins Telefon. Rasch blickte er auf die Nummer. Jean Odinot.
Es wäre unpassend, das Telefonat anzunehmen. Aber Dupin musste es tun. Vielleicht würde Jean ihn instruieren, was er dem Kommissar aus Rennes sagen sollte.
»Einen Moment bitte, Commissaire Queméner.« Dupin wandte sich – er hatte die Hand seines Gegenübers beinahe schon berührt – zur Seite ab. Und ging eiligen Schrittes auf die Mauer Richtung Wald zu. In seinem Rücken konnte er hören, wie Nolwenn die Situation rettete: »Commissaire Queméner, wie geht es Ihnen? Und Ihrer Frau? Ich …«
»Ja?« Dupin sprach mit gedämpfter Stimme.
»Ich habe mit meinem Chef gesprochen und der mit dem Innenminister höchstpersönlich – du ermittelst. Ganz offiziell. Im Auftrag der Pariser Polizei und der Police Nationale. Einer Sonderabteilung von uns.«
»Was?«
»Du leitest diese Untersuchung als Sonderermittler. Alle regionalen Präfekturen und Kommissariate arbeiten dir in dieser Angelegenheit zu.«
Es war schwer, Dupin im Innersten aus dem Gleichgewicht zu bringen, doch Odinot war es in diesem Moment gelungen.
»Wie bitte?«
»Wie ich gesagt habe. Es ist dein Fall.«
»Ich will ihn aber nicht!«
Dupin wollte ihn wirklich nicht.
»Das alles klingt doch nach einer besonders – interessanten Geschichte, Georges, oder? Und wir arbeiten mal wieder zusammen, zumindest ein bisschen. Sogar offiziell. Wie in alten Zeiten. Das ist doch was!«
Dupin war verstummt. Jean schien sich einen Spaß zu erlauben. Der allerdings gar nicht lustig war.
Dupin konnte hören, wie ein paar Meter hinter ihm ein Telefon klingelte.
»Bist du noch dran, Georges?«
»Du machst Witze, richtig?«
»Ich mache keine Witze. Mitgefangen, mitgehangen. – Es ist dein Fall. Und ich bin deine Pariser Anlaufstelle.«
»Ich …« Dupin brach ab. »Ich …«
»Ich melde mich gleich wieder, Georges, ein Telefonat …«
Das Gespräch war beendet.
Dupin verharrte einen Augenblick regungslos. Dann schüttelte er sich. Schaute zu Nolwenn, die neben Kommissar Queméner stehen geblieben war und Dupin einen fragenden – vielleicht auch strafenden – Blick zuwarf. Queméner telefonierte. Legte aber gleich wieder auf.
Auf seinem Gesicht erschien eine Art Lächeln. Er kam auf Dupin zu, Nolwenn folgte.
»Entschuldigen Sie, Commissaire Queméner, es war ein – sehr wichtiger Anruf. Ich musste ihn annehmen, ich …«
»Ich habe von meinem Präfekten gehört, dass Sie jetzt hier der Boss sind. Umso besser. Meine Schwägerin feiert morgen ihren 75. Geburtstag. In Nizza.« Dem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, schien er sich darüber zu freuen. »Meine Frau hatte schon Sorge, dass ich nicht mitkomme. Wegen des Toten.«
Es war wie in einem absurden Theaterstück. Alles hier.
»Aber jetzt hat es sich ja aufs Wunderbarste gefügt. – Der Fall gehört Ihnen, lieber Kollege Dupin.«
Der Kommissar aus Rennes gab sich nicht die geringste Mühe, seine Zufriedenheit zu verbergen.
Dupin lag Protest auf der Zunge.
»Ehrlich gesagt«, Queméner kam ihm zuvor, »bin ich saufroh, dass ich damit nichts zu tun habe. Eine bekannte, hoch angesehene Persönlichkeit, erschossen. – Und das in Tréhorenteuc.« Er winkte ab. »Na gut, dann mache ich mich auf den Weg. Viel Erfolg!«
Nolwenn warf Dupin erneut einen Blick zu. Sagte aber kein Wort.
»Aber«, setzte Dupin an, »ich brauche Sie. Ich meine, jemanden, der sich hier auskennt. Jemanden von hier. Der die Leute hier kennt«, ein Satz klang hilfloser als der andere. »Der eine Idee hat, worum es hier gehen könnte.«
»Bestimmt um den Heiligen Gral.« Queméner hatte lustig klingen wollen, merkwürdigerweise wirkten seine Gesichtszüge dabei sehr ernst. »Und beim Gral geht es ja bekanntlich mehr um die Suche als um den Gegenstand selbst. Also«, er machte Anstalten, sich endgültig abzuwenden, »Sie sind jetzt der Gralsritter. – Ach ja, bevor ich es vergesse: Der Gerichtsmediziner verspätet sich leider. Und halten Sie sich an Colonel Aballain. Ein Eingeborener«, er hatte es anerkennend ausgesprochen, »und ein höchst patenter Gendarm, Sie werden sehen. – Ach ja, mein Chef hat gesagt, Sie können für Ihre Sondereinheit auf sämtliche lokalen Einheiten zurückgreifen.«
»Forensik, Spezialisten? IT und so?«
Dupin hatte die Frage mechanisch gestellt.
»Genau. Alles über Rennes. – Aber praktischerweise haben Sie Ihr eigenes Team ja schon mitgebracht.«
Dupin wollte etwas erwidern, ließ es jedoch.
Der Kommissar aus Rennes entfernte sich beschwingten Schrittes.
Wieder musste Dupin sich zurückhalten, und dieses Mal fiel es ihm noch schwerer.
»Wahnsinn, das ist der reine …«
»Unser Fall? – Warum ist das unser Fall?«, fiel Nolwenn Dupin ins Wort. »Was meint er damit?«
Tiefe Falten lagen auf ihrer Stirn.
»Der Innenminister und der Präsident der Pariser Polizei haben mir auf Odinots Empfehlung hin den Fall übertragen. Als Sonderermittler der«, ein verzweifeltes Stocken, »Pariser Polizei.«
»Ich …« Nolwenn brach ab. Ein dunkler Wagen fuhr mit viel zu hohem Tempo heran. Zwei Polizisten sprangen zur Seite. Nahe dem Eingang zum Manoir bremste der schicke Volvo und kam abrupt zum Stehen. Es machte einen höllischen Lärm auf dem Schotter.
Die Fahrertür flog auf. Eine Frau in einem dunkelgrauen Kostüm sprang aus dem Auto und bewegte sich ohne Umschweife auf den Hauseingang zu.
Dupin ging ihr zügig entgegen.
»Madame Cadiou?«
Die Frau schien ihn erst jetzt zu bemerken. Sie bedachte ihn mit einem leeren Blick. Im nächsten Augenblick war sie im Haus verschwunden, ohne ein Wort zu sagen.
Als Dupin ins Zimmer trat, kniete Blanche Cadiou neben ihrem toten Mann. Ihr Blick ruhte auf seinem Gesicht. Starr, ohne erkennbare Empfindung.
Dupin war im Türrahmen stehen geblieben.
Die Spurensicherung war immer noch nicht da, Dupin war froh darüber, sie waren allein.
Blanche Cadiou verharrte regungslos.
Zwei, drei lange Minuten verstrichen.
»Ich werde – – – den Mörder finden.«
Dupin hatte die Worte beinahe nicht gehört. Blanche Cadiou hatte sie eher gezischt als gesprochen; scharf, gepresst vibrierend, kalt.
Langsam stand sie auf.
Dupin näherte sich ihr vorsichtig. Jetzt sah er Tränen auf ihren Wangen. Sah Schmerz und Entsetzen, aber auch eine Art verbissenen Zorn.
»Commissaire Georges Dupin«, er war seitlich von ihr stehen geblieben, hielt kurz inne und sprach dann gemessen weiter. »Können wir etwas für Sie tun? Möchten Sie, dass ich einen Arzt für Sie rufe, Madame Cadiou?«
»Nein.«
Eine prompte, entschiedene Antwort. Ohne Dupin anzusehen. Ihr Blick haftete auf ihrem Mann. Sie schien unmittelbar die Kontrolle wiedererlangt zu haben. Erneute Stille, dann:
»Wissen Sie schon etwas, Commissaire?«
In einer fast gespenstischen Weise war die Frage ohne Betonung gewesen.
»Nicht das Mindeste. Und Sie, Madame Cadiou – haben Sie eine Ahnung, was hier geschehen sein könnte?«
Sie wandte den Blick zum ersten Mal Dupin zu und musterte ihn.
»Sind Sie es, der die Untersuchung leitet?«
Was sollte er sagen? So wie es im Moment aussah, leider ja. Und selbst wenn er versuchen würde – und das würde er –, daran noch etwas zu ändern, wäre es nicht der passende Augenblick, dies zu erörtern.
Dupin bemühte sich um Entschlossenheit in der Stimme. »Das bin ich.«
Sie nickte stumm.
»So schwer es auch ist, Madame Cadiou – fällt Ihnen zu dieser fürchterlichen Tat unmittelbar etwas ein? Wer sie begangen haben könnte? Und warum?«
»Nein.« Ein minimales Kopfschütteln.
»Haben Sie in der letzten Zeit etwas Ungewöhnliches an Ihrem Mann bemerkt? In den letzten Tagen? An seinem Verhalten? An seiner Stimmung?«
»Er war wie immer.« Sie strich sich ihre dunkelbraunen Haare aus der Stirn.
»Gab es Streitigkeiten? Konflikte? Mit wem auch immer.«
Wieder das minimale Kopfschütteln, wie abwesend. Der Blick erneut starr auf ihren Mann geheftet. Sie befand sich in einem Schockzustand.
Trotzdem wusste Dupin, dass ein ermittlerischer Grundsatz immer mit Absolutheit galt: Jeder, ausnahmslos jeder konnte es gewesen sein.
»Gerade am Anfang einer Ermittlung sind wir auf alle Hinweise angewiesen, Madame Cadiou. Jede Kleinigkeit, die Ihnen einfällt, könnte von Belang sein, so unbedeutend sie Ihnen auch vorkommen mag.«
»Alles war völlig normal. Er war wie immer.«
»Ihr Mann kannte Gustave Laurent. Er war im Frühsommer …«
»Chef!«
Riwal kam in den Raum gestürzt, irgendetwas musste vorgefallen sein, Dupin kannte diesen Gesichtsausdruck.
»Chef!«, er strengte sich vergeblich an, gefasst zu sprechen. »Noch ein Mord! – Wir haben noch einen Toten.«
Blanche Cadiou hatte sich abrupt zu Riwal umgewandt.
»Was?«
Das war doch vollkommen irre.
»Es gibt einen zweiten …«
Dupin war augenblicklich bei seinem Inspektor. Kadeg, Nolwenn und der Colonel aus Paimpont waren hinter Riwal erschienen.
»Wer ist es, Riwal?«
»Paul Picard. Ein Professor aus Paris. Mittelalterspezialist und Archäologe. Er wurde eben im Wald gefunden«, Riwal wurde blasser, während er sprach, »in der Nähe der Quelle von Barenton. Man erwartet Sie dort, Chef, Sie …«
»Wie ist er gestorben?«
»Stichwunden, er ist verblutet.« Riwal holte tief Luft. »Das ist kein Zufall, Chef. Hier ist etwas im Gange. Sie haben …«
»Das ist doch Wahnsinn.« Dupin hatte halblaut gesprochen, aber jeder hatte es gehört.
»Ein Kollege«, Madame Cadiou war bei ihrem Mann stehen geblieben, ein monotones, mechanisches Flüstern, »Paul Picard ist ein Kollege meines Mannes. Ein Freund. Er ist zu der Konferenz angereist.«
»Konferenz?«, hakte Dupin nach.
Riwal war anscheinend bereits im Bilde. »Eine Konferenz zu neuesten Ergebnissen der Artus-Forschung. Sie findet jedes Jahr statt. Dieses Mal geht es um aufsehenerregende Ausgrabungen.« Riwal hatte die Fassung wiedererlangt.
Dupin lief ein paar Schritte hin und her.
Ein ungeheurer Fall hatte sich hier in Kürze aufgetan. Und er wollte eigentlich nichts – gar nichts – mit dieser Ermittlung zu tun haben! Er musste dringend mit Jean sprechen.
»Wo findet dieses Treffen statt?«
»Im Centre de l’Imaginaire Arthurien«, antwortete Riwal, »im Schloss von Comper, wo Monsieur Cadiou Direktor ist«, er setzte ab, »war. – Die Konferenz sollte gleich beginnen und bis Freitagnachmittag dauern. Sieben Wissenschaftler. Die Crème de la Crème der Artus-Forscher. Die fünf anderen haben auf die beiden gewartet, sie dachten, sie verspäten sich bloß.«
»Sind sie noch da?«
»Sie meinen, im Centre? Soweit ich weiß, ja.«
»Sie sollen«, Dupin zögerte, führte den Satz dann aber doch zu Ende. »Sie sollen alle dableiben. Keiner verlässt dieses Centre. Ich …«
»Da bin ich«, ein kleiner, hagerer Mann mit Glatze war hinter Riwal aufgetaucht. »Wo haben wir denn die Leiche?«
Heiter beschwingt nickte der Gerichtsmediziner ihnen zu. Dupin stand prinzipiell mit diesem Berufsstand auf Kriegsfuß, dieser Vertreter hier würde, das konnte Dupin schon jetzt sagen, keine Ausnahme bilden.
»Wir treffen uns in einer halben Minute draußen«, wandte er sich an Riwal. »Ich bin gleich da.«
Er ging zu Madame Cadiou zurück, die immer noch bei der Leiche stand.
»Fällt Ihnen jetzt vielleicht etwas zu den Geschehnissen ein, Madame Cadiou?«
Dupin wusste, dass er zu viel Druck machte, aber er konnte nicht anders. »Ich meine, wegen dem zweiten Toten, dem Professor aus Paris«, er hatte sich den Namen nicht gemerkt. »Was ist hier im Gange, Madame Cadiou?«
Dupin sah ihr direkt in die Augen. Intensive dunkelbraune Augen. Erstaunlich: die gleiche Farbe wie ihr schulterlanges Haar.
Sie schüttelte den Kopf.
»Ich kann Ihnen wirklich nichts sagen«, eine Pause, »ich wünschte, ich wüsste irgendetwas.«
»Ihr Mann und das zweite Opfer waren sogar Freunde, sagten Sie?«
»Ja.«
»Gute Freunde?«
»Sie haben sich nicht häufig gesehen. – Aber ja, Freunde.«
»Und sie haben ähnliche Forschungsgebiete, wenn ich das richtig verstehe.«
»Das haben sie.«
Dupin hätte gerne noch viele weitere Fragen gestellt, aber es ging nicht. Er musste los.
»Gut, Madame Cadiou. Noch einmal mein aufrichtiges Beileid«, er hatte es noch keinmal gesagt, fiel Dupin in diesem Moment auf. »Das ist eine furchtbare Tragödie. – Der Kollege aus Paimpont«, er sollte sich auch diesen Namen unbedingt einprägen, eine von Dupins großen Schwächen, »bleibt vor Ort, er leitet das Team hier. Sie können sich jederzeit an ihn wenden. – Und wenn Ihnen doch etwas einfällt«, es war nicht selten, dass dies nach dem ersten Schock geschah, »dann rufen Sie mich bitte umgehend an. Die Kollegen werden Ihnen meine Nummer geben.«
Madame Cadiou hatte sich wortlos wieder ihrem toten Mann zugewandt. An dem der kleine Gerichtsmediziner bereits herumhantierte.
Dupin fiel auf, dass die Spurensicherung immer noch nicht da war.
»Ich muss vor allem den Todeszeitpunkt wissen«, wies Dupin den Mann an, während er sich zum Gehen wandte. »Unterrichten Sie mich bitte unverzüglich.«
Als der Gerichtsmediziner von dem Toten abließ und zu einer Antwort ansetzte, war Dupin bereits draußen.
Die schmale Straße verlief wie eine kerzengerade geschlagene Schneise durch den großen Wald. Der Wald schien diese Wunde immer noch heilen zu wollen, von beiden Seiten wucherte die Schneise mit aller Kraft wieder zu. Büsche und Sträucher bahnten sich ihren Weg. An manchen Stellen waren die Bäume an den Wipfeln zusammengekommen und bildeten ein grünes Dach. Die Straße, so machte die Natur hier deutlich, war eine flüchtige Angelegenheit.
Dupin hatte sich – nachdem er vergeblich versucht hatte, Jean Odinot zu erreichen – kurz mit Nolwenn, Riwal, Kadeg und dem Colonel besprochen. Aballain hieß er, nun hatte Dupin sich den Namen endlich gemerkt. Nolwenn würde zum Hotel fahren, um von dort aus einige Recherchen zu erledigen, Kadeg blieb mit Aballain beim Manoir. Riwal fuhr mit Dupin zur Quelle, wo der zweite Tote gefunden worden war.
Während ihrer Unterredung war die Spurensicherung eingetroffen – immerhin vier Mann, darunter ein Ballistiker. Alle Routinen wurden aufgenommen; es ging um die Computer, Handys, Telefonanschlüsse. Die Bankkonten der beiden Toten.
»Georges? Ich habe gerade versucht, dich …«
Endlich war die Leitung frei.
»Zwei!«, Dupin schrie beinahe. »Jetzt sind es schon zwei Morde, Jean! Das ist doch aberwitzig. Man hat an irgendeiner Quelle in diesem Wald einen toten Professor aus Paris gefunden. Das ist …«
»Ich weiß. – Die Meldung ging auch an den Kommissar aus Rennes. Der umgehend bei mir sicherstellen wollte, dass alles dennoch ausschließlich dein Fall bleibt. Weil die beiden Ereignisse in einem Zusammenhang stünden, was sie ohne Zweifel tun, möchte er damit nichts zu tun haben …«
»Und ich ebenso wenig. Ich werde diesen Fall auf keinen Fall übernehmen!«
»Selbst wenn wir wollten, Georges, wir kommen da nicht mehr raus. Keine Chance. Wir hängen da jetzt drin. – Aber immerhin zusammen.«
Die Lautstärke der in die Jahre gekommenen Freisprechanlage ließ sich seit einigen Wochen nicht mehr regulieren. Sie stand permanent auf Maximum. Die Stimmen wurden entsetzlich verzerrt.
»Warum kann Paris nicht jemand anderen aus Rennes beauftragen, verdammt noch mal! Oder selbst jemanden schicken?«
»Weil du der Beste bist! Und ich verantwortlich bin. Ich brauche dich, Georges. – Ich hatte keine Vorstellung, womit wir es da zu tun bekämen. Wir sind da beide reingeschlittert.«
»Ich …«
Dupin brach ab.
Er steckte mit drin. So war es. Jean hatte leider recht. Und es war nicht Dupins Art, sich aus irgendetwas herauszuwinden. Aber er spürte den anhaltenden heftigen Affekt in sich. Nicht bloß, dass er doch wieder etwas mit der Pariser Polizei zu tun haben würde – gar als ihr »Sonderermittler« unterwegs wäre. Er verspürte zudem ein seltsames Unbehagen bei diesem Fall. Außerdem, es war ihm eben wieder eingefallen – siedend heiß –, konnte er das Claire nicht antun: sie in diesen Tagen mit den unzähligen Kartons alleine lassen.
»Tu es für mich«, bat Jean. Geschickter konnte sein Freund nicht vorgehen. Was sollte Dupin da sagen?
Es entstand eine längere Pause. Dupin warf Riwal einen kurzen Blick zu. Riwal versuchte vergeblich, einen unbeteiligten Eindruck zu machen.
Dupin seufzte laut und trat fester aufs Gas – sie flogen auf die Kuppe eines Hügels zu. »Erzähl mir noch einmal alles über diesen Herzinfarkt. Diesen Laurent und seine Dienstreise. Und über seine Frau.«
»Ich habe mit Madame Laurent telefoniert«, Odinot war tiefe Erleichterung anzuhören, die er zu verbergen versuchte – er war sich also nicht sicher gewesen, Dupin tatsächlich im Team halten zu können. »Laurent befand sich auf einer Ausgrabung. Den ganzen Mai über. Ein Team aus vier Forschern. Irgendein grüner Hügel im Südwesten Englands. Cadiou hat ihn dort zwei Tage besucht, sie kannten sich wohl gut, sind ein Jahrgang, haben sich in Paris an der Sorbonne als junge Wissenschaftler eine Stelle geteilt und früher teilweise zusammen veröffentlicht. Später war auch Konkurrenz dazugekommen. So hat sie es ausgedrückt.«
Dupin war nicht entgangen, dass Riwal unruhig auf seinem Sitz hin- und herrutschte.
»Dieser Laurent ist gestorben, während Cadiou da war?«
»Zwei Wochen nach dessen Abreise. – Wir müssen Laurent, so schnell es geht, exhumieren lassen, wir haben bereits einen Eilantrag bei einem Richter eingereicht.« Jean besaß die gleiche – schwierige, aber höchst nützliche – Eigenschaft wie Dupin: Alles musste sofort passieren; einer der Gründe, warum sie sich so gut verstanden hatten, zudem standen beide im Ruf, manisch zu sein. »Ich habe mit Madame Laurent noch einmal über den hohen Blutdruck ihres Mannes gesprochen. Er hat jeden Morgen drei verschiedene Tabletten genommen. Betablocker, ACE-Hemmer, Kalziumantagonisten. Dennoch war der Druck in stressreichen Zeiten immer wieder zu hoch, die Werte erreichten vereinzelt bedenkliche Peaks. Klar«, Jean war eine gewisse Anspannung anzumerken, »hätte jemand die Medikamente ersetzen können. Gegen Placebos oder gar gegenteilig wirkende Mittel austauschen können. So was lässt sich beschaffen.«
»Hat Madame Laurent etwas über Fabien Cadiou gesagt?«
»Sie nimmt ihn ausdrücklich von allem Verdacht aus. Was bei ihr etwas bedeutet. – Sie hatte ja unbedingt gewollt, dass wir mit ihm sprechen.«
»Hat sie genauer gesagt, warum?«
»Nein. Nur wiederholt, dass sie nicht an den natürlichen Tod ihres Mannes glaube.«
»Aber ohne irgendeine auch noch so vage Idee davon zu haben, warum es ein Mord gewesen sein sollte?«
»Genau. Wir sollten mehr herausfinden. Deswegen das erneute Gespräch mit Cadiou. Sie bestand darauf, sie hatte die Hoffnung, dass er irgendetwas wusste.«
»Aber Cadiou hat«, Dupin dachte laut nach, »von sich aus anscheinend nichts Verdächtiges geargwöhnt.«
»Exakt.«
»Madame Laurent hatte keinen besonderen Verdacht irgendeiner Person gegenüber?«
»Nein. Sie kennt nicht mal die Namen der anderen Grabungsteilnehmer.«
»Was hat den Verdacht denn überhaupt ausgelöst?«
»Sie hatte das Gefühl, ihr Mann sei in den letzten Monaten vor seinem Tod irgendwie verändert gewesen. Mehr konnte sie nicht sagen. Er hat wohl noch mehr gearbeitet als sonst, hat aber, anders als gewöhnlich, nichts von seiner Arbeit erzählt, auch nicht auf Nachfrage. Er sei ständig in Gedanken gewesen. Abwesend.«
»Sonst noch irgendetwas?«
»Er sei sehr angespannt gewesen. – Aber sie hatte ausdrücklich nicht das Gefühl, dass er sich bedroht gefühlt habe. Sie wusste auch von keinem Konflikt.«
»Hast du die Namen der anderen Teilnehmer der Ausgrabung?«
»Ja. Wir knöpfen uns die drei noch einmal eingehend vor. Ich habe übrigens auch schon zwei Polizisten zur Wohnung von Picard geschickt. Im sechsten Arrondissement.«
Dupin hatte während Jeans Ausführungen in einer abenteuerlichen Aktion im Handschuhfach nach irgendetwas Beschreibbarem und einem Stift geforscht, während Riwal die Beine umständlich zur Seite gedreht hatte. Das Einzige, was Dupin gefunden hatte, war die vergilbte, zerfledderte Betriebsanleitung seines Wagens. Er hatte sie Riwal in die Hand gedrückt. Der sofort verstanden und willkürlich eine Seite aufgeschlagen hatte, um Notizen zu machen.
»Was weiß man über den Zustand der Ehe der Laurents?«
Bei dem Stichwort fiel ihm ein: Er würde Claire anrufen und sie vorwarnen müssen.
»Sehr glücklich, so Madame Laurent.«
Riwal kritzelte.
»Glaubhaft?«
»Im Moment nicht zu sagen. – Ich bin um halb sechs mit ihr verabredet.«
Jean hatte recht. Man musste immer persönlich mit den Leuten sprechen.
»Was no…«
»Hier jetzt rechts.«
Riwal hatte fast geschrien. Die hohe Lautstärke der Freisprechanlage hatte zur Folge, dass man selbst sehr laut sprach.
Dupin nahm mutig die Abfahrt, die Reifen quietschten. Sie hatten den Wald verlassen und fuhren nun an seinem Rand entlang, weiterhin war es sanft hügelig.
»Was noch? Worum ging es bei dieser Ausgrabung?«
Wieder nahm Dupin aus dem Augenwinkel eine gewisse Unruhe an Riwal wahr.
»Um eine Burg aus der Zeit von Artus oder so etwas.«
Riwal hielt es nicht mehr aus:
»Hier spricht Inspektor Riwal, Monsieur Inspecteur général Odinot. – Ich sitze neben Kommissar Dupin«, Riwal bemühte sich um einen formellen Ton. »Cadbury Castle heißt die Burg. Der grüne Hügel, von dem Sie sprachen, ist eine archäologische Sensation. In der Gegend hat man sich schon immer Artus-Geschichten erzählt. Vor fünfzig Jahren wurden dort massive Befestigungen einer Anlage entdeckt, die exakt in die für Artus reklamierte Zeit zwischen 500 und 550 passen. – Manche halten sie für Camelot.«
»Ich verstehe«, kommentierte Odinot in neutralem Ton. »Danke für die Erläuterung, Inspektor.«
Dupin fand das nicht uninteressant: »Hat man bei Laurents Ausgrabung etwas Spektakuläres gefunden, Riwal?«
»Andere beeindruckende Gebäuderuinen.«
»Und wonach hatte man gesucht?«
»Nach Zeugnissen der historischen Bewohner der Burg. Inschriften, Steintafeln, Schriften.«
»Aber nichts gefunden?«
»Nein.« Riwal war augenfällig enttäuscht, diese Antwort geben zu müssen. »Aber man sucht weiter.«
Dupin reichte es für den Moment: »Melde dich wieder bei mir, Jean!«
»Klar.«
»Habt ihr noch weitere Informationen zu Fabien Cadiou?«
»Keine. Nein. Es gab bisher ja keinerlei Grund, sich mit ihm zu beschäftigen.«
»Zu dem zweiten Toten?«
»Auch nicht.«
»Wir nehmen die Recherche gerade auf.«
Nolwenn würde bald in La Gacilly ankommen, ein Gendarm fuhr sie.
»Gut. Und spiel deinen Status rücksichtslos aus, Georges. Du bist ganz offiziell ein Sonderermittler mit speziellen Befugnissen. Ihr habt für alles die volle Rückendeckung«, Jean zögerte, er würde sich an das eine oder andere aus der gemeinsamen Zeit erinnern, vermutete Dupin, »für fast alles.«
Das klang – interessant. So hatte Dupin die Situation noch nicht betrachtet.
»Gut. Also: Wir übernehmen, Jean. – Bis später.«
Dupin tippte auf die kleine rote Taste und beendete das Gespräch.
Die Straße war kurvig, doch Dupin fuhr unvermindert rasant.
Er dachte über den zweiten Toten nach: »Was hat dieser Professor eigentlich hier im Wald gemacht? Haben die Kollegen dazu etwas herausgefunden?«
Riwal hatte am Manoir mit einem der beiden Gendarmen telefoniert, die sich schon am Fundort der Leiche befanden.
»Sie wissen noch nichts Genaues.«
»Wir sollten danach mit diesen anderen Forschern sprechen.«
Eigentlich, merkte Dupin, wäre er am liebsten direkt zu ihnen gefahren. Der Mann an der Quelle war ohnehin tot.
»Colonel Aballain hat übrigens zwei Kollegen von der Spurensicherung zum Centre geschickt, um Cadious Büro zu inspizieren.«
Der Anfang des Falls war ein einziges Durcheinander gewesen – Dupin hatte an ein paar Selbstverständlichkeiten gar nicht gedacht. Es würde noch etwas dauern, bis er fest im Sattel säße.
Sie hatten ein kleines Dorf erreicht. Nicht mehr als fünfzehn, zwanzig Häuser. Dupin bremste den Wagen etwas ab.
»La Folle-Pensée. – Hier haben die Druiden einst die Wahnsinnigen gepflegt. Mit dem Wasser aus der legendären Quelle, der Fontaine de Barenton.«
Wahnsinn brachte alles gut auf den Punkt. Der Begriff war Dupin die letzten eineinhalb Stunden bereits viele Male durch den Kopf gegangen. Er sollte vorsichtshalber einen Schluck aus der Quelle nehmen. Einen großen Schluck.
»Wir müssen so schnell wie möglich die Liste dieser Forscher haben. Und alles über sie wissen, was man nur wissen kann.«
»Klar, Chef.«
Im Nu waren sie durch den Ort hindurch. Dupin trat erneut beherzt aufs Gas.
»Wir müssen gleich rechts ab«, sagte Riwal besorgt. Das Gelände war unübersichtlich. Es war noch hügeliger geworden.
»Achtung, hier!«
Dupin war kurz vom Gas gegangen, sofort nach der Abbiegung hatte er wieder beschleunigt. Die Straße, auf der sie jetzt fuhren, war eher ein Sträßchen, nicht viel breiter als der Wagen. Mit engen Kurven.
»Ich weiß nicht, ob Sie davon in den Zeitungen gelesen haben?« Riwal hielt sich am Griff über der Tür fest. »Hier im Wald tobt zurzeit ein erbitterter Streit. Besser: ein Streit um den Wald. Seit einem Jahr.«
Dupin las jeden Morgen die Zeitungen – die beiden regionalen zuerst, Ouest-France und Le Télégramme –, eigentlich entging ihm nichts Wichtiges. Doch das war ihm neu.
»Erzählen Sie. Aber …«
Plötzlich tauchte direkt vor ihnen etwas auf der Straße auf. Dupin trat mit aller Kraft auf die Bremse. Und riss das Lenkrad herum. Der Wagen brach nach links aus, Dupin steuerte gegen und gewann die Kontrolle zurück. Allerdings nicht mehr rechtzeitig.
Ein infernalischer Lärm brach los. Der Citroën streifte an einem mächtigen Baum entlang. Ein einzelner lauter, brutaler Schlag: Der Seitenspiegel wurde abgerissen.
Ein paar Meter weiter kam das Auto ächzend zum Stehen. Für einen langen Moment herrschte eine gespenstische Stille.
Die Gurte hatten Dupin und Riwal fest eingeschnürt. Der Wagen hatte keine Airbags.
»Verdammt«, durchbrach Dupin die Stille. »Was war das denn?«
Es dauerte eine Weile, bis Riwal etwas sagte: »Irgendein Tier«, seine Stimme zitterte. Er versuchte, sich in den Griff zu bekommen, sein Gesicht war aschfahl. »Das war knapp.«
Tatsächlich hatte nicht viel gefehlt, und sie hätten den Baum nicht bloß gestreift.
Jetzt erst schauten sie sich an.
»Sind Sie verletzt, Riwal?«
Der schüttelte bloß den Kopf.
Beide stiegen sie vorsichtig aus.
»Sieht übel aus.« Riwal war neben dem Wagen stehen geblieben.
Dupin hatte sich nach hinten begeben. Er blieb stumm, seine