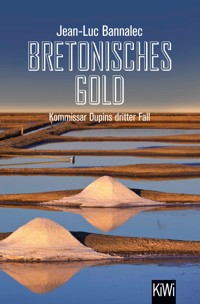14,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Dupin ermittelt
- Sprache: Deutsch
Ein mysteriöser Tod auf der tiefgrünen Insel Ouessant versetzt Kommissar Dupin in Alarmbereitschaft. Kann er das Rätsel des keltischen Ritus lösen? Am äußersten Rand der Bretagne, inmitten des gewaltigen Atlantiks, liegt die Insel Ouessant. Dort soll Kommissar Dupin im Spezialauftrag des Präfekten einen rätselhaften Todesfall aufklären. Ein keltischer Musiker wurde leblos am Ufer gefunden. In seinem Haus entdeckt die Polizei einen beunruhigenden Hinweis, der auf einen uralten, dunklen Ritus hindeutet. Doch die eingeschworene Gemeinschaft der abgelegenen Insel macht Dupin die Ermittlungen nicht leicht. Sirenen, Priesterinnen und Geschichtenerzählerinnen leben hier nach eigenen Regeln und wissen: Das Unsichtbare ist entscheidend. Dupin steht vor einer schier unlösbaren Aufgabe – er muss herausfinden, was sich hinter den Geheimnissen der Insel verbirgt. In »Bretonische Sehnsucht«, dem 13. Fall für Kommissar Dupin, entführt Bestsellerautor Jean-Luc Bannalec die Leser in die mystische Welt der Bretagne. Ein atmosphärischer Krimi, der keltische Mythen und bretonische Musik zu einem fesselnden Rätsel verwebt – perfekt für den Urlaub in Frankreich. Die Krimi-Bestseller aus der Bretagne sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Bretonische Verhältnisse - Bretonische Brandung - Bretonisches Gold - Bretonischer Stolz - Bretonische Flut - Bretonisches Leuchten - Bretonische Geheimnisse - Bretonisches Vermächtnis - Bretonische Spezialitäten - Bretonische Idylle - Bretonische Nächte - Bretonischer Ruhm - Bretonische Sehnsucht - Bretonische VersuchungenDie Bücher erzählen eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Jean-Luc Bannalec
Bretonische Sehnsucht
Kommissar Dupins dreizehnter Fall
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Jean-Luc Bannalec
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Jean-Luc Bannalec
Jean-Luc Bannalec ist der Künstlername von Jörg Bong. Er ist in Frankfurt am Main und im südlichen Finistère zu Hause. Die Krimireihe mit Kommissar Dupin wurde für das Fernsehen verfilmt und in zahlreiche Sprachen übersetzt. 2016 wurde der Autor von der Region Bretagne mit dem Titel »Mécène de Bretagne« ausgezeichnet. Seit 2018 ist er Ehrenmitglied der Académie littéraire de Bretagne. Zuletzt erhielt er den Preis der Buchmesse HomBuch für die deutsch-französischen Beziehungen.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Am äußersten Rand der Bretagne, inmitten des gewaltigen Atlantiks, liegt die tiefgrüne Insel Ouessant. Dort soll Kommissar Dupin im Spezialauftrag des Präfekten einen mysteriösen Tod aufklären.
Ein keltischer Musiker wurde am Ufer angeschwemmt. In seinem Haus entdeckt die Polizei einen Hinweis, der mit einem uralten dunklen Ritus in Verbindung gebracht wird.
Doch die eingeschworene Gemeinschaft der abgelegenen Insel erschwert Dupin das Ermitteln – Sirenen, Priesterinnen und Geschichtenerzählerinnen leben hier abseits der Norm und wissen: Auf das Unsichtbare kommt es an. Und Dupin stellt sich der beinahe unlösbaren Aufgabe, herauszufinden, was das sein könnte.
Hinweis für E-Reader-Leserinnen und Leser
Wenn Sie sich die Karte in Farbe und zoombar ansehen möchten, dann geben Sie bitte die folgende Internetadresse im Browser Ihres Computers oder Smartphones ein:
www.kiwi-verlag.de/karten-bretonische-sehnsucht
Hinweis für Leserinnen und Leser auf dem Smartphone/Tablet oder am Computer
Sie möchten sich die Karte zoombar anschauen? Dann tippen bzw. klicken Sie bitte auf die Abbildung. Es öffnet sich ein neues Fenster mit der entsprechenden Website-Ansicht.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Der erste Tag
Der zweite Tag
Der dritte Tag
Vier Tage später
Dank
À L.
»EIN VERSCHWIEGENES WORT IST BESSER ALS ZWEI GESPROCHENE.«
Bretonisches Sprichwort
Der erste Tag
Nichts hier schien von dieser Welt zu sein. Nicht die mystische Szenerie, die jäh aus dem Atlantik aufragenden Granitfelsen, das surreale Grün des Grases auf ihren Kuppen, nicht das silbrig grüne Meer, nicht der bläulich kristallin glimmende Himmel in seiner endlos scheinenden Weite. Noch weniger die wundersam sphärische Musik der fünf Frauen, die sie an diesem Sommerabend hier am Phare du Stiff erklingen ließen.
Die Île d’Ouessant schien nicht von dieser Welt.
Genau das war Kommissar Georges Dupins Eindruck gewesen, als er sie heute Nachmittag zum ersten Mal betreten hatte. Er war in seinem ganzen Leben noch an keinem vergleichbaren Ort gewesen. Mit den anderen bretonischen Inseln jedenfalls hatte Ouessant nichts gemein. So wunderbar und eigensinnig die Belle-Île, die Île de Sein, die Îles de Glénan und alle anderen auch waren, gehörten sie doch eindeutig dem Reich der Wirklichkeit an, der »gewöhnlichen Welt« – und das stand bei Ouessant erheblich infrage.
Enez Eusa lautete der königliche bretonische Titel der Insel, »am weitesten draußen gelegen«. Vor dem äußersten nordwestlichen Rand der bretonischen Welt, und nicht nur das: des gesamten europäischen Kontinents, des »großen Landes«, wie die Inselbewohner die ferne Festlandwelt ein wenig skeptisch nannten. Die »Erhabene«, denn auch das bedeutete Enez Eusa,lag zweiundzwanzig Kilometer vor den allerletzten Felsen des Finistère – sogar noch jenseits vom »Ende der Welt«. Im Norden befanden sich Cornwall und – ein Stück weiter westlich – Irland. Führe man geradewegs gen Westen, stieße man nach Tausenden Kilometern Atlantik auf Neufundland.
Ouessant war eine wilde Schönheit. Eine Urgewalt. Das galt für die Insel selbst, aber noch mehr für das Gefühl, das sie in einem auslöste. Man hatte den Eindruck, mitten in die entfesselte Natur geworfen zu sein. Mehr Atlantik ging nicht. Là où souffle un vent fort de la liberté, hieß es, »da, wo ein starker Wind der Freiheit bläst«. Es mochte pathetisch klingen, traf aber gut, was man auf Ouessant fühlte: eine große Freiheit. Knapp acht Kilometer lang war die Insel, maximal vier breit – die Küste heftig zerklüftet, ein paar wenige Kiesstrände, vier kleine Sandstrände, alles beschützt von einer Armada an Leuchttürmen. Von oben gesehen hatte Ouessant, es war verblüffend, ziemlich genau die Form einer Hummerschere, und von Hummern wimmelte es in ihren Gewässern. Dupin war beruhigt gewesen: Verhungern würde er nicht.
Hier, am äußersten nordöstlichen Zipfel – wo der berühmte Stiff-Leuchtturm stand –, präsentierte die Insel eine atemberaubende Steilküste, brachial, erhaben, bedeckt von Mooren, Heidekraut, Ginster und struppigem Gras. In Richtung Westen überraschte sie mit einer sanften Senke, dem grünen Tal von Arlan, in dem die wenigen Bäume der Insel standen. Diese hatten ihre liebe Not auf Ouessant. Die Gischt, die beim jähen Brechen der anrollenden Wellen in die windigen Sphären verwirbelt wurde, brachte Salz und Jod über die ganze Insel. Der Regen war kein großes Thema, tatsächlich regnete es weniger als auf dem Festland. Dafür blies der Kornog, und zwar fast immer. Ein rauer Westwind, so charakteristisch, dass er von den Ouessantins einen eigenen Namen bekommen hatte.
Über zwei Dutzend Angriffen heftiger Stürme war Ouessant durchschnittlich in einem Jahr ausgesetzt, die meisten attackierten die Insel im Februar. Windstärke neun war dann keine Seltenheit. Die Spitzen, coups de tabac genannt, »Tabakschläge«, betrugen regelmäßig bis zu 180 km/h, bei den legendären Stürmen 1930, 1960 und 2023 hatte man Schläge über 200 km/h verzeichnet. Noch viel bedenklicher, fand Dupin, war allerdings eine andere Zahl, sie allein machte drastisch klar, wo man sich befand: 28,6 Meter. Diese Zahl gab die Höhe eines Brechers an, einer »Monsterwelle« – so die wissenschaftliche Bezeichnung –, die die Insel im letzten November während eines Sturms im Westen erwischt hatte. Doppelt so hoch wie Dupins Haus.
Noch eine Besonderheit der Insel: Es fühlte sich an, als wäre man in eine eigentümliche Zeitlosigkeit gereist. Die Natur, die schroffen Klippen, das ungestüme Meer, die Heidelandschaften, wo auch Farne und Ginster wuchsen, hätten vor Jahrtausenden, in neolithischer Zeit, genauso ausgesehen wie in der Gegenwart. Überhaupt war man in eine andere Welt katapultiert, mit einer intensiven, archaischen Aura voller alter Magie. Wie ein wüster Traum, in den man stürzte.
»Eine wildere, rauere, verwegenere Bretagne gibt es nicht! Ein karger Granitbrocken mitten im wüstesten Atlantik«, hatte Riwal Dupin vor dessen Aufbruch eingestimmt. »Da ist nichts mit Mittelmeer, Karibik, Südsee oder so! Da liegen Sie völlig falsch, Chef.«
Es war eine seltsame Konversation gewesen, denn Dupin hatte kein Mittelmeer, keine Karibik und auch keine Südsee erwartet. »Auf Ouessant ist überhaupt nichts lieblich! Rein gar nichts!«, war sein erster Inspektor leidenschaftlich fortgefahren. »Das Ende der Welt kann nicht überall einladend sein! Selbst wenn die Delfine Sie dort ausgelassen umschwärmen, Kormorane erhaben auf den Felsen sitzen und die rotschnäbeligen Austernfischer atemberaubende Manöver fliegen. Dafür gibt es mehr Mysterium als überall sonst. Mystik en masse!« Riwal hatte sich gar zu einer diffusen Warnung veranlasst gesehen: »Sehen Sie sich vor, Chef! Merken Sie sich meine Worte.«
Dupin hatte wohlweislich nicht nachgefragt. Man hätte meinen können, er würde zu einer Indiana-Jones-Mission aufbrechen. Wobei Dupin zugeben musste, dass er jetzt, nach ein paar Stunden auf der Insel, zumindest ein wenig verstand, was Riwal mit »Mystik en masse« gemeint haben könnte.
»Auf jeden Fall passt der Name der Gruppe, finden Sie nicht? Sie heißt Sous le charme des Sirènes. Im Bann der Sirenen. Wir hier auf der Insel nennen sie einfach nur die Sirenen. Es ist Musik aus einer anderen Welt.«
Alana Rigo, die Bürgermeisterin, lächelte Dupin zu.
Der Kommissar nickte freundlich.
Sie hatte recht. Die geheimnisvollen, sanften Klänge, die die Musikerinnen ihren Stimmen und Instrumenten entlockten, schienen anderen Sphären zu entstammen. Dupin musste zugeben, dass er selbst nach zwölf Jahren intensiver Bretonisierung mit keltischer Musik nicht so richtig warm geworden war. Aber auf diese geheimnisvolle Insel hier passte sie. Sehr gut sogar. Oder anders: Es wirkte so, als käme sie von hier. Als wäre sie genau hier erdacht worden.
»Das ist eine Sensation! Allein schon, dass die fünf wieder zusammen spielen«, fuhr die Bürgermeisterin fort. »Es wird in allen Zeitungen stehen! – Zu schade, dass dafür erst eine solche Tragödie nötig war.«
Bedrückt schüttelte sie den Kopf.
»Wann haben sie das letzte Mal zusammen gespielt?«
So sanft die Klänge waren, Dupin musste die Stimme dennoch deutlich heben.
Die Bürgermeisterin dachte kurz nach.
»Das war vor acht Jahren. – Dann verließ Rayanne die Insel.«
Eine längere Pause. Der letzte Satz hatte ein wenig so geklungen wie: Dann ist es zum Sündenfall gekommen.
»Sie ging nach Dublin und wurde berühmt. Richtig berühmt. – Seitdem sind die Sirenen nicht mehr zusammen aufgetreten.«
Sie machte eine melancholische Pause.
»Rayanne war nur selten hier in den letzten Jahren. – Aber«, sie lächelte, »das hat sich ja nun geändert.« Alana Rigo holte tief Luft: »Rayanne ist zurück!«
Als Dupin heute Nachmittag auf der Insel angekommen war, hatte Madame le Maire ihn offiziell empfangen. Alana Rigo war nicht nur die Bürgermeisterin der achthundertfünfzig Insulaner, sondern, qua ihres Amtes, ebenso officier de police der Insel. Sie war eine gut aussehende Frau um die fünfzig, lange schwarze Haare, schlank, schwarze Jeans, schwarze Regenjacke, obwohl von Regen weit und breit keine Spur war, nicht einmal von Wolken. Manchmal wirkte sie formell, dann wieder ganz emotional. Zusammen mit zwei weiteren Bewohnern der Insel bildete sie die garde champêtre, die offizielle Landwache. Die ständige Präsenz einer Gendarmerie lohnte sich nicht für Ouessant, dafür passierte zu wenig. Um das, was doch passierte, kümmerte sich die Landwache. Echte Polizei gab es nur während der Hauptsaison, zwischen Mitte Juni und Ende August, dann waren sie zu sechst hier. Passierte in den anderen Monaten etwas Schwerwiegendes, kam jemand vom Festland herüber. Schwerwiegend war der gegenwärtige Vorfall ohne Zweifel.
Gestern früh war eine Männerjacke angeschwemmt worden, heute früh dann der ganze Mann – nahe der Hafenmole im Osten der Insel, wo die Fähre ankam. Es war die Leiche des Insulaners Lionel Saux, das war schon beim Fund der Jacke klar gewesen – niemand sonst hier trug eine uralte Levis-Jeansjacke mit dem Cover der ersten Fleetwood-Mac-Single als Rückenaufdruck. Die Küstenwache hatte nach dem Fund der Jacke umgehend eine Suchaktion gestartet, ein Hafenarbeiter hatte den Toten dann heute Morgen zufällig entdeckt. Einundvierzig Jahre war Lionel Saux im Sommer geworden. Noch war alles denkbar: ein Unfall, vielleicht mit gesundheitlichen Problemen verbunden, Selbstmord oder – ein Verbrechen.
Die Bürgermeisterin hatte Dupin gebrieft. »Er war Musiker, das war schon als Jugendlicher sein Wunsch gewesen.« Die Musik, das hatte Dupin in den wenigen Stunden auf der Insel gelernt, spielte eine große Rolle auf Ouessant. Lionel Saux hatte anscheinend so gut wie jedes Instrument beherrscht, ein Allrounder, am liebsten aber hatte er Songs geschrieben. Zudem hatte er sich als Produzent versucht, vor zwölf Jahren war ein komplettes Album mit einer Künstlerin aus Le Conquet entstanden, das allerdings erfolglos blieb. Wie auch seine anderen musikalischen Projekte. Es hatte also nicht geklappt mit einer professionellen Musikerkarriere. Genauso wenig mit seiner zweiten Berufsidee: einem Irish Pub auf der Insel. »Sie müssen wissen, dass es rege Verbindungen zwischen Ouessant und der Grünen Insel gibt«, war Dupin belehrt worden. »Die Ouessantins fühlen sich dort sehr wohl.« Was keineswegs verwunderte, Irland war wie die Bretagne eine passionierte keltische Nation. Einen Irish Pub hatte es auf Ouessant noch nicht gegeben, als Lionel Saux die Idee gehabt hatte, aber das beliebte und alteingesessene Ty Korn hatte einen irischen Besitzer, zudem spielte das kleeblattgrüne Schild über der Eingangstür mit dem Nimbus der populären irischen Kneipenkultur. Die Touristen bevorzugten sowieso authentisch bretonische Kneipen, von denen es auf der Insel ein paar ganz wunderbare gab. Letztes Jahr, nach drei deprimierenden Jahren, hatte Saux seinen Pub aufgeben müssen. »Ein Unglücksrabe«, hatte die Bürgermeisterin unsentimental kommentiert. »Das mit dem Ende des Pubs hat ihm irgendwie den Rest gegeben, war mein Gefühl, auch wenn ich ihn nicht gut kannte. – Auf jeden Fall hat er manchmal zu viel getrunken. Schon vor der Sache mit dem Pub. Dann konnte er auch mal cholerisch werden, ab und zu gab es eine Prügelei, obwohl er eigentlich harmlos war. Ein guter Kerl im Grunde. Mit großen Träumen. Saux’ Eltern waren vor ein paar Jahren, mit Anfang siebzig, aufs Festland gezogen, in einen Vorort von Brest. – Und was ist passiert? Da sind sie nach zwei Jahren gestorben. Fern der Heimat, kein Wunder. Ich hatte es ihnen prophezeit.«
Sentimental war Madame Rigo wirklich nicht.
Saux’ Leiche war bereits am Mittag in der Gerichtsmedizin von Brest angekommen, man hatte sofort mit der Untersuchung begonnen. Knie und Schulter wiesen ernste Verletzungen auf, als wäre er an einen Felsen geschlagen, zum Beispiel bei einem Sturz ins Meer, hatte die Gerichtsmedizinerin befunden – eine neue Kollegin, mit der Dupin bisher noch nicht zu tun gehabt hatte. Aber natürlich waren all das Spekulationen. Die Todesursache jedenfalls war eindeutig: Ertrinken. Der Kopf war unversehrt, wahrscheinlich hatte Saux noch gelebt, als er ins Wasser gestürzt war. Vielleicht, die Gerichtsmedizinerin hatte mögliche Szenarien durchgespielt, hatte er durch den Sturz das Bewusstsein verloren. Bisher wurden keine Hinweise auf Fremdeinwirkung gefunden. Wobei es, je nachdem, wie sich so etwas zutrug, gar nicht viel brauchte, um jemanden die Klippen hinunterzustoßen. Ein Schubs genügte und schon verlor der andere das Gleichgewicht. Ein Spaziergang auf einem der spektakulären einsamen Küstenwege und … Es kam einem perfekten Mord erschreckend nah. Niemand würde es je beweisen können. Eine verheerend einfache Methode, jemanden loszuwerden.
Wenn man die Strömungen berücksichtigte, musste Lionel Saux auch im Osten ins Meer gestürzt sein, auf Penn Arlan höchstwahrscheinlich, einem besonders rauen und zerklüfteten Vorsprung, der wirkte, als würde er beim nächsten heftigen Sturm von der Insel abgerissen werden, so fragil war der schmale Landstreifen, der ihn noch mit Ouessant verband. Eine karge Ödnis, auf der sich außer einem siebentausend Jahre alten Steinkreis rein gar nichts befand.
»Sind Ihnen noch weitere Personen eingefallen, zu denen Lionel Saux engeren Kontakt hatte, Madame Rigo?«
Die Bürgermeisterin hatte Dupin am Nachmittag eine erste Liste mit sechs Personen erstellt. Alles Inselbewohner. In Lionels Hosentasche hatte ein Handy gesteckt, es war unversehrt, allerdings gesperrt. Zum Telefonieren hatte er es offenbar nur selten benutzt, die Verbindungsnachweise lagen bereits vor. In der Woche vor seinem Tod hatte er zweimal mit einem Musikgeschäft in Brest telefoniert, da war es um spezielle Saiten für eine Gitarre gegangen, einmal mit Romy Potin, einer der fünf Musikerinnen, und einmal mit einem Bäcker wegen einer Bestellung.
»Nein. Nur die sechs. Mehr waren es nicht. Wie gesagt, Lionel war eher ein Eigenbrötler.«
Sie musterte Dupin immer noch neugierig. Natürlich, er war ein Fremdkörper auf der Insel. Er fühlte sich auch so.
Der Präfekt, Dupins oberster Dienstchef – und persönliches Grauen –, war heute früh, was er sonst nie tat, unangekündigt im Kommissariat aufgetaucht. Mit einem »Spezialauftrag«. Er sei bei Saux’ Tod »in alarmierendem Maße persönlich involviert«. Jade Quiniou, die einzige der Musikerinnen, die nicht auf der Liste mit den Kontakten stand – Bodhrán-Spielerin, Kulturbeauftragte und conteuse –, war Locmariaquers Nichte. Was man der Frau gar nicht anmerkte, fand Dupin – sie wirkte ausgesprochen freundlich, ja sympathisch. Dupin empfand aufrichtiges Mitleid mit ihr. Für seine Verwandtschaft konnte man nichts, und das war ein hartes Los. Er hatte heute Nachmittag ein paar Worte mit ihr gewechselt, morgen würde er ausführlich mit ihr sprechen. Was Dupin bereits herausgehört hatte, war, dass sie offenbar keine enge Beziehung zu ihrem Onkel hatte, auch das sprach für sie. Eigentlich wäre der Kommissar aus Brest für den »höchst sensiblen Fall« zuständig gewesen, der Liebling des Präfekten, ein eitler Pfau, mit dem Dupin auf Kriegsfuß stand. Der aber war für drei Wochen verreist. »Ganz und gar wohlverdiente Ferien«, so der Präfekt. Die Schwester des Präfekten hatte Locmariaquer mächtig unter Druck gesetzt, schließlich befände sich ihre Tochter »in Lebensgefahr«. Eine beim jetzigen Stand der Ermittlungen überzogene Befürchtung, fand Dupin. »Finden Sie heraus, was hinter dem Tod dieses Mannes steckt, und passen Sie gut auf meine Nichte auf«, so die Instruktion des Präfekten.
Der Zeitpunkt für den »Spezialauftrag« hätte nicht unglücklicher ausfallen können: Nolwenn – offiziell Dupins Assistentin, eigentlich aber das Zentralgestirn des Commissariat de Police Concarneau – befand sich auf einem Segeltrip. Nicht auf irgendeinem Segeltrip, nein, auf einem ganz großen. Einer ihrer Kindheitsträume ging in Erfüllung. Sie segelte die legendäre Transat-Regatta nach, eine der berühmtesten Segelregatten der Welt, die jedes Jahr in Concarneau startete. Ihr Mann hatte ihr den Trip zu ihrer Silberhochzeit geschenkt. Sie waren beide passionierte Segler. Vor zwei Wochen waren sie gemeinsam mit zwei Freunden aufgebrochen. Sie waren von Concarneau bis Porto Santo auf Madeira gefahren, das sie bereits hinter sich gelassen hatten. Die zweite, ungleich schwierigere Etappe führte nun über den gesamten Atlantik bis nach Saint-Barthélemy, das zu den Kleinen Antillen gehörte. Dupin hielt die Unternehmung für einigermaßen wahnsinnig. Aber natürlich hatte er kein Wort gesagt. Er hoffte inständig, dass zuträfe, was bei Nolwenn eigentlich immer zutraf: dass sie wusste, was sie tat.
Der Dudelsack, der eine Weile geschwiegen hatte, hob nun laut an. Dupin hätte es nicht für möglich gehalten, dass einem Dudelsack derartige Töne entströmen konnten. Die hochgewachsene, dünne Musikerin – so dünn, dass man sich fragte, woher sie das nötige Volumen an Luft nahm – mit den leuchtend rostroten Haaren klang, als würde sie versuchen, mit dem Instrument den Wind nachzuahmen.
Die fünf Sirenen, direkt hier unter dem Leuchtturm von Stiff, spielten die mythischen Grundinstrumente der keltischen Musik: Violine – Laute – Bodhrán, eine keltische Rahmentrommel – Dudelsack – Harfe. Hin und wieder kam eine Flöte hinzu, dann verstummte der Dudelsack, die rothaarige Musikerin spielte beide Instrumente. Bands dieser Kombination gab es zahllose, in jedem bretonischen Dorf; was die fünf Frauen über die virtuose Beherrschung der Instrumente hinaus so besonders machte, waren ihre atemberaubenden Stimmen. Heute Abend schlugen sie hier ein paar Hundert Menschen – vermutlich die Hälfte der Bevölkerung – sprichwörtlich in ihren Bann, die zu dem von ihnen und der Bürgermeisterin spontan organisierten »Konzert für Lionel« gekommen waren. Man hatte einen künstlichen Grasteppich auf ein halbes Dutzend alter Holzpaletten zu Füßen des Phare du Stiff gelegt – fertig war die Bühne.
Der alte Leuchtturm war ein Mythos, weit über die Insel hinaus. Eine einzigartige Konstruktion: Zwei runde Türme, äußerst solide, dabei nicht minder elegant, waren ineinandergebaut, wie um sich gegenseitig im Kampf gegen die tosenden Elemente zu stützen. Ein einzelner Turm alleine, schien es, reichte hier oben, auf dem exponiertesten Punkt der Insel, nicht aus. Ein Doppelleuchtturm. Dupin hatte so etwas noch nie gesehen, ein wahres Kunstwerk.
Der Phare du Stiff, Dupin hatte es nicht glauben wollen, war von Vauban, dem legendären Architekten des Sonnenkönigs Louis XIV., entworfen worden – von dem Mann also, der die Festung von Concarneau erbaut hatte. Und ebenso die von Saint-Malo, Camaret und La Rochelle. Natürlich war Vauban auch in Paris zugange gewesen. Und anscheinend sogar hier, auf diesem winzigen Flecken Erde mitten im tobenden Atlantik.
Selbstverständlich bestand Le Stiff aus mehr als nur dem Doppelleuchtturm, Vauban hatte wie immer ein ganzes Ensemble ersonnen. Rechts und links des Turms – alles streng symmetrisch – zwei hübsche einstöckige Gebäude in demselben Stil, strahlend weiß wie der Leuchtturm. Die gesamte Anlage war von einer meterhohen alten Steinmauer umgeben und ergab ein präzises Rechteck. Der einzige, mit einem Tor versehene Zugang lag an dem schmalen Sträßchen. Hier standen die Fahrräder der Konzertbesucher, das Hauptverkehrsmittel der Insel. Touristen durften ihre Autos nicht mit auf die Insel bringen, nur ein paar Ouessantins besaßen welche. Die Landschaft der Pointe de Bac’haol – des Vorsprungs, auf dem der altehrwürdige Stiff stand – war karg und windumtost.
Das tadellose Weiß des Leuchtturms und der beiden Gebäude hatte sich mit den Jahren leicht orange verfärbt. Orange würde, so sah es aus, auch die Farbe des heutigen Sonnenuntergangs. Jeden Tag wählten Himmel und Sonne neue Farbtöne, neue Stimmungen, mal mit Wolken in unendlichen Formen, mal ganz ohne, wie heute. Jedes Mal war es ein aufwendiges Spektakel, inszeniert für eine einzige Vorstellung, unwiederholbar.
Der Kommissar hatte sein kleines rotes Notizheft herausgeholt und machte sich eine Notiz.
»Jetzt kommt das Harfensolo! Achtung! – Rayanne spielt!«
In der Stimme der Bürgermeisterin lag Ehrfurcht, sie schwieg sodann und schwelgte.
Rayanne Ker war ein Superstar, wusste Dupin, nicht bloß in der keltischen Musik, sondern auch im Jazz. Sie sah wirklich aus wie eine Sirene, zumindest so, wie man sich Sirenen vorstellte. Gewellte lange, unglaublich dichte Haare. Hell, aber nicht blond, ein Sonnengelb, Safrangelb beinahe. Die Haare schwangen im Rhythmus der Musik. Ihre Augen leuchteten blaugrün, so intensiv, als gäbe es in ihr selbst eine Quelle des Lichts, die nach außen strahlte.
Dupin war genau aus diesem Grund heute hierhergekommen, um die Sirenen ein wenig näher in Augenschein zu nehmen. Natürlich auch, um sich etwas umzusehen, die Insel besser zu verstehen. Wie es hier zuging, was für ein Menschenschlag hier lebte. Insbesondere aber ging es ihm tatsächlich um die Musikerinnen, von denen sich gleich vier auf der Liste der Bürgermeisterin befanden. Vier der sechs Personen, zu denen Lionel Saux in halbwegs regelmäßigem Kontakt gestanden hatte, waren Sirenen. Darunter Rayanne Ker. Und die rothaarige Flötistin und Dudelsackspielerin, Céleste Bourvil, Automechanikerin und Inhaberin der einzigen Autowerkstatt der Insel. Darüber hinaus war sie Taxiunternehmerin, Taxi Lavender hieß das kleine Unternehmen. Die alten Citroën-Minibusse, die sie und eine Teilzeitangestellte fuhren, waren wirklich lavendelfarben. Auch die Violinistin stand auf der Liste der Bürgermeisterin, Romy Potin, die einzige kurzhaarige Sirene, Besitzerin der Bar in Lampaul, dem Hauptort der Insel. Sie war es gewesen, die Lionel Saux vor vier Tagen abends von seinem Handy aus angerufen hatte. Ein Telefonat von drei Minuten. Die Vierte war Enora Gaëc, Landwirtin, sie baute Kartoffeln und Gemüse an, besaß Ziegen und Schafe und stellte Käse her, in der Band spielte sie die Laute. Für Dupin sah das Instrument aus wie eine eigenartige Gitarre, was er natürlich nicht laut sagen würde. Nur zur fünften der Sirenen, Jade Quiniou, der Nichte des Präfekten, hatte Lionel Saux keinen engeren Kontakt mehr gehabt. »Früher schon, aber das ist viele Jahre her«, hatte die Bürgermeisterin gesagt – warum zuletzt nicht mehr, hatte sie nicht gewusst. Jade Quiniou arbeitete als Kulturbeauftragte in der Mairie, als Fremdenführerin und professionelle conteuse, Erzählerin. Sie bot Touren zu den Orten der Sagen und Legenden der Insel an. Bei den Sirenen spielte sie die Bodhrán, die – überaus spezielle – keltische Rahmentrommel.
Alle fünf waren sie auf Ouessant geboren und hier aufgewachsen, genau wie Lionel Saux, allerdings war dieser fast zehn Jahre älter. Er hatte die fünf Frauen nach der Gründung der Band produzieren wollen, hatte die Bürgermeisterin erzählt und dabei die Augen verdreht. »›Ich bring euch ganz groß raus!‹, hat er ihnen gesagt. – Am Anfang sind die fünf nur in der Bar am Friedhof aufgetreten. Die, die jetzt Romy gehört.«
Stürmischer Applaus setzte ein.
Rayanne Ker hatte ihr Solo beendet, die anderen Instrumente setzen wieder ein. Der Beifall hatte sicherlich zwei, drei Minuten angehalten. In seiner warmen Innigkeit war es mehr gewesen als ein gewöhnlicher Applaus. Die Ouessantins schienen Rayanne Ker, den gefeierten internationalen Star – fast überall in Europa und sogar in Kanada war sie mittlerweile bekannt –, immer noch als eine von ihnen zu betrachten. Was für Rayanne Ker und ihre Verbindung zur Insel sprach. Sie hatte im Sommer öffentlich angekündigt, wieder auf Ouessant leben und arbeiten zu wollen. Sich hier ein Studio einzurichten. Alle bretonischen und nationalen Medien sowie natürlich auch die irischen hatten davon berichtet. Es wäre nicht das erste Tonstudio auf der Insel, das berühmteste hatte sich Yann Tiersen eingerichtet – der durch den Soundtrack zu Die fabelhafte Welt der Amélie bekannt geworden war: Es befand sich in einer ehemaligen Diskothek, der einzigen, die es je auf der Insel gegeben hatte. Hier hatte er unter anderem sein Album All realisiert, inspiriert von der Insel, auf der er aufgewachsen war.
Dupin mochte beides: den Mann und seine Musik. Genauso wie den Chansonnier Christophe Miossec, Tiersens engen Freund, auch er ein Wahl-Ouessantin. Dupin besaß all seine Alben. Aber nicht nur die beiden, auch viele andere Musiker waren Ouessant verfallen und kamen regelmäßig auf die Insel, um die gewöhnliche Welt für eine Weile hinter sich zu lassen. Es war ein Ort höchster Kreativität. Auf Ouessant meditierten, experimentierten, komponierten sie, schrieben, spielten in den Kneipen der Insel, probierten neue Songs aus. Es war ein Phänomen – die innige Verbindung Ouessants mit der Musik. Gleich drei bekannte Musikfestivals gab es auf der Insel, hatte die Bürgermeisterin stolz erzählt. Eines begann morgen, es klang kurios, fand Dupin. Fanfares! war sein schlichter Name. Und genau darum ging es. Dupin wusste, dass sich Fanfaren in der Bretagne großer Beliebtheit erfreuten, und auch die Bürgermeisterin, Dupin hätte es nicht vermutet, hatte sich als begeisterte Anhängerin geoutet. »Wissen Sie eigentlich, wer da morgen alles kommt? Tintamarre & Postillons, Bakchich, WestCostars, Poil O’Brass, Fanfare Gertrude, À Bout de Souffle und sogar Fanfarnaüm!« Dupin hatte von keiner der Bands je gehört. Ein Festival ausschließlich für Fanfarengruppen: Trompeten, Posaunen, Hörner, Tuben, Saxofone, Fagotte – als einzige Nicht-Blasinstrumente spielten kleine und große Pauken mit, die dann allerdings sehr vernehmlich. Es waren ansehnliche Gruppen, fünfzehn, zwanzig Instrumente kamen in einer Band zusammen. Jedes Jahr wurde ein Dutzend Gruppen aus der Bretagne und den anderen fünf keltischen Nationen zum Aufspielen auf die Insel geladen, für einen Tag und eine Nacht. »Sie spielen vierundzwanzig Stunden komplett durch! Jede Gruppe sucht sich ihren Ort auf der Insel oder wandert umher. – Eine ziemlich wilde Sache«, hatte Alana Rigo erzählt. Nicht ganz so wild schien es beim Festival de la musique classique zuzugehen, das vor ein paar Wochen, im August, stattgefunden hatte. Das mit Abstand größte Festival jedoch, unter anderem von Miossec und Tiersen gegründet, war das Festival Îlophone mit seinem selbstbewussten Slogan Le festival le plus à l’Ouest. Die Bürgermeisterin warb nicht minder begeistert: »Dieses Jahr fand es schon zum vierzehnten Mal statt! Seit ein paar Jahren gibt es eine Austernbar am jeweiligen Veranstaltungsort, allein für die Eröffnung haben wir sechshundert Dutzend Austern bestellt. Natürlich von einer unserer Schwesterinseln, der Île de Sein! Und zu jedem Zwölfergedeck gehört selbstredend eine Flasche Muscadet.« Auch in der neueren Rock-Pop-Rap-Musik wirkte Alana Rigo beeindruckend firm: »Es gab dieses Jahr Afro-Funk von Vaudou Game, Electro-Blues der Duos No Money Kids und Bootleggers United und danach haben die DJs Zebra und Prosper aufgelegt. Ein wunderbar verrücktes Festival mit wunderbar verrückten Bands. Kosmopolitische, ganz gegenwärtige Musik! – Und den Strom für das Festival steuert ein Gezeitenkraftwerk bei, Teller und Gläser sind aus bretonischem Bio-Algenplastik, damit das Ganze ohne größere Umweltbelastung vonstattengehen kann. Wir leben mit der Natur!«
Die Bürgermeisterin warf einen raschen Blick auf ihre Uhr.
»Wie angekündigt, Monsieur le Commissaire, ich muss jetzt leider gleich weg. Die Hochzeitsfeier meiner Schwester – aber Sybil Jaouen müsste jeden Augenblick eintreffen.«
»Wie gesagt, das ist nicht nötig, Madame le Maire. Ich komme klar.«
»Ich weiß, ich weiß. Aber niemand hat so viel Wissen über die Insel wie Madame Jaouen.«
Madame Jaouen war die Leiterin des kleinen Museums hier am Phare du Stiff, hatte Dupin erfahren, eines der beiden Gebäude neben dem Leuchtturm. Wie Jade Quiniou, die Bodhrán-Spielerin der Sirenen, war sie zudem eine conteuse, eine Erzählerin, in der Bretagne ein höchst anerkannter Beruf. Frauen und Männer, die die unzähligen Sagen, Legenden und Märchen in- und auswendig kannten – keine Gegend der Welt wies eine solche Fülle an Erzählungen auf wie die Bretagne – und sie bei Führungen in kleinen Gruppen zum Besten gaben. Auf Ouessant schien es noch mehr Geschichten zu geben als anderswo in der Bretagne, denn auf der Insel lebten gleich drei conteuses. Auch die einzige Fischerin der Insel, Ondine Morin, die heldenhaft für nachhaltige Fischerei kämpfte – eine bretonische Heldin, auch Nolwenn und Riwal waren große Fans –, war eine von ihnen.
»Also, bis bald! Madame Jaouen fährt Sie dann auch zu Ihrem Hotel.«
Die Bürgermeisterin wandte sich zum Gehen.
Dupin hatte zu seinem Leidwesen keine Wahl. Er musste über Nacht bleiben. Eigentlich hatte er noch nach Concarneau zurückkehren wollen. Aber zum einen war das Hin- und Herfliegen mit dem Polizeihubschrauber aufwendig, teuer und ökologisch unverantwortlich und zum anderen hatte er für morgen früh um sieben bereits eine erste Verabredung getroffen. Mit dem Inselpfarrer.
Dupin hatte sich strikt geweigert, mit dem Boot überzusetzen. Die Insel lag in den unruhigsten und gefährlichsten Gewässern des Nordatlantiks. Die Gegend war bei Seefahrern auf der ganzen Welt berüchtigt für die zahllosen Schiffbrüche, die sich seit Menschengedenken hier ereignet hatten. Um Ouessant herum war das Meer ein wahres Massengrab. Also war Dupin mit dem Hubschrauber aus Brest gekommen. Der »Helikopterlandeplatz«, von dem der Pilot gesprochen hatte, hatte sich als ein verwittertes, heftig zerfurchtes Betonquadrat von bedenklich kleinen fünf mal fünf Metern erwiesen, das direkt neben der Mairie, dem Bürgermeisteramt, lag. Es war mit einem abgebröckelten gelben Kreis versehen, darin ein großes H. Was bei Nebel herzlich wenig helfen würde, hatte Dupin bei sich gedacht; von Beleuchtung oder Sicherheitstechnik war nichts zu sehen gewesen. Dafür ein einladend wirkendes Café und Restaurant gleich gegenüber, das La Duchesse Anne. Hinter dem Hubschrauberlandeplatz befand sich nur ein kleines Stück Wiese, dann ging es auch dort steil hinunter zum Meer, in die Bucht von Lampaul.
»Und unterschätzen Sie die Insel niemals, Monsieur le Commissaire! Das endet immer fatal. Sie wissen ja: À Ouessant rien n’est jamais comme ailleurs.«
»Auf Ouessant ist nichts jemals wie anderswo« war eines der Mantras der Insel, Dupin hatte es in den Stunden seit seiner Ankunft schon ein paarmal gehört.
»Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, Madame Rigo.«
Die Bürgermeisterin drehte sich noch einmal um: »Meine Handynummer haben Sie ja – für alle Fälle!«
Jetzt spielte die Violine ein Solo. Sie klang wie ein sanfter, samtiger Wind.
Dupins Blick schweifte über das Meer. Er hielt Ausschau. Studierte die Meeresoberfläche, suchte den Horizont ab. Ihm war zunächst selbst nicht bewusst gewesen, was genau er da suchte. Es fiel ihm nicht leicht, es sich einzugestehen. – Es waren die 26,8 Meter. Die Geschichte von der Monsterwelle, die die Insel getroffen hatte, hatte ihn beeindruckt. Nicht vor hundert Jahren war es passiert, nicht vor Jahrzehnten, nein, erst vor Kurzem. Zwar wütete im Moment kein Sturm, aber zum einen konnte es ein bisschen weiter draußen schon ganz anders aussehen, und zum anderen wusste Dupin nur zu gut, wovor in der Bretagne ständig gewarnt wurde: davor nämlich, dass Wellen wanderten und Hunderte Kilometer zurücklegten, ohne an Energie und Wucht zu verlieren. Manchmal bauten sie sich dabei sogar noch weiter auf. So kam es zu dem bedrohlichen Phänomen der Wellen »aus dem Nichts«. Schon oft hatte er Bretonen davon erzählen hören. Wie eine Wand erschienen sie unvermittelt vor einem. Folglich würde es nicht schaden, die Augen offen zu halten. Immerhin, hier im Osten an der stolzen Steilküste, zweiundsechzig Meter hoch – Madame Rigo hatte die Zahl gleich mehrmals erwähnt –, war er erst einmal sicher. Höchstwahrscheinlich zumindest.
Der Kommissar schüttelte den Kopf. Er sollte sich auf die Arbeit konzentrieren, statt nach Monsterwellen Ausschau zu halten.
Vor allem eine Sache mutete im Zusammenhang mit dem Tod von Lionel Saux mysteriös an: Nach dem Fund der Jacke hatte die Landwache auf dem Kopfkissen seines Bettes ein eigenartiges Kreuz gefunden. Kreuze dieser Art hatten auf der Insel über Jahrhunderte eine rituelle Bewandtnis besessen. Seit dem Mittelalter hatte man einen außergewöhnlichen Ritus praktiziert. Durchgeführt wurde er ganz offiziell von den jeweiligen Pfarrern der Insel, bis 1962. Dupin hatte noch nie davon gehört gehabt, die Bürgermeisterin hatte ausführlich berichtet. Nur an einem einzigen anderen Ort der Welt war der Ritus ebenfalls praktiziert worden, auf einer winzigen Insel im Ägäischen Meer. Proella hieß die aufwendige Zeremonie. Sie war den Verlorenen gewidmet, die auf dem Meer und in der Ferne ihr Leben gelassen hatten. Wenn man der Leiche des Menschen nicht habhaft werden konnte, brachte der Pfarrer ein aus weißem Wachs gefertigtes und gesegnetes Kreuz ins Haus des Vermissten. Dort blieb es dann für eine Nacht, gebettet auf einer Trachtenhaube, die auf dem Kopfkissen lag. Jedes Detail durfte nur auf eine genau vorgeschriebene Weise ausgeführt werden. Die Angehörigen wachten mit dem Pfarrer die ganze Nacht am Bett. Mit dem ersten Tageslicht trug der Pfarrer das Kreuz dann in einer Prozession zur Kirche von Lampaul. Dort wurden die Kreuze in einen am Altar hängenden Schrein gelegt. Anschließend hielt der Pfarrer einen Gedenkgottesdienst. War der Schrein voll – was sehr schnell geschah, wenn zum Beispiel große Schiffsunglücke passiert waren –, wurden die angesammelten Kreuze in einer weiteren Prozession auf den Friedhof hinter der Kirche gebracht. Alle Anwesenden trugen die pechschwarzen Trachten, die auf der Insel seit Menschengedenken getragen wurden. Dupin war ein leiser Schauer über den Rücken gelaufen, als die Bürgermeisterin davon erzählt hatte. Hunderte schwarz gekleidete Gestalten, die den gesegneten weißen Kreuzen folgten, das Ganze vielleicht noch inmitten eines düsteren Sturms. Ihre letzte Ruhestätte fanden die Kreuze dann in einem nur zu diesem Zweck errichteten Mausoleum, das aussah wie eine Miniaturkirche. Hier lagen sie nun, für alle Ewigkeit. Auf Ouessant, in ihrer Heimat, bei ihren Verwandten, Freunden, den anderen Ouessantins. Das Ritual hatte mit einem strengen Gebot zu tun: Wer auf der Insel geboren wurde, musste auch auf der Insel begraben werden. Ansonsten drohte die Hölle. Alleine das Ritual konnte die Vermissten erretten. Der theologische Clou des Ritus war dieser: Mit seinem Vollzug wurden die Kreuze zu den Vermissten selbst. Man holte ihre Seelen zurück, zauberte sie in die Kreuze hinein.
Über all das wollte Dupin morgen früh mit dem Pfarrer der Insel sprechen. Das Kreuz nämlich, das auf Lionel Saux’ Kopfkissen gebettet worden war, war aus weißem Wachs, handgefertigt und offenbar, so die Bürgermeisterin, auch so groß wie die Kreuze damals. Es war, wie der Tote, in die Forensik nach Brest gebracht worden; Fingerabdrücke oder andere Spuren waren darauf bisher nicht zu entdecken gewesen. Die Bürgermeisterin hatte Dupin eines der ganz wenigen Fotos gezeigt, die von den alten Kreuzen existierten. Die Kreuze selbst waren in dem Mausoleum eingeschlossen.
Die Bürgermeisterin hatte nach der Durchsuchung des Hauses umgehend eine Befragungsaktion auf der Insel gestartet, um herauszufinden, ob jemand wusste, wer das Kreuz auf Lionel Saux’ Kopfkissen gelegt hatte. Sie hatte an einen symbolischen Akt der Pietät gedacht. Dupin fand die Idee seltsam, aber was wusste er schon über diese Insel? Die Befragung war ohne Ergebnis geblieben. Auch keiner der sechs, die mit Lionel Saux in näherem Kontakt gestanden hatten, wusste, was es mit dem Kreuz auf sich hatte. Aber möglicherweise wollte sich auch einfach niemand dazu bekennen.
Davon abgesehen war die vordringlichste aller ermittlerischen Fragen natürlich: Handelte es sich um einen Unfall, um Selbstmord oder gar um Mord? Unter Umständen ließ sich das Kreuz mit einer Selbstmordhypothese verbinden. Das Kreuz anstelle eines Abschiedsbriefes? Ein Gestus, der vielleicht bewusst ein Rätsel aufgeben sollte? Die Bürgermeisterin hatte versichert, dass niemand bei Saux Hinweise auf Depressionen oder Selbstmordabsichten bemerkt hatte, was aber nicht unbedingt etwas heißen musste. Eine kürzlich entdeckte schwere Krankheit war unwahrscheinlich, er hatte niemandem von Beschwerden erzählt, andererseits damit angegeben, seit zwölf Jahren nicht mehr beim Arzt gewesen zu sein. Die Gerichtsmedizinerin hatte keinen Hinweis auf eine Krankheit gefunden.
Dupin war bei der Durchsuchung von Lionel Saux’ Haus dabei gewesen, wenn auch nur kurz. Das Team der Spurensicherung hatte sich, auch das ohne Ergebnis, danach die Pointe de Penn Arlan angesehen, den Vorsprung, von dem Saux hinabgestürzt sein konnte. Sie waren die wenigen Pfade abgelaufen, die es gab; besonders eingehend hatten sie sich die Abschnitte angeschaut, an denen der holprige Pfad dem tödlichen Abgrund halsbrecherisch nahe kam. Aber so war das in der Bretagne mit den berühmten sentiers côtiers, Dupin kannte sie zu gut, nicht selten waren sie, wenn man ehrlich war, lebensgefährlich. Man durfte ihren Ursprung nie vergessen: Einst waren sie die abseitigen, unzugänglichen Wege tollkühner Schmuggler gewesen. Aber es war ziemlich unwahrscheinlich, dass jemand, der hier aufgewachsen war, plötzlich so unvorsichtig wäre, dass er von einer Klippe stürzte.
Der Kommissar wandte sich von der Bühne ab, er würde die fünf Musikerinnen morgen ausführlich befragen, die Verabredungen war bereits getroffen.
Dupin sah sich um. Es herrschte eine wunderbare Stimmung. Was auch daran lag, dass es nicht kühl geworden war. Der Abendwind war kräftig – aber lau. Das Publikum war bunt gemischt, die Menschen verteilten sich großzügig auf dem Gelände, gedrängt war es nur direkt vor der provisorischen Bühne. Die meisten wiegten sich im ätherischen Klang der Musik. À Ouessant rien n’est jamais comme ailleurs …
Auch Männer waren zu sehen, die ansonsten, wie er gehört hatte, auf der Insel offenbar keine allzu große Rolle spielten. Ouessant lag in der Hand der Frauen. »Hier herrscht das Matriarchat, müssen Sie wissen, immer schon«, hatte die Bürgermeisterin Dupin schon am Hubschrauberlandeplatz lapidar informiert. »Wir Ouessentines sind Amazonen.«
Dupin hatte sich ein wenig von der Bühne entfernt. Mit einem Mal entdeckte er einen knallroten Citroën 2CV, der über das schmale Sträßchen langsam zum Leuchtturm gehoppelt kam. Er musste unwillkürlich lächeln. Eine Ente war sein erstes Auto gewesen, genau in dieser Farbe. Unvergleichlich.
Der 2CV blieb vor dem Eingang zum Leuchtturmgelände stehen. Dann dauerte es, bis etwas geschah. Die Tür ging wie in Zeitlupe auf und eine alte – offenbar sehr alte –, kleine weißhaarige Frau stieg aus. Zuletzt holte sie einen Gehstock aus dem Wagen. Mit dem bewegte sie sich auf den Eingang zu, jetzt mit erstaunlicher Geschwindigkeit. Es war eindeutig: Die alte Dame kam zum Konzert. So war das hier auf Ouessant.
Dupin folgte ihr mit seinen Blicken, bis er bemerkte, dass sie direkt auf ihn zukam. Jetzt winkte sie mit der freien Hand.
Es bestand kein Zweifel, das Winken galt ihm.
»Monsieur le Commissaire?« Die alte Dame hatte den Kommissar erreicht.
Ihre Stimme war erstaunlich kräftig, laut, eher tief. Ihr Timbre war energisch.
»Soso, in Zivil und ganz schön lässig gekleidet.«
Sie musterte Dupin von oben bis unten. Dupin trug Jeans, ein blaues Poloshirt, eine blaue Jacke. Seine übliche Dienstkleidung. Die alte Dame trug ein langes, eng gewebtes Wollkleid, das ein wenig an eine Tracht erinnerte, eher strenger vom Schnitt, aber nicht formell. Bleu marine, ein dunkles Blau. Schwarze, ungewöhnlich spitz zulaufende Lederschuhe.
»Mit wem habe ich das Vergnü…«
»Madame Sybil Jaouen. Nennen Sie mich Sybil. Das tun sie alle hier. Ich werde auf Sie aufpassen.«
Sie klang nicht unfreundlich.
»Die Dame vom Museum?«
Dupin hatte nicht verhindern können, überrascht zu klingen.
Sie lächelte.
Ein sondersames Lächeln, fand Dupin. Wie die ganze Erscheinung etwas Sondersames hatte. Das kurze weiße Haar stand wild ab. Sie hatte tiefe Falten im Gesicht, sie musste sehr alt sein, bestimmt um die neunzig. Stechende blaugrüne Augen, ähnlich wie Rayanne Ker, sie schienen auf der Insel häufiger vorzukommen, auch Jade Quiniou, die Bodhrán-Spielerin, hatte die gleiche Augenfarbe.
»Danke für Ihr Kommen, Madame, ich …«
»Da geht etwas Dunkles vor sich. Das mit Lionel. – Ich fühle es, ich sehe es.«
Ihre Stimme war fest und klar.
»Was meinen Sie, Madame?«
»Genau, was ich gesagt habe.«
»Sie meinen, dass es kein Unfall war? Ist es das, was Sie sagen wollen?«
»Hier geht etwas Fatales vor.«
Sie blickte ihn durchdringend an.
Dupin wartete einen Moment, aber mehr kam nicht.
»Haben Sie eine Idee, was es mit dem Kreuz auf sich haben könnte, Madame?«
»Das Kreuz«, wiederholte sie langsam. Sie starrte jetzt an Dupin vorbei aufs Meer. »Das mit dem Kreuz ist nicht gut, glauben Sie mir. Überhaupt nicht gut.«
Sie verstummte. Anscheinend hatte sie nicht vor, das Gesagte näher zu erläutern.
»Denken Sie, es handelt sich um ein echtes Kreuz von damals? Ein Original?«
Sie blieb stumm und wandte sich von Dupin ab.
»Die Bürgermeisterin sagte …«, begann er.
»Die meisten Menschen kennen die Unterschiede zwischen Meerjungfrauen, Sirenen und Nixen nicht. Ich hoffe, Sie schon, Monsieur. – Ein Kommissar der Police Nationale!«
Madame Jaouens Blick war streng.
»Ich …« Dupin musste nachdenken. »Ehrlich gesagt nicht.«
»Habe ich mir doch gedacht!«
Sie holte tief Luft.
»Im Aussehen sind sie sich sehr ähnlich: weibliche Wesen, deren Körper halb Fisch, halb Mensch sind. Ihrer Natur nach aber sind sie völlig verschieden. Bei Sirenen und Nixen handelt es sich um Todesdämonen.«
Sybil Jaouen machte eine effektvolle Pause.
»Sie locken die Männer mit betörendem Gesang – und in böser Absicht. Bloß, um sie ins Verderben zu führen, in den sicheren Tod. Sie bezirzen und verführen sie, zuletzt ziehen sie sie auf den Meeresgrund. Meist vorbeifahrende Seemänner, aber nicht nur, zuweilen auch Einheimische.«
Ihre Stimme wurde einen Ton tiefer.
»Meerjungfrauen dagegen sind gewöhnliche Frauen, die das Pech hatten, von einem bösen Geist verdammt zu werden. Unschuldig. Eine fatale Metamorphose.«
Sie wirkte nun mitgenommen.
»Sie können fortan nur noch durch die Liebe eines Mannes befreit werden – die Armen. Bedauernswerte Wesen!«
Es war nicht ganz klar, ob sich das Bedauern auf die Verwandlung oder auf die Tatsache bezog, zur Rettung auf einen Mann angewiesen zu sein.
»Meerjungfrauen wollen keinen Schaden anrichten, nie, im Gegenteil. Dennoch verursachen sie stets ein Desaster. Sagen wir mal so: bis auf ganz wenige Ausnahmen.«
Sie neigte den Kopf, es schien, als hätte Madame Jaouen konkrete Fälle im Sinn.
»Meerjungfrauen vermögen durchaus, an Land zu leben, da verschwindet ihr Fischschwanz. Bei der Berührung mit Wasser jedoch erscheint er wieder – aber diese Geschichte kennen Sie ja.«
Madame Jaouen schien Dupins Gesichtsausdruck zu prüfen. Offensichtlich zu ihrer Zufriedenheit.
»Um Ouessant herum gibt es sie alle, Monsieur: Meerjungfrauen, Sirenen, Nixen. So zahlreich wie an wenigen anderen Orten der Welt. – Also ist es wichtig, dass Sie die Unterschiede kennen. – Ouessant ist vieles, wie Sie wissen, aber vor allem dies: die Insel der Meerjungfrauen, Nixen und Sirenen.«
Dupin wusste nicht recht, was er entgegnen sollte.
»Aber selbst für Meerjungfrauen, alle Melusinen und Undinen dieser Welt gilt schlussendlich, dass eine Liebe zu einem gewöhnlichen Mann unmöglich ist.«
Wieder dieser durchdringende, bohrende Blick.
»Hören Sie, Monsieur? Solche Affären enden tragisch! – Ich spreche von Katastrophen.«
Es schien, als wollte sie Dupin dringend warnen.
»Halten Sie sich fern, Monsieur! Verstehen Sie?«
Sie wartete ganz offenbar auf eine angemessene Reaktion.
»Ich bin verheiratet, Madame. Sehr glücklich verheiratet«, hörte Dupin sich sagen.
Sybil Jaouen entfuhr ein lautes »Hach! Das heißt gar nichts.«
Im nächsten Augenblick beugte sie sich zu Dupin und senkte die Stimme:
»Haben Sie von den Morganezed gehört?«
»Nein, Madame.«
»Ein uralter Stamm von Meerjungfrauen, der nur hier lebt. Um Ouessant herum. Kleiner von der Statur her, dafür noch schöner, noch strahlender als alle anderen. Es gibt an die hundert von ihnen. Sie sind besonders eng mit den Delfinen befreundet. Auch davon haben wir sehr viele.«
Das Meer um die Insel herum schien heftig bevölkert zu sein.
»Ihr durchsichtiger Palast aus Edelsteinen befindet sich in der Bucht von Lampaul. Für uns Menschen sieht er aus wie ein großer Felsen, eine Felseninsel. Sie haben ihn sicher schon gesehen. Zwischen offener See und Bucht.«
Dupin erinnerte sich; der gewaltige dunkle Felsblock mitten in der Bucht war nicht zu übersehen, die Hotelbesitzerin hatte erklärt, er sei so etwas wie das Wahrzeichen von Lampaul. Er war aber nicht durchsichtig.
»Das ist natürlich nur die Spitze des Palastes. Unter Wasser und im Meeresgrund dehnt er sich weiter aus. Dort haben die Morganezed sämtliche Schätze gesammelt, die sie seit Urgedenken auf den Meeresböden gefunden haben. Ganze Berge von Gold, Silber, Edelsteinen, Kristallen. Sie lieben den Glanz. Sie selbst glänzen. Ihr Wesen ist von unendlicher Freundlichkeit, ihre Grazie denen der Engel vergleichbar. Eine Zeit lang galten sie als Engel, aber das ist natürlich Blödsinn, sie sind viel älter als die Engel.«
Man spürte einen heftigen Affekt.
»Morgen Nacht könnten Sie sie sehen. Sie kommen nur bei Vollmond aus dem Meer. Für diese eine Nacht, den Tag davor und den danach. Dann sieht man sie manchmal auf den einsamen Felsen der Insel. Aber«, sie hielt inne und warf Dupin einen schwer zu lesenden Blick zu, »aber die allermeisten, die behaupten, eine Morganezed entdeckt zu haben, haben in Wirklichkeit bloß einen Seehund gesehen!«
Dupin glaubte es aufs Wort.
»Ich wiederhole, Monsieur: Machen Sie keinen Unsinn. Widerstehen Sie! Auch wenn sie einer Morganezed gefallen sollten.« Sie musterte den Kommissar ein zweites Mal kritisch von oben bis unten. »Man weiß nie«, fuhr sie fort, »was ihnen an einem Mann gefällt – halten Sie Abstand. Es wird böse enden. Es ist ein Fluch!«
»Ich sehe hier keinerlei Gefahr«, bekräftigte Dupin.
»Das sagen sie alle. – Wie Yvon. Ein Fischer aus Kadoran. Auch er war in einer glücklichen Beziehung, auch ihn hatte man gewarnt, auch er hatte die Warnung abgetan. Und dann geschah es. Er verlor sein Herz an eine Morganezed – und diese an ihn, aufrichtig, voller Liebe, sie verließ für ihn sogar das Meer, gab all ihre Schätze auf, war bereit, ihre Familie nie wiederzusehen. Sie haben dann geheiratet, in der Kirche von Lampaul, und ein überaus glückliches Leben in Yvons Dorf begonnen. So glücklich, dass die zwei Schwestern der Meerjungfrau eifersüchtig wurden, als sie davon hörten. Und diese Eifersucht wurde immer schlimmer. In einer dunklen Nacht haben sie Yvon dann in einem Furor ins Meer gezogen und er ertrank. – Sehen Sie, was ich meine, Monsieur?«
»Kannten Sie Lionel Saux persönlich, Madame?«
Dupin musste unbedingt das Thema wechseln.
»Auf der Insel kennen alle einander. Und ich bin eine der bestinformierten Personen überhaupt.«
Die alte Dame hatte kein Problem mit dem Themenwechsel.
»Kannten Sie ihn denn näher?«
Sie schien zu überlegen. »Ich weiß es nicht. Schwer zu sagen.«
Dupin würde interessieren, was genau daran schwer zu sagen war.
»Wir hatten eigentlich schon lange nichts mehr miteinander zu tun. Früher schon. – Da hat er ein paarmal hier am Stiff gespielt. Ein äußerst beliebter Ort für Konzerte, wie Sie ja sehen. Ich leite das Museum seit vierzig Jahren. Damals habe ich allerdings noch in der Mairie gearbeitet. – Ich hatte ihren Job«, Sybil deutete auf die Bodhrán-Spielerin, Locmariaquers Nichte, »Jade weiß übrigens sehr viel über Meerjungfrauen.«
Dupin erinnerte sich: Auch sie war conteuse. Wovon der Präfekt nichts erwähnt hatte. Aber er hatte sowieso kaum etwas über seine Nichte erzählt, nur dass sie Musikerin war und dass ihre Mutter, seine Schwester, sich große Sorgen machte.
»Das ist bestimmt zehn Jahre her«, fuhr Sybil Jaouen fort.
»Was ist zehn Jahre her, Madame?«
»Na, dass Lionel hier zum letzten Mal gespielt hat.«
»Aber Sie haben sich auch danach noch ab und zu gesehen?«
»Die Ausdehnung der Insel in der materiellen Welt ist einigermaßen gering, Monsieur. Natürlich begegnet man sich. Gerade letzten Sonntag hab ich ihn im Supermarkt gesehen. Ich musste Geld holen.«
Dupin wusste Bescheid. Er hatte auch Geld abheben müssen, als er ankam. Der einzige Geldautomat befand sich im supermarché mitten in Lampaul, unmittelbar links, wenn man reinkam, quasi im Eingang, trotzdem übersah man ihn leicht, Dupin hatte ihn suchen müssen.
»Kam er Ihnen da irgendwie verändert vor?«
»Oh nein, kein bisschen.«
»War er alleine?«
»Oh ja.«
»Wissen Sie, ob er eine Freundin hatte? Möglicherweise war er – unglücklich verliebt?«
Die Bürgermeisterin hatte nur erzählt, dass Lionel Saux in keiner Beziehung war, mehr wusste sie anscheinend nicht.
Sybil Jaouen lächelte abermals ihr sonderbares Lächeln. Das vielleicht, dachte Dupin mittlerweile, gar kein Lächeln war.
»Ich sehe: So langsam verstehen Sie, Monsieur.«
»Bitte?«
Dupin war wirklich verwirrt.
»Sehr gut.«
»Was meinen Sie, Madame?«
Wieder nur dieses Lächeln.
»Auf der Insel ist also nichts von einer neuen Liebe bekannt? Einer Affäre?«
»Bekannt nicht, nein. – Aber das heißt natürlich nichts, das muss ich Ihnen ja sicher nicht sagen.«
»Nein. Ich …«
Dupins Telefon klingelte.
Rasch warf er einen Blick auf die Nummer. Der Präfekt. Er hatte es eben bereits versucht, kurz vor dem Konzertbeginn. Und vorher auch schon. Alle halbe Stunde, seit Dupin auf der Insel angekommen war. Und so würde es in diesem Fall weitergehen. Ein Albtraum.
Dupin drückte den Anruf nach einem kurzen Zögern mit Entschiedenheit weg.
»Wenn ich Ihnen etwas raten darf …«
Sybil Jaouen kam noch einen Schritt näher, sie musste den Kopf in den Nacken legen, um zu Dupin aufzuschauen, was ihr indessen nichts auszumachen schien.
»Halten Sie sich an Jolla.«
Sie machte eine dramaturgische Pause.
»Jolla ist eine der Neun.«
Noch eine Pause.
»Der neun druidischen Priesterinnen, die einst die Insel regierten.«
Madame Jaouen formulierte das Wort so lapidar, als würde sie »Supermarktverkäuferin« sagen.
»Und die Neun regieren immer noch. Besser gesagt ihre Geister. – Aber es ist wie immer: Auf das Unsichtbare kommt es an, das Unsichtbare ist es, das alles Sichtbare beherrscht. Denken Sie an die dunkle Materie im Universum.«
Es klang wie das, was Claire ihm immer sagte. Aber nur, was das Universum anbelangte.
»Jolla will Gutes. Sie kennt jede Strömung, weiß von jeder Welle, atmet mit jeder Böe. Als sie noch eine materielle Gestalt besaß, sagte sie den Seeleuten, welche Routen sie fahren mussten, um sicher ans Ziel zu gelangen. Fehlte es an Wind, brachten sie ihr ein Geschenk, und Jolla gab Wind. – Auch Sie werden Jolla brauchen, Monsieur le Commissaire, das versichere ich Ihnen.«
Madame Jaouen machte dem Titel der conteuse wirklich alle Ehre. Eine Berufung, wusste Dupin, kein Beruf.
Sie blickte ihn durchdringend an.
»Sie lebt bei dem Cromlec’h. Wie die Geister der anderen acht Druidinnen. Bei dem uralten Steinkreis auf der Pointe d’Arlan.«
Da, wo Lionel Saux möglicherweise ins Meer gestürzt war.
»Das war – das ist ihre heilige Stätte. Die der Neun. Ein Steinkreis, der älter ist als Stonehenge, älter als Carnac. ›Der Ursprung‹ heißt er. – Wussten Sie, dass es auf Ouessant Zeugnisse einer urzeitlichen Besiedelung von vor über zehntausend Jahren gibt? Und einen Inselarchäologen. Ein Ire ursprünglich.«
Etwas arbeitete in Dupin.
»Irisch? Wie der Besitzer dieser Kneipe?«
»Docteur Mathis Cëvaër. Er ist der Besitzer. Als junger Wissenschaftler kam er in archäologischer Mission zu uns, geriet in den Bann der Insel und blieb. Dann eröffnete er die Kneipe.«
Ein promovierter Archäologe als Kneipenbesitzer. Ouessant überraschte stets aufs Neue.
Dupin holte sein Notizbuch hervor.
»Arbeitet er noch als Archäologe?«
»Nein. – Das Ty Korn läuft blendend.«
»Bestimmt.«
Die von den Einheimischen besuchten Kneipen, besonders Inselkneipen, liefen in der Bretagne immer blendend, wusste Dupin; vielen waren sie ein zweites Zuhause, manchen gar das erste.
Dupins Blick war ein weiteres Mal über das Meer geschweift, unwillkürlich. Es war verrückt: Das Meer hatte die gleiche Farbe angenommen wie der Himmel – ein tiefes, intensives, ganz und gar gleichmäßiges Orange, sodass der Horizont fast nicht auszumachen war. Eine friedfertige, harmonische Farbe. Die Sonne – ein grelles, gelbliches Weiß – hielt sich knapp über dem Wasser, kurz vor dem vollständigen Untergang.
»Halten Sie schon nach ihnen Ausschau, Monsieur?«
»Nach wem?«
Dupin fühlte sich ertappt.
»Nach den Meerjungfrauen.«
»Bitte?«
»Tun Sie nicht so.«
Madame Jaouen meinte es ernst.
»Ich glaube nicht an Nixen, Madame.«
Dupin biss sich sofort auf die Zunge.
»Zum einen ist das äußerst bedauerlich und verhindert unter Umständen, dass Sie diesen Fall lösen werden, wer weiß? Zum anderen spreche ich nicht von Nixen, Monsieur. Nixen sind …«
»Ich weiß, Madame. Sie haben mir den Unterschied gerade erklärt.«
Dupin versuchte ein betont freundliches, versöhnliches Lächeln.
»Na gut. – Wissen Sie, dass unsere Insel ganze viertausend Jahre älter ist als die Britischen Inseln?« Madame Jaouen schien den Satz wirken lassen zu wollen, sie fuhr erst nach einer kleinen Pause fort: »Wir waren das Haupt des europäischen Kontinents, dieser Boden hier gehörte zu den letzten Ausläufern des nordwestlichen Finistère, der gigantischen Granitplatte, die aller Bretonen Heimat ist. Dann stiegen die Meere dramatisch an, vor zwölftausend Jahren wurden wir schließlich eine Insel. England, Schottland, Irland – das ganze große Britannien dagegen erst vor achttausend Jahren. Da entstand der Kanal. Die Briten sind also erst seit ganz Kurzem eine Insel.«
»Interessant.« Dupin nickte vorsichtshalber heftig. Und natürlich hatte sie recht: Erdgeschichtlich betrachtet waren achttausend Jahre in der Tat »erst seit ganz Kurzem«.
»So!« Die Sirenen hatten das Stück beendet, die Lautenspielerin – Enora Gaëc, die Landwirtin, wenn Dupin sich richtig erinnerte – richtete sich mit forscher, gut gelaunter Stimme ans Publikum. »Nachdem wir Lionel musikalisch in jenseitige Sphären begleitet haben, tummeln wir Lebenden uns nun wieder ganz im Diesseits. Jetzt feiern wir – wie es sich gehört! Ihr wisst, Lionel war vor allem eines: Musik. Also lasst uns für ihn tanzen! – Für Lionel!«
Mit dem Namen des Toten setzte ein rasanter Trommelrhythmus ein, dem nach und nach alle weiteren Instrumente folgten. Die langen schwarzen Locken von Enora Gaëc flogen wild umher. Sie trug ein meerfarbenes Kleid, genauer: ein Kleid aus fließendem Stoff in der bretonischen Farbe glaz, ein Ton zwischen Blau, Grün, Grau.
Das Lied klang nach einem keltischen Traditional, es ging sehr beschwingt zu. Mit einem Mal war die Stimmung eine andere, aus den ätherisch-schwebenden Bewegungen war ein ausgelassenes Tanzen geworden. Und wieder waren Jung und Alt gleichermaßen dabei. Vor Dupin sprangen zwei Mädchen in langen bunten Kleidern umher und sangen lauthals mit. Das Lied schien bekannt zu sein – der Text bretonisch –, nicht nur die beiden Mädchen, fast alle sangen mit, Dupin sah, wie Sybil Jaouen zufrieden lächelte.
Augenblicklich kam sich Dupin höchst deplatziert vor.
Sybil Jaouen beugte sich zu ihm vor: »Eher der steife Typ, sehe ich.« Sie beäugte ihn kritisch. »Hatte ich mir gedacht.«
Dupin würde einen schweren Stand auf der Insel haben, merkte er, bei Madame Jaouen jedenfalls ganz sicher.
»Das ist unsere Hymne. Ein Lied, das wir seit über dreihundert Jahren auf der Insel singen. Unsere Geschichte. Unser Herz.«
Dupin nickte freundlich.
»Ich habe nicht das Gefühl, dass Sie die Sache ernst genug nehmen, Monsieur. Hören Sie sich das Lied einmal genau an. Ich kann es Ihnen nur dringend raten.«
»Das werde ich, Madame, gewiss.«
Jetzt musste man schreien, um sich zu unterhalten. Das Seltsame: Dupin hörte trotz der lauten Musik ein hohes, sphärisches Klingen, das sich über alles zu legen schien.
»Diese beiden anderen Personen, mit denen Lionel Saux Kontakt hatte. Kennen Sie sie? Ondine Morin und Daniel Destoc.«
»Selbstverständlich kenne ich sie.«
»Ich meinte, ob Sie sie näher kennen.«
»Ondine? Aber ja doch! Sie kommt regelmäßig hier zum Leuchtturm, alleine oder mit ihren Gruppen, die sie über die Insel führt. Sie ist die Seele der Insel. Und eine moderne Jeanne d’Arc! Sie führt einen großen Kampf. Einen historischen Kampf! Für unseren Planeten, gegen seine Zerstörung aus reiner Profitgier. Für eine Fischerei im Einklang mit der Natur. Die industrielle Fischerei ist eine mörderische Maschinerie, die sämtliches Leben im Meer vernichtet. Wir wissen es und lassen es trotzdem geschehen. Sie …«
»Ich weiß, was Ondine Morin macht, Madame.«
Und jede Bewunderung war gerechtfertigt. Claire und Dupin hatten letztens erst auf France 3 eine Reportage über sie und ihr Boot gesehen. Sie hatte auch einen Mann, Jean-Denis, der sich mit ihr zusammen aufs Meer wagte, aber so war es hier auf der Insel: Die Männer schienen Anhängsel zu sein.
»Auf Ouessant sind es die Frauen, die erzählen, die die Geheimnisse und das wahre Wesen der Insel bewahren. Am Leben halten. Generation für Generation. Wie die große Marie Tual aus dem neunzehnten Jahrhundert – sogar Anatole Le Braz, unser bretonischer Nationalpoet, rühmt sie. Oder Barba, la conteuse, wie sie schlicht genannt wurde, die im zwanzigsten Jahrhundert wirkte.«
Wieder bedachte sie Dupin mit diesem durchbohrenden Blick.
»Die Namen sagen Ihnen wahrscheinlich nichts?«
Die Musik wurde immer wilder. Es wurde ein anstrengendes Gespräch, Dupin musste sich weit zu Madame Jaouen hinunterbeugen.
»Nein.«
»Na gut. – Ondine hat mir gesagt, dass Sie sie morgen sehen werden«, wechselte Madame Jaouen selbst das Thema, Dupin war froh.
»Wir sind verabredet.«
Dupin hatte mit allen sechs Personen auf der Liste jeweils ein Treffen vereinbart.
»Und Daniel Destoc, Madame? Wie gut kennen Sie ihn?«
»Der Schrottplatzbetreiber. Ich weiß nicht. Ein eigenbrötlerischer Kerl. Wir haben uns eigentlich noch nie unterhalten.«
Kaum zu glauben, auf einer so kleinen Insel.
Als die Bürgermeisterin Dupin von Lampaul zum Leuchtturm rausgefahren hatte, waren sie am Schrottplatz vorbeigekommen: ein sehr überschaubarer, unförmiger Berg verrosteter Eisenteile.
»Werden Sie sich mit ihm treffen?«
Im Ton der Frage hatte eine merkwürdige Vorsicht gelegen, die gar nicht zu Madame Jaouen passte.
»Das werde ich«, nickte Dupin.
Er war müde, geradezu erschöpft. Mehr war hier für ihn vorerst nicht zu tun. Von Madame Jaouen würde er auch nicht mehr erfahren, nichts, was ihm momentan helfen würde. Außerdem entwickelte sich die Veranstaltung zu einem immer ausgelasseneren Fest.
Claire und er waren heute Morgen um halb fünf Uhr aufgestanden, Claire hatte um sechs weggemusst, nach Paris, zum Flughafen – von Charles-de-Gaulle aus war sie nach Boston geflogen. Ein kardiologischer Fachkongress. Dort, wo sie schon ein paarmal gewesen war. Wo auch dieser »nette Sam« war, von dem sie immer erzählte, ein, so Claire, »brillanter« Kardiochirurg aus Washington.
»Ich muss heute Abend noch ein paar Telefonate führen, Madame Jaouen. Die Bürgermeisterin sagte, Sie könnten mich eventuell zu meinem Hotel fahren? Das wäre sehr freundlich.«
Er hatte überlegt, zu Fuß zurückzulaufen, einmal über die Insel, aber dafür hätte er sicher mindestens eine Dreiviertelstunde gebraucht.
»Sie wollen schon gehen?«
Dupin hörte echtes Bedauern heraus.
»Na gut«, seufzte sie. »Dann los.«
Prompt drehte sie sich um und steuerte auf ihr Auto zu. Wieder war Dupin erstaunt, wie flink sie mit ihrem Stock unterwegs war, es war kein bisschen ersichtlich, warum sie ihn überhaupt brauchte.
Keine Minute später saßen Dupin und Sybil Jaouen in der roten Ente, die sich, wie Dupin feststellte, in einem penibel gepflegten und völlig originalen Zustand befand. Was bedeutete, dass Dupin auf einem Stoffsitz mit echten Sprungfedern saß, gemütlich wie ein altes Sofa. Ein Baujahr um 1970, schätzte er.
Madame Jaouen drehte den Zündschlüssel, der Wagen machte einen forschen Satz. Ein Blitzstart, sie hatte kräftig Gas gegeben und fuhr nun, um den Wagen zu wenden, einen großen, holprigen Kreis über das stoppelige Inselgras. Als sie das Sträßchen wieder erreicht hatte, trat sie erneut das Gaspedal durch.
»Kurz ein paar Instruktionen für Ouessants Argoat – ich meine, wenn Sie sich in den nächsten Tagen über die Insel bewegen wollen.«
Sie warf Dupin einen prüfenden Blick zu, der besagte: Den Begriff »Argoat« werden Sie ja wohl kennen. Natürlich kannte Dupin ihn: Er bezeichnete das Landesinnere der Bretagne, die bretonische Campagne – im Gegensatz zu Armor, der bretonischen Küste.
»Hören Sie genau zu, Monsieur. Es könnte über Leben und Tod entscheiden.«
Dupin tat, was er immer getan hatte, sobald er in seiner Ente saß: Er klappte das Seitenfenster nach oben und legte den Unterarm ab. Wunderbar.
»Zum Beispiel Boutou Bahou, schon mal gehört?«
Erneut traf ihn Madame Jaouens prüfender Blick. Sie schien die Strecke in- und auswendig zu kennen, viel Aufmerksamkeit schenkte sie der Straße jedenfalls nicht.
»Sagt Ihnen nichts, sehe ich.«
»Nein.«
»Ein blutgieriger Missetäter. Die reine Bosheit. Ein Vampir von der Gestalt einer Fledermaus und so groß wie ein Mensch. Er wohnt in einer der Dutzenden Felshöhlen im Osten, an der Steilküste, in die man nur vom Wasser aus kommt und nur bei tiefster Ebbe. Nachts aber verlässt er sie und treibt sein Unwesen. Er taucht aus dem Nichts auf, es kann jederzeit und überall passieren.« Sie schüttelte heftig den Kopf. »Er verabscheut uns Menschen zutiefst.«
Dupin musste zugeben, dass die Geschichte, die Madame Jaouen mit ihrer brüchigen, zuweilen krächzenden Erzählstimme vortrug, in der mystischen Landschaft durchaus einen leichten Schauder auszulösen vermochte. Und das hieß etwas. Claire hatte eine Schwäche für Horrorfilme, Dupin begleitete sie meistens ins Kino – und langweilte sich durchweg, zweimal war er sogar eingeschlafen.
»Anders als gewöhnliche Vampire trinkt er nicht nur Ihr Blut«, Madame Jaouen sprach Dupin jetzt direkt an, »sondern frisst Ihnen die Haare vom Kopf, buchstäblich, er skalpiert Sie bei lebendigem Leib.«
Sybil Jaouen hatte offensichtlich keine Probleme mit den brutalen Passagen ihrer Geschichte, gerade diese erzählte sie besonders leidenschaftlich.
»Zu guter Letzt verzehrt er Ihre Augäpfel. Bei jedem Opfer bewahrt er sie sich bis zum Schluss auf, sein liebster Schmaus. Genüsslich saugt er sie Ihnen aus dem Kopf, erst das rechte, dann das linke.«
Äußerst eigenwillige Vorlieben, fand Dupin. Aber so war es stets bei bretonischen Monstern. Auch sie waren nie gewöhnlich. Wie die Bretagne selbst überboten auch die bretonischen Ungeheuer alles. Superlative des Horrors.
»Jetzt werden Sie sich fragen, wie Sie bei einem nächtlichen Inselspaziergang überhaupt unversehrt bleiben können?