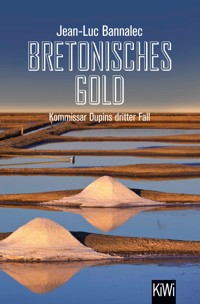10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Dupin ermittelt
- Sprache: Deutsch
Bretonische Austern, mysteriöse Druiden-Kulte und ein kniffliger Fall für Kommissar Dupin – willkommen in der malerischen Bretagne! Am idyllischen Fluss Belon, bekannt für seine weltberühmten Austern, zwischen atemberaubenden Klippen, geheimnisvollen Zauberwäldern und dem rauen Atlantik, stolpert eine eigenwillige alte Filmdiva kurz vor Ostern über die Leiche eines Mannes. Nur wenig später erreicht Kommissar Dupin ein Anruf aus den sagenumwobenen Hügeln der Monts d'Arrée, um die sich Legenden von Feen und dem Teufel ranken. Auch dort wurde ein Toter gefunden. Doch niemand kennt seine Identität. Als sich herausstellt, dass die Spuren zu keltischen Brudervölkern, einer Sandraub-Mafia und rätselhaften Druiden-Kulten führen, ahnt der Kommissar: Dies wird sein bisher aberwitzigster Fall in der Bretagne. Jean-Luc Bannalecs vierter Band seiner erfolgreichen Krimi-Reihe um den charismatischen Kommissar Dupin entführt die Leser in die malerische Küstenlandschaft des Finistère und verspricht spannende Urlaubslektüre mit Ferienstimmung. In seinen atmosphärischen Krimis mit Kommissar Dupin aus der Bretagne liefert Jean-Luc Bannalec die ideale Lektüre für den Urlaub. Er entführt seine Leser mit feinem Humor und regionalem Verständnis in die unverwechselbare Bretagne, wo man die salzige Meeresbrise geradezu einatmen kann. Die Krimi-Bestseller aus der Bretagne sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Bretonische Verhältnisse - Bretonische Brandung - Bretonisches Gold - Bretonischer Stolz - Bretonische Flut - Bretonisches Leuchten - Bretonische Geheimnisse - Bretonisches Vermächtnis - Bretonische Spezialitäten - Bretonische Idylle - Bretonische Nächte - Bretonischer Ruhm - Bretonische Sehnsucht - Bretonische VersuchungenDie Bücher erzählen eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2015
Sammlungen
Ähnliche
Jean-Luc Bannalec
Bretonischer Stolz
Kommissar Dupins vierter Fall
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Jean-Luc Bannalec
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Jean-Luc Bannalec
Jean-Luc Bannalec ist ein Pseudonym; der Autor ist in Deutschland und im südlichen Finistère zu Hause. Die ersten sieben Bände der Krimireihe mit Kommissar Dupin, »Bretonische Verhältnisse«, »Bretonische Brandung«, »Bretonisches Gold«, »Bretonischer Stolz«, »Bretonische Flut«, »Bretonisches Leuchten« und »Bretonische Geheimnisse«, wurden für das Fernsehen verfilmt und in zahlreiche Sprachen übersetzt. 2016 wurde Jean-Luc Bannalec von der Region Bretagne mit dem Titel »Mécène de Bretagne« ausgezeichnet. Seit 2018 ist er Ehrenmitglied der Académie littéraire de Bretagne.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
»Die größte Herausforderung ist es, nicht schon während des Lesens einen Urlaub in der Bretagne zu buchen, weil Bannalec die Region so leidenschaftlich in Szene setzt.« WDR 2
»Bannalecs Kriminalromane sind ebenso spannende Urlaubslektüre wie […] anregende Erzählung über eine exponiert gelegene Region und das sehr eigene Völkchen.« Gießener Allgemeine
»Ein Muss für Bretagne-Fans! Starke Dialoge, spannend.« Woman
»Der Sommer ist gerettet! Beim vierten Krimi um den in die Bretagne strafversetzten schrulligen Kommissar Dupin […] kommt sofort Ferienstimmung auf, sogar beim Lesen auf Balkonien.« Grazia
»Allerbestes Urlaubsgepäck, auch wenn man ganz woanders hinfährt!« Westdeutsche Allgemeine Zeitung
Hinweis für E-Reader-Leserinnen und Leser
Wenn Sie sich die Karte in Farbe und zoombar ansehen möchten, dann geben Sie bitte die folgende Internetadresse im Browser Ihres Computers oder Smartphones ein:
https://www.kiwi-verlag.de/magazin/extras/die-karten-zu-bretonischer-stolz
Hinweis für Leserinnen und Leser auf dem Smartphone/Tablet oder am Computer
Sie möchten sich die Karte zoombar anschauen? Dann tippen bzw. klicken Sie bitte auf die Abbildung. Es öffnet sich ein neues Fenster mit der entsprechenden Website-Ansicht.
Inhaltsverzeichnis
Motto
Widmung
Der erste Tag
Der zweite Tag
Der dritte Tag
Der vierte Tag
Es gibt Leute, die machen dich glücklich, wenn sie kommen, und solche, die machen dich glücklich, wenn sie gehen.
Bretonisches Sprichwort
à L.
à Dr. H. A.
Der erste Tag
Er war der Größte von allen. Er rief laut. Zackig. Einsilbig. Den Kopf aufschneiderisch nach oben gereckt. Der forsche Ruf galt einem Kumpan, der hinter einem Felsvorsprung hervorlugte und nun herbeieilte. Es war kalt, um die null Grad, die Luft roch nach feuchtem Eis.
Kommissar Georges Dupin vom Commissariat de Police Concarneau stand genau vor ihm, nicht unbeeindruckt. Sein bei allem Getue tatsächlich imposantes Gegenüber war sicherlich einen Meter groß.
Ein schwarzer Kopf, eindringliche braune Augen, schwarze Kehle. Leuchtend gelborange Flecken am Hinterkopf. Ein langer, nobler Schnabel, oben dunkel, unten tieforange. Die Brust grell gelborange, darunter ein strahlendes Weiß. Der Rücken vom Nacken bis zum Schwanz schimmernd, ein silbriges Schiefergrau. Wie die Flossen. Die Füße und Beine dagegen wieder pechschwarz. Der Königspinguin war ein exquisites Spektakel: royal.
Sein Kumpan, ein Stück kleiner, war derweil zu ihm gestoßen, die einzelnen Pinguine, wusste Dupin, erkannten sich verlässlich an ihren Stimmen.
Plötzlich begannen sie beide zu rufen. Kurz, abgehackt. Drohrufe. Eindeutig. Dupin hatte für einen Moment gedacht, sie gälten ihm. Aber er hatte sich geirrt. Am anderen Rande des Vorsprungs des beschneiten arktischen Pavillons standen drei seiner Lieblingspinguine: Eselspinguine, die hier, im Océanopolis bei Brest, zusammen mit einer Gruppe von Felsenpinguinen die größte Pinguinkolonie Europas bildeten und Dupin, den Pinguinliebhaber, alle paar Monate, wenn er Richtung Brest musste, dazu brachten, einen Abstecher hierher zu unternehmen. Heute gemeinsam mit Henri, seinem mittlerweile besten Freund in der »neuen Heimat«, ebenso ein Ex-Pariser, der am Ende der Welt seine große Liebe und sein Glück gefunden hatte, vor über zwei Jahrzehnten bereits. »Alles beginnt am Ende der Welt« hieß es, »tout commence au Finistère«. Eine der bretonischen Formeln, die es auf den Punkt brachte: So dachte und fühlte man hier.
Kommissar Dupin war auf dem Weg zu einem »polizeilichen Fortbildungsseminar« in Brest, das lästigerweise zu seiner »Beförderung« gehörte, von der er obendrein immer noch nicht wusste, was genau sie bedeutete. Er war höchstoffiziell vom Hauptkommissar zum »Leitenden Kommissar« ernannt worden, wobei es seit Menschengedenken ohnehin immer bloß einen Kommissar gegeben hatte im Commissariat de Police Concarneau. Einem sehr überschaubaren Kommissariat, dem einzigen in Frankreich jedoch, das, so die nie überprüfte Behauptung, einen Panoramablick aufs Meer besaß. Und auf die Altstadt im großen Hafenbecken mit ihren gewaltigen Festungsmauern. Ein sehr überschaubares Kommissariat, dessen »regionaler Zuständigkeitsbereich« sich jedoch in den letzten Jahren peu à peu – mit jeder Pensionierung eines Kommissars in den anliegenden Gemeinden und der akuten Klammheit der öffentlichen Haushalte – ausgeweitet hatte. Dupins Beförderung war fast mit seinem fünfjährigen bretonischen Dienstjubiläum zusammengefallen. Der Präfekt hatte bei dem »feierlichen« Anruf etwas von »nicht schlecht« gemurmelt, dass es »eine passable Arbeit« gewesen sei, die Dupin da »abgeliefert« habe. Dass man »doch durchaus von ein paar respektablen gemeinsamen Ermittlungserfolgen« sprechen könne. Am ersten März vor fünf Jahren war Dupin nach seiner unschönen »Versetzung« aus der Metropole – um deren Gründe sich immer abstrusere Legenden rankten – zu seinem ersten bretonischen Arbeitstag angetreten.
Thema der Fortbildung nun – sie war ihm individuell als »Bonus« von der Präfektur zugewiesen worden – war die »systematisch-systemische Gesprächsführung in Ermittlungssituationen«. Selbstverständlich basierend auf neuesten Erkenntnissen wissenschaftlich-psychologischer Forschungen. Dupin war geradezu berüchtigt für seine unkonventionellen, ohne Zweifel höchst unpsychologischen Ermittlungsgespräche, die alles sein mochten, aber nie »systematisch«, zumindest nicht im gewöhnlichen Sinne.
Aber die Teilnahme an dem Kurs war verpflichtend, und die Beförderung ging mit einer nicht üppigen, aber gleichwohl doch interessanten Gehaltserhöhung einher. Erpressung also. Dupin hätte auch deswegen nicht die geringsten Schwierigkeiten gehabt, die Auftaktveranstaltung heute zu schwänzen, wenn es sich nicht so nett mit Henris Plänen getroffen hätte, der zu einer Zusammenkunft von Gastronomen in der Nähe von Brest musste.
Die beiden Könige watschelten jetzt auf die drei Esel zu, die sich daraufhin mit ihren Flossen Zeichen zu geben schienen, sich einen Augenblick später in Bewegung setzten und mit einem tollkühnen Satz in das Wasserbecken sprangen. In halsbrecherischem Tempo, mit irrwitzigen Wendemanövern, vor allem aber mit herausfordernd guter Laune stoben sie auseinander, jeder in eine andere Richtung, drehten abrupt um, schossen erneut wagemutig eng aneinander vorbei und verschwanden dann in den Wasserfluren zu anderen Becken. Die kleine Show hatte keine fünf Sekunden gedauert. Aus den an Land unbeholfen wirkenden Vögeln, die ihre Flugfähigkeit im Laufe der Evolution wieder aufgegeben hatten, wurden, sobald sie in ihrem Element waren, die mit Abstand geschicktesten und rasantesten Schwimmkörper, die die Wasserwelt kannte. Bis auf vierzig Stundenkilometer beschleunigten sie, wusste Dupin, stromlinienförmig in Perfektion. Bis zu zweiundzwanzig Minuten konnten sie mit einem einzigen Atemzug tauchen, und das bis zu fünfhundert Meter tief. Was immer es über Pinguine zu lesen gab – Dupin las es, und er hatte diese Fakten und Zahlen parat wie früher die vom Autoquartett. Besonders beeindruckte ihn die Orientierung der Pinguine: Über viele Quadratkilometer prägten sie sich mit scharfen Augen und unschlagbaren Mnemotechniken die Details unter der Eisdecke und auf dem Meeresboden ein, sie wussten in jedem Moment, wo sich das nächste Loch zum Auftauchen befand – überlebenswichtig. Auch für einen Kommissar gewissermaßen. Genauso wie die Fähigkeit, bei einer gefühlten Höllenkälte von minus einhundertachtzig Grad eine konstante Körpertemperatur von dreißig Grad zu halten, bei heulenden Stürmen, wochenlanger Dunkelheit und ohne Futter, eine schreckliche Vorstellung, fand Dupin.
Henri und Dupin hatten vergeblich versucht, den drei Eselspinguinen mit den Blicken zu folgen. Gerade wollten sie sich abwenden, als die drei hinter den beiden Königspinguinen mit einem mächtigen Satz aus dem Wasser schossen. Im nächsten Augenblick standen sie sicheren Fußes auf dem eisigen Vorsprung – eine filmreife Aktion. Das Auseinanderstieben der Eselspinguine war also alles andere als planlos gewesen, sie hatten eine ausgeklügelte Aktion verabredet. Pinguine waren im Teamwork unschlagbar.
Die beiden Königspinguine wirkten sichtlich irritiert. Einen Augenblick schien es, als würden sie eine Aggression erwägen, sie richteten sich mit demonstrativer Körperspannung auf. Der größere stieß dabei ein paar harsche Rufe aus. Dann aber, ebenso unvermittelt, ließen sich die Könige kopfüber ins Wasser gleiten, ganz ohne Hektik, gemächlich fast, schauten noch einmal hoch und schwammen schließlich davon.
Der Vorsprung, auf dem die Fütterungen stattfanden, gehörte nun den drei Eselspinguinen.
»Die wissen, wie’s geht«, schmunzelte Dupin.
»Am Ende ist der Klügere der Stärkere«, Henri lachte.
Die Pinguinkolonie in der Bretagne war die größte Europas, viel spektakulärer aber war noch etwas anderes: Es handelte sich bei ihnen um französische Pinguine. Sie kamen von offiziellem französischem Staatsgebiet, den Îles Crozet, subantarktischen Inseln. Und, noch viel entscheidender: Diese Inseln waren in Wahrheit ein bretonisches Archipel! Denn entdeckt worden war es im 18. Jahrhundert von dem Marineoffizier Julien-Marie Crozet. Der aus dem Morbihan stammte, nahe dem berühmten Golf. Ein Bretone! Diese Pinguine hier – es waren Bretonen. Was ebenso bedeutete: Es gab eine original antarktische Bretagne! Für Bretagne-Anfänger mochte es kurios klingen – Dupin aber erstaunte es längst nicht mehr, hatte er in den letzten Jahren doch bereits die Südsee-Bretagne, die karibische, die mediterrane und auch die australische Bretagne kennengelernt. »Die Bretagne gibt es nicht! Es gibt viele Bretagnen!«, war einer der grundlegenden Lehrsätze seiner Assistentin Nolwenn.
»Wusstest du, dass Pinguine sich durch explosive Beschleunigungstechniken bis zu zwei Meter hoch aus dem Wasser katapultieren können? Waffeningenieure haben sich das zum Abschießen von Torpedos abgeguckt und …«
Dupins Begeisterung wurde vom hohen, monotonen Piepsen seines Handys unterbrochen. Er kramte es widerwillig hervor.
Nolwenn.
»Ja?«
»Das ist vollkommen unannehmbar, Monsieur le Commissaire! Das kann nicht angehen!«
Es war ernst. So viel war klar. Auch wenn Dupin es in all den Jahren nicht häufig erlebt hatte: Seine Assistentin – universell patent und für gewöhnlich noch in den brenzligsten Situationen ruhig und souverän – befand sich in großer Aufruhr. Sie holte tief Luft:
»In ein paar Tagen wird der letzte Leuchtturmwärter Frankreichs seinen Leuchtturm verlassen! Dann laufen sie überall nur noch computergesteuert. Und heißen nicht mehr phares, sondern DirmNAMO!«
»Nolwenn, ich …«
»Ein ganzer Beruf verschwindet. Aus und vorbei. Es gibt keine Leuchtturmwärter mehr! Jean-Paul Eymond und Serge Andron haben fünfunddreißig Jahre in dem Leuchtturm gelebt, auf siebenundsechzigeinhalb Meter Höhe, die härtesten Stürme ausgestanden, mit Wellen, deren Gischt über die Kuppel schlug und bei denen man nur noch beten konnte. Wie oft haben sie in solchen Stürmen den Leuchtturm repariert und ihr Leben riskiert, um das anderer zu retten! Wird der Computer demnächst in schweren Unwettern selbst seine defekten Kabel reparieren? Das zerborstene Glas?« Sie holte erneut Luft: »Der Leuchtturmwärter – das ist eine wichtige historische Figur, Monsieur le Commissaire! – Wie gesagt: Das ist vollkommen unannehmbar!«
So tieftraurig diese Meldung tatsächlich anmutete, so war Dupin doch unklar, was Nolwenn konkret von ihm erwartete. Dass er polizeilich einschritt? Jemanden verhaftete?
»Ein Mord? Ist etwas passiert?« Henri sprach gedämpft, um Diskretion bemüht, aber auch mit spürbarer Neugier. Dupins Gesicht hatte offensichtlich etwas von Nolwenns Affekt gespiegelt oder auch nur seine Ratlosigkeit ausgedrückt. Er wiegelte rasch mit einer beruhigenden Geste ab.
»Sind Sie bereits im Seminarzentrum, Monsieur le Commissaire?« Nolwenns Stimme hatte sich von der einen zur anderen Sekunde restlos verändert. Gänzlich unsentimental nun, die reine Sachlichkeit. Dupin kannte das. Bei dem Wort »Seminarzentrum« sah er blumendekorverzierte Plastik-Thermoskannen auf bräunlichen Resopaltischen vor sich, mit lausigem, vor Stunden gebrühtem lauwarmem Kaffeewasser. Andererseits: Er hatte seit letzter Woche ohnehin die strenge medizinische Anweisung, einen Monat lang auf Kaffee zu verzichten – und auch darüber hinaus seinen »exzessiven Kaffeekonsum«, so die Worte seines resoluten Hausarztes Docteur Garreg, »drastisch einzuschränken«. Garreg hatte (zum wiederholten Mal) eine akute Entzündung der Magenschleimhaut diagnostiziert, eine schmerzhafte Gastritis, Typ C. Und so fühlte es sich auch an: schmerzhaft. Doch Garreg hatte nicht bloß eine Gastritis bei Dupin festgestellt, sondern grundsätzlich eine »ernsthafte medizinische Koffeinabhängigkeit mit prototypischer Symptomatik«. Was lächerlich war. Und: Das Kaffeeverbot war eine albtraumartige Anweisung für Dupin, die imstande war, ihn, nähme er sie vollständig ernst, psychisch in eine schwerwiegende Krise zu stürzen, ungleich schwerwiegender als irgendwelche gar nicht bestehenden Abhängigkeitssymptome. So hatte er sich mit sich selbst auf einen petit café am Morgen geeinigt und auf die Formel, dass ein kleiner Kaffee kein Kaffee war.
»Ich – nein, ich bin …«
»Ich kann die Pinguine hören.«
Nolwenn hatte ganz ohne Ironie gesprochen. Manchmal beschlich ihn das Gefühl, dass sie ihn mit einem GPS-Sender markiert hatte, es wäre ihr zuzutrauen.
»Monsieur le Commissaire, das Seminar beginnt in genau drei Minuten.«
»Ich weiß.«
»Gut. Riwal muss Sie noch sprechen. Es geht um den Einbruch in der Bank gestern Nacht.«
»Gibt es etwas Neues?«
Jemand hatte bei einem Einbruch in eine Bankfiliale eines winzigen Kaffs nicht bloß das Geld aus einem Automaten geklaut, sondern gleich den gesamten Automaten. Was schweres Gerät erforderte. Und insgesamt nicht nach einer klugen Idee klang.
»Inspektor Kadeg und er waren eben in der Bank. Sie sind gerade zurück.«
»Sagen Sie ihm, dass ich mich gleich aus dem Wagen melde.«
»Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen, Monsieur le Commissaire.«
Nolwenn legte auf.
Henri blickte weiterhin fragend zu ihm herüber.
»Nichts Wichtiges.«
»Ich muss los«, Henri orientierte sich Richtung Ausgang.
»Ja, ich auch.«
Dupin folgte seinem Freund. Mit gehöriger Unlust. Aber es half nichts. Er würde dieses Seminar über sich ergehen lassen müssen.
Das Wasser kam von überall, von der Seite, rechts, links, von vorne, von hinten, von schräg unten, manchmal und eher wie zufällig auch von oben. Dieser Regen war einzigartig: Es waren keine Tropfen, kein Regen, den man sah, es waren unendlich dünne, unendlich viele lange Fäden, Tentakel, die sich in die Kleidung hineinwanden, getrieben von wankelmütigen, ständig die Richtungen wechselnden Windbewegungen. Es waren nicht einmal Wolken zu sehen, der Himmel war eine nebulös-trist-graue Materie. Ein monotoner Block. Und er hing enorm tief. Was Dupin prinzipiell niederschmetternd fand und eigentlich in der Bretagne so gut wie nie vorkam, es würde alles perfekt zu dem Seminarzentrum passen. Zudem: Es roch nach Regen, die ganze Welt roch nach Regen. Muffig.
Die dreißig Meter vom Ausgang des Hauptgebäudes bis zum Einlasspavillon, wo Henri und er jetzt unterstanden, hatten gereicht, um buchstäblich bis auf die Unterwäsche nass zu werden. Früher, in Paris, war Regen einfach Regen gewesen, erst hier in der Bretagne hatte Dupin erfahren, was das war: echter Regen – das galt auch für die Wolken, den Himmel, das Licht. Für alle Elemente. Für alle Sinne. Er hatte gelernt, verschiedenste Arten von Regen zu unterscheiden, so wie die Bretonen es taten; wie die Eskimos mit dem Schnee. Noch schlimmer als der Fadenregen war der ausgeprägte, totale Sprühregen – le crachin –, von dem man noch weniger sah und ihn eigentlich nur dadurch wahrnahm, dass man innerhalb von Sekunden ebenfalls klatschnass war. Was Dupin aber vor allem gelernt hatte – eine an Tagen wie diesen zugegebenermaßen abstrakte Erkenntnis: dass es hier lange nicht so viel regnete wie das hartnäckige, hässliche Vorurteil es wollte. Letztens hatte er in einem Pariser Blatt gelesen: »In der Bretagne gibt es zwei Jahreszeiten – die kurze Zeit der langen Regenfälle und die lange Zeit der kurzen Regenfälle«; jede seriöse wissenschaftliche Statistik strafte solche verleumderischen Sätze Lügen. In der (südlichen) Bretagne fiel jährlich weniger Niederschlag als an der Côte d’Azur. Das alles Entscheidende aber war noch etwas anderes: Bretonen nahmen Regen in Wirklichkeit gar nicht wahr, eine lebensweise Haltung, fand Dupin. Nicht weil sie so sehr an Regen gewöhnt waren, nein, aus zwei gewichtigen Gründen: Es war eben nur das Wetter, und es gab Wichtigeres, das Leben zum Beispiel – nie käme man hier auf die Idee, eines der unzähligen Feste abzusagen, nur weil es regnete. Zudem widerstrebte es den Bretonen im Innersten ihres Wesens, sich etwas von »außen« diktieren zu lassen. Seien es zentralistische Pariser Pläne oder eben das Wetter. So war es zu einer der liebsten Redewendungen der Bretonen gekommen, mit der sie zur Attacke übergingen, wenn sich andere über den Regen beschwerten: »En Bretagne il ne pleut que sur les cons« – in der Bretagne regnet es nur auf Idioten. Bei stärkstem Regen vor die Tür zu gehen, ohne ihn überhaupt wahrzunehmen, hatte es für das fabelhafte Magazin Bretons sogar auf die Liste der zehn todsicheren Eigenschaften geschafft, an denen man einen Bretonen erkennt. Neben Dingen wie: Er macht ein Riesentheater, wenn die Butter nicht gesalzen ist; er sagt innerhalb der ersten zwei Minuten einer Begegnung: »Trinken wir ein Glas?« oder er holt seinen Gwenn ha Du aus der Tasche – die bretonische Flagge –, sobald mehr als zwanzig Menschen zusammenkommen, um eine bretonische Versammlung daraus zu machen.
Henris und Dupins Autos standen nebeneinander, vorne in der ersten Reihe des kolossalen Parkplatzes, der jetzt, in der Woche vor Ostern, an einem gewöhnlichen Dienstag um siebzehn Uhr, fast ausgestorben war.
Wieder ertönte das laute gleichförmige Piepsen.
»Großartig.«
Dupin holte das Telefon aus der Jeans, das Display voller Schlieren, hoffentlich war das Gerät wasserfest; durchschnittlich kam er auf einen Verbrauch von mindestens zwei Handys im Jahr, dies hier war erst einen Monat alt, das erste Smartphone des Kommissars, eine kleine Revolution, die Nolwenn angezettelt hatte.
Dupin sah Riwals Nummer. Natürlich. Aber jetzt passte es gar nicht. Sie mussten los.
»Ich will nicht zu spät kommen, Georges«, Henri machte sich zum zweiten Sprint dieses Tages bereit, zwanzig Meter waren es schätzungsweise noch bis zu den Autos. »Ich muss mein Plädoyer für den bretonischen Speck halten. Ich will ihn unbedingt durchkriegen. Nichts trägt so viel Geschmack! Besonders der von Terre et Paille aus Bossulan.«
Es machte wirklich keinen Sinn zu warten, ob die Böen nachlassen würden.
Dupin ließ es klingeln. Der Anruf würde an Nolwenn weitergeleitet. Henris Satz hatte ihm trotz aller widrigen Umstände das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. Bei Henris Treffen ging es um die jährliche zeremonielle Abstimmung, welche Lebensmittel oder Gerichte Thema der diesjährigen »Semaine du Goût«, der »Woche des Geschmacks«, würden. Eine Woche lang wurden dann in Schulen, in Kindergärten, in Kantinen und auch in Restaurants vier, fünf Lebensmittel »gefeiert«. Eine Hommage an die schier unendlichen sinnlichen Schätze Frankreichs.
»Mit dem Speck beginnt alles!«, fürs Schwärmen hatte Henri offenbar doch noch Zeit. »In einem großen Schmortopf den Speck in gesalzener Butter anbräunen und mit etwas Waldhonig leicht karamellisieren: Für ein Friko Kaol, ein bretonisches Cassoulet, ist der Speck der wichtigste Bestandteil – neben geräucherten Würsten, Kartoffeln, Zwiebeln und Wirsing aus Lorient – hmmm, mein Gefühl sagt mir, dass ich ein paar gute Ideen haben werde.«
»Mich interessiert jede einzelne.«
Wieder das durchdringende monotone Piepsen.
Noch einmal Riwal.
Dupin zögerte. Vielleicht sollte er doch rangehen.
»Komm bald mal wieder vorbei«, und mit diesen Worten stürzte Henri in die Flut hinaus, »Salut Georges!«
»Bis dann, Henri!«, rief Dupin und hatte das Telefon schon am Ohr.
»Gerade ist es schlecht, Riwal. Wir …«
»Es geht um den Einbruch in der Bank. Sie haben …«
»Wir telefonieren später, Riwal.«
»Sie haben versehentlich das Banking-Terminal geklaut, nicht den Geldautomaten!«
»Was?«
»Sie wissen ja, die beiden Automaten sehen identisch aus, an dem einen holt man das Geld, an dem anderen erledigt man seine Bankgeschäfte. – Von den Tätern fehlt weiterhin jede Spur.«
»Sie haben – den Kontoauszugsdrucker geklaut?«
»Das ist nicht bloß ein Drucker, man …«
»Absurd.«
»Man kann zum Beispiel auch Überweisungen vornehmen oder …«
»Wir sprechen morgen darüber.«
»Gut, ich wollte nur, dass Sie Bescheid wissen, ich …«
Ein lauter Schlag war am anderen Ende zu hören, wie von einer Tür, die mit Gewalt aufgeworfen wurde, Riwal brach seinen Satz jäh ab.
Einen Augenblick passierte gar nichts, dann konnte Dupin eine Stimme hören, äußerst deutlich. Dynamisch. Ein Kommandoton. Kadeg. Sein zweiter Inspektor.
»Sofort auflegen. – Wir müssen umgehend den Kommissar benachrichtigen. Auf der Stelle. Ein Notfall«, Dupin konnte Kadeg einwandfrei verstehen: »Wir haben eine Leiche! Blutverschmiert. – Nicht weit vom Belon, im Gras neben einem kleinen Parkplatz. Unten an der Pointe de Penquernéo. Wenn man von Port Belon den Fluss entlang zur nahen Mündung geht, auf dem oberen Fußweg, der nach Rosbras führt«, Kadegs militärische Art war seiner – ebenso typischen – umständlichen Übergenauigkeit gewichen, »da kommt doch ein großes Feld, und von rechts …«
»Was?«, rief Dupin. »Riwal, was ist los?«
»Ich – Kadeg kam gerade hereingestürzt und hat berichtet …«
»Auflegen!«, Kadeg schien nun unmittelbar neben Riwal zu stehen. Und aus voller Kehle in den Hörer zu brüllen.
»Kadeg, das ist doch der Chef!«, wehrte sich Riwal verzweifelt. »Der Chef ist schon am Apparat!«
»Riwal, geben Sie mir Kadeg«, befahl Dupin.
Im nächsten Augenblick war der zweite Inspektor am Telefon.
»Monsieur le Commissaire? Sind Sie es?«
»Wer sonst, Kadeg? Was ist passiert?«
»Ein Mann, er liegt …«
»Wer ist der Mann? Was wissen wir?«
»Nichts. Wir wissen noch gar nichts. Der Anruf ging eben gerade ein, ein Kollege aus Riec-sur-Bélon. Eine alte Dame war mit ihrem Hund spazieren. Und hat einen Mann in komischer Haltung regungslos daliegen sehen, mit Blut, wie sie sagt. Sie ist, so schnell sie konnte, zu einem Restaurant, weil das näher lag als ihr Haus, und hat von dort aus angerufen. La Coquille, das ist …«
»Ich kenne das La Coquille.«
Kadeg ließ eine überflüssige Pause entstehen.
»Und?«
»Nichts. Das ist alles, was wir wissen. Zwei Kollegen aus Riec sind schon unterwegs, sie müssten in wenigen Minuten da sein.«
»Ich – gut. Ich will einen sofortigen Bericht. Ich mache mich umgehend auf den Weg. In einer Dreiviertelstunde bin ich da. Ich sehe Sie beide dort – Riwal und Sie. Rufen Sie mich an, sobald Sie mehr wissen.«
»Wird gemacht, Monsieur le Commissaire.«
»Und sagen Sie Nolwenn, sie soll mir sofort die genauen Angaben zu diesem Parkplatz durchgeben. Wo die Leiche liegt.«
»Wie gesagt, oben auf den Klippen, wenn …
Dupin legte auf.
Einen Augenblick stand er regungslos da.
»So ein Scheiß.«
Dann lief er schnellen Schrittes zu seinem Auto. Immerhin würde er das Seminar verpassen, und es war noch nicht mal seine Schuld.
Dupin hatte gerade den letzten rond-point vor der »Vierspurigen« mit hundert Stundenkilometern genommen, was den alten Citroën XM spür- und hörbar an seine physikalischen Grenzen gebracht hatte. Gleich wäre er auf der »bretonischen Autobahn«, der Vierspurigen, und würde erst in Riec wieder abfahren. Nolwenn hatte sich bereits gemeldet, die kleinen Sträßchen auf dem Vorsprung der Belon-Mündung hatten – wie immer – keine Namen. Sein Navigationssystem würde nicht weiterhelfen. Sie hatte ihm eine erste grobe Orientierung gegeben, er würde sie später noch mal anrufen. Spurensicherung und Gerichtsmedizin waren unterwegs. Nolwenn und er hatten nicht lange gesprochen, Dupin hatte die Leitung nicht blockieren wollen. Die Scheibenwischer rasten aufgeregt hin und her und machten ihre Arbeit dennoch mehr schlecht als recht, eigentlich sollte er langsamer fahren.
Das tiefe Brummen ertönte erneut, das Autotelefon, fast so alt wie der Wagen.
Dupins Finger fuhren auf die winzigen Tasten.
»Chef, hören Sie mich?«
»Einwandfrei, Riwal.«
»Sie können wieder umkehren! Doch keine Leiche. – Falscher Alarm.«
»Bitte?«
»Es gibt anscheinend doch keine Leiche, Chef.«
Dupin saß kerzengerade.
»Sie machen Witze, oder?«
»Die beiden Kollegen aus Riec sind am Parkplatz. Dort, wo die Leiche liegen sollte. Aber da ist nichts. Keine Leiche, kein Toter, kein Verletzter. Niemand. – Es sind keinerlei Spuren zu sehen. Auch kein Blut.«
Dupin hatte den Fuß ein wenig vom Gaspedal genommen. Ein klein wenig.
»Was soll das bedeuten?«
»Im Moment können wir …«
»Haben Sie mit der alten Dame gesprochen, die den Toten gesehen hat? Wer ist sie? Was wissen wir über sie?«
Das konnte doch nicht wahr sein.
»Eine ehemalige Schauspielerin. Sophie Bandol. Sehr berühmt. Sie wohnt in Port Belon, am Rande des Ortes. Sie ist anscheinend etwas exzentrisch. Und manchmal verwirrt. Hat der Kollege gesagt.«
»Sophie Bandol? Sophie Bandol lebt in Port Belon?«
Das war unglaublich. Dupin verehrte sie. All ihre Filme. Sie war eine der großen französischen Schauspielerinnen des 20. Jahrhunderts, der goldenen Jahre, in einer Reihe mit Jeanne Moreau, Catherine Deneuve, Brigitte Bardot, Isabelle Huppert.
Aber er hätte sie an der Côte d’Azur oder in Paris vermutet.
»Ja. Lange schon. Auch wenn sie nicht von hier ist. – Pariserin.«
Es war auch nebensächlich.
»Ist sie bei den Polizisten?«
»Ich denke nicht.«
»Vielleicht sind die Kollegen nicht am richtigen Ort.«
»Sie kennen jeden Winkel dort. Und die Beschreibung war äußerst genau. Madame Bandol macht dort anscheinend täglich ihren Spaziergang.«
»Ich will mit ihr sprechen, Riwal. – Sie soll zum Parkplatz kommen. Umgehend. Ich bin gleich da.«
»Ich – gut. Ich sage den Kollegen Bescheid. Kadeg und ich sind kurz vor Trégunc, sollen wir denn überhaupt …«
»Unbedingt! Ich will alle sehen. Vor Ort.«
»Vielleicht hatte sich jemand verletzt. Und wollte sich nur kurz erholen. Und ist dann nach Hause gegangen. – Könnte doch sein.«
Dupin schnaufte.
Das könnte sein.
»Oder – Sophie Bandol ist ja schon ziemlich alt, bestimmt achtzig, vermute ich, da hat man manchmal Anwandlungen …«
»Sie meinen, dass sie nicht mehr ganz bei Sinnen ist? Dass sie sich das eingebildet hat?«
»Wäre doch möglich.«
Es wäre theoretisch möglich. Natürlich.
»Wie nah war die Schauspielerin an der Leiche?«
»Das weiß ich nicht. – Wie gesagt, es scheint gar keine Leiche zu geben.«
»Vielleicht ist die Leiche verschwunden?«
»Verschwunden?« Riwal klang ratlos. Und auch ein wenig so, als würde er am Verstand des Kommissars zweifeln.
»Bis gleich, Riwal.«
Im nächsten Moment hatte Dupin aufgelegt.
Er lehnte sich im Autositz zurück.
Selbst wenn es tatsächlich falscher Alarm gewesen sein sollte, es gar keine Leiche gegeben hatte, überhaupt kein polizeilich relevantes Ereignis, so musste dies, nach einer einmal eingegangenen Meldung, erst zweifelsfrei festgestellt werden. Es bedurfte einer formellen Bestätigung. Er kam also gar nicht umhin, sich den angeblichen Tatort anzusehen. Theoretisch könnte er dies freilich an seine Inspektoren delegieren. Aber dann würde er zum Seminar zurückmüssen. Außerdem gab es die verrücktesten Geschichten.
Dupin trat das Gaspedal bis zum Anschlag durch.
Fünfunddreißig Minuten später quietschten die Reifen des Citroëns beim Bremsen auf dem brüchigen Asphalt des kleinen Parkplatzes unterhalb von Goulet-Riec.
»Danke, Nolwenn. Ich bin jetzt da. Ich melde mich später.«
Dupin legte auf. Nolwenn hatte ihn wie immer perfekt geleitet.
Auf der Höhe von Quimper war es mit einem Mal unerwartet heller geworden, das niederschmetternde Grau immer dünner und durchscheinender, je näher er dem Meer gekommen war. Der Regen hatte aufgehört. Bei der Abfahrt von der Vierspurigen war das Grau aufgerissen und hatte einen hellsilbrigen magischen Himmel freigegeben, zart, ganz klar, kristallin, das war das Wort; eine Farbe, ein Ton, den es nur im Frühjahr gab. Die verschiedenen Jahreszeiten besaßen ihre eigenen Himmelsfarben, jeder einzelne Monat.
Der Wetterwechsel hätte bretonischer nicht sein können, Dupin hätte geschworen, dass der triste Regen sich für Tage festsetzen würde; wirklich alles hatte danach ausgesehen und sich so angefühlt.
Am Ende des Parkplatzes standen rechts drei Polizeiwagen. Die beiden Peugeots seiner Inspektoren – Kadeg und Riwal hatten die Angewohnheit, prinzipiell in ihren eigenen Wagen zu fahren –, der dritte musste den Kollegen aus Riec gehören. Dupin hatte ein Stück vor dem Parkplatz gehalten, auf dem schmalen grasbewachsenen Seitenstreifen, halb auf der Straße.
Niemand war zu sehen.
Der Kommissar stieg aus, blieb einen Moment stehen und atmete tief ein.
Wunderbar. Alles war zurück, die Weite, der Himmel, das Licht. Und es roch besonders intensiv. Der Atlantik war nah.
Man schmeckte noch hier am Fluss das Salz in der Luft, roch Algen, Tang, Mineralien. Dupin hatte sich im Zuge seines letzten großen Falls mit der genauen Zusammensetzung des Meerwassers auseinandersetzen müssen und war sehr beeindruckt gewesen, kein Wunder, dass hier das Leben entstanden war. Man konnte hören, wie die Wellen auf die Felsen krachten. Bei Seewind hörte man sie über große Entfernungen. Jede einzelne Welle. Wenn Dupin irgendetwas auf dieser Welt je zu tiefer Ruhe bringen könnte – was in diesem Leben nicht passieren würde –, dann wäre es eine Wellen-Meditation.
Dupin lief zur Mitte des etwas abschüssigen Parkplatzes.
Am Ende ging ein Weg ab zu einem ansteigenden Pfad, zwischen knorrigen Eichen hindurch, die grell zu knospen begonnen hatten. Zwei schmale, steinige Wege führten auf die Klippen zum Meer, windschiefe Weißdornbüsche und einzelne Pinien waren zu sehen, vor allem aber knallgelber Ginster. In diesen Wochen stand er in herausfordernder Blüte, weitflächige struppig-buschige Tupfer überall in der Landschaft. Und hinter dem Ginster: ein breiter, kräftiger blaugrüner Streifen, der Atlantik. Keine hundert Meter entfernt. Und darüber das kristalline Blau. Ein nahezu übernatürliches Licht.
Dupin schaute sich noch einmal um. Auch von hier aus war niemand zu sehen. Nichts rührte sich. Der Parkplatz war zweifelsohne ein einsamer Ort, landeinwärts durch meterhohes Gestrüpp zugewachsen, dahinter ein Wäldchen.
Im Gras neben dem Parkplatz, hatte Kadeg gesagt. Intuitiv suchte Dupin mit seinen Blicken den Boden ab, auch wenn es unsinnig war. Er hatte keine Ahnung, wo genau die famose Schauspielerin die Leiche gesehen haben wollte. Der Asphalt war nass, bis vor Kurzem hatte es auch hier geregnet, er glänzte in der Sonne.
Dupin wählte Riwals Nummer. Nichts. Kadegs Nummer. Nichts. Das Telefon zeigte zwei stabile Balken. Warum nahmen sie nicht ab? Vielleicht hatten sie keinen Empfang.
Dupin überlegte kurz und steuerte dann auf den erdigen Pfad zu, zwischen den Eichen entlang, die immer enger standen.
Der Pfad führte den Hügel hinauf, unerwartet steil. Dupin war fast oben angelangt. Hier veränderte sich die Landschaft mit einem Mal. Der urtümlich keltische märchenhafte Eichenwald wich einer sanft geschwungenen Wiese, versehen mit Dutzenden von frischen Maulwurfshügeln, die nach schwerer Erde rochen, und vereinzelten Apfelbäumen. Eine milde bilderbuchähnliche Landschaft, »les terres« nannten die Bretonen sie, harmonische Formen, friedlich, beschaulich, ganz anders als die harschen Klippen, die Gewalt des Ozeans. So verschiedene Landschaften, so nah beieinander.
Das hügelige Plateau lag zwischen der Mündung des Avens und des Belons, zwei mythischen Flüssen, Fjorden eigentlich, die in derselben ausgefransten Bucht ins Meer mündeten, der eine von Nordwesten, der andere von Nordosten her. Mit ihren breiten Einschnitten tief ins Land ließen sie ein gleichmäßiges Dreieck entstehen. Eine Dreiviertelinsel gewissermaßen. Sie schufen ein eigenes geschütztes Territorium, das nur von Norden aus zu erreichen war, auf winzigen Sträßchen zwischen Pont-Aven und Riec-sur-Bélon.
Keine Spur von irgendjemandem, auch hier oben nicht.
Dupin kehrte um.
Und war im Nu zurück am Parkplatz. Er würde es mit einem der Wege Richtung Meer versuchen.
Plötzlich hörte er Stimmen, wenn auch undeutlich. Wenig später konnte er sehen, wie sie den Weg entlangkamen: seine beiden Inspektoren, eine weitere Polizistin und ein Polizist, die Dupin nicht kannte.
»Wo ist die Schauspielerin?«
Dupin hatte weder mit einem Wort noch mit einer Geste gegrüßt, sein Ton war brummiger gewesen, als er beabsichtigt hatte.
»Sie wollte unbedingt zurück nach Port Belon, sie hat gefroren«, hielt Kadeg genussvoll dagegen. »Wir konnten die alte Dame ja nicht zwingen, hierzubleiben, bis Sie von den Pinguinen zurück sind.«
Riwal kam einer Reaktion Dupins zuvor, die eine sichere Eskalation bedeutet hätte:
»Sie hat uns die Stelle gezeigt, wo – sie glaubt, die Leiche gesehen zu haben. Dann haben wir sie ins La Coquille gebracht«, er blieb betont sachlich.
»Und der Tote ist nicht wieder aufgetaucht?«
»Nein, Chef.«
»Zeigen Sie mir die Stelle, wo Sophie Bandol den Mann gesehen hat.«
»Folgen Sie mir«, die junge Polizistin mit blondem Pferdeschwanz und blitzenden grünen Augen hatte unversehens übernommen und einen scharfen Bogen nach links eingeschlagen.
Sie gingen bis vorne, wo der Parkplatz begann – vielleicht fünfundzwanzig Meter lang, fünfzehn Meter breit –, die Gestrüppmauer bildete hier eine Art Nische. Das wilde, buschige Gras war knöchelhoch.
»Hier«, die Polizistin zeigte auf die Stelle, einen halben Meter vom Asphalt entfernt, direkt vor dem dichten Gestrüpp.
»Der Kopf des Mannes war wohl seltsam abgeknickt. Und sie hat Blut gesehen, sagt Madame Bandol. Ich habe alles mit einer Schnur markiert.«
Erst jetzt sah Dupin sie. Eine Nylonschnur. Parallel zur Asphaltkante.
»Das, äh – das ist unsere – neue Kollegin. Polizistin. Sie ist – noch neu, ich denke, das wäre eher die Arbeit der Spurensicherung gewesen«, stammelte jetzt der ältere Polizist, Ende fünfzig, schätzte Dupin, und auf den ersten Blick durchaus sympathisch, »mein Name ist – Erwann Braz. Sie wissen – es ist äußerst ungewiss, ob es hier überhaupt einen, äh – verfolgenswerten Vorfall gab. Wir haben uns alles genau angesehen und nichts entdecken können. – Es ist mir übrigens eine Ehre, Monsieur le Commissaire, Sie kennenzulernen.«
Den letzten Satz hatte er mit peinlich unterwürfigem Ausdruck gesprochen. Das war es mit der anfänglichen Sympathie gewesen. Dupin konnte Schleimerei nicht ausstehen.
»Ich denke, dass die Kollegin«, Dupin blickte die Polizistin direkt an, »Magalie Melen« kam es wie aus der Pistole geschossen, »dass Kollegin Melen das vollkommen richtig gemacht hat.«
Magalie Melen machte nicht den Eindruck, als ob sie die Unterstützung des Kommissars gebraucht hätte.
»Hat Sophie Bandol das Gesicht des Mannes sehen können?«
Melen übernahm erneut das Antworten:
»Nein, wegen der verrenkten Haltung und weil sie in einiger Entfernung stehen geblieben ist.«
»Und wo hat sie das Blut gesehen?«
»Sie konnte es nicht sagen.«
Ein Wagen war zu hören, alle drehten sich um. Ein protziger Geländewagen. Dupin erkannte ihn sofort: René Reglas. Sein Lieblingspathologe. Der Mister Universum der Forensik. Unerträglich. Dupins kleine Glückssträhne, eine Zeit lang um ihn herumgekommen zu sein, war am heutigen Tag zu Ende gegangen.
»Na bravo.«
»Madame Bandol kam dort vom Hügel«, fuhr Melen unbeirrt fort, sie deutete auf den Pfad, den Dupin eben genommen hatte. »Sie sagt, sie habe den Körper erst spät gesehen, ihr Hund habe plötzlich heftig gebellt. Sie sei aber nicht näher als vier, fünf Meter herangegangen. Sie hat uns gezeigt, wo sie stehen geblieben ist. Sie sagt, der Hund sei schon dort vollständig außer sich geraten. Sie hatte Angst, dass er an die Leiche geht«, Melen schien unschlüssig zu sein, »und sich vielleicht ansteckt.«
»Ansteckt?«
»Ja, das hat sie gesagt.«
»Sie ist eine alte Dame«, vermittelte Riwal, »das alles hat ihr sicher Angst gemacht.«
»Es ist bekannt, dass sie manchmal verwirrt ist. Desorientiert. Sicherlich bereits eine Form von Altersdemenz. Abgesehen von ihrem grundsätzlich etwas verschrobenen, schrulligen Wesen«, schaltete sich Erwann Braz ungeduldig ein.
»Wer sagt das? Woher wollen Sie das wissen?«, fragte Dupin harsch.
»Das ist gemeinhin bekannt. Sie hat sich bereits in den letzten Jahren ein paarmal wegen vermeintlicher Diebstähle an die Polizei gewandt. Lappalien. Und nie gab es irgendetwas Stichhaltiges. Einmal war ein großer Findling aus ihrer Einfahrt verschwunden. Wir kennen sie auf der Gendarmerie.«
Wenige Wendungen machten Dupin – sein Leben lang schon – wütender als »Das ist gemeinhin bekannt …«
»Der Findling war tatsächlich weg«, hielt Magalie Melen unerschrocken dagegen.
»Sehen Sie«, fügte Dupin erfreut hinzu.
Kadeg brachte erstaunlicherweise Sachlichkeit in das Gespräch zurück:
»Wir haben die Umgebung inspiziert, Commissaire. – Nichts Auffälliges.«
»Na, dann steht der forensische Befund ja schon fest! Sensationell! Und wir hätten uns den Weg sparen können«, Reglas war von hinten an die kleine Gruppe herangetreten. »Die Polizei erledigt die Arbeit der Spurensicherung heutzutage gleich mit. Höchst bemerkenswert!«
Reglas wurde von seinem Team begleitet; zwei Jüngelchen, die sich genauso großartig und unbesiegbar fühlten wie er.
»Ich will sofort alle Wagen vom potenziellen Tatort entfernt sehen. Darunter verstehe ich den gesamten Parkplatz. Jeder einzelne Wagen, der hier steht, ist ein Verstoß gegen die Dienstordnung. Sie haben vielleicht bereits entscheidende Spuren kontaminiert.«
Reglas und sein Team stellten ihre stattlichen silbernen Koffer synchron ab und öffneten sie. Weder die beiden Polizisten aus Riec noch Dupin und seine Inspektoren reagierten auf die Aufforderung des Forensikers.
»Es hat«, sagte Riwal unbeeindruckt, »unter Umständen gar keine Leiche gegeben.«
»Wir verfügen über keinen einzigen seriösen Beweis«, disqualifizierte sich der ältere Polizist erneut.
»Zunächst«, Kadeg blieb bei seiner erstaunlichen Sachlichkeit, »liegt eine bisher nicht widerlegte Aussage vor, dass hier eine Leiche gelegen hat. An der Blut zu sehen war. Auch wenn sie jetzt nicht mehr vorhanden ist. Wofür es Gründe geben könnte – der Mörder hat sie möglicherweise einfach entsorgt.«
»Zeigen Sie mir, wo die Leiche gelegen haben soll.« Auch Reglas beherrschte das Unbeeindrucktsein.
Der ältere Polizist schaute unterwürfig fragend zu Dupin, der die Augenbrauen hochzog und mit den Schultern zuckte.
»Hier, behauptet die alte Dame, die die Aussage gemacht hat«, Braz zeigte Reglas die Stelle.
»Das hier ist eine auratische Gegend«, sagte Riwal plötzlich dunkel-mysteriös – er war bekannt für diese Neigung, der eine höchst praktische Seite gegenüberstand –, alle Köpfe drehten sich unvermittelt zu ihm um. Dupin war froh, dass niemand nachfragte, auch die beiden Kollegen aus Riec nicht. Im nächsten Moment zog Kadeg wieder die Aufmerksamkeit auf sich:
»Mein Informant vermutet, dass am Plage Kerfany-les-Pins und am Plage de Trenez in den letzten Tagen Sand abtransportiert worden ist. Das ist ganz in der Nähe.«
Großartig. Das hatte gerade noch gefehlt. Seit Wochen lag Kadeg Dupin und dem gesamten Kommissariat mit diesem Thema wie ein Besessener in den Ohren: der Sandraub. Dupin konnte es nicht mehr hören, auch wenn Nolwenn ihm nachdrücklich vermittelt hatte, dass er das Thema nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Fälle von Sandraub kamen tatsächlich immer wieder vor, an manchen Küsten sogar in großem Stil. Sand war, entgegen dem allgemeinen Empfinden, ein extrem kostbarer, fast universeller Rohstoff und wurde in großen Mengen zu verschiedensten Zwecken gebraucht: für Beton, Mörtel, Glas, Papier, Plastik, vor allem das Silicium im Quarzsand war essenziell für Mikrochips, für Computer, Handys und vieles mehr. Kadeg hatte Fakten rauf- und runtergebetet: Zweihundert Tonnen Sand brauchte man für den Bau eines einzigen Hauses, dreißigtausend Tonnen für einen Kilometer Autobahn. Siebzig Prozent aller Strände der Welt waren, so eine vorsichtige Schätzung, bereits Opfer der Industrie geworden. Der allergrößte Teil auf illegale Weise. Der Sand wurde in gewaltigen Mengen von kriminellen Banden und Unternehmen geklaut. Ein globales Phänomen, hatte Dupin gelernt, das auch die Bretagne betraf und katastrophale ökologische Folgen zeitigte. Vor ein paar Jahren hatte sich ein kämpferischer Verein gegründet, um öffentlichkeitswirksamen Widerstand zu leisten zum Schutz der Strände: le peuple des dunes, das Volk der Dünen. Nolwenn hatte Dupin dazu einen großen Artikel auf den Tisch gelegt: »La guerre du sable« – der Krieg um den Sand.
So dringlich das Thema auch sein mochte – nicht hier und nicht in diesem Moment.
»Jetzt nicht das mit dem Sand, Kadeg! Wir haben andere Sorgen.«
»Sie wissen, dass an den wilden Stränden bei Kerouini und Pendruc über zwei Jahre lang Sand geraubt wurde, bis man es überhaupt bemerkt hat. Den Täter hat man rein zufällig erwischt.«
Kadeg war fanatisch. Auch wenn es stimmte: Ein geschickt begangener Sandraub war schwer festzustellen. Die Täter fuhren in Ebbenächten mit Lastern zu einsamen Stränden, und am nächsten Morgen hatte die Flut alle Spuren beseitigt. Sogar das Fehlen stattlicher Mengen bemerkte niemand, schon deswegen nicht, weil das Meer bei größeren Fluten und Stürmen häufig gigantische Sandmengen mit sich nahm – und manchmal erst nach Tagen wieder zurückbrachte und sie eventuell an völlig anderen Stellen ablegte. Oder nur einen Teil davon. Und den anderen behielt. Es passierte viele Male im Jahr. Dupin hatte jedes Mal Sorge, dass es seinen Lieblingsstrand treffen könnte – dass der Sand eines Tages einfach nicht zurückkäme. Es war verrückt, wie das Meer unablässig neue Landschaften schuf, mal war eine weite Bucht voller feinstem Zuckersand und lief flach über einen halben Kilometer ins Meer, mal war dieselbe Bucht steinig, felsig und lag zwei, drei Meter tiefer, ganz ohne Sand. Im Februar hatte ein Sturm an den Sables Blancs in Concarneau so viel Sand weggenommen, dass tagelang versteinerte Stämme eines jahrtausendealten Eichenwaldes zu sehen gewesen waren. Wie eine riesenhafte Installation hatten sie einen halben Meter aus dem schlammigen Boden geragt.
»Und Sie sehen einen Zusammenhang zwischen der Leiche, die Madame Bandol meint, gesehen zu haben, dem Verschwinden der Leiche und kriminellen Sandraub-Aktivitäten hier an der Küste?«
Dupin war der jungen Kollegin dankbar für diese präzise Frage. Auch wenn sie Kadeg nicht stoppen konnte.
»Ich denke, dass der Täter von Kerouini kein Einzeltäter war. Auch wenn der Bauunternehmer das behauptet. Dahinter steckt ein System. Ausgeklügelte organisierte Kriminalität. Eine Mafia! Gerade wurde im Senegal eine dieser Banden hochgenommen!«
»Im Augenblick scheint mir das eminent vage«, sagte Magalie Melen gelassen.
»Alle wollen ihn: Wir in der Bretagne haben den besten Sand der Welt. Reinster Granit. Darauf sind sie besonders scharf. Er ist ideal für alles, für …«
»Genug, Kadeg. Wir wissen Bescheid.«
»Ich will noch einmal darauf hinweisen, dass es immer noch mehr als fraglich ist«, Erwann Braz gab sich stur, »ob wir es hier überhaupt mit irgendetwas zu tun haben.«
»Um welche Uhrzeit genau will die alte Dame hier jemanden liegen gesehen haben?«, polterte Reglas dazwischen, er kniete ein paar Meter von ihnen entfernt auf dem Boden.
»Um kurz vor fünf, behauptet sie.«
»Exzellent. Da hat es sicher auch hier noch heftig geregnet.« Es klang so, als würde Reglas dies als persönliche Beleidigung empfinden. »Bei einem solchen Regen löst sich jede organische Spur innerhalb von Minuten auf, wir werden Bodenproben vornehmen müssen und auch dann vermutlich keine Chance haben.«
Dupin spürte, wie er immer unruhiger wurde.
»Ich werde selbst mit Madame Bandol sprechen.«
»Aber was sollen wir …«
Wie immer hatte Kadeg Einwände.
»Sie warten hier mit Riwal und den beiden Kollegen, bis Monsieur Reglas einen ersten Bericht für uns hat.«
Dupin hatte sich mit diesen Worten bereits ein Stück entfernt und ging zügig auf seinen Wagen zu.
»Aber wir …«
Kadeg war nicht still zu kriegen.
»Bis später.«
Dupin öffnete die Wagentür, stieg ein und trat mit dem Starten des Motors aufs Gaspedal, der Citroën machte einen Satz nach vorne.
Es war eine aberwitzige Situation. Nicht nur Kadeg mit seiner fixen Sandraub-Idee. Sondern auch die große Filmikone des 20. Jahrhunderts, die eine Rolle spielte; eine Leiche, die plötzlich wieder verschwunden war – und von der man in der Tat nicht wissen konnte, ob es sie überhaupt je gegeben hatte. Auch wenn Dupin die grandiose Sophie Bandol, nur weil sie alt war und anscheinend etwas eigentümlich, erst einmal nicht prinzipiell für unglaubwürdig hielt, stimmte es: Ältere Leute konnten zuweilen wirklich verwirrt sein.
Dupin liebte Port Belon, den verwunschenen, irgendwie aus der Zeit und Welt gefallenen winzigen Ort. Seinen Charme, seine Patina, sein Flair. Wie in einem dieser Filme aus den Siebzigern und Achtzigern, die das Leben an langen Holztischen in wilden Gärten an Flüssen, Seen oder am Meer feierten.
Port Belon lag in der Mündung des Belons, der hier, nur noch ein paar Hundert Meter vor dem offenen Atlantik, bereits sehr breit war. Bei Flut schob der Atlantik sein Wasser kilometerweit ins Land hinein. Von der anderen Seite, vom Land, kam der Belon, der als Bach durch bilderbuchartige Wiesen und Wälder floss, über dunkle, nährstoffreiche Böden, von denen er immer ein wenig mittrug. Bei Le Guily, wo es noch acht Kilometer bis zum Meer waren, floss er als kleiner Bach unter einer malerischen Brücke hindurch und war auf der anderen Seite jäh ein Fluss, ein Meeresfluss. Süße und salzige Wasser mischten sich in immer wechselnden Verhältnissen. Und etwas Einzigartiges entstand.
Ein Geheimnis, ein Geschenk. Meer und Fluss, das war das Besondere dieses Ortes, etwas, das man in der Luft, in den außergewöhnlichen Gerüchen, wahrnahm und schmeckte: eine einzigartige Mischung aus Land – mit grünen Wiesen, Gräsern, Blumen, Feldern, dem Geschmack schwerer Böden und feuchtem Wald –, Fluss und, je nach Windrichtung und Windstärke, salzig-jodigem Meer.
Der Ort verbarg sich inmitten eines dichten bretonischen Wäldchens auf einem spitzen, flachen Vorsprung, ein Wäldchen wie das bei den Klippen am Parkplatz, uralt, voller Efeu und Misteln. Entlang der einzigen Straße, die nach Port Belon führte, wuchsen hohe Baumkronen über der Straße zusammen und bildeten einen dunkelgrünen Tunnel.
Mehr als ein Dutzend Häuser waren es nicht, die hier standen, weiß oder aus hellem Granit, und zwei jahrhundertealte Gutshäuser, regelrechte Châteaux, mit anarchischen Gärten, aus denen einzelne buschige Palmen herausragten. Man sah den Anwesen die alte Pracht noch an, aber man sah auch die Zeit, die vergangen war, allgegenwärtiger Efeu und abblätternde Farbe. Das Flair der Verwitterung, der Vergänglichkeit.
Dupin hatte seinen Wagen auf dem Parkplatz ein wenig oberhalb stehen lassen und war zu Fuß zum Ort hinuntergelaufen, wie er es immer tat; die schmale Stichstraße hinunter, die geradewegs auf das Wasser zuführte und unvermittelt auf einem kleinen Quai endete.
Dupin liebte es, hier zu stehen. Auf der Mole, direkt am Wasser. Eine steile Treppe mit einem unendlich verrosteten Gerüst führte zum Fluss hinunter, bei Flut direkt ins Wasser hinein.
Gegenüber, auf der anderen Seite des Flusses, lag Belon, ebenfalls nur ein paar Häuser, weiß mit atlantikblauen Fensterläden und dunklen Schieferdächern. Auch sie eingebettet in zart grünende Wälder an sanft hügeligen Ufern, Eichenwälder wie auf der Seite Port Belons, hier und dort einzelne hoch aufragende Pinien und Kiefern dazwischen. Auf dem glatten, jetzt dunkeltürkisfarbenen Wasser des Flusses schaukelten ein paar der lokalen Fischerboote gemächlich hin und her, in kräftigen Farben, Orange, Grellgrün, Gelb, Türkis, Signalrot. Au Large, Horizont, Dauphin hießen sie, eines L’Espoir II; und jedes Mal dachte Dupin melancholisch darüber nach, was die traurige Geschichte der »ersten Hoffnung« gewesen sein mochte.
Es war noch Ebbe, tiefe Ebbe, der Belon war jetzt wirklich ein Fluss, man sah die Strömung Richtung Meer. Große Flächen lagen zu beiden Seiten frei, Sand und Schlick, die die Sonne grell spiegelten. Ausgedehnte unruhig blitzende Landschaften entstanden. Traumartige schwarz-weiße Szenerien, das gleißende Licht blendete so sehr, dass es der Landschaft die Farben nahm. Hunderte Künstler hatten diese unvergleichliche Natur festgehalten. Als bizarre dunkle Schatten sah man von hier aus, was den zauberhaften Ort seit dem 19. Jahrhundert so berühmt gemacht hatte, legendär, musste man sagen, nicht nur in der Bretagne und Frankreich, sondern überall auf der Welt: die Austernparks. Die weitläufigen Austernparks, die bei Flut im Wasser versanken.
Port Belon war – neben Cancale im Norden – das Mekka der Austern, der »Huîtres«, und der Kunst ihrer Zucht und Veredelung, der »Ostréiculture«. Die bretonische Austernzucht war hier überhaupt erst entwickelt worden und die Belon-Austern auf der ganzen Welt ein Mythos; in den besten Bars und Restaurants schlürfte man sie, in Tokio, in New York, in Rom, in London, natürlich in Paris. Hier kamen sie her. Und doch war alles hier vollkommen unprätentiös, unaufgeregt. Es war wie mit den Dörfern in der Champagne: Solch exklusive Delikatessen ließen einen wer weiß wie noble Orte erwarten, und dann waren sie ganz bodenständig.
Port Belon war nicht schick, aber dafür umso schöner. Man stieg aus dem Wagen und spürte ihn: einen Zauber. Manche Orte hatten ihn. Der Kommissar führte eine persönliche Liste der Orte, die ihn froh machten, glücklich, auch wenn es ein großes Wort war; man musste sie sich suchen im Leben. Erst vor ein paar Wochen war er mit Claire hier gewesen, wie fast jedes Mal, wenn sie übers Wochenende kam (als Normannin war sie verrückt nach Austern). In letzter Zeit hatten sie sich überhaupt seltener in Paris getroffen, immer häufiger war Claire nach Concarneau gekommen. Was Dupin gefreut hatte, so kamen sie um die obligatorischen, zeremoniellen Besuche bei seiner Mutter herum. Claire war sogar unter der Woche gekommen, wenn sie wieder einmal ein Wochenende lang in der Klinik durchgearbeitet hatte. »Ich will eine Vorstellung davon haben, wie das normale Leben hier so ist. Dein Alltag«, hatte sie gesagt. Sie waren spätnachmittags bei prächtiger Sonne und frischem Wind am Ufer des Belons entlanggelaufen, einer der herrlichsten Spaziergänge, die Dupin kannte, und waren dann mit einer wohligen Müdigkeit und von Wind und Sonne geröteten Wangen eingekehrt. Hatten bis spätnachts gesessen. Gesessen, gegessen, getrunken, geredet und gelacht.
Dupin löste sich.
Hier konnte er unendlich lange stehen und schauen. Versinken dabei.
Aber nicht jetzt.
Das La Coquille lag nur ein paar Schritte entfernt, am Rand des Ortes, in einer letzten, scharfen Biegung des Fjordes. Das von drei betagten Schwestern geführte Restaurant war eine Institution, ein Paradies für Meeresfrüchte-Liebhaber.
Es waren erst ein paar Tische des Restaurants besetzt, das würde sich bald ändern. Dupin erkannte Sophie Bandol sofort, sie saß an einem der Fenster, die zur hölzernen Terrasse hinausgingen. Ein kleiner Zweiertisch, direkt an einer breiten Fensterbank, die vollgestellt war mit geschnitzten Möwen, kleinen bunt bemalten Booten, einem blau-weiß gestreiften Leuchtturm, einer Lampe mit ausladendem altmodischem Schirm und mehreren Bilderrahmen, in denen atlantische Malereien zu sehen waren. Alles wild durcheinander. Über Jahrzehnte waren im La Coquille Hunderte, meist maritime Objekte zusammengetragen worden, an die Wände gehängt, hingestellt, hingelegt, wo immer und wie immer Platz war, überall, nach und nach, ohne Ordnung. Dupin mochte das sehr. Sextanten, Rettungsringe, Muscheln und Steine, kleine Kästen mit Glasscheiben, hinter denen Miniatur-Strandlandschaften gebastelt worden waren, Bootsruder, Barometer, Stücke von Tauen, Kajütenlampen.
Dupin registrierte, dass er ein wenig aufgeregt war. Was ihm peinlich war und so gut wie nie passierte; weder offizielle Autoritäten noch Prominente hatten ihn je beeindruckt. Außer, wenn er sie bewunderte.
»Bonsoir, Madame Bandol, enchanté. – – – Commissaire Georges Dupin, Commissariat de Police Concarneau.«
In seiner Verlegenheit war er formell geworden, was ihm augenblicklich unangenehm war. Sophie Bandol musterte ihn mit einer Mischung aus Skepsis und Neugier.
Dupin setzte erneut an.
»Sie – Sie haben die Polizei verständigt, Madame Bandol, weil Sie auf einem Parkplatz in der Nähe der Pointe de Penquernéo einen Mann liegen gesehen haben. Sie haben angenommen, der Mann sei …«
»Ich weiß, wenn jemand tot ist. – Und ich habe einen Toten gesehen. Eine Leiche. Mausetot. Ein trauriges Vorkommnis.«
Sie sah großartig aus. Verwuschelte, schulterlange Haare, ein kunstvoll gefärbtes Dunkelblond, unordentlicher Mittelscheitel, glänzend pechschwarze, warme Augen – die Dupin schon immer fasziniert hatten, seit dem ersten Film, in dem er sie gesehen hatte –, ein breiter Mund mit geschwungenen Lippen, knallroter, eleganter Lippenstift, ein verschwenderisches Lächeln ohne jede Zurückhaltung. Ungekünstelt, großzügig.
Das Lächeln, das er aus den Filmen kannte, das Lächeln, das so berühmt war wie ihr kokett-mürrischer Schmollmund.
»Ich – Madame Bandol, es ist mir eine große Freude, ich meine: Ich freue mich ungemein, Sie kennenzulernen, das ist kaum zu glauben.«
Jetzt waren die Sätze einfach aus ihm herausgekommen. Aber Dupin war einverstanden damit. Er saß hier mit Sophie Bandol! Er fühlte sich wie ein Fan.
»Was gedenken Sie zu unternehmen, Monsieur le Commissaire? Nun, wo der Tote verschwunden ist. Wie wollen Sie ihn wiederfinden? Sie können doch nicht einfach hinnehmen, dass Ihnen eine Leiche abhandenkommt. Die Lage nimmt sich höchst misslich aus, denke ich.«
»Was darf ich bringen?« Jacqueline, eine der drei Schwestern vom La Coquille, stand neben ihnen.
»Jacqueline hat meine Bestellung bereits aufgenommen. Ich habe einen Bärenhunger, müssen Sie wissen«, Madame Bandol sprach mit einem Mal in einem zutiefst vertraulichen Ton, als säße sie mit einem guten Freund am Tisch. »Was werden Sie essen, Monsieur le Commissaire?«
»Ich – nein, danke. Ich nehme«, Dupin überlegte, wie viele petits cafés noch unter »kein Kaffee« fallen würden, man musste das sicherlich in Relation zu seinen sonstigen Kaffeemengen betrachten. »Ich nehme nur – einen Tee«, Dupin wusste, dass es kläglich geklungen hatte, zudem half ihm Tee gar nicht, er hatte es immer wieder versucht, er wirkte nicht, und zwar exakt kein bisschen, egal wie schwarz er ihn trank. »Und«, beeilte er sich zu sagen, Jacqueline hatte sich bereits abgewandt, nicht ohne seine Bestellung mit einem schwer irritierten Blick zu quittieren, »und ein Glas Anjou«. Einer seiner Lieblingsweißweine.
»Immerhin«, Jacqueline klang einigermaßen versöhnt.
»Hier bei uns ist etwas Furchtbares passiert«, raunte Madame Bandol. Echter Schrecken lag in ihrem Satz. Dann, im nächsten Moment, zeigte sich übergangslos ein beschwingtes Lächeln auf ihrem Gesicht: »Ich bin und ich bleibe beim Champagner, wenn Sie nichts dagegen einzuwenden haben.« Sie hielt ein leeres Glas in der Hand.
»Was haben Sie gesehen, Madame Bandol? Erzählen Sie bitte noch einmal alles haargenau. So kleinteilig, wie es nur geht, jedes Detail, an das Sie sich erinnern.«
»Zizou hat plötzlich wie verrückt gebellt«, sie schaute an ihren Beinen hinunter – unter dem Tisch lag, direkt neben ihren Füßen, regungslos ein mittelgroßer, freundlich dreinschauender weiß-brauner Hund. Dupin war nicht sehr bewandert mit Hunden, aber diese Rasse kannte er: Es war ein Foxterrier, Tims Hund. Ein Struppi. Einen Augenblick lang hob der Hund den Kopf, um ihn dann wieder wohlig auf den Vorderbeinen abzulegen.
»Er war völlig außer sich. Da waren wir noch in dem kleinen Wäldchen. Auf dem Pfad. Noch gar nicht auf dem Parkplatz. Ich wusste sofort, dass etwas nicht stimmte. Zizou verliert nicht einfach aus heiterem Himmel die Nerven, müssen Sie wissen, er hat ein sehr solides Temperament. Mir war klar, dass es nicht nur ein Wildschwein, Hase oder Fuchs war. Manchmal bellt er auch, wenn Kiki in der Nähe ist, aber auch das war es nicht. Glücklicherweise hatte ich ihn an der Leine«, sie setzte ab.
»Und weiter?« Dupin kramte sein rotes Notizheft aus der hinteren Hosentasche hervor. Und einen der Bic-Kulis, die er im Tabac-Presse neben dem Amiral in nennenswerten Mengen kaufte, um sie dann beeindruckend schnell wieder zu verlieren.
»Ich habe ihn gefragt, was los ist. Er hat mich daraufhin heftig drängend direkt zum Parkplatz geführt. Und wurde immer aufgeregter. Dann habe ich ihn gesehen. Den Mann, meine ich. Er lag im Gras. Direkt neben dem Asphalt. Ich habe Ihrem Inspektor die Stelle gezeigt. Ich bin nicht näher rangegangen, ich wollte nicht, dass Zizou sich noch schlimmer aufregen muss. Oder sich etwas einfängt.«
Dupin ging auf den letzten Satz nicht ein.
»Beschreiben Sie mir alles, was Sie gesehen haben.«
»Es hat Bindfäden geregnet, die Sicht war nicht besonders gut. – Was soll ich sagen? Es war ein Mann. Der Kopf lag seltsam abgewinkelt, das war nicht normal, auch das eine Bein, ich weiß nicht mehr, welches, stand merkwürdig ab. Ich habe das Gesicht nicht sehen können. Vielleicht ein bisschen. Ich bin wie gesagt wohlweislich keinen Schritt näher herangetreten.«
»Woher wussten Sie, dass er tot ist?«
»Das stand fest.«
Eine unanzweifelbare Auskunft, so viel war klar. Jacqueline hatte den Tee, den Wein und ein weiteres Glas Champagner im Vorbeigehen abgestellt.
»Und das Blut?«
»Es war da. An der Leiche war Blut!«
»Wo an der Leiche?«
»Ich vermag es nicht zu sagen.«
»Viel Blut?«
»Nein, das glaube ich nicht. Aber auch nicht wenig.«
»Wie alt war der Mann, was schätzen Sie?«
»Es war unmöglich zu sehen. Aber er hatte definitiv Haare. Kurze Haare, glaube ich«, sie hielt inne und wirkte plötzlich erstaunt, »die Haarfarbe war dunkelbraun.« Sie kniff die Augen zusammen, »ja, dunkelbraun. Na, da haben Sie ja doch einen richtigen Hinweis.«
»Sind Sie sich ganz sicher – bei diesem Detail, den dunkelbraunen Haaren?«
»Absolut, denke ich.«
»Aber nicht bei den kurzen Haaren?«
»Nein.«
»Und das hatten Sie den Kollegen eben noch nicht mitgeteilt?«
»Da war es mir nicht präsent. Ich nehme an, ich stand doch ein wenig unter Schock. Ansonsten«, sie hob die Stimme, »hätte ich es natürlich zu Protokoll gegeben.«
»Können Sie sich an sein Gesicht erinnern? An irgendetwas Auffälliges?«
»Ich habe den Mann ja eigentlich nur von der Seite gesehen.«
»Und da ist Ihnen nichts Besonderes aufgefallen?« Dupin seufzte leise. »Eine besonders große Nase, was auch immer?«
Madame Bandol schaute überrascht.
»Nein.«
»Denken Sie, dass …« Dupin brach ab.
»Sie sollten sich mit aller Kraft auf die sicheren Details konzentrieren, Monsieur le Commissaire!«
»Erinnern Sie sich, was der Mann anhatte?«
»Nein«, mittlerweile lag deutlicher Missmut in ihrer Stimme, »es war keine Situation, in der sich irgendetwas genau betrachten ließ.«
»Was haben Sie noch sehen können? Etwas neben dem Mann, auf dem Rasen? Auf dem Parkplatz?«
»Was meinen Sie?«
»Ist Ihnen auf dem Parkplatz irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen?«
»Nein.«
»Haben Sie einen Wagen dort gesehen?«
»Nein.«
»Eine andere Person, auf dem Weg hin oder zurück?«
»Doch, ja.«
Dupin horchte auf.
»Wann haben Sie jemanden gesehen? Wo?«
»Nein, ich meine einen Wagen. Da stand ein Wagen. Ein großer Wagen, glaube ich.«
»Was heißt das?«
»Keiner dieser neumodischen kleinen Wagen.«
»Erinnern Sie sich an die Farbe?«
»Nein. Vielleicht dunkel.«
»Schwarz?«
»Nein. Unter Umständen rot. Ich weiß es nicht mehr. Es war nicht zu sehen.«
»Es war nicht zu sehen?«
»Die Sicht war nicht gut. Und Zizou und ich waren doch sehr mit dem toten Mann beschäftigt.«
»Wo stand der Wagen?«
»Wenn Sie von der Straße kommen, links. Noch vor dem Parkplatz.«
»Weit von der Leiche entfernt?«
»Ein Stück schon. Aber nicht weit. Nein.«
»Und auch das war Ihnen eben entfallen, als Sie mit den Kollegen gesprochen haben?«
»Ja«, antwortete sie unbekümmert.
»Und es war nur ein Wagen – da stand nur ein Wagen? Können Sie das mit Sicherheit sagen – kein zweiter?«
»Ich vermute schon.«
»Pardon«, Jacqueline kam mit einer bemerkenswert großen Plâteau de fruits de mer an ihren Tisch – eine der legendären Platten, auf der sich gigantische Berge von Meeresfrüchten auftaten.
»Nehmen Sie doch auch etwas – Jacqueline, bringen Sie dem Commissaire ein Gedeck.«
Die Küche hatte es gut mit Madame Bandol gemeint, es