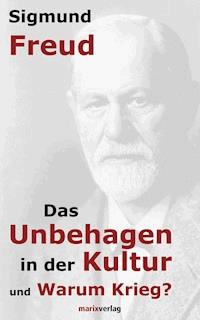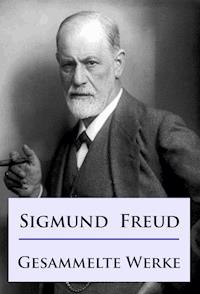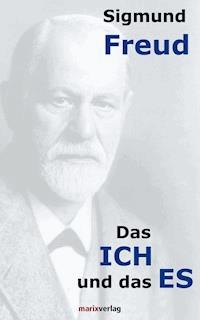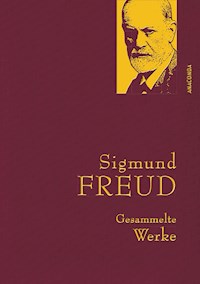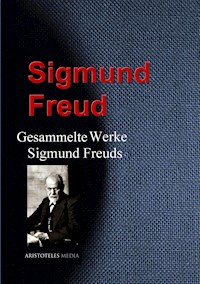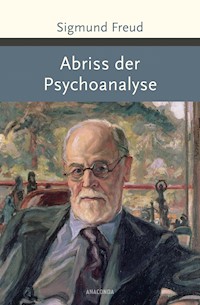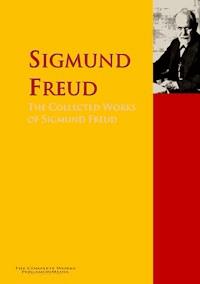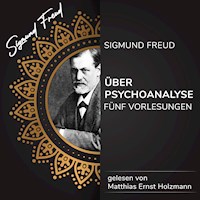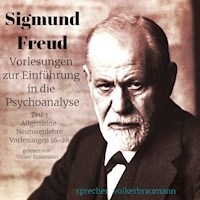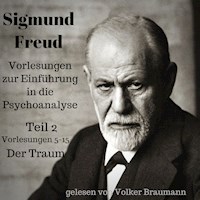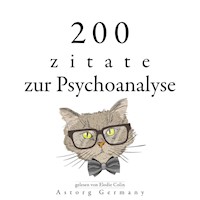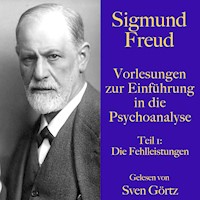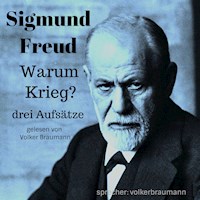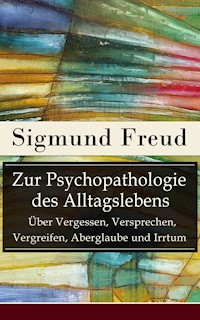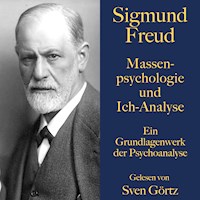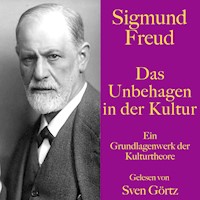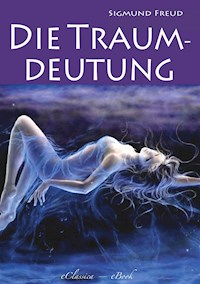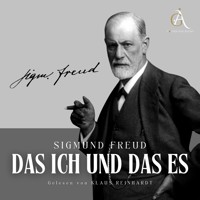44,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Sigmund Freuds Briefe an seinen nahen Freund Wilhelm Fließ, den Berliner Hals-Nasen-Ohrenarzt und Biologen, transkribiert von Gerhard Fichtner und hier ohne Kürzung veröffentlicht, sind das bewegende tagebuchartige Protokoll der tiefen wissenschaftlichen und persönlichen Krise, aus der Freud, von der akademischen Welt isoliert, in den neunziger Jahren des vorletzten Jahrhunderts das Paradigma der Psychoanalyse entwickelte. Der Leser kann gleichsam die Geburt eines Ideensystems miterleben, welches wie kaum ein zweites das Denken unserer modernen Zeit geprägt, das Wissen des Menschen über sich selbst von Grund aus revolutioniert hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1127
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Sigmund Freud
Briefe an Wilhelm Fließ 1887–1904
Über dieses Buch
Auf unbemerkt-selbstverständliche Weise nehmen wir uns und andere heute in Freudschen Begriffen wahr. Niemand wird mehr bezweifeln, daß die Psychoanalyse mit den Konzepten des Unbewußten, der infantilen Sexualität, des Ödipuskomplexes, des Narzißmus das Denken des Menschen über sich selbst grundlegend verändert hat. In den neunziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts hat Sigmund Freud diese theoretischen Vorstellungen entwickelt: Er wußte damals bereits, daß seine neurotisch erkrankten Patienten nicht an Hirnschäden oder konstitutioneller Nervenschwäche, sondern an »Reminiszenzen« litten, denen mit den herkömmlichen organmedizinischen Methoden nicht beizukommen war. Indem er sich von den Symptomen zur Symptomgenese und schließlich zur Lebensgeschichte zurückfragte, verließ er Physiologie und Neurologie und wechselte zur Psychologie über. Gleichzeitig nahm er eine radikale Veränderung des traditionellen Arzt-Patient-Verhältnisses vor; er machte den vorher entmündigten Kranken zum Partner des analytisch-therapeutischen Forschungsdialogs. Unter dem Druck quälender eigener neurotischer Beschwerden steigerte er seine gelegentliche Selbstbeobachtung zur systematischen, mit unerbittlicher Disziplin geübten Selbstanalyse, in der er bald ein »notwendiges Zwischenstück« in seinen Forschungen erkannte.
Von der Schwere dieser Jahre des Kampfes erfahren wir aus Freuds offiziellen autobiographischen Schriften wenig. Doch gibt es ein einzigartiges Dokument, in das, wie in ein Logbuch, der dramatische Forschungsprozeß, die Mühsal der Selbstanalyse, aber auch die intellektuelle Schönheit der Arbeit und das Glück der großen Funde eingetragen sind: Freuds Briefe an Wilhelm Fließ, mit dem er in jener Phase die intimste Freundschaft seines Lebens unterhielt.
Sie zerbrach Anfang des neuen Jahrhunderts. Von der Witwe nach Fließ’ Tod Ende der zwanziger Jahre danach befragt, meinte Freud sich zu erinnern, dessen Briefe schon vor langem vernichtet zu haben. Bis auf einige wenige Stücke fehlt von ihnen tatsächlich jede Spur. Hingegen sind Freuds eigene Briefe nahezu vollständig erhalten geblieben und auf abenteuerlichen Wegen in den Besitz von Marie Bonaparte, einer Schülerin Freuds, gelangt. Als er davon erfuhr, beteuerte er: »Unsere Korrespondenz war die intimste, die Sie sich denken können.« Und: »Ich möchte nichts davon zur Kenntnis der sogenannten Nachwelt kommen lassen.« Marie Bonaparte, die die Bedeutung des Dokuments erkannte – sie verglich es mit Goethes Gesprächen mit Eckermann –, rettete das Konvolut durch die Wirren des Zweiten Weltkriegs.
Unter dem Titel Aus den Anfängen der Psychoanalyse ist 1950 in London, Jahre nach Freuds Tod, eine Auswahl erschienen, 1962 und 1975 von S. Fischer nachgedruckt. In sorgfältiger neuer Edition wird nun die lange erwartete ungekürzte Fassung, mit sämtlichen seinerzeit fortgelassenen Briefen und Briefteilen, zugänglich gemacht. – Der amerikanische Psychoanalytiker Jeffrey Moussaieff Masson ist der Herausgeber der bei Harvard University Press erschienenen englischsprachigen Ausgabe. Der Berliner Soziologe und Historiker Michael Schröter hat deren editorischen Apparat für die deutsche Originalfassung bearbeitet und wesentlich ergänzt; er hat auch die maßgebenden Kommentare einbezogen, die seinerzeit Ernst Kris für die Erstausgabe von 1950 verfaßte. Die Verläßlichkeit der neuen Transkription ist dem Tübinger Medizinhistoriker Gerhard Fichtner zu verdanken.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Der Band enthält neunundzwanzig Abbildungen und elf Faksimiles.
Eine Liste der Errata und Addenda zur zweiten Auflage von 1999 findet sich am Schluß.
Lektorat:
Ilse Grubrich-Simitis und Ingeborg Meyer-Palmedo
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die amerikanische Ausgabe der Briefe
erschien im April 1985 unter dem Titel
The Complete Letters of Sigmund Freud to Wilhelm Fliess 1887–1904
bei The Belknap Press of Harvard University Press,
Cambridge, Massachusetts, und London, England:
© 1985 and under the Berne Convention
Sigmund Freud Copyright Ltd.
Für diese Ausgabe hat J. M. Masson die Edition besorgt:
© 1985 J. M. Masson, Oakland, California.
Sein editorischer Apparat wurde von Michael Schröter
für die deutsche Fassung übersetzt und bearbeitet.
Für die deutsche Ausgabe:
© 1986 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Coverentwurf: Manfred Walch
Coverabbildung: Brief vom 21. September 1897. © Sigmund Freud Copyrights/Library of Congress
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490511-2
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Vorwort/Einleitung/Zur Transkription/Zur deutschen Ausgabe
Vorwort
Einleitung
Zur Transkription
Zur deutschen Ausgabe
Briefe/Abhandlungen/Notizen
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
[Manuskript A]
Probleme
Sätze
Reihen
Ätiologische Momente
21. Kapitel
[Manuskript B]
I. [Die Neurasthenie]
II. Die Angstneurose
Schlußfolgerungen
[Manuskript C/1]
[Manuskript C/2]
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36 [Brief an Ida und Wilhelm Fließ]
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
[Manuskript D]
I. Gliederung
II. Theorie
[Manuskript E]
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
[Manuskript F/1]
49. Kapitel
[Manuskript F/2]
50. Kapitel
51. Kapitel
[Manuskript O]
52. Kapitel
[Manuskript G]
I
II
III
IV
V
VI
53. Kapitel
[Manuskript H]
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
[Manuskript I]
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
[Manuskript J]
[I.]
II.
85. Kapitel
[Manuskript K]
86. Kapitel
87. Kapitel
88. Kapitel
89. Kapitel
90. Kapitel
91. Kapitel
92. Kapitel
93. Kapitel
94. Kapitel
95. Kapitel
96. Kapitel
97. Kapitel
98. Kapitel
99. Kapitel
100. Kapitel
101. Kapitel
102. Kapitel
103. Kapitel
104. Kapitel
105. Kapitel
106. Kapitel
107. Kapitel
108. Kapitel
109. Kapitel
110. Kapitel
111. Kapitel
112. Kapitel
113. Kapitel
114 [Brief an Ida Fließ]
115. Kapitel
117. Kapitel
118. Kapitel
119. Kapitel
120. Kapitel
121. Kapitel
122. Kapitel
123. Kapitel
124. Kapitel
125. Kapitel
126. Kapitel
[Manuskript L]
127. Kapitel
128. Kapitel
[Manuskript M]
129. Kapitel
[Manuskript N]
130. Kapitel
131. Kapitel
132. Kapitel
133. Kapitel
134. Kapitel
135. Kapitel
136. Kapitel
137. Kapitel
138. Kapitel
139. Kapitel
140. Kapitel
141. Kapitel
142. Kapitel
143. Kapitel
144. Kapitel
145. Kapitel
146. Kapitel
147. Kapitel
148. Kapitel
149. Kapitel
150. Kapitel
151. Kapitel
152. Kapitel
153. Kapitel
154. Kapitel
155. Kapitel
156. Kapitel
157. Kapitel
158. Kapitel
159. Kapitel
160. Kapitel
161. Kapitel
162. Kapitel
163. Kapitel
164. Kapitel
165. Kapitel
166. Kapitel
167. Kapitel
168. Kapitel
169. Kapitel
170. Kapitel
171. Kapitel
172. Kapitel
173. Kapitel
174. Kapitel
175. Kapitel
176. Kapitel
177. Kapitel
178. Kapitel
179. Kapitel
180. Kapitel
181. Kapitel
182. Kapitel
183. Kapitel
184. Kapitel
185. Kapitel
186. Kapitel
187. Kapitel
188. Kapitel
189. Kapitel
190. Kapitel
191. Kapitel
192. Kapitel
193. Kapitel
194. Kapitel
195. Kapitel
196. Kapitel
197. Kapitel
198. Kapitel
199. Kapitel
200. Kapitel
201. Kapitel
202 Wien, 27.6.99
203 3. Juli 99
204. Kapitel
205. Kapitel
206. Kapitel
207. Kapitel
208. Kapitel
209. Kapitel
210. Kapitel
211. Kapitel
212. Kapitel
213. Kapitel
214. Kapitel
215. Kapitel
216. Kapitel
217. Kapitel
218. Kapitel
219. Kapitel
220. Kapitel
221. Kapitel
222. Kapitel
223. Kapitel
224. Kapitel
225. Kapitel
226. Kapitel
227. Kapitel
228. Kapitel
229. Kapitel
230. Kapitel
231. Kapitel
232. Kapitel
233. Kapitel
234. Kapitel
235. Kapitel
236. Kapitel
237. Kapitel
238. Kapitel
239. Kapitel
240. Kapitel
241. Kapitel
242. Kapitel
243. Kapitel
244. Kapitel
245. Kapitel
246. Kapitel
247. Kapitel
248. Kapitel
249. Kapitel
250. Kapitel
251. Kapitel
252. Kapitel
253. Kapitel
254. Kapitel
255. Kapitel
256. Kapitel
257. Kapitel
258. Kapitel
259. Kapitel
260. Kapitel
261. Kapitel
262. Kapitel
263. Kapitel
264. Kapitel
265. Kapitel
266. Kapitel
267. Kapitel
268. Kapitel
269. Kapitel
270. Kapitel
271. Kapitel
272. Kapitel
273. Kapitel
274. Kapitel
275. Kapitel
276. Kapitel
277. Kapitel
278. Kapitel
279. Kapitel
280. Kapitel
281. Kapitel
283. Kapitel
284. Kapitel
285. Kapitel
286. Kapitel
287. Kapitel
Anhänge
Einleitung zur Erstausgabe 1950
I Wilhelm Fließ’ wissenschaftliche Interessen
II Psychologie und Physiologie
III Infantile Sexualität und Selbstanalyse
IV Die Psychoanalyse als unabhängige Wissenschaft
Konkordanz
Sexualschema (Umzeichnung)
Normalschema (Umzeichnung)
Normalschema (Transkription)
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungen
Verzeichnis der Abbildungen mit Quellennachweisen
Bibliographie
Index der Namen
Errata und Addenda
Vorwort Einleitung Zur Transkription Zur deutschen Ausgabe
Vorwort
Die Auswahlausgabe der Briefe von Sigmund Freud an Wilhelm Fließ, die 1950 unter dem Titel Aus den Anfängen der Psychoanalyse erschien, erweckte bei jedem Leser, und so auch bei mir, den Wunsch nach einer vollständigen und ungekürzten Edition dieser einzigartigen Quelle. 1978 wandte ich mich deshalb an Freuds Tochter Anna, erzählte ihr von meinem Interesse und gab meiner Überzeugung Ausdruck, daß in den unveröffentlichten Briefen und Briefteilen noch wertvolle Informationen zu finden seien. Sie gewährte mir Einblick in die Briefe des Jahres 1897, und als ich ihr zeigen konnte, daß darin tatsächlich bedeutsames Material zur Geschichte der Psychoanalyse enthalten war, erklärte sie sich bereit, eine vollständige Publikation in Erwägung zu ziehen. Aber erst als sich K.R. Essler, der enge Freund und geachtete Ratgeber von Miss Freud, meinem Votum anschloß, ließ sie sich gänzlich umstimmen und erteilte mir die Erlaubnis, eine neue Ausgabe in Angriff zu nehmen. Ich war mir damals nicht im klaren, wie kompliziert und mühevoll die Aufgabe werden würde, wie viele Länder ich würde besuchen, wie viele Bibliotheken durchforsten, wie viele Einzeldokumente ich würde ausgraben müssen. Am Ende meiner Arbeit waren zu den 168 Briefen und Manuskripten, die in der Erstausgabe ganz oder teilweise abgedruckt waren, 133 zuvor unveröffentlichte Stücke hinzugekommen.
Es ist ein riskantes Unterfangen, ein Werk dieser Größenordnung zu edieren, das voraussichtlich das Bild eines großen Mannes verändern wird. Doch werden wohl die meisten Leser mit mir darin einig sein, daß diese ungekürzte Ausgabe der Fließ-Briefe einen menschlicheren Sigmund Freud sichtbar und faßbar werden läßt. Auch widerspricht die weniger lückenhafte Dokumentation seines Denkens über einige psychoanalytische Schlüsseltheorien in mancher Hinsicht der Darstellung, die Freud selbst viele Jahre später der Nachwelt in seinen veröffentlichten Werken gab. Das ist vielleicht unvermeidlich. Ebenso unvermeidlich ist, daß der Zugang zu Äußerungen, die nie zur Veröffentlichung bestimmt waren, den unparteiischen Historiker zu schwierigen und manchmal unpopulären Schlußfolgerungen zwingt. In dieser Neuausgabe habe ich versucht, die Briefe so objektiv wie möglich vorzulegen, und mich jeder eigenen Interpretation und Bewertung enthalten.
Sobald Anna Freud beschlossen hatte, eine Gesamtveröffentlichung der Briefe zu gestatten, stellte sie mir ihre Zeit und ihr Wissen mit gleichbleibender Großzügigkeit zur Verfügung. Ich verbrachte viel Zeit in ihrem Haus in Maresfield Gardens (das auch die Wohnung ihres Vaters in seinem letzten Lebensjahr gewesen war), las dort in Freuds Privatbibliothek und durchforschte Schränke und Schubladen nach Dokumenten, die mir helfen könnten, die eine oder andere Anspielung in den Fließ-Briefen zu klären. Immer wieder sprach ich mit Anna Freud über die Briefe und ihren Inhalt. Die Aufregung der gründlichen Suche in Freuds Schreibtisch, wo sich lange verloren geglaubte Schriftstücke fanden, nahm uns beide rasch gefangen. Ich habe den Eindruck, daß Miss Freud erkannte, wieviel Material noch zu entdecken blieb und welche Freude es machte, etwas davon aufzuspüren. Sicher teilte sie mit mir das hohe Vergnügen an der Art von Detektivarbeit, die mit der Zusammenstellung dieses Bandes verbunden war.
Meine Dankbarkeit gilt daher an erster Stelle der verstorbenen Anna Freud und ihren zahlreichen Freundlichkeitsbeweisen mir gegenüber. Weiterhin hätte dieses Unternehmen nicht begonnen werden können ohne die Hilfe von K.R. Essler. Er schenkte mir viel Zeit und Energie und ebnete mir, in der Library of Congress und anderswo, den Weg zu einem riesigen Fundus an Originalquellen, von denen viele die Anmerkungen dieses Bandes bereichert haben.
Wer immer an diesen Briefen Interesse findet, hat eine Dankesschuld gegenüber Marie Bonaparte, die sie gerettet, und gegenüber Ernst Kris, der sie (zusammen mit Anna Freud) erstmals herausgegeben hat.
Ohne die Unterstützung von Gerhard Fichtner, der für den deutschen Brieftext verantwortlich ist, wäre dieser Band nicht möglich gewesen. Er nahm sich trotz seiner vielfältigen Verpflichtungen an der Universität Tübingen die Zeit, mich in Berkeley (Kalifornien) zu besuchen und mir seine sachkundige Hilfe anzubieten. Ein erheblicher Teil des Verdienstes an dieser Ausgabe gebührt ferner meiner Forschungsassistentin Marianne Loring, die sowohl zur Herstellung des definitiven Textes als auch zur Annotierung viel beigetragen hat. Sie war meine intellektuelle Gefährtin in den sechs Jahren der Arbeit an diesen Briefen, und es ist keine Übertreibung zu sagen, daß ich ohne ihre fröhliche, geschickte, uneingeschränkte Hilfe nicht zurechtgekommen wäre. Ich bin den beiden Genannten, Gerhard Fichtner und Marianne Loring, dankbarer, als ich es ausdrücken kann.
Zu besonderem Dank verpflichtet bin ich auch Lottie Newman für ihre Mitarbeit in den frühen Phasen der Vorbereitung dieser Edition. Ihr kritischer Scharfsinn war stets von großem Nutzen.
Mark Paterson von Sigmund Freud Copyrights hat mich über die ganze Zeit meiner Arbeit unterstützt. Bei Ilse Grubrich-Simitis habe ich immer wertvollen Rat gefunden. Muriel Gardiner hat sich von Anfang an für das Projekt begeistert. Und Elenore Fließ, die Witwe des Sohnes von Wilhelm Fließ, Robert, wurde mir während der Entstehung dieses Buches zur persönlichen Freundin. Ich bedaure, daß sie das Erscheinen des fertigen Bandes nicht mehr erleben kann; er hätte ihr viel Freude gemacht.
Einige der in diesem Band enthaltenen Briefe stammen aus der Jüdischen National- und Universitätsbibliothek Jerusalem, wo sie von Pauline Fließ Jacobsohn, der Tochter von Wilhelm Fließ, deponiert worden sind. Peter Swales machte mich auf sie aufmerksam; Mrs. Jacobsohn bin ich zu Dank verpflichtet für die Erlaubnis, sie zu benutzen. Prinzessin Eugenie von Griechenland erlaubte freundlicherweise die Benutzung von Auszügen aus den Aufzeichnungen von Marie Bonaparte.
John Broderick, Paul Hefron und besonders Ronald Wilkinson mit den Mitarbeitern der Handschriftenabteilung der Library of Congress waren jederzeit bereit, mir bei dem Auffinden von schwer zugänglichem Material zu helfen und mir von allem, was ich benötigte, Photokopien anzufertigen.
Schließlich möchte ich den folgenden Personen danken, die mir in verschiedener Weise behilflich waren: Angela Harris, Susan Mango, Annie Urbach, Robert Wallerstein und Trude Weisskopf. Ein Werk dieses Umfangs hätte nicht ohne finanzielle Unterstützung zustande gebracht werden können. Für ihre großzügige Hilfe danke ich der New Land Foundation, dem Fund for Psychoanalytic Research der Amerikanischen Psychoanalytischen Vereinigung, der National Library of Medicine und dem National Endowment for the Humanities.
J.M.M.
Einleitung
Sigmund Freuds Briefe an Wilhelm Fließ, den engsten Freund, den er je hatte, sind vermutlich die wichtigste einzelne Quelle zur Geschichte der Psychoanalyse. Niemals zur Veröffentlichung vorgesehen, umspannen sie den Zeitraum zwischen 1887 und 1904, d.h. die Periode, in der die Psychoanalyse geboren und entwickelt wurde. In den 17 Jahren dieses Briefwechsels schrieb Freud einige seiner revolutionärsten Werke, darunter die Studien über Hysterie (1895d), die Traumdeutung (1900a) und die berühmte Krankengeschichte von Dora (1905e [1901]). Nie hat der Begründer eines völlig neuen Zweiges der Humanwissenschaften so offen und so detailliert über die Denkprozesse Auskunft gegeben, die zu seinen Entdeckungen führten. Keine der späteren Schriften Freuds kommt diesen frühen Briefen an Frische und Eindringlichkeit gleich, und keine enthüllt mit gleicher Dramatik die innersten Gedanken, die ihn bewegten, während er die Psychoanalyse schuf. Das Ergebnis ist ein ungewöhnlich fesselndes Dokument, das hier erstmals ohne Kürzungen vorgelegt wird.
Am Anfang der Korrespondenz war Freud ein 31jähriger Privatdozent für Neuropathologie an der Universität Wien. Er hatte soeben seine langjährige Braut Martha Bernays geheiratet und seine eigene nervenärztliche Praxis eröffnet, nachdem er sechs Monate in Paris bei dem berühmten Neurologen Jean Martin Charcot studiert hatte. Fließ, zwei Jahre jünger als Freud, war bereits ein namhafter Hals-, Nasen-, Ohrenspezialist in Berlin. Im Herbst 1887 unternahm er eine Studienreise nach Wien und besuchte bei dieser Gelegenheit, offenbar auf Anregung des bedeutenden Arztes Josef Breuer (1842–1925), auch die Vorlesung Freuds. Bald nach seiner Rückkehr schrieb Freud den ersten aus der langen Reihe von Briefen an ihn, die von der allmählichen Herausbildung der Psychoanalyse Zeugnis ablegen sollten.
Im Laufe der nächsten fünf Jahre entspann sich zwischen Freud und Fließ ein regelmäßiger Briefwechsel. 1890 begannen ihre Treffen in Berlin, Wien (wo Fließ seine Frau, Ida Bondy, fand) und verschiedenen anderen österreichischen und deutschen Städten, die sie später als ihre privaten »Kongresse« bezeichneten. Die Beziehung vertiefte sich: Fließ wurde Freuds intimster Freund, und dieser eröffnete ihm freimütiger als jedem anderen seine Gefühle und Gedanken über berufliche und persönliche Dinge.
Es läßt sich nicht sicher ausmachen, was die zwei Männer zueinanderzog. Einige Gemeinsamkeiten jedoch fallen ins Auge: beide waren Juden, beide Ärzte und von wissenschaftlichen Ambitionen erfüllt. Und was wahrscheinlich noch wichtiger ist: beide mußten früh feststellen, daß sie an Aspekten ihres Fachgebietes interessiert waren, die abseits der gängigen Pfade der Schulmedizin lagen – was sich u.a. darin ausdrückte, daß sie beide nach Paris gefahren waren, um unter Charcot zu arbeiten. Eine Lust am Forschen und am wissenschaftlichen Abenteuer scheint sie beruflich verbunden zu haben. Überdies zeigten sie bei ihren Zusammenkünften eine ungewöhnliche Bereitschaft zum Austausch über Einzelheiten ihres Privat- und Familienlebens. Freuds unerbittliches Ausloten der psychischen Folgen früher Sexualerlebnisse bei seinen Patienten stieß auf die Ablehnung seiner konservativeren Medizinerkollegen und führte zu einer Isolierung, die zweifellos die zunehmende Häufigkeit seiner Briefe erklärt. Für viele Jahre war Fließ sein »einziges Publikum«.
In einem unveröffentlichten Brief vom 17. April 1893 an seine Schwägerin Minna Bernays beschreibt Freud seine Zuneigung und Bewunderung für Fließ[1]: »Er ist ein ganz singulärer Mensch, die Gutmütigkeit selbst, ich glaube nötigenfalls auch die Güte selbst bei all seinem Genie. Dabei die Sonnenklarheit, die Courage.« Und auch in den Briefen an den Freund selbst äußert er sich beinahe verehrungsvoll. So heißt es am 1. Januar 1896 (Brief 85): »Die Art wie Du sollte nicht aussterben …; wir anderen bedürfen Deinesgleichen zu sehr. Was danke ich Dir alles an Trost, Verständnis, Anregung in meiner Einsamkeit, an Lebensinhalt, den ich auf Dich zurückführe, und zuletzt noch an Gesundheit, die mir kein anderer hätte zurückbringen können.«
Es ist wenig erhellend, die Intensität dieser Zuwendung, wie manche es tun, als Übertragungsphänomen zu deuten, d.h. in der Beziehung zu Fließ vor allem einen notwendigen Vorläufer von Freuds Selbstanalyse zu sehen. Jede Liebesbeziehung – und dies war gewiß eine solche – enthält ein Geheimnis, das der Analyse trotzt. Freud pflegte später von der homosexuellen Komponente dieser Freundschaft zu sprechen[2], und wie man weiß, waren beide Männer der Meinung, daß alle Menschen bisexuelle Anlagen in sich trügen.
Eine Bemerkung von Robert Fließ (dem Sohn von Wilhelm Fließ) gegenüber dem Pionier der Freud-Forschung Siegfried Bernfeld ist in diesem Zusammenhang aufschlußreich. Er schreibt[3]: »Sie haben ganz recht, wenn Sie auf den stark emotionalen Charakter der Bedeutung hinweisen, die diese zwei Männer füreinander hatten. Ich habe von beiden einiges darüber gehört – natürlich von meinem Vater über viele Jahre hin, aber auch in einer langen Unterhaltung mit Freud 1929, in der er mit einer Offenheit sprach, die für ihn in persönlichen Dingen nicht allzu üblich war.«
Aus der Korrespondenz gewinnt man den Eindruck, daß Freud der großzügigere Freund von beiden war und sich der Beziehung schrankenlos öffnete, während Fließ eher zurückhaltend blieb. In der Tat war Freud so sehr von der Mitteilung seiner eigenen Entdeckungen in Beschlag genommen, daß er nicht bemerkt zu haben scheint, wie sich Fließ ab der Jahrhundertwende von ihm zurückzog und allmählich die Freundschaft auflöste.
Marie Bonaparte (1882–1962), eine der Lieblingsschülerinnen und -analysandinnen Freuds, hat eine unveröffentlichte Darstellung vom Niedergang der Beziehung zwischen Freud und Fließ hinterlassen.[4] Aus den Briefen, so berichtet sie, »geht hervor, daß die Freundschaft mit Fließ sich … [bereits] nach der Veröffentlichung des Traumbuches, also ab 1900, zu lockern begann. Freud hatte keine Ahnung davon. Erst ich habe es ihm gezeigt. So sehr widerstrebte es ihm, aus Freundschaft für Fließ, diesen des Neides zu verdächtigen. Fließ konnte die Überlegenheit seines Freundes nicht ertragen; und ebensowenig – dies nach Freuds eigenen Worten – seine wissenschaftliche Kritik an der Periodenlehre. Darüber hinaus tat Ida Fließ, ›ein böses Weib‹ [i.O. deutsch], aus Eifersucht alles, um die beiden Freunde zu entzweien – während Martha Freud wohl verstand, daß Fließ ihrem Mann etwas anderes geben konnte als sie. Fließ empfand für Freud, nach Freuds eigener Aussage, eine ebenso leidenschaftliche Freundschaft wie Freud für Fließ.«
Die aufkommenden Schwierigkeiten lagen z.T. an der Starrheit, mit der Fließ seine Theorien verteidigte und als sein geistiges Eigentum reklamierte. Er hielt entschlossen an seiner Annahme fest, daß alle wesentlichen Ereignisse im Leben eines Menschen durch eine biologische Periodizität vorherbestimmt seien. Seine Hypothesen über die Rolle der Nase hingegen betrachtete Freud mit weniger Skepsis. In der Fortsetzung ihrer Aufzeichnungen schreibt Marie Bonaparte: »An den Beziehungen der Nase zum Rest des Organismus ist etwas Wahres. Freud hat den Beweis an sich selbst erlebt, im Zusammenhang seiner Herzkrämpfe, die nach einer nasalen Behandlung plötzlich verschwanden. Er konnte auch sehen, wie Fließ mit diesem Mittel die Schmerzen bei der Entbindung dämpfte. Was die Bisexualität betrifft, so konnte Fließ, auch wenn Freud von ihr erstmals durch ihn erfahren hat, keine Priorität für den Gedanken selbst in der Biologie beanspruchen. ›Und wenn er mir die Bisexualität gegeben hat, so hatte ich ihm vorher die Sexualität gegeben‹ [i.O. deutsch]. Das hat mir Freud gesagt.«
Freuds Erkenntnis, daß er Fließ doch nicht gar so viel verdanke, war erst die Frucht späterer Jahre und wurde vermutlich nur gegenüber Marie Bonaparte ausgesprochen. In der Zeit seiner Freundschaft mit Fließ glaubte er, daß sie beide in gleicher Weise an Problemen der Sexualtheorie interessiert seien. Die Wahrheit jedoch ist, daß zwischen ihnen ein unübersehbarer Gegensatz bestand, vor allem was die Gefühle angeht, die von der menschlichen Sexualität ausgelöst werden. Freud hatte recht, wenn er Marie Bonaparte mitteilte, daß er es war, der Fließ, wie unvollkommen auch immer, über die Bedeutung der Sexualität für die medizinische Psychologie aufklärte.
Das schließliche Ende der Freundschaft war für Freud ein traumatisches Erlebnis, und in späteren Jahren hat er Fließ kaum jemals erwähnt. Seinen Briefen an seine Kollegen und Schüler C.G. Jng, Karl Abraham und besonders Sándor Ferenczi ist zu entnehmen, daß er mit ihnen über Fließ gesprochen hat – aber nur selten und nie mit der Ausführlichkeit, die zumindest Ferenczi sich wünschte.[5] Anna Freud hat, nach einer persönlichen Mitteilung, von ihrem Vater nie etwas über Fließ gehört, ausgenommen einige spärliche Hinweise gegen Ende seines Lebens aus Anlaß des Wiederauftauchens der Briefe. Als Grund gab sie an, daß der Bruch der Freundschaft selbst nach so vielen Jahren immer noch schmerzhaft für ihn gewesen sei.
Die Briefe Freuds an Fließ haben von ihrer Niederschrift bis zu ihrer Publikation einen langen und verschlungenen Weg zurückgelegt. Im Fließ-Archiv in Jerusalem befinden sich Kopien von je zwei unveröffentlichten Briefen von Ida Fließ an Freud und von diesem an sie.[6] Die kurze Korrespondenz wurde von Ida Fließ am 6. Dezember 1928, knapp zwei Monate nach dem Tod ihres Mannes, eröffnet:
»Verehrter Herr Professor!
Ob Sie mir die Berechtigung zusprechen werden, weiß ich freilich nicht, aber [ich habe] eine Bitte, die [ich] doch versuchen möchte, Ihnen zu unterbreiten. Sie sind vielleicht im Besitz von Briefen, die Wilhelm vor den Zeiten der Trübung an Sie gerichtet hat. Sie werden wahrscheinlich nicht vernichtet worden sein, obwohl sie die innere Beziehung zu Ihnen eingebüßt haben, und wenn dem so ist: hätten Sie, sehr geehrter Herr Professor, das Vertrauen und die Güte, diese Briefe in meine Hände zu legen als derjenigen von allen Menschen, die das tiefste Interesse daran hat? Zu keinem äußeren Zweck, wie ich versichere, oder, wenn es sein müßte, nur leihweise und mit begrenzter Frist.
Dieser Wunsch hat mir den längst versperrten Weg zu Ihnen frei gemacht – ob [ich] ihn noch einmal werde gehen dürfen, um Ihnen von Herzen zu danken?
Ihre sehr ergebene
Ida Fließ«
Freud antwortete postwendend am 7. Dezember:
»Verehrte Frau!
Ich beeile mich, Ihren Brief zu beantworten, obwohl ich heute noch nichts für die Erfüllung Ihres Wunsches Entscheidendes mitteilen kann. Meine Erinnerung sagt mir, daß ich den größeren Anteil unserer Korrespondenz irgendwann nach 1904 vernichtet habe. Sie läßt aber die Möglichkeit offen, daß eine ausgesuchte Anzahl von Briefen aufbewahrt wurde und durch eine sorgfältige Suche in den Räumen, die ich seit 37 Jahren bewohne, zum Vorschein gebracht werden kann. Ich bitte Sie also, mir über die Weihnachtstage Frist zu geben. Was ich finde, wird bedingungslos zu Ihrer Verfügung sein. Wenn ich nichts finde, so wollen Sie annehmen, daß nichts der Vernichtung entgangen ist.
Gewiß würde auch ich gerne hören, daß meine Briefe an Ihren Mann, meinen langjährigen, intimen Freund, ein Schicksal gefunden haben, das sie vor jeder zukünftigen Verwendung bewahrt.
Ich bleibe in der durch die Verhältnisse gebotenen stillen Teilnahme
Ihr ergebener
Freud«
Aus dieser Mitteilung kann man folgern, daß Freud vielleicht doch nicht alle Briefe seines früheren Freundes vernichtet hat.[7] Am 30. Dezember freilich gab er der Witwe folgenden Bescheid:
»Verehrte Frau!
Ich habe bisher nichts gefunden und neige sehr zu der Annahme, daß die ganze Korrespondenz vernichtet worden ist. Da ich aber auch anderes nicht gefunden habe, was ich gewiß aufbewahren wollte, wie die Charcot-Briefe, betrachte ich die Sache nicht als abgeschlossen. Meine Zusage für den Fall, daß ich etwas finde, bleibt natürlich aufrecht.
Ihr sehr ergebener
Freud«
In ihrer Antwort vom 3. Januar 1929 dankt Ida Fließ Freud für die Auskunft und fügt hinzu: »Noch lassen Sie mir ja einen Schimmer, und es wäre möglich, daß sich eines Tages doch der eine oder andere Brief fände, den der Zufall bewahrt hat.«
Später verkaufte Ida Fließ den auf ihrer Seite erhalten gebliebenen Teil der Korrespondenz, wie wir aus einem Briefwechsel zwischen Marie Bonaparte und Freud erfahren.[8] Am 30. Dezember 1936 schrieb Marie Bonaparte u.a.:
»Heute ist ein Herr Stahl zu mir gekommen aus Berlin. Er hat von der Witwe von Fließ Ihre Briefe und Manuskripte aus dem Nachlaß von Fließ erhalten. Die Witwe wollte zuerst alles an die Nationalpreußische Bibliothek übergeben, aber seitdem Ihre Werke in Deutschland verbrannt wurden, hat sie darauf verzichtet und die Manuskripte an diesen Herrn Stahl, der einen sehr guten persönlichen Eindruck macht und der Schriftsteller und Kunsthändler ist, verkauft. Er soll Angebote aus Amerika bekommen haben für diese Sammlung Ihrer Schriften, aber ehe er sich resignierte, diese wertvollen Dokumente nach Amerika weggehen zu sehen, hat er sich an mich gewendet, und ich habe mich entschlossen, alles von ihm zu kaufen. Damit es in Europa und in meinen Händen bliebe, hat er mir sogar einen niedrigeren Preis gegönnt, 12000 Francs allsammen für 250 Briefe von Ihnen (mehrere von Breuer) und sehr lange theoretische Entwürfe von Ihrer Hand in ziemlich großer Mehrzahl. Ich freue mich, daß ich das tun konnte, denn es würde mir leid tun, wenn alles das in der weiten Welt herumginge. Daß es von Ihnen ist, kein Zweifel! Ich kenne ja Ihre Schrift!«
Freud antwortete am 3. Januar 1937:
»Meine liebe Marie!
… Die Angelegenheit der Korrespondenz mit Fließ hat mich erschüttert. Nach seinem Tode verlangte die Witwe seine Briefe an mich zurück. Ich sagte bedingungslos zu, konnte sie aber nicht auffinden. Ob ich sie vernichtet oder bloß kunstvoll versteckt, weiß ich noch heute nicht.
Unsere Korrespondenz war die intimste, die Sie sich denken können. Es wäre höchst peinlich gewesen, wenn sie in fremde Hände gefallen wäre … Es ist darum ein außerordentlicher Liebesdienst, daß Sie sie an sich gebracht und allen Gefahren entrückt haben. Nur tut es mir leid um Ihre Ausgabe. Darf ich Ihnen anbieten, mich mit der Hälfte des Betrages zu beteiligen? Ich hätte die Briefe doch selbst erwerben müssen, wenn sich der Mann direkt an mich gewendet hätte.
Ich möchte nichts davon zur Kenntnis der sogenannten Nachwelt kommen lassen …
Nochmals herzlichen Dank von Ihrem
Freud«
Vier Tage später schrieb Marie Bonaparte aus Paris:
»… Der Herr Stahl ist eben gekommen und hat mir den ersten Teil der Fließ-Papiere übermittelt: wissenschaftliche Essays, die in Ihren Briefen zerstreut waren und die er separat gesammelt hat. – Das übrige, die eigentlichen Briefe, die ungefähr 200 bis 250 Stücke umfassen, sind noch in Deutschland, woher er sie in einigen Wochen von jemand nach Paris bringen lassen wird. Die Briefe und Manuskripte wurden mir angeboten unter der Bedingung, daß ich sie nicht direkt oder indirekt an die Freud-Familie verkaufen würde, denn man fürchtete eine Vernichtung dieses wichtigen Materials für die Geschichte der Psychoanalyse. Das wäre kein entscheidender Grund für mich, die Sache mit Ihnen nicht zu besprechen, aber Sie werden nicht erstaunt sein, denn Sie kennen meine Ideen und Gefühle darüber, daß ich persönlich eine ungeheure Abneigung vor der Vernichtung Ihrer Briefe und Manuskripte habe.
Sie selbst … empfinden sich vielleicht nicht in Ihrer vollen Größe. Sie gehören der Geschichte des menschlichen Denkens wie Plato, sagen wir, oder Goethe. Was wäre für uns arme Nachwelt verlorengegangen, wenn die Gespräche Goethes mit Eckermann vernichtet worden wären oder die Dialoge von Plato, diese letzten aus Pietät für Sokrates' Figur, sagen wir, damit die Nachwelt nicht erfahre, daß Sokrates sich der Päderastie mit Phaidros oder Alkibiades gewidmet hatte? In Ihren Briefen kann ja nichts von der Art sein! Nichts, wenn man Sie kennt, das Sie verkleinlichen könnte! Und Sie selbst … haben in Ihrer schönen Arbeit gegen die Idealisierung á tout prix der großen Männer, der großen Vatergestalten der Menschheit, geschrieben. Und wenn ich es richtig erahne, würde an der Geschichte der Psychoanalyse, dieser einzigen neuen Wissenschaft, Ihrer Schöpfung, die wichtiger ist als die Ideen von Plato selbst, etwas verlorengehen, wenn für einige persönliche Bemerkungen, die in diesen Briefen stehen, das gesamte Material vernichtet wäre!
Meine Idee war die folgende: die Briefe erwerben, damit sie nicht von, wer weiß, publiziert werden, und sie jahrelang aufbewahren, z.B. in einer Staatsbibliothek, in Genf, sagen wir, wo Kriegsgefahren und Revolutionen weniger zu fürchten sind, mit dem Auftrag, nichts darin anzuschauen bis 80 oder 100 Jahre nach Ihrem Tode. Wer könnte dann verletzt sein, sogar von Ihrer Familie, wenn was darin stünde!
Außerdem weiß ich nicht, was darin steht. Ich werde Ihre Briefe nicht lesen, wenn es Ihr Wille ist, nichts davon. Nur einen habe ich heute angeschaut, der mit den Essays war, einen begleitete, nichts sehr Kompromittierendes stand darin!
Erinnern Sie sich wirklich, was darin stand, nach so langer Zeit? Sie haben ja sogar vergessen, ob Sie die Briefe von Fließ zerstört oder versteckt haben … So peinlich muß der Abbruch dieser Freundschaft gewesen sein.
Wahrscheinlich haben Sie über viele Leute sich ganz frei ausgesprochen. Sogar über Ihre Familie, … vielleicht über sich selbst sehr viel gesagt …
Die Briefe habe ich außerdem noch nicht, erst in einigen Wochen werde ich sie bekommen. Wenn Sie wollen, könnte ich Anfang März, auf meiner Reise dann nach Griechenland, mich ein oder zwei Tage in Wien aufhalten, um die Angelegenheit mit Ihnen zu besprechen.
Ich liebe Sie … und verehre Sie, und deshalb habe ich Ihnen in dieser Weise geschrieben.
Marie
[P.S.] Ich will die Briefe allein erwerben; wir werden freier darüber sprechen!«
Freud erwiderte auf diesen Brief am 10. Januar 1937:
»… Daß meine Briefe an Fließ noch nicht bei Ihnen, sondern in Berlin sind, ist eine Enttäuschung … Ihre Auffassungen und Vergleiche, die Sie anstellen, kann ich nicht leicht annehmen. Ich sage mir nur, daß in 80 oder 100 Jahren das Interesse für den Inhalt der Korrespondenz wesentlich geringer sein wird als heute.
Es ist mir natürlich recht, wenn auch Sie die Briefe nicht lesen, aber Sie sollen nicht glauben, daß sie nichts als schwere Indiskretionen enthalten; bei der so intimen Natur unseres Verkehrs verbreiten sich diese Briefe natürlich über alles Mögliche, Sachliches wie Persönliches, und das Sachliche, das alle Ahnungen und Irrwege der keimenden Analyse betrifft, ist in diesem Falle auch recht persönlich … Darum wäre es mir so lieb, den Stoff in Ihren Händen zu wissen …
Ihr Versprechen, im März, wenn auch nur auf Tage, nach Wien zu kommen, nehme ich dankend an.
Herzlich Ihr Freud«
Marie Bonaparte beeilte sich, Freuds Besorgnisse zu zerstreuen (12. Januar): »Ich will Sie gleich beruhigen wegen der Fließ-Briefe. Sie sind nicht mehr, obwohl in Deutschland noch, in den Händen der ›Hexe‹, sondern gehören schon dem Herrn Stahl, der sie von ihr mit ihrer gesamten Bibliothek erworben hat. Sie sind in seinem Besitz, und eine Freundin von ihm wird sie hierher bringen …« Und am 10. Februar konnte sie endlich mitteilen: »… Heute sollen mir Ihre Briefe gebracht werden. Eine Dame hat sie in London mitgenommen, und jetzt sind sie in Paris, und ich werde sie heute abend bekommen.«
In ihren Aufzeichnungen, die ich in Freuds Schreibtisch in seiner letzten Wohnung in Maresfield Gardens (London) fand, faßt Marie Bonaparte ihre Rettungsaktion folgendermaßen zusammen[9]:
»Als ich Freud aus Paris schrieb, daß Ida Fließ seine Briefe verkauft habe und daß ich sie von Reinhold Stahl erworben hätte, war er sehr bewegt. Er sah darin einen höchst feindseligen Akt der Witwe von Fließ und war froh zu wissen, daß sich die Briefe wenigstens in meinen Händen befanden und nicht irgendwohin nach Amerika gegangen waren, wo man sie zweifellos sogleich veröffentlicht hätte … Freud erbot sich, die Hälfte des Preises für die Briefe zu bezahlen, was ich jedoch ablehnte. Später sagte er mir, er habe diesen Vorschlag einer Ausgabenteilung nur gemacht, weil er sicher gewesen sei, daß ich auf ein Angebot, alles zu bezahlen, nicht eingegangen wäre.
Ich fragte in einem Brief bei Freud an, ob ich seine Korrespondenz lesen dürfe. Er antwortete zunächst, es sei ihm lieber, wenn ich sie nicht läse. Als ich ihn aber danach Ende Februar oder Anfang März 1937 in Wien besuchte und er mir sagte, daß es ihm am liebsten wäre, wenn seine Briefe verbrannt würden, weigerte ich mich. Ich bat ihn, sie lesen zu dürfen, um ein Urteil über ihren Charakter zu gewinnen, und Freud erteilte mir die Erlaubnis. ›Ich hoffe, ich bringe Sie noch dahin, sie zu vernichten‹, sagte er eines Tages.
Martin und Anna [Freud] meinen wie ich, daß die Briefe aufbewahrt und später veröffentlicht werden sollen. Freud hingegen erzählte mir am 20. November 1937, als ich mich wiederum und bereits seit fünf Monaten aktiv mit seinen Briefen beschäftigte, die Geschichte vom Auerhahn: ›Ein Jäger hat einen Auerhahn erlegt. Er fragt einen Freund, wie er ihn zubereiten solle. Der Freund antwortet, er solle ihn rupfen, ausnehmen und dann ein Loch in der Erde graben. In das Loch gebe man Tannenzweige, lege den Vogel darauf, bedecke ihn nochmals mit Zweigen und schütte alles mit Erde zu. »Und dann?« fragt der Jäger. »Nach zwei Wochen holst du ihn aus der Erde heraus.« »Und dann?« »Dann wirfst du ihn auf den Mist.«‹
Freud interessierte sich indessen für den Brief aus Thumsee [Brief 270], den ich ihm zuvor gezeigt hatte, und bezeichnete ihn als einen sehr wichtigen Brief. Ich werde ihm noch andere ausgewählte Stücke zeigen.[10]
Er machte mich darauf aufmerksam, daß Briefe fehlen: alle, die sich auf den Bruch mit Fließ beziehen (Stahl behauptet, daß sie bei den Prozeßunterlagen geblieben sind), und einer über einen Traum, der mit Martha Freud zu tun hatte. Vier Umschläge sind außerdem leer.«[11]
An dieser Niederschrift ist speziell der vorletzte Satz von Bedeutung. Die den eigentlichen Bruch mit Fließ betreffenden Briefe sind schließlich nach Jerusalem gelangt und werden unten an Ort und Stelle abgedruckt.[12] Weniger klar hingegen ist, was es mit dem anderen Brief auf sich hat, der einen Traum über Martha Freud enthalten haben soll und der nach wie vor verschollen ist. Wahrscheinlich ging es darin um den »verlorenen Traum«, den Freud auf Veranlassung von Fließ aus der Traumdeutung entfernte und der in den nachfolgenden Briefen mehrfach erwähnt wird.[13] Woher wußte Freud, daß dieser Brief fehlte? Wenn er nicht das ganze von Marie Bonaparte erworbene Konvolut durchgesehen hat, wird man annehmen müssen, daß er ihn schon lange zuvor von Fließ zurückbekommen hatte. Es ist besonders bedauerlich, daß dieser Text wohl als verloren gelten muß: Er wäre zweifellos eines der wichtigsten Stücke der Sammlung gewesen, da er vermutlich einen Traum enthielt, von dem Freud selbst sagt, er sei »zu Grunde« analysiert worden.[14]
Die Fortsetzung der abenteuerlichen Geschichte dieser Briefe wird von Ernest Jones erzählt[15]: »Glücklicherweise hatte sie [Marie Bonaparte] den Mut, ihrem Analytiker und Lehrer Trotz zu bieten, und deponierte sie [= die Briefe] während des Winters 1937/38 bei der Bank Rothschild in Wien, in der Absicht, sie bei ihrer Rückkehr im Sommer darauf weiter zu studieren. Als Hitler im März in Österreich einmarschierte, war eine jüdische Bank nicht mehr sicher, und Marie Bonaparte eilte sofort nach Wien, wo man ihr, da sie eine Prinzessin von Griechenland und Dänemark war, erlaubte, in Gegenwart der Gestapo den Inhalt ihres Safes an sich zu nehmen. Diese hätte die Korrespondenz sicher vernichtet, wenn sie bei jener Gelegenheit oder vorher in Berlin entdeckt worden wäre. Als Marie Bonaparte im Februar 1940 – vier Monate vor dem Einmarsch der Deutschen – Paris verlassen mußte, deponierte sie die kostbaren Dokumente bei der dänischen Gesandtschaft in Paris. Es war nicht der sicherste Ort; aber dank dem General von Choltitz, der bei der Befreiung Hitlers Befehle mißachtete, blieb Paris und damit auch die Gesandtschaft verschont. Nachdem die Briefe alle diese Gefahren überstanden hatten, trotzten sie auch noch den Minen im Ärmelkanal und gelangten, für den Fall einer Schiffskatastrophe in wasserdichtes, schwimmfähiges Material eingepackt, unversehrt nach London.«
In den späten 40er Jahren wurden die Briefe von Marie Bonaparte an Anna Freud ausgehändigt, die sie abschreiben ließ und sie Ernest Jones zur Auswertung für seine monumentale Freud-Biographie überließ. 1980 vermachte Anna Freud die Originale der Library of Congress, wo sie für die Öffentlichkeit gesperrt sind.
Die Öffentlichkeit erfuhr von der Existenz dieser Briefe und von der intensiven Freundschaft zwischen den beiden Männern, als 1950 in London (bei Imago Publishing Company) eine deutsche Ausgabe unter dem Titel Sigmund Freud, Aus den Anfängen der Psychoanalyse. Briefe an Wilhelm Fließ, Abhandlungen und Notizen aus den Jahren 1887–1902 erschien.[16] Als Herausgeber zeichneten Marie Bonaparte (Paris), Anna Freud (London) und Ernst Kris (New York). Dem Band war eine exzellente, ausführliche Einleitung von Ernst Kris beigegeben[17], einem renommierten Analytiker und engen Freund von Anna Freud, der selbst mit der Familie Fließ verschwägert war.[18] In diese Edition wurden freilich nur 168 der 284 den Herausgebern verfügbaren Briefe und Arbeitspapiere aufgenommen. Auch wurden in den meisten Briefen – gelegentlich stillschweigend – kürzere oder längere Passagen ausgelassen. Hierzu bemerken die Herausgeber in ihrem Vorwort: »Prinzip der Auswahl war, zu veröffentlichen, was sich auf die wissenschaftliche Arbeit und die wissenschaftlichen Interessen des Schreibers bezieht sowie auch auf die sozialen und politischen Verhältnisse, unter denen die Psychoanalyse entstanden ist. Gekürzt oder ausgelassen andererseits sind Stellen, die der ärztlichen oder persönlichen Diskretion zuwiderlaufen; Bemühungen des Schreibers, auf Fließ' wissenschaftliche Theorien und Periodenberechnungen einzugehen; ferner alle Briefe und Briefstellen, die Wiederholungen gleicher Gedankengänge enthalten, die sich auf die häufigen Verabredungen, geplante und zustandegekommene Begegnungen und auf manche Vorkommnisse im Familien- und Freundeskreis beziehen.«
In der vorliegenden Neuausgabe hingegen werden sämtliche Briefe, einschließlich solcher, die neuerdings in der Jüdischen National- und Universitätsbibliothek Jerusalem[19], in Maresfield Gardens[20] und in Robert Fließ' privater Sammlung[21] entdeckt wurden, ohne alle Streichungen abgedruckt. Nur die Namen von Patienten, die nicht bereits an anderer Stelle identifiziert sind, werden durch willkürlich gewählte Initialen verschlüsselt (ein Verfahren, das Freud selbst angewandt hat). Ferner wurde der eigentlich zu diesem Konvolut gehörende ›Entwurf einer Psychologie‹ (in Freud 1950a) nicht mit aufgenommen, der vielmehr demnächst im Nachtragsband der Gesammelten Werke Freuds in einer revidierten Fassung zugänglich gemacht werden wird.
Der im folgenden wiedergegebene deutsche Text der Briefe weicht nicht selten vom Wortlaut der älteren Ausgabe ab. Er ist das Resultat eines mehrstufigen Transkriptions- und Revisionsprozesses. Zunächst stellte mir Anna Freud das ursprüngliche, von ihr selbst und von Kris korrigierte Transkript sämtlicher Briefe zur Verfügung, nach dem der Abdruck in der gekürzten Erstveröffentlichung erfolgt war. Diese Abschrift wurde von meiner Assistentin Marianne Loring mit einer Photokopie der 284 Originalbriefe und -abhandlungen verglichen (von denen sich einige noch im Nachlaß von James Strachey befanden). Der Vergleich ergab zahlreiche verbesserte Lesungen, die ich zum Teil mit Anna Freud besprach. Später ging Gerhard Fichtner vom Institut für Geschichte der Medizin in Tübingen das ganze Konvolut durch und entdeckte weitere Irrtümer im anfänglichen wie im korrigierten Transkript. Fichtner fertigte eine neue Abschrift an, die wiederum von M. Loring und mir durchgesehen wurde. Die so vorbereitete Fassung wurde von Fichtner mehrmals an den Originalen überprüft. Seine daraufhin hergestellte definitive Transkription diente, mit einigen Berichtigungen von Michael Schröter, als Druckvorlage für diesen Band. Sie liegt ferner der Neuübersetzung in der gleichzeitig erscheinenden englischen Fassung dieser Ausgabe zugrunde: The Complete Letters of Sigmund Freud to Wilhelm Fliess, 1887–1904, translated and edited by Jeffrey Moussaieff Masson, Cambridge, Mass. – London 1985.
Es ist ratsam, die hier gebotene Edition der Briefe Freuds an Fließ in Verbindung mit einigen anderen bahnbrechenden Werken der Freud-Biographik zu lesen. Vorzügliche Hinweise auf Parallelstellen in Freuds veröffentlichten Schriften finden sich in den Anmerkungen Stracheys (1966) zu seiner Übersetzung ausgewählter Stücke, insbesondere der ›Manuskripte‹, des Fließ-Konvoluts in Bd. 1 der englischen Standard Edition der Werke Freuds. Max Schur, der persönliche Arzt von Freud und später selbst ein namhafter Analytiker, hat einige zuvor unbekannte Briefe und Briefteile der Fließ-Korrespondenz in seinem Aufsatz ›Weitere »Tagesreste« zum »Traummuster«‹ (1966) und insbesondere in seinem Buch Sigmund Freud. Leben und Sterben (1972) publiziert und erörtert. Seine Deutung von Freuds Beziehung zu Fließ erscheint mir unter allen bisherigen Versuchen als die ausgewogenste. Ernest Jones zitiert in seiner umfassenden Lebensbeschreibung Freuds ebenfalls zahlreiche Passagen aus dem gesamten Briefkorpus und informiert über den biographischen Hintergrund vieler darin erwähnter Ereignisse.
Trotz der Tatsache, daß Freuds Leben im Äußeren bemerkenswert undramatisch verlief, ist mehr über ihn geschrieben worden als über jeden anderen Denker der Gegenwart – wahrscheinlich deshalb, weil er so nachhaltig zur Veränderung und Prägung des intellektuellen und emotionalen Klimas unserer Tage beigetragen hat. Viele Analysen beschäftigen sich mit seinem Innenleben, obwohl so gut wie alles, was wir darüber wissen, aus seinen eigenen veröffentlichten Schriften stammt. Die unvollständige Ausgabe seiner Briefe an Fließ löste einen enormen Aufschwung der Freud-Biographik aus, da er nirgendwo sonst seine innersten Gedanken mit derselben Aufrichtigkeit, Unmittelbarkeit und Tiefe zu Papier gebracht hat. Nun endlich, fast 100 Jahre nach ihrer Entstehung, liegen diese Briefe ungekürzt vor. Sie bilden einen der Marksteine des Menschenverständnisses in unserer Zeit.
Fußnoten
[1]
Ausführlich zitiert in Anm. 2 zu Manuskript C/1. (Anm. des Bearb.)
[2]
Vgl. den bei Jones (1953–57, Bd. 2, S. 106f.) abgedruckten Auszug aus einem Brief an Ferenczi vom 6. Oktober 1910: »Daß ich kein Bedürfnis nach jener vollen Eröffnung der Persönlichkeit mehr habe, haben Sie nicht nur bemerkt, sondern auch verstanden und auf seinen traumatischen Anlaß richtig zurückgekehrt [?] … Seit dem Fall Fließ, mit dessen Überwindung Sie mich gerade beschäftigt haben [?], ist dieses Bedürfnis bei mir erloschen. Ein Stück homosexueller Besetzung ist eingezogen und zur Vergrößerung des eigenen Ichs verwendet worden. Mir ist gelungen, was dem Paranoiker mißlingt.«
[3]
In einem unveröffentlichten Brief vom 28. August 1944, auf Englisch; im Bernfeld-Archiv der Library of Congress.
[4]
Siehe unten Anm. 9 und Text dazu. (Anm.d. Bearb.)
[5]
Nur der Briefwechsel mit Jung (Freud 1974a) und Abraham (Freud 1965a) liegt bisher im Druck vor. In einem unveröffentlichten Brief an Ferenczi vom 17. Oktober 1910 schreibt Freud: »Wahrscheinlich stellen Sie sich ganz andere Geheimnisse vor, als ich mir reserviert habe, oder meinen, es sei ein besonderes Leiden damit verknüpft, während ich mich allem gewachsen fühle und die Überwindung meiner Homosexualität mit dem Ergebnis der größeren Selbständigkeit gutheiße.« Und am 16. Dezember 1910 nennt er gegenüber demselben Adressaten zum letzten Mal den Namen von Fließ (ebenfalls unveröffentlicht): »Fließ habe ich jetzt überwunden, worauf Sie so neugierig waren.«
[6]
Die Originale liegen in der Jüdischen National- und Universitätsbibliothek in Jerusalem.
[7]
Anna Freud versicherte mir, daß zahlreiche gründliche Suchaktionen im Haus der Familie Freud in Maresfield Gardens (London) keinerlei Briefe von Fließ zutage gefördert hätten. Zur selben Zeit jedoch, als sie dies sagte, entdeckte ich dort ein ebensolches, bisher unbekanntes Schreiben (Brief 282). Es ist angesichts der Bedeutung, die diese Beziehung für ihn hatte, schwer vorstellbar, daß Freud die Briefe vernichtet haben sollte, ohne sich später mit Sicherheit daran zu erinnern – zumal er nach seinem eigenen Zeugnis erst 1910 imstande war, Fließ zu »überwinden«.
[8]
Diese (auf Deutsch geschriebenen) Briefe wurden – mit einigen hier rückgängig gemachten Auslassungen – von Max Schur in englischer Übersetzung veröffentlicht (Schur 1965). Die Originale, die sich im Marie-Bonaparte-Archiv der Library of Congress befinden und bis zum Jahr 2020 unter Verschluß liegen, waren mir nicht zugänglich. Doch erhielt ich Einblick in die (gekürzten) Abschriften, die vermutlich von der Verfasserin selbst an Ernest Jones übersandt wurden (heute im Ernest-Jones-Archiv, London). – In der folgenden Wiedergabe sind einige geringfügige grammatische Irrtümer stillschweigend berichtigt worden.
[9]
In diesen französisch abgefaßten, handschriftlichen Aufzeichnungen (unter dem Datum des 24. November 1937) gibt Marie Bonaparte eine Liste aller Briefe an Fließ, jeweils mit einer kurzen Inhaltsangabe (gewöhnlich nicht mehr als ein oder zwei Absätze pro Brief). Am Ende finden sich einige Seiten mit Notizen über ihre Gespräche mit Freud über Fließ.
[10]
Marie Bonaparte hat zwei Blätter angelegt: »Liste von Briefen, die Freud oder Anna Freud in Wien, Herbst 1937, gezeigt werden sollen.« Es ist nicht ganz deutlich, welche Briefe Freud tatsächlich zu Augen gekommen sind. Marie Bonaparte schreibt: »Freud hat nur die ––– [unleserlich], Anna die blau markierten Briefe gesehen.« Das unleserliche Wort muß wahrscheinlich »rot« heißen, da einige Stücke mit einem blauen Kreuz, andere mit einem roten Strich gekennzeichnet sind. (Vgl. die Faksimiles im vorliegenden Band, Abb. 2)
[11]
Auf einem gesonderten Blatt, das ebenfalls in Freuds Schreibtisch in Maresfield Gardens aufgefunden wurde, sind die folgenden Daten angeführt: 2. August 1896 (aus Aussee), 13. Februar 1898 (ein großer Umschlag), 17. Juli 1899 (aus Wien), 24. Dezember 1899 (aus Wien). (Zusatz des Bearb.:) Der erste dieser Briefe scheint tatsächlich zu fehlen; der zweite Umschlag mag eine später zurückgesandte Aufzeichnung betreffen (siehe Brief 157 mit Anm. 6); der dritte könnte zu dem von Freud falsch datierten und daher wohl in dem Konvolut falsch eingeordneten Brief 206 gehören; warum der vierte von M. Bonaparte nicht mit Brief 230 in Verbindung gebracht wurde, ist unerfindlich.
[12]
Vermutlich Briefe 281, 283, 285, 287 (vgl. Anm. 1 zu Brief 281 und Anm. 11 zu Brief 287); der englische Originaltext der Einleitung des Herausgebers wurde gemäß dieser Identifizierung umformuliert. (Anm.d. Bearb.)
[13]
Vgl. etwa Brief 169 mit Anm. 1. (Anm.d. Bearb.)
[14]
Der Herausgeber der vorliegenden Edition hegt eine »schwache Hoffnung«, daß dieser Brief eines Tages vielleicht doch noch auftauchen könnte (was freilich von Anna Freud kategorisch verneint wurde). Plausibler erscheint demgegenüber die Vermutung, daß Freud mit dem »Traumbrief« eine in Brief 157 erwähnte Aufzeichnung meinte (vgl. dort Anm. 6), die ihm Fließ wenig später tatsächlich zurückgeschickt hat (siehe Brief 158) und die dann der großen Verbrennung aller persönlichen Papiere im Jahre 1908 (vgl. Jones 1953–57, Bd. 1, S. 10) zum Opfer gefallen sein mag. Der obige Abschnitt der Einleitung ist gegenüber dem Original entsprechend dieser letzteren Hypothese redigiert worden. (Anm.d. Bearb.)
[15]
Jones (1953–57, Bd. 1, S. 338).
[16]
Ein erster Hinweis auf die Freundschaft findet sich bereits in einem Vortrag von Ernst Kris (1950b) auf dem 16. Internationalen psychoanalytischen Kongreß in Zürich (August 1949).
[17]
Diese Einleitung ist im Anhang des vorliegenden Bandes (S. 519–561) wieder abgedruckt. (Anm.d. Bearb.)
[18]
Siehe Anm. 4 zu Brief 106 und Anm. 5 zu Brief 246.
[19]
Die Briefe 12, 14, 73, 134, 281, 283–287 (unter den letzten auch zwei Briefe von Fließ in Abschrift). (Anm.d. Bearb.)
[20]
Briefe 28, 282 (von Fließ). (Anm.d. Bearb.)
[21]
Briefe 36, 114. (Anm.d. Bearb.)
Zur Transkription
Bei meinem Besuch in Berkeley zu Beginn des Jahres 1982, der eigentlich der Transkription anderer Freud-Texte dienen sollte, wurden mir von Jeffrey M. Masson einige fragliche Lesungen der vollständigen Transkription von Freuds Briefen an Wilhelm Fließ vorgelegt, einer Transkription, die einst von den Herausgebern der Ausgabe von 1950 angefertigt worden war. Eine stichprobenartige Überprüfung ergab sehr schnell, daß Verläßlichkeit nur durch eine gründliche Revision des gesamten Textes zu erreichen sei. So habe ich in den folgenden Wochen alle Texte nach den vorliegenden Xerokopien der Originalbriefe und -manuskripte auf Tonband diktiert, während Marianne Loring gleichzeitig die Lesungen der bereits existierenden Transkription kontrollierte und mich auf Abweichungen aufmerksam machte. Die Arbeit an den Texten bot zugleich die Möglichkeit, mit J.M. Msson intensiv über das Verständnis der Texte zu diskutieren. Ich erinnere mich gern und dankbar an diese Arbeitsgemeinschaft.
Nach meiner Rückkehr nach Deutschland fertigte ich eine vollständige Abschrift der Briefe und Manuskripte an, die ich in der Folgezeit noch mehrfach an den Xerokopien überprüfte, wobei die Hinweise und Fragen des Herausgebers und seiner Forschungsassistentin Marianne Loring berücksichtigt wurden.
Als ich in der Schlußphase der Mitarbeit an dieser Edition den deutschen Text des Anmerkungsapparates durchsehen konnte, erwies es sich zur Klärung fraglicher Punkte als notwendig, den Nachlaß von Wilhelm Fließ in der Handschriftenabteilung der Deutschen Staatsbibliothek Berlin/DDR durchzusehen. Dabei stieß ich – zu meiner eigenen Überraschung – auf eine Reihe bisher unbekannter Freud-Manuskripte, die eindeutig in den Zusammenhang des Fließ-Briefwechsels gehören und die gegenseitige Einflußnahme und Zusammenarbeit von Freud und Fließ neu und eindrücklich beleuchten (Manuskript C/2, Manuskript O, Beilage zu Brief 147, Beilagen [?] zu den Briefen 119, 132, 139)[1]. Die bereitwillige Unterstützung des Leiters der Handschriftenabteilung, Herrn Dr. H.-E. Teitge, und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermöglichte es, diese Texte noch in die vorliegende Ausgabe des Briefwechsels aufzunehmen. Dafür möchte ich auch an dieser Stelle herzlichen Dank sagen. Die Arbeiten an der amerikanischen Ausgabe der Fließ-Briefe waren zu diesem Zeitpunkt schon zu weit fortgeschritten, als daß die Ergänzungen vor der Publikation noch hätten eingearbeitet werden können. Sie sollen dort in einer zweiten Auflage berücksichtigt werden.
Sehr dankbar bin ich schließlich für die verständnisvolle und stimulierende Zusammenarbeit mit Ilse Grubrich-Simitis und Ingeborg Meyer-Palmedo vom S. Fischer Verlag und – last not least – mit Michael Schröter bei der Schlußredaktion dieser Ausgabe.
Zur Textgestaltung:
Abweichende Lesungen gegenüber der älteren Ausgabe (Freud 1950a) sind im vorliegenden deutschen Text nur dann kenntlich gemacht worden, wenn der Sinn durch die neue Lesart mehr oder weniger deutlich modifiziert wird. In diesen Fällen sind die entsprechenden Wörter oder Passagen in kleine Winkelklammern ⌈ ⌉ eingeschlossen. Neu aufgenommene Briefteile oder neue Briefe sind in der Konkordanz im Anhang nachgewiesen.
Ein textkritischer Apparat, der durch hochgestellte Kleinbuchstaben gekennzeichnet ist, macht nicht nur auf fragliche Lesungen aufmerksam, sondern weist auch Streichungen, Verbesserungen und Verschreibungen von Freuds Hand nach, soweit sie für das Verständnis des Textes von Belang sein könnten. Offensichtliche und kleine Schreibfehler, die nicht als bedeutsam angesehen werden konnten, wurden dagegen stillschweigend verbessert.
Im übrigen wurde die Textgestaltung nach folgenden Prinzipien vorgenommen:
Die Orthographie wurde dem heutigen Stand angeglichen, jedoch wurde der Lautbestand gewahrt (z.B. kömmt, nicht: kommt). Ebenso wurde die Interpunktion behutsam normalisiert. Die Normalisierung bezieht sich auch auf die getrennte oder zusammengezogene Schreibung bestimmter Wörter. Zahlen von eins bis zwölf wurden in der Regel ausgeschrieben (nicht bei Bruchzahlen, Uhrzeiten, Zahlengruppen u.ä.). Personennamen wurden stets in der zu ihrer Zeit gebräuchlichen Schreibweise wiedergegeben (z.B. Möbius, nicht Moebius).
Landschaftliche oder persönliche Spracheigentümlichkeiten wurden beibehalten.
Abkürzungen wurden stillschweigend aufgelöst. Nur wenn über die Auflösung einer Abkürzung Zweifel bestehen können, wurde der aufgelöste Teil in eckige Klammern gesetzt. Eckige Klammern wurden auch dort verwendet, wo die Art der Abkürzung aufschlußreich erscheint (z.B. bei den von Freud zunächst verwendeten Abkürzungen, bevor er zu seinen charakteristischen Kürzeln wie Bw und Ubw findet). Allgemein gebräuchliche Abkürzungen (wie z.B., d.h., usw.) wurden beibehalten.
Zum Verständnis notwendige Ergänzungen im Text wurden grundsätzlich in eckige Klammern gesetzt.
Die gedruckten Briefköpfe wurden so wiedergegeben, wie sie in den Originalen erscheinen, allerdings auch heutiger Schreibweise angeglichen. Die Grußformeln wurden wie in den Originalen belassen, dort auftauchende Abkürzungen des Namens beibehalten.
Nachschriften sind immer ans Ende der Briefe gesetzt, gleichgültig wo und in welcher Form sie in den Originalen erscheinen. Anmerkungen, die Freud gelegentlich in den Briefen verwendet, sind durch Sterne bezeichnet und dadurch deutlich von den Anmerkungen des Herausgebers und des Bearbeiters unterschieden worden.
Unterstreichungen von Freuds Hand werden durch Kursivdruck hervorgehoben.
Gerhard Fichtner
Fußnoten
[1]
Vgl. außerdem Anm. 2 zu Brief 105.
Zur deutschen Ausgabe
Die vorliegende deutsche Edition basiert auf der Arbeit des Herausgebers und Übersetzers der im April 1985 (bei Harvard University Press) erschienenen amerikanischen Ausgabe, geht aber zum Teil auch eigene Wege. Was die Erschließung und Kommentierung der Texte anbelangt, so sind folgende Besonderheiten der deutschen gegenüber der amerikanischen Ausgabe zu nennen:
Innerhalb des Brieftextes werden, abgesehen von arabischen Zahlen, die auf die durchnumerierten Sachanmerkungen verweisen, zwei weitere Arten von redaktionellen Zeichen verwendet:
Hochgestellte Kleinbuchstaben verweisen auf den textkritischen Apparat, für den G. Fichtner verantwortlich zeichnet.
Durch Winkelhäkchen sind abweichende Lesungen gegenüber der älteren Ausgabe (Freud 1950a) markiert (vgl. ›Zur Transkription‹).
Die Verschlüsselung der Patientennamen wurde so abgeändert, daß nach Möglichkeit identische Personen durch identische Buchstaben bezeichnet werden und daß umgekehrt dieselben Buchstaben immer dieselben Personen meinen.
Die sachlichen Erläuterungen zu den Briefen unterscheiden sich in mehrfacher Hinsicht von denen der englischen Ausgabe:
Sie umfassen den Hauptbestand der Noten von Ernst Kris zur gekürzten Erstveröffentlichung der Fließ-Briefe (z.T. in einer an den Kontext der Neuausgabe angepaßten Gestalt). Eine solche Einbeziehung, die von Bearbeiter und Verlag gemeinsam beschlossen wurde, war unter den gegebenen Umständen sowohl möglich, da die Rechte an jener Edition in derselben Hand (bei S. Fischer) liegen, als auch wünschenswert, da auf dem deutschsprachigen Markt, anders als auf dem englischsprachigen, die ältere, seit Jahren vergriffene Ausgabe nicht mehr erscheinen wird. Ihre unverlierbaren Errungenschaften konnten und mußten daher in der jetzigen Neuausgabe im vollen Sinne des Wortes »aufgehoben« werden.
Einige der ursprünglichen Anmerkungen des Herausgebers wurden für den vorliegenden Band gestrafft und dem maßstabsetzenden Schreib- und Argumentationsstil von Kris angeglichen; andere, vor allem sprachliche Erläuterungen, konnten ganz wegfallen.
Schließlich wurden vom Bearbeiter zahlreiche Ergänzungen hinzugefügt. Spezielle Mühe wurde darauf verwandt, die fehlende Hälfte der Korrespondenz, die Briefe von Fließ, durch ausgesuchte Mitteilungen aus dessen Werken wenigstens in einigen Bruchstücken zu ergänzen.
Der Sachapparat dieses Bandes setzt sich demnach aus Beiträgen verschiedener Herkunft zusammen. Diese sind folgendermaßen kenntlich gemacht:
Anmerkungen, die wörtlich oder im Informationsgehalt auf den Herausgeber zurückgehen, erscheinen prinzipiell ungezeichnet.
Den von Ernst Kris übernommenen Noten ist das Sigel (K) beigefügt. Um innerhalb der Anmerkungen ein Maximum an Konsistenz und Einheitlichkeit zu erzielen, erwiesen sich gewisse Änderungen des Krisschen Textes als unumgänglich. Diese redaktionellen Eingriffe (Umplazierungen, geringfügige Richtigstellungen, Kürzungen, Anpassung der Zitierweise, stilistische Glättungen) sind, soweit sie nicht die Substanz seiner Gedanken und Funde berühren, stillschweigend durchgeführt worden.
Zusätze des Bearbeiters sind mit der Initiale (S) markiert.
Wo es nötig schien, Informationen aus mehreren Quellen in einer Anmerkung zu verbinden, werden entweder die einzelnen Komponenten gezeichnet oder, wenn diese allzu eng ineinandergearbeitet sind, Mischsigel – z.B. (K/M), (M/S) – verwendet, wobei die Reihenfolge der Initialen die Gewichtsverteilung zwischen den verschiedenen Beiträgen andeuten soll. Nur in solchen kombinierten Fällen sind auch die Erläuterungen des Herausgebers durch das Sigel (M) eigens ausgewiesen.
Im Sinne des Erfordernisses, die bahnbrechende Leistung von Ernst Kris in der deutschen Version dieser Ausgabe »aufzuheben«, wird seine damalige Einleitung als Anhang wieder zugänglich gemacht (unten S. 519–561).
Es erschien nützlich, der deutschen Ausgabe, als Hilfsmittel der Forschung, eine Konkordanz beizugeben (unten S. 562–569), in der die jetzigen Briefnummern und Seitenzahlen mit den entsprechenden Daten der früheren Ausgabe zusammengestellt werden und aus der zugleich ersichtlich wird, wo die Neuausgabe in welchem Umfang zuvor fehlendes Material enthält.
Die abschließende Bibliographie faßt sämtliche in diesem Band, d.h. insbesondere in den editorischen Beigaben, erwähnten Quellen und Werke der Sekundärliteratur zusammen; sie wurde für die deutsche Fassung dieser Ausgabe weitgehend selbständig erarbeitet.
Es bleibt mir die erfreuliche Pflicht, den Menschen zu danken, die mich bei der Bearbeitung der vorliegenden Edition unterstützt haben. Gerhard Fichtner hat sich, über seine Transkription hinaus, in vielfacher Weise um diesen Band verdient gemacht. Er hat nicht nur mit ungeahntem Erfolg den Fließ-Nachlaß in Berlin/DDR durchforscht (siehe seine Vorbemerkung ›Zur Transkription‹, S. XXVII), sondern außerdem im Januar/Februar 1985 mein gesamtes ursprüngliches Manuskript des Anmerkungsapparates durchgesehen, kommentiert und ergänzt und mir für die Endredaktion die von ihm erarbeiteten Registerwerke (zu den Fließ-Briefen, aber auch zu wichtigen Titeln der Freud-Literatur) zur Verfügung gestellt. Jeder Leser muß ihm, ebenso wie ich, für sein generöses Engagement dankbar sein. – Nicht minder gilt mein Dank Frau Ilse Grubrich-Simitis und Frau Ingeborg Meyer-Palmedo vom S. Fischer Verlag, deren Rat und Hilfe in einer Fülle von sachlichen und technischen Fragen mir angesichts meiner schwierigen Aufgabe eine permanente Quelle der Ermutigung gewesen sind.
Michael Schröter
Briefe AbhandlungenNotizen
1
Wien, 24. XI. 87
[I., Maria Theresienstraße 8]
Verehrter Freund und Kollege!
Mein heutiger Brief hat zwar einen geschäftlichen Anlaß; ich muß ihn aber mit dem Bekenntnis einleiten, daß ich mir Hoffnung auf Fortsetzung des Verkehrs mit Ihnen mache und daß Sie mir einen tiefen Eindruck zurückgelassen haben, der mich leicht dazu führen könnte, Ihnen frei heraus zu sagen, in welche Rangordnung von Männern ich Sie stellen muß.