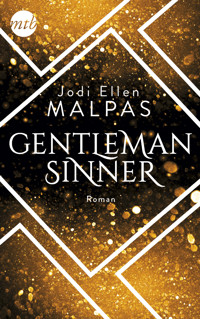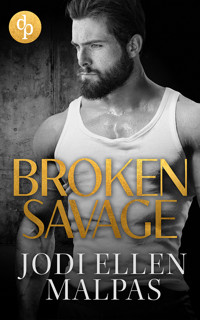
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In einer Welt des Verbrechens sind Gefühle das tödlichste Risiko
Die düstere Mafia Romance von Jodi Ellen Malpas nun endlich auf Deutsch
Rose Cassidy scheint selbst nur ein Spielball in der grausamen Welt der Mafia Clans zu sein. In einem tödlichen Machtspiel gerät sie in die Fänge des berüchtigten Danny Black. Doch in seiner Gegenwart verspürt Rose nicht nur Angst, sondern auch ein nie dagewesenes Verlangen nach dem geheimnisvollen Briten. Sie kann sich seiner dunklen und fesselnden Anziehungskraft nicht entziehen.
Danny Black gilt als gefühllos, kalt und skrupellos. Doch eine wilde Faszination zieht ihn unwiderstehlich zu der schönen Rose und treibt ihn beinahe an den Rand des Wahnsinns, so sehr begehrt er sie. Er muss sich selbst daran erinnern, dass sie nur ein Köder ist. Ein Mittel zum Zweck. Doch sie weckt starke Gefühle in Danny. Aber Emotionen sind riskant, wenn man von gnadenlosen Feinden gejagt wird …
Erste Leser:innenstimmen
„Ein fesselnder Liebesroman voller Leidenschaft und Gefahren!“
„Eine perfekte Mischung zwischen dunklen Mafia-Intrigen und einer erotischen Liebesgeschichte“
„Intensiv, spannend, leidenschaftlich“
„Der geheimnisvolle Bad Boy wird von der mutigen und starken Protagonistin in den Bann gezogen.“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 710
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Kurz vorab
Willkommen zu deinem nächsten großen Leseabenteuer!
Wir freuen uns, dass du dieses Buch ausgewählt hast, und hoffen, dass es dich auf eine wunderbare Reise mitnimmt.
Hast du Lust auf mehr? Trage dich in unseren Newsletter ein, um Updates zu neuen Veröffentlichungen und GRATIS Kindle-Angeboten zu erhalten!
[Klicke hier, um immer auf dem Laufenden zu bleiben!]
Über dieses E-Book
Rose Cassidy scheint selbst nur ein Spielball in der grausamen Welt der Mafia Clans zu sein. In einem tödlichen Machtspiel gerät sie in die Fänge des berüchtigten Danny Black. Doch in seiner Gegenwart verspürt Rose nicht nur Angst, sondern auch ein nie dagewesenes Verlangen nach dem geheimnisvollen Briten. Sie kann sich seiner dunklen und fesselnden Anziehungskraft nicht entziehen. Danny Black gilt als gefühllos, kalt und skrupellos. Doch eine wilde Faszination zieht ihn unwiderstehlich zu der schönen Rose und treibt ihn beinahe an den Rand des Wahnsinns, so sehr begehrt er sie. Er muss sich selbst daran erinnern, dass sie nur ein Köder ist. Ein Mittel zum Zweck. Doch sie weckt starke Gefühle in Danny. Aber Emotionen sind riskant, wenn man von gnadenlosen Feinden gejagt wird …
Impressum
Deutsche Erstausgabe Dezember 2023
Copyright © 2025 dp Verlag, ein Imprint der dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH Made in Stuttgart with ♥ Alle Rechte vorbehalten
E-Book-ISBN: 978-3-98778-302-9
Copyright © 2021, Jodi Ellen Malpas Titel des englischen Originals: The Brit
Published by Arrangement with JODI ELLEN MALPLAS LTD
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Übersetzt von: Martha Sonnenburg Covergestaltung: ArtC.ore-Design / Wildly & Slow Photography unter Verwendung von Motiven von stock.adobe.com: © romantsubin, © elnariz, © shevtsovy Korrektorat: Dorothee Scheuch
E-Book-Version 04.12.2025, 11:10:55.
Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Sämtliche Personen und Ereignisse dieses Werks sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen, ob lebend oder tot, wären rein zufällig.
Abhängig vom verwendeten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Unser gesamtes Verlagsprogramm findest du hier
Website
Folge uns, um immer als Erste:r informiert zu sein
Newsletter
TikTok
YouTube
Prolog – Teil I
DANNY
London – Vor zwanzig Jahren
Ich konnte es riechen. Bacon. Fettig und triefend. Was dazu führte, dass sich mein Magen nur noch mehr verkrampfte, während ich wie jeden Tag in dem großen Müllcontainer hinter der Burgerbude nach Essen suchte. Meine Hände gruben hektisch, als hinge mein Leben davon ab, wühlten sich tiefer und tiefer durch labbrige Pommes und Brot, um an das gute Zeug zu kommen. Als ich schließlich einen Karton zur Seite schob und der Geruch intensiver wurde, sich seinen Weg an mein dreckiges Gesicht bahnte, war ich kurz davor, dem Himmel zu danken. Aber ich tat es nicht, denn wenn es einen Gott gäbe, müsste ich nicht wie ein Penner im Müll wühlen.
Ohne Zweifel sah Bacon noch nie so lecker aus, und der Streifen, den ich gefunden hatte, war über und über mit geschmolzenem Käse bedeckt. Das Wasser lief mir im Mund zusammen und mein Magen knurrte heftig. Also schob ich mir den Speckstreifen zwischen die Lippen, kaute wie ein Besessener und schluckte schließlich viel zu zeitig. Ich hätte es genießen sollen. Wer wusste schon, wann ich das nächste Mal ein solches Stück Himmel finden würde, denn – sind wir mal ehrlich – wer nahm denn bitte den Bacon von einem Bacon-Cheeseburger? Heute war also mein Glückstag.
Nachdem ich meine Hände abgewischt hatte, sprang ich von der Kante des Containers und zuckte zusammen, als ich einen stechenden Schmerz auf Höhe meiner Rippen spürte. Ich zog mein T-Shirt nach oben – eins von nur zwei Kleidungsstücken dieser Art, die ich besaß, wobei dieses hier sogar für meinen abgemagerten zehnjährigen Körper noch drei Größen zu klein war – und betrachtete den Schaden.
„Bastard“, knurrte ich, als ich die vielfarbigen Flecken auf meinem Oberkörper sah. Sie ergaben eine hässliche Mischung aus violett, gelb und blau. Ich war ein dummer Idiot. Er hatte mir gesagt, ich sollte ihm vertrauen. Er hatte versprochen, mich nicht zu verprügeln, wenn ich tat, was er von mir verlangte, und ihm sein Bier brächte. Als ich ihm jedoch die Dose reichte, nahm er sie und begann, damit auf mich einzuschlagen. Es tat nicht weh. Währenddessen tat es niemals weh. Erst später, wenn ich dem Arschloch entkam und mich nicht länger selbst betäubte, setzte der Schmerz ein. Ein Teil von mir wusste, dass ich ihn nur noch wütender machte, wenn ich einfach ohne einen Mucks ertrug, was er austeilte. Ich lernte bereits vor Jahren, dass es mich befriedigte, ihn zu frustrieren. Er würde mich niemals betteln hören, niemals meinen Schmerz sehen. Niemals. Nicht einmal dann, wenn er mein Gesicht auf die Küchentheke presst und seinen Schwanz in meinen Arsch schiebt.
Ich lief die Gasse in Richtung der Hauptstraße entlang. Nicht einmal die beißende Kälte konnte mir noch etwas anhaben. Ich war hart. War die schleichende Folter, die mein trauriges Leben sein sollte, gewöhnt. Ich trug ein T-Shirt, auf der einen Seite derart zerrissen, dass man meinen dürren Oberkörper erkennen konnte. Im Dezember. Die Temperatur lag bei minus einem Grad und ich fühlte verdammt noch mal nichts.
Gerade als ich das Ende der Gasse erreichte, rief jemand meinen Namen. Die Stimme hätte mich dazu veranlassen sollen, loszusprinten und wegzurennen. Stattdessen drehte ich mich um und sah Pedro, einen Jungen, der in dem todschicken Anwesen die Straße hinauf wohnte. Umgeben war er von seiner üblichen Gang bestehend aus fünf Kindern, die alle besser dran waren als ich. War auch nicht schwer. Pedro war Italiener. Seiner Familie gehörte ein Restaurant auf dem Hauptboulevard, wo ich oft nach Essen kramte. Als ich das erste Mal auf der Suche nach Resten durch den Mülleimer stöberte, erwischte er mich. Seit diesem Tag war es Pedros Mission, mir mein Leben zur Hölle zu machen. Oder besser: Noch mehr als es das eh schon war.
Die sechs Jungs kreisten mich ein und ich ließ meinen Blick über jeden einzelnen wandern. Ich hatte keine Angst. Tatsächlich bewunderte ich ihre sauberen Klamotten und ihre brandneuen Turnschuhe. Sie alle waren Italiener. Cousins, nahm ich an. Aber Pedro war der Anführer ihrer Gang, und er war ebenfalls einige Zentimeter größer und breiter als die anderen.
„Was Leckeres gefunden, kleiner Penner?“, fragte Pedro und nickte in Richtung des Containers, aus dem ich gerade gekrochen war. Seine Cousins kicherten, als hätten sie nicht schon ein Duzend Mal gehört, wie er mir genau diese Frage gestellt hatte. Ich blieb still. Meine Antwort hätte nichts daran geändert, worauf das Ganze hier hinauslief, und Wegrennen würde lediglich unsere nächste Begegnung zu einer unangenehm langen Sache machen. Also stand ich da, wartete darauf, dass er auf mich zukäme, und verschloss mich das zweite Mal an diesem Tag. Mit einem gefährlichen Grinsen lehnte er sich in meine Richtung, roch an mir und zog schließlich angewidert seine Nase kraus. „Also?“, hakte er nach.
„Bacon“, antwortete ich stoisch. „War besser als die räudige Pizza, die ich immer in den Containern deiner Familie finde.“
Seine Gesichtszüge entglitten ihm, bevor er sich schnell wieder fing und seine Abscheu nur noch offensichtlicher zur Schau stellte. Zuckersüß genoss ich es, obwohl ich wusste, dass mir unvermeidbar Prügel drohten. „Schlitz ihn auf“, zischte er und stieß dem großen, schlaksigen Jungen neben sich den Ellbogen in die Rippen. Ich glaube, sie nennen ihn Bony. Innerlich lächelte ich, denn er konnte mir gar nichts.
Bony holte ein Klappmesser aus seiner modischen Jeans hervor, inspizierte die Klinge. Ich hätte zusammenzucken sollen, aber ich tat es nicht. Nichts, womit man mich konfrontierte, hätte mich an diesem Punkt in meinem Leben anheben können. „Mach schon“, stachelte ich ihn an, während ich einen Schritt auf ihn zu ging. Seine Lippen verzogen sich und sein Arm schoss nach vorn. Ich schloss meine Augen, aber bewegte mich sonst nicht, als ich die Klinge tief ins Fleisch meiner Wange eindringen spürte.
Die Gang johlte; sie waren augenscheinlich begeistert von ihrem Tagewerk. Ich öffnete meine Augen und fühlte, wie etwas warm und feucht mein Gesicht hinunterlief und sich in meinem Mundwinkel sammelte. Ich leckte ein wenig Blut mit der Zunge auf und machte mich so erneut mit jenem Geschmack nach Eisen vertraut.
„Du bist krank, Mann“, fauchte Pedro.
„Kostprobe gefällig?“ Ich führte meine Hand an meine Wange, fuhr mit einem Finger durch das Blut der Wunde und hielt ihn ihm entgegen.
Die Wut in seinem Blick, als er einen Schritt auf mich zu ging, faszinierte mich. Er war bereit, mir jederzeit heftig ins Gesicht zu schlagen. Ich war genauso bereit. Jede Minute meines Lebens war ich bereit. Was ich zu Hause ertragen musste, machte es einfach, das einzustecken, was auch immer dieses verzogene Stück Scheiße mit mir vorhatte.
Pedro erhob die Faust, aber das Geräusch von quietschenden Reifen ließ ihn innehalten. Wir drehten uns alle synchron um und sahen einen kaputten alten Mercedes auf uns zu rasen. Pedro und seine Gang machten sich in alle Himmelsrichtungen aus dem Staub. Und ich? Ich stand einfach da und sah, wie zwei weitere Mercedes’ in der Gasse auftauchten, diese jedoch brandneu. Einer versperrte dem alten Mercedes den Weg nach hinten, der andere kam vom anderen Ende der Gasse und blockierte diesen Weg.
Ich verzog mich in die Schatten und sah dabei zu, wie sechs große, in Anzüge gekleidete Männer aus den neuen Mercedes’ ausstiegen; drei aus jedem Auto. Obwohl Dezember war, trugen sie alle Sonnenbrillen. Darunter ausdruckslose Mienen. Allesamt sahen sie wie fiese Scheißkerle aus. Einer öffnete die hintere Tür eines der Autos und ein weiterer Mann stieg aus. Dieser hob sich durch seinen cremefarbenen Leinenanzug von den anderen ab. Er ließ sich Zeit, glättete einige Falten seines Jacketts und fuhr sich mit der Hand durch sein Haar. Er sah wichtig aus. Mächtig. Furchtlos. Respektiert. Sogar mir als Zehnjährigem war klar, dass er genau das verdiente. Er war nicht einfach nur ein Tyrann. Ich war sofort von ihm begeistert.
Voller Faszination beobachtete ich, wie er auf den alten Mercedes zu schritt und schließlich die Fahrertür öffnete. Dann hörte ich jemanden um Gnade flehen.
Und dann hörte ich einen lauten Knall. Einen Schuss.
Ich blinzelte einige Male, war wie hypnotisiert, als der Mann im cremefarbenen Anzug eiskalt die Tür des alten Mercedes’ schloss und – als wäre nichts gewesen – zurück zu den anderen Autos schlenderte. Ich sah hinüber zu dem alten Mercedes und sah überall Blut, ebenso einen Körper, der über dem Lenkrad hing.
„Kümmert euch drum“, forderte der Mann im cremefarbenen Anzug und zog seine Hosen an den Knien nach oben, um zurück ins Auto zu steigen.
Dann sah ich ihn. Einen Mann auf der anderen Seite eines Maschendrahtzauns, der gerade dabei war, eine Mauer nach oben zu kraxeln, welche die Gasse überblickte. In seiner Hand befand sich eine Waffe. Bei ihm handelte es sich ganz klar um eine Bedrohung. Er sah zu schmuddelig und dreckig aus, um zu den Männern mit ihren eleganten Anzügen und glänzenden neuen Autos zu gehören. Noch bevor ich wahrnahm, dass sich mein Mund überhaupt bewegte, rief ich: „Hey, Mister. Hey!“
Der Mann im cremefarbenen Anzug hielt inne, sah zusammen mit den anderen gut gekleideten Männern in meine Richtung. Seine blauen Augen leuchteten mir entgegen. Ich war ein Kind, ja, aber ich erkannte das Böse, wenn ich es sah. Ich begegnete ihm fast jeden Tag; was mir jedoch gerade in diesem Moment in die Augen sah, war auf eine andere Art und Weise bedrohlich. Mein kindlicher Geist konnte nicht genau sagen, wo der Unterschied lag. Er war einfach … da.
Ich hob meine Hand und deutete auf die Mauer. „Er hat eine Waffe.“ Als ich erneut nach oben sah, richtete der Typ seine Pistole hinunter in die Gasse, genau auf den Mann im cremefarbenen Anzug.
Ein Schuss fiel. Nur einer und er kam nicht von dem Mann hoch über uns. Wie ein Sack kippte der Typ, stürzte nach unten und schlug mit einem ekelhaften Geräusch auf dem Asphalt auf. Ich starrte auf seinen malträtierten Körper; sein Genick war offenbar gebrochen, sodass sein Kopf einen merkwürdigen Winkel zum restlichen Körper aufwies. Seine Augen waren geöffnet und in ihnen sah ich das altbekannte Böse. Die Art, wie ich sie jeden Tag zu sehen bekam.
Ich sah nicht weg, bis sich ein Schatten über mich beugte. Als ich aufblickte, fand ich mich Auge in Auge mit dem Mann im cremefarbenen Anzug. So nah war er noch größer, noch furchteinflößender. „Wie heißt du, Junge?“, fragte er. Er hatte einen Akzent, genau wie der, den ich immer hörte, wenn ich mich in die Kinosäle mogelte. Amerikanisch.
„Danny.“ Normalerweise unterhielt ich mich nicht mit Fremden, aber der Mann forderte wortlos, dass man ihm antwortete.
„Wer ist für dein Gesicht verantwortlich?“ Er nickte in Richtung meiner Wange und ließ seine Hand in seine Tasche wandern. Ich bemerkte, dass seine andere noch immer die Waffe hielt.
Ich berührte meine Wange und spürte meine Handfläche durch das Blut gleiten. „Das ist nichts. Tut nicht weh.“
„Großer, harter Typ, hm?“ Seine dicken Augenbrauen hoben sich und ich zuckte die Schultern. „Aber das war nicht meine Frage.“
„Nur ein paar Kinder.“
Er legte seine Stirn ein wenig in Falten und das Böse schien noch stärker. „Wenn sie sowas noch einmal versuchen, bring sie um. Keine zweiten Chancen, Junge. Denk immer daran. Zögere nicht, stell keine Fragen. Tu es einfach.“
Ich blickte hinüber zu dem Auto voller Blut, nickte und Mr. Cremefarbener Anzug betrachtete mich, wobei sich seine Nase auf Grund meines schäbigen Äußeren verzog. Als sich seine bewaffnete Hand nach vorn bewegte und er mit der Mündung seiner Pistole den Stoff meines T-Shirts anhob, hielt ich ihn nicht auf. Ich zuckte nicht, bewegte mich nicht einmal. „Waren sie das auch?“
„Nein, Mister?“
„Wer dann?“
„Mein Stiefvater.“
Seine blauen Augen fanden meinen Blick. „Er schlägt dich?“, wollte er wissen und ich nickte. „Warum?“
Um ehrlich zu sein, wusste ich es nicht. Er hasste mich, hatte er schon immer. Also zuckte ich erneut mit meinen knochigen Schultern.
„Deine Mutter?“
„Ist abgehauen, als ich acht war.“
Er atmete ein, trat einen Schritt zurück und ich nahm an, dass er mein elendes Puzzle zusammensetzte. „Wenn dein Stiefvater dich das nächste Mal anfasst, bring auch ihn um.“
Ich lächelte, genoss den Gedanken, genau das zu tun. Ich würde es nicht, könnte es nicht tun – mein Stiefvater war fünfmal so groß wie ich – aber ich nickte trotzdem. „Ja, Mister.“
Ich war mir nicht sicher, dachte aber, ich hätte ein Lächeln in seinen Mundwinkeln gesehen. „Hier.“ Er holte einen Haufen Geldscheine hervor, die ordentlich von einem glänzenden Geldscheinkontakt zusammengehalten wurden, und zog einen Fünfziger heraus. Meine Augen wurden riesig. Noch nie zuvor hatte ich einen Fünfziger gesehen. Nicht einmal einen Zwanziger. „Hol dir war zu essen und saubere Klamotten, Junge.“
„Danke, Mister.“ Ich nahm ihm den Schein aus den Fingern und hielt ihn mit beiden Händen vor mich. Ich war begeistert und es muss so offensichtlich gewesen sein, dass er leise lachte und einen weiteren Schein hervorzog.
Fasziniert sah ich dabei zu, wie er meine Wange abwischte. Mit einem Fünfzig-Pfund-Schein! „Du blutest ganz schön.“ Er legte den blutigen Schein in meine Hand. „Und jetzt hau ab.“
Ich machte mich mit den zwei Fünfzigern aus dem Staub; meine Augen klebten daran, als ich die Gasse hinunterlief und jederzeit befürchtete, jemand könnte sie mir aus der Hand reißen. Lauf, Danny, lauf!
Ich hörte das mir nur zu bekannte Geräusch des alten Nissan vor mir und blieb sofort stehen. Mein Stiefvater hielt mit quietschenden Reifen, sprang aus dem Wagen und lief mit dem typischen mordlustigen Blick in seinen Augen auf mich zu. Er sprach nicht mit mir. Tat er nie. Sein Handrücken kollidierte mit meiner bereits verletzten Wange. Ich zuckte nicht, nicht einmal als ich spürte, wie die Wunde noch ein wenig größer riss. „Woher zur Hölle hast du die?“, spuckte er mir entgegen und krallte sich die Fünfziger aus meiner Hand.
Es war komplett untypisch für mich, doch ich brüllte ihn an und hechtete nach ihm, um sie zurückzubekommen. „Hey, die gehören mir! Gib sie zurück!“
Ich wollte nicht um sie kämpfen oder ihm zeigen, dass sie mir wichtig waren, aber … sie gehörten mir. Ich hatte noch nie etwas besessen. Ich würde sie nie ausgeben, niemals, aber wenn er sie besäße, hätte er sie bis zum Ende des Tages für Alkohol, Drogen und eine Nutte verprasst.
Mein Sichtfeld verschwamm, als er mir einen Fausthieb versetzte, der meinen Kiefer knacken ließ. Dann griff er in meine viel zu langen Haare und zerrte mich zu seinem Scheißhaufen von einem Auto. „Steig ein, du kleines Arschloch.“
„Entschuldigung.“ Mein Stiefvater wandte sich um und nahm mich mit sich. „Was?“
Der Mann im cremefarbenen Anzug war herübergekommen. Das Böse, das ich bereits in seinen Augen erkannt hatte, war unübersehbar zurück. „Ist das dein Stiefvater, Junge?“, fragte er und ich nickte, so gut ich das mit der eingeschränkten Bewegungsfreiheit meines Kopfes tun konnte. Mr. Cremefarbener Anzug nickte kurz und wandte seine ganze Aufmerksamkeit meinem Stiefvater zu. „Gib dem Jungen sein Geld.“
Mein Stiefvater schnaubte. „Fick dich.“
Ohne ein weiteres Wort, eine zweite Chance oder eine Warnung hob Mr. Cremefarbener Anzug seine Waffe und platzierte eine Kugel genau mittig in der Stirn meines Stiefvaters. Mein Kopf wurde nach hinten gezerrt, als er zu Boden sank und mir dabei einige Haare ausriss. Einfach so. Bang. Keine zweiten Chancen. Tot.
Weg.
Mr. Cremefarbener Anzug machte einen Schritt nach vorn, bückte sich und nahm die Fünfziger aus den toten Händen meines Stiefvaters. Dann hielt er sie mir hin. „Keine zweiten Chancen“, sagte er ganz einfach. „Hast du noch Familie?“
Ich nahm die Geldscheine und schüttelte den Kopf. „Nein, Sir.“
Langsam richtete er sich wieder zu seiner vollen Größe auf, wobei er die Lippen verzog. Er überlegte. „Zwei Fünfziger bringen dich im Leben nicht besonders weit, oder?“
In diesem Moment fühlte ich mich wie das reichste Kind der Welt. Aber ich wusste natürlich, dass hundert Mäuse nicht lang vorhalten würden. „Ich glaube nicht, Mister. Wollen Sie mir noch mehr geben?“ Ich grinste ihn frech an und er erwiderte das Grinsen.
„Steig ins Auto.“
Meine Augen wurden groß. „In Ihr Auto?“
„Ja, in mein Auto. Steig ein.“
„Warum?“
„Weil du mit mir nach Hause kommst.“ Damit drehte er sich um und schlenderte davon; ich rannte ihm nach.
„Aber Mister …“ „Kannst du irgendwo anders hin?“ Er ging weiter, reichte einem seiner Männer die Waffe, als er den glänzenden Mercedes erreichte.
„Nein.“
Als er auf dem Rücksitz Platz nahm, ließ er die Tür offen und sah nach draußen zu mir, wie ich vor seinem Auto stand. „Du hast nicht einmal gezuckt, als er dich geschlagen hat.“
Ich zog die Schultern hoch. „Tut nicht mehr weh. Und überhaupt“, fuhr ich fort und spürte, wie meine schmale Brust anschwoll, als könnte ich diesen großen, imposanten Fremden beeindrucken, „würde ich ihn das niemals sehen lassen, selbst wenn es weh tun würde.“
Er lächelte. Das Lächeln war breit und ich bekam das Gefühl, dass er dieses nicht oft zur Schau stellte. „Ich gebe keine zweiten Chancen.“
Ohne zu zögern, stieg ich ein.
Prolog – Teil II
ROSE
Miami – Vor zehn Jahren
Der Schmerz war unerträglich. Mein ganzer Körper zog sich zusammen, jeder Muskel angespannt, um ihn zu bewältigen. Mein nackter Rücken schabte über den Betonboden unter mir, meine Haut unter dem zerfetzten T-Shirt zerkratzt, während ich mich wand und mir den Bauch hielt. Ich schrie heulend und schrill. Mein langes, verfilztes Haar war schweißnass und klebte an meinem Gesicht. Es war stickig und ich glaubte, jeden Moment ohnmächtig zu werden. Vielleicht wäre es besser so. Ohnmacht schien mir der einzige Ausweg aus diesem endlosen Loch aus Schmerz. Oder der Tod. Aber ich wollte nicht sterben, nicht, wo ich doch endlich etwas hatte, wofür es sich zu leben lohnte.
Ich wusste nicht, wie lange ich schon hier war. Stunden. Tage. Seit Ewigkeiten? Mein Leben fühlte sich an, wie eine einzige riesige Grube voller Qualen.
Wann würde das vorbei sein?
Ich drehte mich auf die Seite und rollte mich zusammen, machte mich so klein wie möglich. Ich war allein. Fünfzehn Jahre alt, nur ein Mädchen, und ich war allein. War es schon immer gewesen. Warum das gerade jetzt fast genauso weh tat wie meine körperlichen Schmerzen, konnte ich nicht verstehen. Ich weinte. Ich schrie. Wellen aus Schmerz folgten aufeinander. Ich konnte sie nicht aufhalten. Konnte sie nicht kontrollieren. Ich war hilflos, den Qualen vollkommen ausgeliefert. „Du dummes Mädchen.“
Die Stimme durchschnitt die Dunkelheit und meinen Schmerz, ersetzte ihn durch Angst. Ich setzte mich schnell auf, kroch rückwärts bis mein Rücken gegen die derben Steine der Wand stieß. Ich wusste nicht warum, aber ich konnte ihm offenbar nicht entkommen.
Seine teuren Anzugschuhe trafen vor mir auf den Betonboden, seine Schritte wurden lauter, bedrohlicher, als er näherkam. Er beugte sich nach unten, nahm meinen zusammengekrümmten Körper unter die Lupe.
Und er lächelte. Lächelte so breit. „Dann lass uns dich nach Hause bringen, Rose.“ Er richtete sich wieder auf und schnippte mit den Fingern; sofort erschienen wie durch Magie fünf Männer. Zwei hoben mich hoch, als gerade eine weitere Schmerzwelle durch meinen Körper schoss, die dafür sorgte, dass ich meinen Rücken krümmte und in ihren Armen wimmerte.
„Sie blutet verdammt nochmal überall“, knurrte einer der Männer und sah mich an, als wäre ich das abartigste Wesen im ganzen Universum. Ich sagte nichts. Akzeptierte ihre Abscheu. Es war pure Ironie, dass jeder der zwei Männer, die mich trugen, der Grund für meinen Zustand hätte sein können.
Ich wurde auf den Rücksitz seines protzigen Autos geworfen und dann zurück dahingefahren, von wo ich vor nicht allzu langer Zeit geflohen war. Die ganze Zeit über hielten sich Angst und Schmerz die Waage.
Als wir ankamen, wurde ich in einen Rollstuhl gesetzt und in ein Einzelzimmer gebracht, aufs Bett gelegt und an eine Maschine angeschlossen.
Eine Krankenschwester beugte sich über mich, während die zwei Männer, die mich hereingetragen hatten, die Tür bewachten, auf dass ich nicht erneut weglaufen würde. Im Moment könnte ich es nicht einmal, wenn ich gewollt hätte. Angst lähmte und Schmerz beherrschte mich.
Dann hörte ich es.
Piep.
Piep.
Piep.
Ich ließ meinen Kopf zur Seite fallen und sah, wie die leuchtende Linie langsam aber regelmäßig auf und ab hüpfte.
„Er ist zwar schwach, aber noch hat sie einen Herzschlag“, sagte die Krankenschwester mit einem Blick zur Tür, als er hereinkam und sich zu seinen Männern stellte.
Er bedachte mich mit einem Blick, der wohl heißen sollte, dass ich dem Tod gerade so von der Schippe gesprungen bin. Ich wusste, dass es stimmte. Aber was würde nach diesem Albtraum kommen? War es das wert, überlebt zu haben? Und würde er jemals enden?
„Zeit zu pressen, Mädchen“, ordnete die Krankenschwester an, als ich gerade von einer weiteren Wehe heimgesucht wurde. Nur war diese schlimmer als alle anderen davor. Ich warf meinen Kopf zurück und schrie, bettelte und betete, dass es aufhören würde.
Nach nur zweimal pressen wurde mir ein winziger Körper auf die Brust gelegt und als ich nach unten blickte, sah ich dort einen kleinen blutverschmierten Kopf. Panik machte sich breit. Mein Baby schrie nicht.
„Ein Junge“, meinte die Krankenschwester, als sie grob sein kleines Gesicht abwischte.
„Lebt es?“, fragte er von der Tür aus.
Es. Mein Sohn war ein Es. Für das kalte Arschloch an der Tür nur ein namenloser Haufen Leben, aber mir bedeutete er alles.
Die Krankenschwester gab der perfekten Haut des Babypos meines Sohnes einen Klaps und dann schrie er endlich. Er schrie so laut, als wollte er der Welt mitteilen, dass er nun ein Teil von ihr war. Ich seufzte und ließ mich nach hinten sinken, nachdem die Krankenschwester die Nabelschnur durchtrennt und mir meinen Sohn an meine Brust gelegt hatte.
Diese fünfzehn Minuten, in denen er das einzig Gute aus mir heraussaugte, waren die wunderbarsten fünfzehn Minuten meines Lebens.
Dann wurde er mir aus den Armen gerissen. „Nein!“ Ich hechtete nach vorn, um ihn zu greifen, als die Krankenschwester ihn fest in eine Decke wickelte und ihn dem Teufel an der Tür übergab. „Bitte, nein.“ Ich begann sofort zu schluchzen, obwohl ich genau wusste, was nun folgte. Der Schock darüber riss mein Herz entzwei.
„Wir haben einen Deal, Rose“, sagte er und wiegte mein Baby auf seinem Arm. „Du kannst dich nicht um ihn kümmern. Was für ein Leben soll er denn mit dir auf der Straße haben?“
Einen Deal? Mit diesem Mann machte man keinen Deal. Man tat, was einem befohlen wurde, oder man starb.
„Er ist mein Fleisch und Blut.“ Mein Inneres zog sich zusammen, als erneut Schmerz durch meinen Körper schoss. Ich schrie, hielt mir meinen nun leeren Bauch. Was waren das für Qualen? Trauer?
„Sie verblutet.“ Die Krankenschwester schien es nicht eilig zu haben, klang ruhig. Ich spürte, wie warme Flüssigkeit aus meinem Körper floss und das Bett unter meinem Po tränkte. „Sie braucht eine Transfusion.“
„Kann sie wieder schwanger werden?“, wollte er von der Tür aus wissen.
„Unwahrscheinlich.“ Die Krankenschwester war so abgestumpft. So kaltherzig.
Es schien, als entwiche das Leben und die Energie innerhalb von Sekunden aus meinem Körper. Meine Lider wurden plötzlich schwer, ich hörte nur noch verzerrt. „Bitte nimm ihn mir nicht weg“, bettelte ich schwach.
„Er wird ein wunderbares Zuhause haben. Liebevolle Eltern, die ihm alles geben werden, was du nicht kannst. Und als Gegenleistung darfst du leben.“ Er sah zu der Krankenschwester. „Gib ihr die Transfusion.“ Bis zu diesem Zeitpunkt war mir nicht aufgefallen, dass die Krankenschwester aufgehört hatte, sich um mich zu kümmern. Sie wartete also auf seine Anweisung, mich am Leben zu halten?
Wenn ich bisher gedacht hatte, dass ich bereits den größtmöglichen Schmerz erfahren hatte, lag ich damit falsch. Ihn mit meinem Baby weggehen zu sehen, war entsetzlich. Das Letzte, das ich erkennen konnte, war, wie die kleine Hand meines Babys den Finger des gefährlichen Bastards hielt – seinen kleinen Finger, an dem er diesen widerlichen Schlangenring trug. Er war fast so groß wie die Hand meines Sohnes und die smaragdgrünen Augen der Schlange waren so grell wie mein Schmerz.
Kapitel 1
DANNY
Miami – Heute
Der Weg den Flur entlang zu seiner Suite fühlt sich endlos an, während das Geräusch meiner Schuhe, die auf den festen Marmor treffen, um mich herum widerhallt. Unser Anwesen riecht nach Tod. Ich habe den Tod oft genug gerochen, um ihn zu erkennen, nur ist er mir jetzt alles andere als willkommen. Ich habe das Gefühl, die Green Mile entlang zu laufen, jedoch werde nicht ich es sein, der am Ende sechs Fuß unter der Erde liegt.
Die zwei Muskelpakete, die die massive doppelflügelige Holztür bewachen, sehen ernst aus. Trauer hängt schwer in der Luft.
Beide nicken mir kurz zu, als ich vor der Tür zum Stehen komme. Das Nicken ist ebenfalls ernst. Sie öffnen die Tür nicht, wissen, dass ich ihnen erst das Zeichen dazu geben muss. Dass ich bereit sein muss. Bin ich das?
„Ist Esther bei ihm?“, frage ich und bekomme ein weiteres Nicken zur Antwort. Ich schlucke und nicke ebenfalls. Dann atme ich tief durch, als sie die Türen für mich öffnen. Ich gehe hinein, ziehe an meiner Anzugjacke und checke, ob sich Flusen darauf befinden. Es ist eine bewusste Handlung, eine, die mich ablenken und den Zeitpunkt hinauszögern soll, an dem ich hinüber zu dem Himmelbett schaue und das sehen werde, wovor ich mich fürchte. Trauer steckt mir in der Kehle, aber ich kann sie nicht zeigen. Er wäre angepisst, würde ich das tun.
Esther, die sich durch den Raum bewegt, lässt meine Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt zurückkehren und ich sehe, wie sie seinen Blasenkatheter leert. Allein das führt dazu, dass sich mein Herz zusammenzieht. Dieser Mann ist stolz. Berüchtigt. Eine verdammte Legende, von jedem in unserer Welt gefürchtet. Allein sein Name lässt Menschen erzittert. Seine Anwesenheit verursacht Angst, wie es sonst niemand vermag. Ich habe immer gedacht, er sei unbesiegbar. Dutzenden Anschlägen auf sein Leben ist er entkommen, hat den unzähligen Attentatversuchen ins Gesicht gelacht. Und hier liegt er nun und wartet darauf, an seinem verdammten Krebs zu sterben, nicht in der Lage, sich selbst zu versorgen. Nicht einmal auf die einfachste Art und Weise.
Schließlich wende ich meinen Blick doch dem Bett zu. Mein Held, mein Vater, der legendäre Carlo Black ist nur noch ein Hauch von dem Mann, der er einst war; die Krankheit zehrt ihn auf. Er atmet laut. Ein Todesröcheln. Nicht mehr lange.
Ich gehe um das Bett herum, setze mich auf den bereitgestellten Stuhl und nehme seine ausgemergelte Hand. „Hol den Priester“, ordne ich Esther an, als sie die Bettdecke ordentlich über seiner Hüfte zurückschlägt.
„Ja, Mr Black.“ Sie sieht zu mir auf und lächelt mir mitfühlend zu. Ich muss wegschauen, da ich ihr stummes Angebot an Mitleid nicht ertragen kann.
„Jetzt“, füge ich knapp hinzu.
Sie verlässt das Zimmer und in jeder Sekunde, die sie nicht da ist, scheint sein Atem lauter und lauter zu werden. „Es ist an der Zeit, Paps“, sage ich sanft, während ich näher rücke, meine Ellbogen auf der Matratze ablege und seine Hand mit meinen beiden umschließe.
Seit zwei Tagen hat er die Augen nicht geöffnet, aber jetzt – als wüsste er, dass ich hier bin und es Zeit für den Abschied ist – regen sich seine Lider. Er versucht, mich zu sehen. Er weiß, dass ich da bin. Ich lege meine Lippen an unsere verschränkten Hände und versuche ihm die Kraft zu geben, mich noch ein letztes Mal anzusehen. Dabei bemerke ich nicht, dass ich meinen Atem anhalte, bis ich in seine glasigen blauen Augen sehe. Das Glänzen ist schon lange nicht mehr da, das Weiße darin nun gelb.
Geistesabwesend sieht er mich an. „Hey“, krächzt er, was sofort von einem flachen Husten begleitet wird, der seinen mageren Körper schüttelt.
„Sprich nicht“, sage ich, zerrissen, ihn derart schwach zu sehen.
„Seit wann ist es angebracht, dass du mir sagst, was ich zu tun habe?“
„Seitdem du mich nicht erschießen kannst“, gebe ich zurück und er lacht leise. Ich genieße das Geräusch, bis es zu einem weiteren Husten wird und er nach Luft ringt. „Bleib ruhig liegen.“
„Fick dich.“ Er drückt schwach meine Hand. „Bist du hier, um dich zu verabschieden?“
Ich schlucke erneut und zwinge mich dann, die Fassade aufrecht zu erhalten, die von mir erwartet wird. „Jap, und ich habe dir ein Abschiedsgeschenk geordert.“
„Was denn?“
„Einen netten Arsch, um deinen Schwanz in den Himmel zu reiten.“
„Nach all den Jahren … in denen du bei mir warst, klingst du immer noch, als … als wärst du gerade aus Buck … ing … ham Palace spaziert, du kleines britisches Arschloch.“
„Selber Arschloch“, murmele ich in einem fürchterlichen amerikanischen Akzent.
Ein weiteres Lachen, lauter diesmal, bevor der Husten noch heftiger einsetzt. Ich sollte ihn nicht zum Lachen bringen, aber genauso sind wir. Waren wir immer. Er hat mir seine raue Zuneigung zuteilwerden lassen und ich habe sie angenommen. Alles, was dieser Mann für mich getan hat, tat er, weil er mich liebt. Und er ist die einzige Person in dieser verdammten kaputten Welt, von dem ich das behaupten kann.
Während er zu mir aufsieht, lächelt er sein so seltenes breites Lächeln, das er immer nur mir geschenkt hat. „Vertraue niemandem“, warnt er mich. Nicht, dass das nötig wäre. Er ist einer von bloß zwei Menschen, denen ich je vertraut habe. Und hier liegt er nun auf seinem Sterbebett, was mir lediglich Brad lässt. Aber Brad empfindet nicht die gleiche Liebe für mich wie Paps. „Zögere nicht, zu töten“, flüstert er.
„Habe ich nie.“ Das weiß er. Immerhin habe ich von ihm gelernt.
Er versucht einen Moment lang, seine Lungen mit Luft zu füllen. „Keine zweiten Chancen, erinnerst du dich?“
„Natürlich.“ „Und ver … verdammt nochmal, lern endlich … Poker zu spielen.“
Ich lache. Ein Geräusch purer Freude, obwohl sich meine Augen mit Tränen füllen. Das Gefühl ist mir fremd. Ich habe nicht geweint, seitdem ich acht Jahre alt war. Meine kläglichen Pokerfähigkeiten waren Zeit seines Lebens Stein des Anstoßes für meinen Vater. Er ist Profi. Gewinnt jedes Spiel. Niemand will es mit ihm aufnehmen, aber nie hat sich jemand getraut, ihm ein Spiel abzuschlagen. Nicht, wenn er keine Kugel in der Stirn haben möchte. „Wenn du mich nicht trainierst, fürchte ich, dass ich ein hoffnungsloser Fall bin.“ Und das stimmt. Der einzige Grund, warum ich gewinne, ist, dass die armen Teufel, die gegen mich spielen, eine unsichtbare Waffe an ihren Schläfen spüren. Über die Jahre ist der Ruf meines Vaters mir vorausgeeilt.
„Stimmt“, krächzt er und grinst verschmitzt. „Jetzt ist es an dir, meine Welt zu regieren, Junge.“ Er führt meine Hände zu seinem Mund und küsst meine Knöchel, bevor er versucht, den Schlangenring von seinem kleinen Finger zu ziehen. Sogar die smaragdgrünen Augen der Schlange sehen stumpf aus. Leblos.
„Hier“, sage ich und beuge mich zu ihm, um ihm dabei zu helfen, den Ring aus Gold und Smaragden zu lösen. Problemlos gleitet er von seinem Finger. Ich schiebe ihn auf meinen eigenen kleinen Finger, aber schaue ihn nicht an. Will ihn nicht an mir sehen. Wollte ich nie. Denn das macht es so verdammt real.
„Mach mich stolz.“ Seine Augen schließen sich und er atmet tief ein, als wäre es sein letzter Atemzug.
„Das werde ich“, schwöre ich ihm und lasse meine Stirn auf das Kissen sinken. „Ruhe in Frieden, Mister.“
***
Als ich gerade die Tür zur Suite hinter mir zu ziehe, laufe ich in Onkel Ernie, den Cousin meines Vaters. Ich habe absolut keine Ahnung, warum ich ihn Onkel nenne, aber Paps bestand darauf, und ich habe immer auf Paps gehört. Ernie ist das komplette Gegenteil meines Vaters und damit meine ich, dass er ein gesetzestreuer Bürger ist. Er macht seine Millionen ganz legitim an der Börse und ist ein aufrechtes, respektiertes Mitglied der Gesellschaft. Ich habe mich immer gefragt, wie er und Paps sich so gut verstehen konnten, wenn man ihre gegensätzlichen Vorstellungen von Moral bedenkt. Vielleicht liegt es daran, dass es sich bei Ernie um den einzig lebenden Verwandten meines Vaters handelt. Ihre Beziehung ist seit jeher eine unkomplizierte gewesen, was aber daher rührt, dass sie eine gegenseitige Vereinbarung getroffen haben: Niemals übers Geschäft sprechen. Wahrscheinlich sind der Respekt und die Liebe, die Ernie meinem Vater entgegenbrachte, vollkommen unangebracht, wenn man Paps Machenschaften kennt, jedoch besitze ich viele geliebte Erinnerungen an die beiden, wie sie lachend bei einer Zigarre und einem Brandy auf der Veranda sitzen.
„Du kommst zu spät.“
Seine Schultern fallen genauso in sich zusammen wie seine extrem faltigen Wangen. In jeder Pore seines Körpers steckt der Tod. „Es tut mir leid, mein Junge. Ich weiß, wie sehr du das barbarische Arschloch verehrt hast.“
Ich bedenke ihn mit einem schwachen Lächeln und er legt mir den Arm um die Schultern, um mich in eine Halbumarmung zu ziehen.
„Weißt du, was dein alter Herr mir immer gesagt hat?“, fragt er.
„Dass du ein vergeblicher Heiliger bist?“
Onkel Ernie lacht, entlässt mich aus der Umarmung und nimmt stattdessen einen Umschlag aus seiner Innentasche. „Vergeblich? Ich habe die Haut deines Vaters mehr als einmal gerettet.“
Ich lächele und erinnere mich an einige dieser Situationen. Das eine Mal in New York, als ein Kleinkrimineller glaubte, in der Hierarchie aufzusteigen, indem er meinen Vater ausschaltete. Ernie sah, wie er seine Waffe herausholte und warnte Paps, der sich gerade so wegducken konnte. Der Täter wurde langsam von den Männern meines Vaters gefoltert. Ich war damals zwölf Jahre alt und ich sah dabei zu. Bei jeder Sekunde, als sie dem Mann die Nägel von den Fingern rissen, als zupften sie unbändige Augenbrauen. Ich sah zu, wie sie das Wappen meiner Familie in seine Brust schnitzten und anschließend Säure in die Wunden kippten. Die ganze Zeit über lächelte ich. Dieser Wichser hatte versucht, den einzigen Menschen umzubringen, der sich jemals um mich gekümmert hatte. Deswegen, ja, verdiente er jede Sekunde, die er an den Metallstuhl gefesselt war, bevor er elektrogeschockt wurde. Ich war der, der den Schalter umlegte.
In anderes Mal in Costa Rica. Ich war fünfzehn. Eine Nutte, die in dieser Zeit das Bett meines Vaters wärmte, hatte versucht ihn im Schlaf zu erstechen. Ernie hielt sie auf. Es stellte sich heraus, dass sie vom KGB eingeschleust war. Ich habe nicht gefragt, was mit der Nutte passiert ist.
Geht mich nichts an.
„Hier.“ Ernie reicht mir den Umschlag. „Dein Vater wollte, dass ich dir das gebe.“
Ich nehme ihn langsam aus seiner Hand, als wäre er eine getarnte Bombe. „Was ist darin?“
„Sein letzter Wille und sein Testament.“ Ernie grinst. „Er war wirklich ein krankes Arschloch.“ Er zwinkert und geht an mir vorbei auf dem Weg ins Zimmer meines Vaters. „Darin stehen auch die Wünsche für seine Beerdigung. Allerdings könnte es da ein Problem geben.“
Ich sehe von dem Umschlag zu Ernie. „Warum?“
„Nun, er hat darauf bestanden, in der Kathedrale verabschiedet zu werden, weswegen du vielleicht nicht dabei sein kannst. Es ist nicht besonders geschmackvoll einen Feind umzulegen, wenn dieser gerade sein Ehegelübde ablegt, Danny.“
Ich lache leise und erinnere mich an das Blutbad vor dem Altar vor einigen Monaten. Nein, geschmackvoll mag es nicht sein, aber noch weniger geschmackvoll ist es, sich kleine Mädchen sexuell gefügig zu machen. Und dieser irische Wichser, der damals gerade dabei war, sein Gelübde im Haus Gottes abzulegen hatte eine bestimmte Vorliebe für kleine Mädchen. Verdammtes Schwein.
Ernie verschwindet in der Suite meines Vaters und ich mache mich auf den Weg zum Büro, währenddessen ich den Umschlag öffne. Ich überfliege den Inhalt, überspringe die Abschnitte, die meine Laune nur weiter trüben würden, und stelle fest, dass mein Vater eine Beerdigung mit allem Drum und Dran möchte. Sogar die Lieder, die gesungen werden sollen, hat er aufgelistet. Ich schüttle den Kopf, als ich die Liste lese. I Watch The Sun Rise steht ganz oben. Für mich. Denn du bist immer bei mir, folgst mir auf allen Wegen.
„Das werde ich, Dad“, sage ich, als ich die Tür zu seinem Büro öffne und den übertriebenen Raum auf mich wirken lasse. Seit sechs Monaten führe ich die Geschäfte, jedoch habe ich es bisher nie über mich gebracht, an seinem Tisch zu sitzen. Es fühlte sich immer zu endgültig an. Jetzt ist er weg. Ich sehe hinunter auf meinen kleinen Finger und bemerke, dass die Augen der Schlange wieder glänzen. Lebendig. Als könnte er mich dadurch beobachten. Überwachen. Sicher gehen, dass ich in seinem Sinn handle. Sicher gehen, dass ich ihm auf allen Wegen nachfolge.
Er muss sich da keine Sorgen machen. Ich habe den Instinkt, den er vom ersten Tag an in mir gesehen hat.
„Danny?“
Ich drehe mich und finde Brad im Türrahmen stehend vor. Sein Gesicht verzieht sich, als er meine Miene wahrnimmt. „Vor fünf Minuten“, bestätige ich seine Vermutung, als sein Blick auf den Ring an meinem kleinen Finger fällt. Ich drehe ihn und finde in dieser Bewegung sowie dem Gefühl der Reibung auf meiner Haut Trost.
„Es tut mir sehr leid, Danny.“
Ich nicke und zwinge mich auf die andere Seite des Schreibtischs meines Vaters zu gehen, ziehe seinen Stuhl hervor. Seinen Thron. Kaum das mein Hintern das weiche Leder berührt, durchströmt mich Ruhe. Als würde er mich umgeben. Mich umarmen. „Hol sie rein“, ordne ich an, woraufhin Brad nickt und losgeht, um die Männer zu holen. Ich habe keine Zeit zu trauern. In dem Moment, als die Welt von der Bettlägerigkeit meines Vaters erfuhr, war die Scheiße am Dampfen. Die Wichser nahmen fälschlicherweise an, dass unsere Rüstung mit mir als Kopf unserer Organisation und vielleicht aufgrund der Ablenkung durch meinen sterbenden Vater Löcher bekommen könnte. Falsch. Mehr Menschen waren in den letzten sechs Monaten durch meine Hand gestorben als in den letzten sechs Jahren. Ich mache keine Gefangenen.
Brad verschwindet und ich ziehe die oberste Schublade des Schreibtisches meines Vaters auf. Der massivgoldene Brieföffner, der schief auf dem geprägten Briefpapier liegt, bringt mich zum Lächeln. Es haut mich immer noch um. Der gefürchtetste Mann der Unterwelt besitzt goldverziertes Briefpapier, um seine Todesdrohungen zu verschicken. Ich lege den Umschlag mit seinem letzten Willen in die Schublade und ziehe mir den Ring vom Finger, platziere ihn darauf. Dann nehme ich den Brieföffner und fahre mit der Kuppe meines Zeigefingers an der Klinge entlang, bis ich die Spitze erreiche. Ich drehe den Öffner, bis der Druck die Haut meines Fingers durchsticht und Blut zum Vorschein kommt, lege meinen Kopf schief und sehe dabei zu, wie es aus meinem Finger quillt.
Als ich ein Klopfen an der Tür höre, sehe ich auf und sauge den Blutstropfen weg. Brad führt zehn Männer meines Vaters herein.
Nein. Meine Männer.
Jeder Einzelne von Ihnen bemerkt meine Position am Schreibtisch meines Vaters und neigt respektvoll seinen Kopf. „Perry Adams.“ Ich komme direkt zum Geschäftlichen. „Wo zur Hölle ist er?“
„Ringo ist vor einer Stunde losgefahren, um ihn zu wecken“, antwortet Brad. „Sie sollten jede Minute hier sein.“
Von all den Männern, die Brad hätte schicken können, schickte er ausgerechnet Ringo. Gut. Ich scherze nicht. „Er wird glauben, noch in seinem Albtraum gefangen zu sein, wenn er Ringos unschöne Visage in seinem Bett sieht.“ Ringo ist einer meiner besten Männer. Er ist auch der hässlichste. Vernarbte Haut, dünn, grausame Lippen, die ganz sicher noch nie gelächelt haben, und eine Nase fast so groß wie sein kahler Kopf. Er kann gestandene Männer zum Weinen bringen und ich nehme an, dass Perry Adams in genau dieser Sekunde flennt wie ein Schlosshund. Mit einer Waffe an seiner Schläfe.
„Sein Albtraum wird nur schlimmer, wenn er nicht bald den Finger zieht“, meint Brad und setzt sich – der einzige andere Mann neben mir, der dies im Büro meines Vaters tut.
Nein. Meinem Büro.
„Wann müssen wir aus Winstable Boatyard raus sein?“, frage ich.
„Die Bauunternehmer kommen nächsten Monat. Wir kümmern uns noch um die nächste Lieferung und dann verschwinden wir dort.“ Ich versinke in Gedanken. Die Zeit läuft uns davon. Winstable wird weg sein und ich habe den Verkauf der Byron’s Reach Marina noch nicht festgemacht. Ich brauche diesen Standort, denn sonst wird das Geschäft gravierend behindert. Oder kommt zum Erliegen. Und Perry Adams, Anwalt des Besitzers der Byron’s Reach Marina, ist der Mann, der diesen Verkauf für mich dingfest machen wird. Außerdem kandidiert er für das Amt des Bürgermeisters von Miami und das bringt mir unglaublich attraktive Vorteile. Aus genau diesem Grund finanziere ich seinen Wahlkampf. Charakter bringt dich in der Politik weit, aber Geld bringt dich weiter und von Letzterem habe ich eine Menge. Ich bekomme den Bootshafen, er den Bürgermeistertitel. Es ist ein einfacher Deal. Zumindest glaubt er das. Er wird meine Marionette sein, wenn er erstmal an der Macht ist. Er wird das Gesicht sein, aber ich werde Miami regieren.
Aber für den Moment soll er mir einfach nur den Verkauf des Bootshafens sichern. Sollte ja nicht so schwer sein, aber offensichtlich ist es das. „Warum braucht er so lange?“
„Keine Ahnung.“ Brad seufzt, als gerade die Tür aufgeht und der Mann höchstselbst über die Schwelle stolpert. In seinen Unterhosen. Die Waffe befindet sich noch immer an seiner Schläfe und Ringos Finger liegt am Abzug, jederzeit bereit, meinen Befehl auszuführen. Perry Adams Stirn glänzt vor nervösem Schweiß. Es belustigt mich. Dieser Typ ist bekannt für seine Arroganz, aber auf diese akzeptierte Art und Weise, mit der Anwälte durchkommen. Sein Image bedeutet alles: Von seinen maßgeschneiderten Anzügen bis zu seiner perfekten Familie. Und jetzt steht er hier in seinen Unterhosen, wobei er aussieht, als hätte er sich eingemacht.
„Morgen“, zwitschere ich und lehne mich im Stuhl zurück, während er vor mir zittert. „Du hast Neuigkeiten für mich.“ Ich formuliere hier eine Aussage, keine Frage.
„Ich brauche nur noch einige Wochen.“ Er stolpert über seine Wörter, tänzelt von einem nackten Fuß auf den anderen. „Die Eigentümer von Byron’s Reach, die Jepsons, sind geschäftlich in Dubai. Eine Last-minute-Reise, unerwartet. Ich wusste nicht, dass sie fliegen würden, bis sie bereits unterwegs waren. Ich habe Ihr großzügiges Angebot übermittelt. Ich habe die Dokumente fertig. Alles ist bereit; ich benötige nur noch eine Unterschrift.“
„Ich habe Ihnen fünf Millionen für diesen Bootshafen und zehn für Ihre Kampagne gegeben, Perry,“ erinnere ich ihn. „Nur noch ein Herzschlag trennt Sie davon, Bürgermeister von Miami zu werden, dennoch bin ich noch immer nicht im Besitz meines verdammten Bootshafens. Das hätte vor Wochen in trockenen Tüchern sein sollen.“
„Ein paar Wochen“, murmelt er, sein Blick fliegt zur Seite, wo Ringo noch immer eine Pistole gegen seine Schläfe hält.
„Du hast eine Woche.“ Ich wedele herablassend mit der Hand. „Bringt ihn raus.“
Ringo lässt die Waffe sinken und zieht sie Adams stattdessen einmal brutal über die Wange, was diesen auf seine Knie befördert.
„Eine Woche“, wiederhole ich, als man ihn aus meinem Büro zerrt. Sobald er verschwunden ist, stehe ich auf und knöpfe mein Jackett zu. „Behaltet ihn im Auge“, befehle ich, als ich an meinen Männern vorbei zur Tür gehe. Ich vertraue Adams nicht; habe ich nie.
Meine Hand hält auf der Klinke inne, denn ich höre einen meiner Männer etwas murmeln. Ich höre nicht genau, was, aber Gemurmel spricht für sich. Ich drehe mich an der Tür langsam um und meine Augen finden Pep. Ich habe ihn nie gemocht. Er hat Jahrzehnte lang für meinen Vater gearbeitet und es in dieser Zeit deutlich gemacht, dass er mich ebenfalls nicht leiden kann – jedoch nie vor Paps.
Sein Blick verflicht sich mit meinem, fordert mich heraus. Dämlicher Wichser. „Entschuldige?“
Seine Schultern straffen sich; Stärke demonstrieren vor meinen anderen Männern. „Von einem Bastard lasse ich mir nichts befehlen.“
Ich nicke, als stimme ich ihm zu, während ich zurück zu meinem Tisch schlendere. Alle sind still. Angespannt. „Du magst mich nicht, Pep?“, frage ich und sehe ihn an. „Das ist okay. Der alte Herr ist tot. Du kannst also sagen, was du wirklich über seinen Bastard von einem Sohn denkst.“
Peps Blick fliegt zu dem Brieföffner in meiner Hand. Er antwortet nicht. Ich gehe lässig zurück zu ihm hinüber und klopfe dabei mit der massiven Goldklinge auf meine Handfläche. Ich sehe, wie er zurückweicht. „Danny, ich meinte es nicht …“
Keine zweiten Chancen. Ich unterbreche ihn mitten in seiner Entschuldigung mit einem einzigen Schnitt quer über seine Kehle. Mit geweiteten Augen greift er nach seinem Hals, während Blut durch seine Finger pulsiert. Ich bin überrascht, wie lange er sich auf den Beinen hält. Tatsächlich langweilt es mich verdammt, darauf zu warten, dass er endlich stirbt. Also steche ich ihm den Brieföffner in die Brust, drehe ihn einige Male, bevor ich ihn wieder herausziehe. Er fällt sofort auf die Knie, zuckt kurz und kracht dann mit dem Gesicht zuerst auf den Boden. „Hat den verdammten Teppich ruiniert“, knurre ich, als ich mich nach unten beuge und den Öffner an Peps Jackett abwische. „Hat noch jemand was zu sagen?“ Ich sehe auf und schenke jedem meiner Männer einen Augenblick meiner Aufmerksamkeit. Stille. „Dachte ich mir.“ Ich richte mich wieder auf und gebe Brad auf meinem Weg aus dem Zimmer den Brieföffner. „Lasst Adams nicht aus den Augen.“
Auf meinem Weg den Flur entlang treffe ich Esther. Mein Blick fällt sofort auf den Haufen an Handtüchern, den sie trägt. „Ruf Amber und schick sie auf mein Zimmer“, befehle ich. Mein Schwanz kommt mit diesem elenden Stress nicht klar und es gibt nur einen Weg, dieser Situation Abhilfe zu schaffen. Jemanden umzubringen, hat der glühenden Wut, die gerade in mir tobt, nichts anzuhaben vermocht. Warum hatte er sterben müssen? Die einzige Person in dieser verdammten Scheißwelt, die sich jemals für mich interessiert hat?
Ich laufe schneller, umrunde die Ecke in Richtung meiner Suite, als ich sehe, wie sich die Tür zum Zimmer meines Vaters öffnet. Shannon kommt heraus. Ich erkenne Tränen in den Augen der Geliebten meines Vaters. Keine Tränen der Trauer. Tränen der Besorgnis. Sie sieht mich näherkommen, aber ich halte nicht an.
„Danny“, ruft sie und kommt mir hinterher. Ich laufe weiter, woraufhin sie mir nachhasten muss, ganz das erbärmliche Schoßhündchen, das sie ist. Sie hat meinen Vater in seinen letzten Tagen von seinen Schmerzen abgelenkt. Dafür war sie gut genug und allein aus diesem Grund habe ich sie hier geduldet. Aber nun ist er tot und ich weiß, was kommen wird. Die geldgierige Hure ist durchschaubar.
Ihre Hand kommt auf meinem Jackettärmel zu liegen, was mich dazu bringt, anzuhalten und auf sie hinab zu schauen. „Was?“, frage ich kalt.
Sie lächelt scheu. „Du weißt doch, dass es mir immer nur um dich ging.“
Ja. Ich habe bemerkt, wie sie mich ansah. Voller Verlangen. Hunger. Und Paps hat es ebenfalls bemerkt. „Schade, dass es mir nie um dich ging“, gebe ich kurz und knapp zurück, schüttle ihre Hand ab. „Pack deinen Scheiß und hau ab.“
„Carlo hätte das nie gewollt“, brüllt sie meinem Rücken panisch entgegen.
Ich halte abrupt an und wirbele herum, greife nach ihr und presse sie gegen die Wand. Wut pumpt sofort durch meine Adern, zerreißt sie fast, bis ich denke, dass ich verbluten könnte. „Du sagst mir verdammt nochmal nicht, was er gewollt hätte“, zische ich. „Tu nicht so, als hättest du ihn gekannt. Das tust du nicht. Er hat dich gevögelt. Nicht mehr.“ Die kalte Wahrheit lässt sie ihr Gesicht verziehen. Es macht mich krank. Worauf hat sie hier gehofft? Lebenslangen Schutz? Ein Vorstadthaus als Vergütung dafür, dass sie den Schwanz meines alten Herrn in seinen letzten Tagen geritten ist? Mein Vater war ein vorhersehbarer Mann. Er liebte Frauen nicht. Er wusste sie zu schätzen, aber liebte sie nie. Und er hat tausendmal wiederholt, dass, wenn er nicht mehr ist, Shannon verschwinden solle. Er wusste genauso gut wie ich, dass sie ihm nur das Bett für die gratis Unterkunft und unseren Schutz wärmte. „Deine Zeit im Wunderland ist um, Shannon. Hau verdammt nochmal ab.“ Ich lasse sie los und die Angst lässt ihre Augen nun aus anderen Gründen tränen.
Ich schaffe es in meine Suite und zerre mir die Krawatte vom Hals, während ich bereits auf dem Weg in mein Badezimmer bin. Schalte die Dusche an, ziehe mich aus und lasse meine Klamotten auf einem Haufen neben dem Waschbecken für Esther zum Wegräumen liegen. Der Mann, der mir aus dem Spiegel entgegenschaut, sieht aus wie immer. Frisch. Gepflegt. Der einzige Unterschied ist die innerliche Verwüstung, die sich heute hinter seinen blauen Augen versteckt. Die nur ich wahrnehme und ich niemanden sonst sehen lassen darf. Sein Tod ist eine Bürde, die ich verstecken muss, denn er könnte meine Schwachstelle sein. Ich bin jetzt allein.
Aber ich werde das schaffen. Ich werde es überleben. Ich kann alles überleben. Darin bin ich geübt.
Ich rolle meine Schultern, kreise den Kopf und versuche so, meine angespannten Muskeln zu lockern. Als ich höre, wie sich die Tür zu meinem Zimmer schließt, fahre ich mir mit den Händen übers Gesicht und seufze. Und nur einen Moment später drapiert sich bereits Amber im Türrahmen meines Badezimmers. Während sie meinen nackten Körper betrachtet, beißt sie sich auf ihre roten Lippen; ihre Hände zucken. „Du hast gerufen“, schnurrt sie, während sie den Clip aus ihren Haaren entfernt, damit ihre blonden Locken über ihre Schulter fallen.
„Deine Ansätze müssen gemacht werden“, sage ich trocken, als ich mich zu ihr drehe. Sie ist keine natürliche Blondine und heute sieht man es. Es macht mich wütend.
Für nur einen Moment ist sie verunsichert. „Wo willst du mich?“
„Auf meinem Schwanz.“ Ich gehe einen Schritt nach vorn und schiebe sie grob mit einer Hand auf ihrem Brustkorb in Richtung des Bettes. „Willst du das, Amber?“, frage ich, denn ich muss dieses Wort hören.
„Ja.“ Sie zögert nie.
„Dreh dich um“, befehle ich, drehe sie und drücke sie mit dem Gesicht zuerst in die Matratze. Ich zerre ihr Kleid nach oben, schiebe ihren Stringtanga zur Seite. Ich vergewissere mich nicht, ob sie bereit ist, denn ich weiß, dass diese Frau bereit ist, sobald sie mich nur sieht. Ich schnappe mir ein Kondom aus der Kommode, streife es über und spreize ihre Pobacken.
„Kein Vorspiel?“, keucht sie.
Ich bringe mich in Position und stoße in sie; und sie schreit ob des harten, plötzlichen Eindringens in ihre einladende Pussy auf. Ich atme ein, halte ihre Hüften. Ich habe weder die Geduld noch die Kraft, lange zu fackeln. Ich muss runterkommen und in meiner Welt ist das – Pussy on demand – die einzige Möglichkeit. Ich stoße wieder und wieder ungehalten zu, lege meinen Kopf in den Nacken, mein Körper auf der Suche nach der Erlösung, die er so braucht.
„Danny“, schreit sie, was mich den Kiefer aufeinanderpressen lässt.
„Sei still“, knurre ich und zwinge sie, ihr Gesicht in den Laken zu vergraben, um mit meinen heftigen Stößen klarzukommen. Das überwältigende Gefühl beginnt in meinem Kopf und hört erst in meinen Zehen wieder auf; mein Schwanz verliert den Rhythmus, als mein Höhepunkt heranrollt. Ich stöhne, drehe meine Hüften, als er schließlich endlos durch mich hindurchpeitscht.
„Fuck, yeah.“ Ich schaue hinunter auf ihren runden Hintern, spreize erneut ihre Backen, um zu sehen, wie mein Schwanz bei jedem Stoß pulsiert. Sofort überkommt mich Erleichterung, aber ich weiß, dass sie nur von kurzer Dauer sein wird.
Als ich leer bin, ziehe ich mich abrupt zurück, lasse sie nach vorn fallen. Schnell dreht sie sich um, ihr Mund setzt zum Sprechen an – wahrscheinlich um zu fragen, warum ich mich nicht um sie und ihre Lust gekümmert habe. Mein Gesichtsausdruck muss Bände sprechen. „Raus“, befehle ich und lasse sie damit still und ungläubig auf dem Bett zurück, während ich zurück ins Badezimmer gehe.
Mittlerweile ist der ganze Raum voller Wasserdampf; nasser Nebel klebt an meiner Haut, aber wärmt mich nicht.
„Das mit deinem Vater tut mir leid“, ruft Amber.
Es tut ihr nicht leid. Den Wenigsten tut es leid. Ich habe das Geschäft sechs Monate lang am Laufen gehalten und oft genug erleichtertes Flüstern gehört, weil Carlo Black bald nicht mehr sein würde.
Dämliche Idioten.
Sie mögen vielleicht meinen Vater los sein, aber nun müssen sie mit mir und mir allein klarkommen. Den Namen Killer mit dem Engelsgesicht habe ich nicht erhalten, weil ich scheißgute Umarmungen verteile. Und wenn ihnen das nicht bewusst ist, haben sie keinen Schimmer, was sie erwarten wird.
***
Ich stehe am Kai von Winstable Boatyard und schaue aufs Wasser. Seit Jahrzehnten pachten wir diesen Hafen von einem alten Jungen, der nie Fragen gestellt hat oder überraschend aufgetaucht ist. Er hat monatlich sein Geld bekommen und sich sonst um seinen Scheiß gekümmert. Bis der arme Schlucker gestorben ist und sein Sohn den Hafen in einem schnellen Deal von gerade mal ein paar Tagen an die Baufirma verkauft hat. Ich nehme an, dass der Deal bereits in Sack und Tüten war, bevor der alte Herr abgetreten ist, weswegen ich nichts mehr dagegen tun konnte. Ich hatte eigentlich vor, der Baufirma das Doppelte ihres Kaufpreises zu zahlen, um meine Geschäfte hier fortführen zu können. Ich hatte außerdem vor, dem Sohn eine Kugel ins Knie zu jagen für die Umstände, die er mir und meinem Geschäft beschert hat. Und dann habe ich es mir anders überlegt. Es stellte sich heraus, dass hier ein College mit Stipendien für die weniger Begünstigten gebaut wird. Nennt mich sentimental, aber ich befürworte es, wenn benachteiligte Kinder unterstützt werden. Außerdem wurde ich auf den Bootshafen von Byron’s Reach aufmerksam; er ist doppelt so groß und noch mehr ab vom Schuss als hier. Der Deal hätte kein Ding sein sollen. Fucking Perry Adams.
Ich habe nur noch wenige Wochen Zeit, bevor ich meine Geschäfte woanders tätigen muss. Um seinetwillen bemüht er sich besser, mir den Bootshafen zu sichern.
Das Wasser ist ruhig, die Wellen rollen sanft ans sandige Ufer. Ich beobachte, wie Blasen an die Oberfläche steigen, kräuselnde Ringe auftauchen und immer größer werden, bevor sie verschwinden. Ich liebe es, hier zu sein. Ich werde es vermissen, doch weiß ich von allen Menschen am besten, dass man sich nicht an Dinge bindet.
Brads Telefon klingelt und ich sehe über meine Schulter zu ihm. „Volodya“, teilt er mir mit, bevor er den Anruf annimmt. „Ja?“ Brads Blick hält an meinem fest und er stellt das Gespräch auf Lautsprecher.
Ich höre das gebrochene Englisch des Mannes, der der russischen Mafia vorsteht. „Die Übergabe muss eher stattfinden und wir müssen unsere Bestellung verdoppeln.“
Ich schüttle meinen Kopf, richte meine Aufmerksamkeit wieder auf das Wasser. Glaubt er, ich zaubere den Scheiß einfach aus einem Hut?
„Unmöglich“, sagt Brad ihm freiheraus. „Es hat einen Grund, warum er immer am Dritten des Monats stattfindet, Volodya. Wenn nicht zu diesem Zeitpunkt, dann gar nicht.“
„Wo ist der Brite?“
„Ich bin hier“, sage ich zum Wasser. „Was ist das Problem?“
„Die Serben“, grollt er tief und langsam, als würde er die Worte bedächtig kauen. „Eine Ratte erzählte mir, dass sie in Miami kaufen.“
„Unmöglich.“ Fast lache ich. „Ich bin der einzige Dealer innerhalb von tausend Kilometern.“ Ich weiß das, denn mein Vater hat jeden anderen umgebracht.
„Unmöglich, wenn sie von dir kaufen.“
„Ich mache keine Geschäfte mit den Serben“, erinnere ich ihn. „Zweifelst du an meiner Integrität, Volodya?“ Ich schaue zu Brad, dessen Augenbrauen wohl ähnliche Höhen erreichen wie meine eigenen. Jemand macht Ärger. Ich würde die Serben nicht einmal mit der Kneifzange anfassen. Ich bin wählerisch, mit wem ich Geschäfte mache, und Vergewaltiger sind ganz unten auf der Liste. „Also, der Dritte oder nicht?“
„Der Dritte“, bestätigt er. „Ich überweise die Hälfte. Den Rest bekommst du, wenn meine Männer die Ware kontrolliert haben.“
„Gern“, erwidere ich, nicht im Geringsten beleidigt. Wir haben dutzende Geschäfte mit den Russen abgewickelt. Wir haben immer geliefert. Aber, wie mein Vater mir immer sagte: Vertraue niemandem. Niemals. Und sei nicht überrascht, wenn dir jemand misstraut. Die Russen und die Serben sind Feinde und bekämpfen sich seit nun zehn Jahren bis aufs Messer. Ich glaube nicht, dass sie überhaupt noch wissen, warum sie sich hassen, aber das soll mir auch egal sein. Sie können sich gegenseitig umbringen, solange es ihre kaputten Herzen glücklich macht. Es hält das Geschäft am Laufen. Ich lächle, rolle mich entspannt auf meine Fersen und atme aus.
„Die Serben kaufen“, sagte Brad hinter mir. „Glaubst du, jemand wagt sich in unser Territorium?“ Er scheint besorgter als ich.
„Der einzige Weg, um irgendwelchen Scheiß ungesehen nach Miami zu bringen, ist über diesen Hafen hier oder Byron’s Bay. Hier sind wir und Byron’s Bay wird rund um die Uhr überwacht. Nichts gelangt in diese Stadt, ohne dass ich davon weiß.“
Kapitel 2
ROSE
Er grunzt und keucht, sein Bauch klatscht gegen meinen Po, während er ungelenk in mich stößt. „Ja, Perry. Oh, Gott, Perry. Oh, bitte, Perry. Fester. Ja, fester, Perry.“ Ich kann mich selbst hören und ich klinge überzeugend, muss aussehen, als sei ich in Ekstase. Aber ich fühle nichts. Ich fühle mich nicht einmal mehr schmutzig. Ich schließe meine Augen und wünsche mich weit weg vom Luxus dieses Hotelzimmers und von diesem Augenblick. Ein Augenblick, über den ich keinerlei Kontrolle habe, in dem ich eine Frau bin, die ich hasse. Aber schließlich finde ich mich in meiner Dunkelheit an dem einzigen anderen Ort wieder, an den ich gehöre. Bei ihm. Dieser innere Konflikt lässt meinen Kopf täglich fast platzen, denn wenn ich keine Spielfigur bin, bin ich eine Gefangene, selbst wenn man mich mit Geschenken überhäuft, ich in Luxus lebe und man mich wie eine Göttin behandelt. Ich bin eine Marionette. Der Sündenbock. Eine Sklavin für alles, was auch immer er wünscht. Ob Hölle oder vorgegaukelter Himmel – über nichts habe ich Kontrolle und deswegen hasse ich jedes grausame Detail meines Lebens. Mit Ausnahme der gestohlenen Momente. Der Momente, in denen ich nicht als Waffe benutzt werde und er mit seinen Geschäften beschäftigt ist. Der Momente, in denen ich mich verstecken und Zeit für mich genießen kann. Wenn ich alles Mögliche auf Netflix bingewatchen und so tun kann, als sei ich nicht ich und ebenso wenig in dieser gottverlassenen Welt gefangen. Wenn ich in der Badewanne liegen, nur im Bademantel faulenzen und Junkfood essen kann. Wenn ich meine Mauern fallenlassen und mein Hirn ausschalten kann. Diese Momente sind selten und mir heilig. Für sie lebe ich und für die Erinnerungen, die ich sicher in meinem Kopf verschließe, weit weg von meinen verdrehten Alltagsgedanken. Sicher vor Verseuchung. Aber sogar diese ruhigen, erhaschten Augenblicke sind von dem Wissen befleckt, dass sie von kurzer Dauer sind. Lediglich Atempausen. Nur ein quälender Geschmack dessen, was sein könnte, wenn ich nicht ich wäre. Aber ich bin ich. Verdreht, kaputt und eingesperrt. Jenseits von Hoffnung und Hilfe.