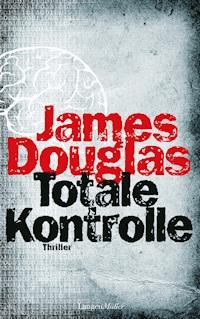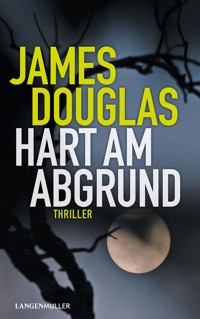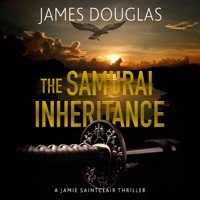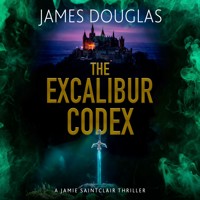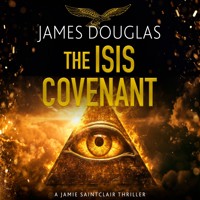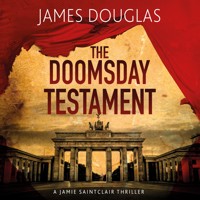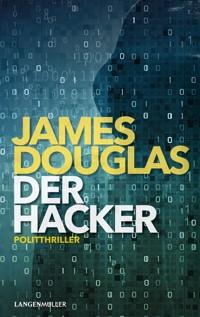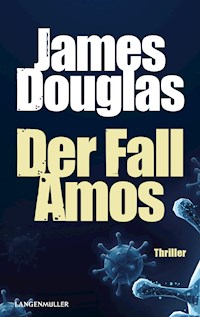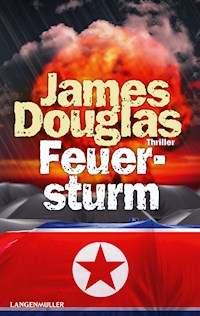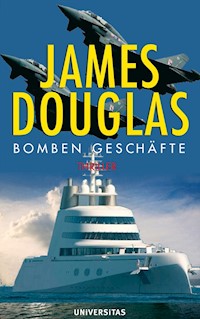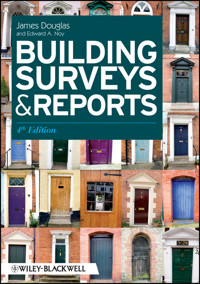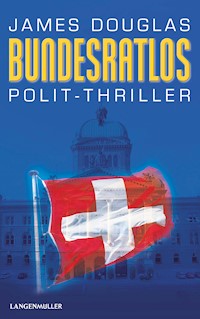
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein neue fessender Polit-Thriller von James Douglas: Das Land ist bundesratlos. Auf ihrem traditionellen SoMMerausflug verschwindet die siebenköpfige Landesregierung der Schweiz spurlos. Niemand bemerkte es. Stehen hinter der dreisten Entführung aufgebrachte Bauern, die dem Bundesrat einen Denkzettel verpassen wollen? Oder hat Top-Terrorist Aziz al-Fakr die Schweizer Regierung als Geisel in seiner Gewalt, um ein brisantes Waffengeschäft ungestört abwickeln zu können?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 483
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Distanzierungserklärung: Mit dem Urteil vom 12.05.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben in diesem E-Book Links zu anderen Seiten im World Wide Web gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in diesem E-Book und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem E-Book angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.
Besuchen Sie uns im Internet unter www.langenmueller.de
© 2021 Langen Müller Verlag GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten
Foto/Umschlag: GLM Marketing AG, Zürich
E-Book Konvertierung: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten
ISBN 978-3-7844-8426-6
Den sieben entführten schweizerischen Bundesräten gewidmet:
Moritz Eulengerber (Energie undVerkehr)
Josy Dreist (Landwirtschaft)
Casparl »Rübe« Bouchecain (Inneres)
Michelle Calamythey (Auswärtiges)
Samuel »Sämi« Amboss (Verteidigung und Sport)
Christoph Emser (Justiz und Polizei)
Max-Rudolf Herz (Finanzen)
Inhalt
Prolog
ERSTER TEIL
Zürich, im Juli
Im Jammeribodenloch
Zürich, in der gleichen Nacht
Zürich, Montag, 28. Juli
Zürich, in der Eissporthalle
Im Kurhaus von Jammeribodenloch, Montag, 28. Juli
Der Rabbiner
Was Dora Zweibach erzählte …
Von der Geburt der Zwillinge
Nike und Abel
Der Tod von Dora Zweibach
Hiobs Bestimmung
Das Treffen
Ritas Los
In der Zentrale von US1A
Der Plan, Montag, 28. Juli
Zürich, Dienstag, 29. Juli
Zürich, Redaktionsräume der Swiss Tribune
Im Bistro auf der anderen Straßenseite, Dienstag, 29. Juli
In Genf, 29. Juli, abends
Zürich, Galaxy-Studio, 29. Juli, abends
Genf, in der Nacht des 29. Juli
Auf Rita Ruchtis Hof im Jammeribodenloch
Genf, im saudischen Herrenhaus
Auf Hermann Strausacks Wydenhof, Mittwoch, 30. Juli
Im Jammeribodenloch, 30. Juli
In Genf und jenseits des Atlantiks, 30. Juli
Auf dem Wydenhof, 30. Juli
Geologie im Jammeribodenloch
Der Überfall bei Urchigen, 30. Juli
Im Führungsbunker von Urchigen, Mittwoch, 30. Juli
Am Nachmittag gleichen Tags im Kurhaus
Der Ernstfall am Mittwoch
Marcos Verhängnis
Von vorne bläst der Wind …, 30. Juli
Bern, im Bundeshaus, 30. Juli
Im Kurhaus Jammeribodenloch, 30. Juli
Airport Bern-Belp, Mittwoch, 30. Juli
In der Lobby des Kurhauses
Im Hinterhof des Kurhauses
Im Verlies des Gewölbekellers
Rita unterwegs
Der dunkelste Tag …
ZWEITER TEIL
Die Quarantäne
Im Forschungslabor, am Morgen des 31. Juli
Bern, Eidgenössisches Justizdepartement, 31. Juli
Zürich, 31. Juli
Auf dem Zivilstandsamt Hinteregg-Jammeribodenloch
Zürich, im Gebäude von Swiss Tribune und Galaxy, 31. Juli
Im Fernsehstudio
Nach dem Clinch
Das Attentat vom 31. Juli in Zürich
Zürich, am Stauffacher vor McDonald’s
Zürich, am Stauffacher, Minuten später
Schamir
Bern, Nussbaumstraße 29, Zentrale des Inlandgeheimdienstes, 31. Juli
Auf der Fahrt ins Gebirge, 31. Juli
Bagdad, Sommer 2003
Unterwegs ins Gebirgstal, 31. Juli
Im Gasthaus zum Kreuz, in der Nacht des 31. Juli
Im Gewölbekeller
Aussicht auf Rettung
Der Ausbruch am 31. Juli, vor Mitternacht
Die Wege trennen sich
DRITTER TEIL
BRISE, 31. Juli
Im Gasthaus ›Zum Bären‹
Ken Coopers These
Bern, im Ad-hoc-Krisenstab
Der Austausch
Der Aufschrei des Berges
In der alten Mühle
Drei Uhr morgens …
In der alten Mühle
Auf der Fahrt ins Dorf …
In der alten Mühle
Vor dem Forschungslabor
Im Institut für Virologie und Gentherapie
Drei Stockwerke tiefer
e-Politiker
Bern, Bundeshaus, nächtliche Pressekonferenz
Im Versuchszentrum der Quarantäne
Im improvisierten Bundeshaus-Studio
Der Unfall
Mona erwacht
In Melissas Zimmer
Die Zeit zerrinnt …
Die Bombe tickt …
Count-down zur Hölle
Clinch live aus dem Jammeribodenloch …
Gut gebrüllt, Löwe …
Bern und Washington
Epilog
Anmerkung des Autors
Prolog
Sie waren nicht zu sehen, die Männer, ihre Gesichter geschwärzt und hinter Strumpfmasken verborgen. Mit dem Sturm kamen sie über den See. Vom flachen Ufer huschten sie lautlos über den weichen Rasen des großen Gartens. Heftige Regenschauer peitschten auf die lange Fassade der großen Villa, ihr Angriffsziel. Windböen fegten kräftig durch die alten, hohen Ulmen, das Geäst ächzte, die Platanen rauschten, und am Ufer neigten sich die Pappeln gegeneinander, als wollten sie sich die Anwesenheit der gefährlichen Besucher zuraunen. Das Gewitter toste. Das prächtige weiße Herrenhaus, das vor Jahren in den Besitz des saudischen Königshauses gelangt war, trotzte dem Sturm stoisch wie eine Festung, und es war tatsächlich eine. Der rechteckige Bau hatte je einen Flügel an den Seiten und war von einem breiten braunroten Ziegeldach bedeckt. Hinter dem feudalen, von finsteren Waldstücken abgeschirmten Anwesen lagen der Helikopterlandeplatz, ein Stallgebäude und zwei Gästebungalows.
Sein einziger Bewohner, der märchenhaft reiche Wüstensohn, liebte das Prasseln und Krachen des Gewitters. Waren die Fensterläden geschlossen und brauste draußen der Wind über den See, erschien ihm das Haus als die allerprächtigste Heimstatt, und die Behaglichkeit in den eigenen vier Wänden war kaum zu überbieten.
Auf der Leopardendecke seines breiten Betts räkelte sich die leicht bekleidete exotische Schönheit Nikrim. Sie sah hinreißend aus. In einer schönen, perfekten Linie verlief ihr Rücken zu ihren schmalen Hüften, erhob sich zur Wölbung ihrer Backen und verschmolz in die vom schwarzen Negligé umflorten Schenkel.
Mit einem Lächeln auf dem Gesicht goss der Prinz den gekühlten Champagner in die goldverzierten Kristallkelche und ergötzte sich an der verführerischen Pose der jungen Frau. Seinen Körper hielt der Bonvivant von ungefähr fünfzig in beneidenswerter Form, er sah attraktiv aus. Der Prinz hatte verlässliche Chancen, dereinst zum König des reichsten Erdöllands der Welt gekrönt zu werden.
Doch die Männer in ihren schwarzen Overalls hegten andere Pläne für seine Zukunft.
Wasser troff von den Linsen der Überwachungskameras. Auf dem verschwommenen Bild sah der Wächter im Untergeschoss die schattenhaften Umrisse der Männer, die plötzlich vom See her auf das Haus zustürmten, deutlich genug, höchst alarmiert griff er zum Telefon.
Die bewaffneten Eindringlinge kauerten am seitlichen Eingang, den sie von den Luftaufnahmen kannten, gaben sich Zeichen, bereit zum Sturm.
Ein dumpfer Knall riss den Prinzen jäh aus seiner erotischen Kontemplation. Nikrim schrie gellend auf.
Die Angreifer preschten durch die Küche in die Halle, durchsuchten alle Zimmer, trieben die Angestellten zusammen, besetzten nach einem genauen Plan die Räume im Haus, jeden Widerstand erstickten sie brutal im Keim.
Eine halbe Stunde später hatte der drahtige Anführer Aziz al-Fakr das Haus unter Kontrolle. Der Topterrorist war zufrieden.
Innerlich bebend, äußerlich gefasst öffnete der leichenblasse Prinz tief im dritten Kellergeschoss das elektronische Sicherheitsschloss. Die Männer stemmten die massive Stahltür auf und staunten: Der riesige Familienschatz schimmerte ihnen entgegen. Zwei Reihen lang verlor sich der matte Glanz der Goldbarren im tiefen Gewölbe – wie Häuserzeilen eines Boulevards, die von der Dämmerung im Westen verschluckt werden.
Der Prinz hielt trotzig den Kopf hoch, und sein fein geschnittenes Gesicht zeigte den Ausdruck abgrundtiefer Verachtung.
Al-Fakr schenkte ihm bloß einen mitleidigen Blick, sofern er überhaupt zu Mitleid fähig war. Als Nummer zwei der al-Qaida, auf den die CIA eine Kopfprämie von zwanzig Millionen Dollar ausgesetzt hatte, stand er vor einem einsamen Höhepunkt. Es war nur eine Frage von Stunden, bis ihm die erste einsatzbereite Atombombe im Austausch für das saudische Gold übergeben würde. Hier, in der Sicherheit der Prunkvilla, knapp eine halbe Stunde von Genf entfernt.
Ungefähr zur gleichen Zeit erklärte in Bern ein Sprecher der Schweizer Bundesregierung in den Abendnachrichten, das Land sei nach einer Studie des Kernstabs für Sicherheit keine Zielscheibe des Terrorismus, und die Bevölkerung habe keinen Grund zur Besorgnis. Die Polizei in den sechsundzwanzig Kantonen stünde in engem Kontakt mit der Bundeskoordinationsstelle für innere Sicherheit.
Nur wenig später, um zwanzig Uhr, begrüßte die beliebte Moderatorin Mona Menn in Clinch, einer der populärsten Fernsehshows, den früheren Vorsitzenden einer Linkspartei und fragte: »Als Hotelier kritisieren Sie die Bauern scharf, sind zugleich aber ein heimlicher Profiteur der Landwirtschaft. Keine Touristenseele käme ins Wallis, wenn die Weiden dort nicht so schön gepflegt wären wie die Hände einer Frau.«
Auch auf dem saudischen Landsitz am Genfer See flimmerte die beliebte Sendung irgendwo über eine der zahlreichen Mattscheiben.
»Nichts gegen ein Profitchen, aber schauen Sie, fünf Kühe kosten die Steuerzahler so viel wie ein Schüler. Gespart wird bei den Lehrerinnen und nicht bei den Kälbern«, meinte der bubenhaft um sich blickende Gast.
Im Badezimmer des Gästeflügels schielte Max Gron alias Abu Khalid in den Spiegel, der zugleich als TV-Projektionsfläche diente, und schrubbte sich, über das Onyx-Waschbecken gebeugt, die Schwärze aus dem Gesicht. Alles war nach Plan verlaufen. Wie immer, wenn der deutschstämmige Max Gron die Sache in die Hand nahm. Belustigt versuchte er, den Wert des Goldschatzes zu schätzen, verlor sich aber in den Nullstellen der Milliarden. Zudem lenkte ihn die attraktive Moderatorin im Fernsehen ab. Er starrte fasziniert auf ihren schönen Mund, der sich reizvoll zu einem Lächeln verzog, als sie meinte: »Aus einem frustrierten Bauernstand wächst ein schlagkräftiges Heer.«
»Die Bauern sind kampfeslustig, aber keine Terroristen. Politikern Mist anzuschmeißen ist die höchste Form ihrer Rebellion«, antwortete der ulkige Typ mit Brille.
»Was kostet uns die Landwirtschaft?«
»Dreizehn Milliarden Franken pro Jahr …«
Max Gron schaltete Clinch weg, trocknete sich die Wange und ging hinaus. Ihr hübsches Gesicht würde er wieder erkennen. Überall.
Als er wenig später das Schwimmbad betrat, stand al-Fakr vor der Kamera.
»Wir tragen den Terror an jeden Ort des Westens«, sprach der Anführer theatralisch und streckte ein blankes Schwert empor. Das Aufnahmelicht der Videokamera leuchtete rot.
Die Hände auf den Rücken gefesselt, kniete der Prinz würdevoll mit nacktem Oberkörper am Rand des Beckens. Plötzlich sauste die Klinge nieder. Blitzschnell.
Der Kopf des Prinzen fiel sofort bei dem wuchtigen Hieb. Sein Blut klatschte auf den weißen Fliesenboden. Totenstille herrschte, während das Wasser im Becken sich grässlich rot verfärbte.
Wortlos ließ der Terrorist die Henkersklinge fallen und schritt salopp hinaus. Die Männer, die der Exekution zugeschaut hatten, lachten und rauchten. Dann brachten sie den Leibwächter, den Chauffeur, die Hausdame und den Gärtner um. Die exotisch schöne Nikrim kam als Letzte an die Reihe. Es war ausgemacht, dass sie Max Gron gehörte.
ERSTER TEIL
Zürich, im Juli
Es begann mit einer Panne. Die Leiche lag auf dem langen, schmalen Bootslandesteg auf dem Bauch, den Kopf zur Seite gewandt, als schliefe die Frau. Ihre Kleider trieften, der Steg tropfte, der Park ertrank unter dem heftigsten Gewitter, das seit Jahrzehnten auf die Stadt niedergegangen war. Dann, kurz bevor die Polizei aufkreuzte, hatte es aufgehört zu schütten. Die Nacht war seltsam still. Ein Kriminalbeamter in schwerer Regenjacke stand über der Leiche. Mit einer Stablampe leuchtete er den Steg ab, während sein Kollege ein Stativ aufbaute.
Als der Zivilist eintraf, im langen Regenmantel und Schlapphut, hatte der Wachtmeister auch die zweite Leiche inspiziert. Sie hing halb im See. Dass sie nicht versunken war, verhinderte der im Geländer verhakte nackte Fuß. Das Bild des seltsam verdrehten Körpers, dessen männliche anatomische Formen deutlich hervortraten, wirkte grotesk. Die Wellen schwappten über die weit aufgerissenen Augen des blassen Gesichts, als umspielten sie eine Boje.
Blitzlichter zischten.
»Was haben wir?«, fragte der Schlapphut und winkte dem Gerichtsmediziner.
Autoscheinwerfer streiften über die Wiese. Die sich nähernden Polizeistreifen hatten im Funk von den Leichen im Park gehört.
Der Tatort erstrahlte in grellem Licht, jemand hatte eine Halogenleuchte installiert. In ihrem Schein stellte der Gerichtsmediziner den Tod der Frau fest. Die Verletzungen, die er an ihrem Körper entdeckt hatte, waren bei Opfern eines Verbrechens selten feststellbar, aber nicht untypisch. Der kräftig gebaute Arzt stand auf und blickte um sich. Ein Baum trieb im See. Abgebrochene Äste übersäten das Ufer. Er schnupperte in der Luft, prüfte die Oberfläche der Holzplanken, tastete das Eisengeländer ab.
»Was haben wir?«, wiederholte der Schlapphut.
Die Todesursache war eindeutig.
Ein Kastenwagen manövrierte rückwärts ans Ufer. Die Polizisten, die überall herumstanden und es für ihre Pflicht hielten, den Kollegen der Spurensicherung im Weg zu stehen, schauten interessiert zu, wie die Räder auf dem Kies durchdrehten, bevor sie über die dicken Äste knackten.
Rolf, der Fahrer des Leichenwagens, trug eine Strickmütze und einen schwarzen Rollkragenpullover, er öffnete die Hecktüre. Seit dreißig Jahren hatte er im Dienst der Stadt mit Leichen zu tun, die nach einer kriminalistischen Untersuchung riefen und im Jargon deshalb Polizeileichen hießen. Die Särge für Polizeileichen waren aus antiseptischem Aluminium gebaut und leicht zu tragen. Rolf stellte einen auf dem Steg ab, dann stapfte er über das Gras zum Schlapphut, der mit dem Gerichtsmediziner ein Zigarillo rauchte.
Die Verwesten waren am schlimmsten, dann kamen die Selbstmörder, deren Hirnmasse an den Zimmerwänden klebte. Traurig, aber auch aufregend war der Anblick der Ermordeten jedes Mal. Als Polizeileichenbestatter vom Dienst war Rolf über die Jahre abgebrüht. Es gab kaum einen Abgrund menschlichen Elends, in den er noch nicht geblickt hatte.
Der Schlapphut gab ihm mit einem Nicken zu verstehen, dass er abräumen könne.
Das Gesicht der Frau faszinierte Rolf. Er wusste sogleich, woran sie gestorben war. Blitzschlagopfer haben diesen seltsam verdutzten Ausdruck auf dem Antlitz. Aber da war noch etwas anderes. Die Tote kam ihm bekannt vor.
Der Untersuchungsrichter griff sich an die Hutkrempe und hielt den Ausweis der Toten gegen das Licht. Die laminierte Karte war an einer Ecke geschmolzen, doch der Name ebenso klar lesbar wie ihr Geburtsdatum. Ihm stockte der Atem. Er steckte die Identitätskarte weg und beschloss, den Namen nicht preiszugeben. Prominente Tote am Tatort sorgten für Schwierigkeiten. Vor allem eine wie diese: Mona Menn, die investigative Journalistin und zurzeit populärste Moderatorin des Fernsehkanals Galaxy.
»Der Mann hat nichts bei sich, das ihn identifizieren lässt«, meldete der Wachtmeister und schaute, wie seine Leute den über den Steg hinaus hängenden Toten emporhievten und in den Sarg legten.
»Genau wie die Frau. Ebenfalls unbekannt«, brummte der Schlapphut.
Der schwarze bullige Hummer hielt vor der Restaurantterrasse, gerade einen Steinwurf vom schauerlich erhellten Landesteg. Sein Fahrer Mazzo hatte die Mütze in die Stirn gezogen, er schaltete die Scheinwerfer aus und beugte sich über das Lenkrad. Am Leichenfundort wimmelte es von Uniformierten. Ein Fotograf in Jeans und langen Haaren kam nicht über das gelbe Plastikband hinaus, mit dem der Wachtmeister den Tatort absperrte.
Mazzo hätte sich die Haare raufen können wegen seiner Verspätung. Wäre nicht das Baugerüst über dem Bus zusammengebrochen, hätte er es noch rechtzeitig geschafft. Die Straße war hoffnungslos zu gewesen. Da half auch der bullige Offroader nichts. Als er schließlich den verabredeten Treffpunkt im Park erreichte, war die Polizei schon weiträumig auf dem Platz.
Er hatte die Frau von ferne an Figur und Kleidung erkannt, zur Sicherheit aber noch das Infrarotteleskop angesetzt. Kein Zweifel, das Gesicht, das ihn traurig durch die Nacht anblickte, gehörte ihr.
Zerknirscht wählte er die Nummer.
Was genau passiert war, blieb ihm schleierhaft. Zweifellos war das seinem Schutz anvertraute Double der Fernsehfrau jetzt tot. Er hatte nicht einfach nur versagt, ihr Tod ging auf sein Konto. Was sollte er der Zentrale erklären? Der Kastenwagen mit den Särgen rumpelte an ihm vorbei, als sich die Stimme am anderen Ende der Leitung meldete.
»Wir haben eine Panne«, meldete Mazzo und hielt seinen Bericht kurz. Er wusste ja auch nicht viel, außer, dass er bis zum Hals im Dreck steckte. Dann wies ihn die Stimme an, die Leiche der Getöteten zu beseitigen.
»Die Leiche der Doppelgängerin muss verschwinden«, lautete unmissverständlich der Befehl vom anderen Ende.
Als der Fahrer sich aufgeschreckt umsah, bemerkte er gerade noch rechtzeitig, wie das Heck des Polizeileichenwagens in die Seestraße einbog.
»Los, den schnappen wir uns«, rief er dem still in sich versunkenen Beifahrer zu und fuhr ruckartig los.
Im Jammeribodenloch
Das Institut, dem Mazzo in dieser Sturmnacht die Nachricht von der Panne übermittelte, lag zweihundert Kilometer westlich von Zürich, in einem abgelegenen Tal mit dem ominösen Namen Jammeribodenloch.
Geschützt von einer verbuckelten Voralpenmoräne wäre im Tal ein lieblicher See entstanden, hätte der Gletscher vor einer halben Million Jahre sich zurückzuziehen geruht.
Das Dorf duckte sich unter den Steilhängen. Sein größtes, wenn auch nicht schönstes Gebäude war der »Bären«, einst ein Bauernhof. Ebenfalls imposant wirkte die alte Mühle, die am Bach und halbwegs an der Straße hinauf zum Kurhaus stand.
Die Südseite des Tals war grün, auch weniger steil, die Fichten, die sich früher dicht an dicht aufreihten, waren für die Schindelproduktion der Axt zum Opfer gefallen. Hinter dem großen Kurhaus, das Ende des 19. Jahrhunderts erbaut worden war, ragte der Berg spitz und dunkel empor, durchzogen vom Zickzack eines Fußweges, der zum Ochsengrindpass hinaufführte.
Außer einer großen alten knorrigen Tanne wuchsen auf dieser Seite keine Bäume.
Wie lange der greise Rabbiner schon im Kurhaus lebte, wusste niemand genau. Man hielt ihn für ein Inventarstück. Edgar Bentley Rosenstock saß im Rollstuhl, die Beine unter einer tief hängenden, verschlissenen Pferdedecke. Aufsehen erregt hatte sein frühes Traktat INTER FAECES ET URINAM NASCIMUR. Der Mensch zwischen Urin und Stuhl in die Welt gestoßen, schrieb Bentley, suhle sich zeitlebens im Sexualund Fäkaljargon, sei zu Niederem geboren, und nur der Teufel könne ihn aus dem moralischen Sumpf erretten.
Die Gescheiten hatten das Tal längst verlassen. Nur die Dummen waren in diesem Nebelloch geblieben, sodass keiner mehr hier war, um dem Rabbiner intellektuell gegenzuhalten. Auch nicht Sturni, der Gemeindepräsident. Dass Becher nicht zu den Hiesigen zählte, galt als gesichert. Kurarzt Doktor Becher war aber der Einzige, der es geistig mit Edgar Bentley Rosenstock aufnahm.
Zürich, in der gleichen Nacht
Mazzo blieb keine Wahl. Zunächst ging es darum, dem Polizeileichenwagen, dessen Fahrer es offensichtlich nicht sehr eilig hatte, auf den Fersen zu bleiben.
Schon nach ein paar Minuten Verfolgungsjagd sah Mazzo zu seiner Genugtuung die Rückstrahler des Kastenwagens aufleuchten, als dieser vor einem Rotlicht hielt.
Mazzo blieb in sicherem Abstand zurück und erläuterte seinem Beifahrer den Plan. Was er sich ausgedacht hatte, gefiel Mazzo, weil es einfach war. Wenn es darauf ankam, funktionierte seiner Meinung nach immer nur das Einfache. Und hier ging es um viel. Eine zweite Schlappe durfte er sich nicht einhandeln.
Vorne setzte sich der Kastenwagen wieder in Bewegung.
»Wir versuchen es an der nächsten Kreuzung. Schnelligkeit ist wichtig«, schloss Mazzo seine Instruktionen.
»Kapiert?«, fragte er, als sie die verlassene Rämistraße hinauffuhren.
»Du bist ausnahmsweise nicht fürs Grobe zuständig, sondern fürs Fahren! Ich verlasse mich darauf«, präzisierte Mazzo, der Gewalt ausschloss und auf List setzte.
Stumm folgten sie weiter dem Wagen.
Im Nachhinein musste sich Mazzo eingestehen, dass es keiner besonderen Glanzleistung bedurfte, um sich der Leichen zu bemächtigen.
»Er hält vor der Ampel«, sagte der Beifahrer, als sie die Steigung fast überwunden hatten, und zeigte mit dem Finger überflüssigerweise nach vorn.
»Jetzt!«, rief Mazzo. Er schloss nahe auf, stoppte, stürzte sich aus der Kabine und rannte nach vorn zum Fahrer des stehenden Leichenwagens.
Rolf, der Leichenbestatter, schaute verdutzt hinaus, als er den Kerl sah, der unvermutet an die Scheibe klopfte und freundlich lächelnd Zeichen von sich gab.
»Ihre Hecktür ist offen«, sagte Mazzo ernst, als Rolf stirnrunzelnd die Scheibe herunterließ. »Bald rutscht Ihnen ein Behälter auf die Straße.«
Rolf strich sich verblüfft übers Kinn, schaute prüfend in den Rückspiegel und entschied sich nachzusehen.
Jeder andere Autofahrer hätte das Gleiche getan. Mazzo hatte zwar noch die Eventualität eingerechnet, dass Rolf vielleicht sein Auto auf den Gehsteig manövrieren oder zuerst in die Seitenstraße abbiegen würde, bevor er nachsehen ging. Doch es herrschte um diese Zeit wenig Verkehr, das Gewitter hielt die Menschen im Schutz ihrer Häuser. Und um die Hecktüre wieder richtig zuzumachen, würde er nur Sekunden benötigen.
»Danke«, quittierte er den Hinweis und salutierte kumpelhaft, indem er die Finger an seine Schläfe tippte. Er zog die Handbremse fest, stieg aus und eilte nach hinten.
Mazzo hatte darauf leichtes Spiel.
Der Motor lief noch im Leerlauf. Er hörte Rolf an der Hecktüre des Polizeileichenwagens rütteln, als er sich hinter das Steuer warf, rasch den Gang einlegte und rasant startete.
Im Rückspiegel beobachtete er, wie Rolf mit den Armen ruderte, herumsprang und brüllte, doch der schwere Hummer hinter ihm vertrieb den übertölpelten Leichenbestatter gnadenlos auf den Bürgersteig.
Wenig später parkten sie beide Wagen an einer verlassenen Tankstelle und luden die beiden Särge rasch um.
Es dauerte knappe zwei Minuten, dann war Mazzo mit seiner Fracht in Richtung Jammeribodenloch unterwegs. Zufrieden, dass er wenigstens diesen Auftrag präzise erfüllt hatte.
Zürich, Montag, 28. Juli
Sie landete zwei Tage nach dem heftigen Gewitter in Zürich und fuhr im Taxi ins Stadtzentrum. Es habe schon ein bisschen geschüttet, meinte der Taxifahrer trocken, als wäre er unter einem Wasserfall geboren.
Wie sie später erfuhr, hatte das Unwetter Tote gefordert. Die Winde rasten, es hagelte schwer, Blitze flammten herab, die Wolken barsten, gossen Ströme herunter, ersäuften die Stadt. Auf dem See brüllten die Wirbel, Schlünde taten sich auf, die Elemente tosten.
Beinahe bereute sie es, nicht im Auge dieses Zyklons gestanden zu haben.
Es war später Nachmittag, als Mona vor ihrem Wohnblock aus dem Taxi stieg. Oben im dritten Stockwerk zerrte sie ihren Koffer aus dem engen Aufzug und erstarrte. Ungläubig schaute sie auf die ihr sonst vertraute Wohnungstür. Wenn es überhaupt ihre Wohnung war. Hatte sie sich in der Etage getäuscht?
Sie rieb sich die Augen. Das Klingelschild verriet M. Menn, und Mona Menn war auch ihr Name. Keine optische Täuschung. Darüber klebte aufsässig der Wisch am Türpfosten. Mona trat näher.
»Siegelung. Steueramt der Stadt Zürich.Zutritt verboten«,
las sie fassungslos und fühlte Wut aufsteigen.
Kreuzweise spannten sich zwei rot-weiße Plastikbänder über die Tür, als wäre dahinter ein unbewachter Bahnübergang. Mona Menn verschränkte die Arme. »Witzbolde!«, zischte sie und riss die Bänder fort.
Den Schlüssel drehen, die Schulter gegen die Tür drücken, alles geschah wie gewohnt im Nu. Sie stand in der Wohnung, fühlte sich bereits geborgen, atmete aus und sehnte sich nach einer heißen Dusche. Der amtsrote Siegellack, von den Spaßvögeln in den Türspalt geklebt, lag nun zerbrochen auf dem Fußboden.
Mona Menn fauchte, knallte die Tür zu, drehte die Musik auf volle Lautstärke und sank in die Couch. Den dummen Scherz hatte sie gerade so nötig gehabt wie eine Torte im Gesicht. Die sonore Stimme von Johnny Cash erfüllte den Raum: I keep my eyes open all the time …
»Ja, Johnny, danke«, murmelte Mona.
Sie hörte den Klingelton erst beim zweiten Mal.
Lang, gebieterisch summte es. Kopfschüttelnd ging Mona zur Tür, öffnete sie und sah das groteskeste Bild der letzten zwanzig Jahre.
Die Frau war klein mit großem Busen, trug einen Haarknoten am Hinterkopf und ein blaues, ausgesprochen unelegantes Kostüm, das der Welt mitteilte, dass die Haut darunter alles Modische abgrundtief verabscheute. Durch die Hornbrille, die sie uralt aussehen ließ, musterte sie Mona streng, als wäre sie ein entflohener Kettensträfling.
Neben ihr, ein Aktenmäppchen unter den Arm geklemmt, stand tapfer ein kränklich wirkender Schlaks. Sein Haar war viel zu schütter für einen so jungen Mann. Wie Zeugen Jehovas wirkten sie, entschlossen, Mona aus dem Pfuhl ihrer vielen Sünden zu erretten.
Nur kommen Zeugen Jehovas in der Regel nicht mit zwei stämmigen Polizeibeamten.
Mona wich erschrocken zurück.
»Sie haben das Siegel gebrochen«, sagte die Beamtin streng. Der junge Mann fand indessen ein bisschen Anteilnahme angebrachter und sprach Mona sein Beileid aus.
»Sie sind sicher ihre Zwillingsschwester«, sagte er mit einem verschwörerischen Lächeln, als ginge er jeden Abend mit Mona Menns Porträt auf dem Bauch ins Bett.
Mona war noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten und hatte keinen Grund, von den Polizisten etwas anderes als die Respektierung ihrer Privatsphäre zu erwarten.
Die Uniformierten unterschieden sich äußerlich zunächst nur dadurch, dass einer über blassen Augenbrauen eine Brille trug, während den anderen ein dünner Schnurrbart und ein Messingohrring zierte.
Piercing macht auch vor den Feinsten der Stadt nicht Halt, dachte Mona, als der mit dem Ohrring seine Hand an die Mütze legte und zweimal überflüssig verriet: »Stadtpolizei«, als wüsste sie nichts mit seiner Uniform anzufangen.
Mona war nicht auf den Mund gefallen. In unzähligen Debatten punktete sie stets mit ihrer Schlagfertigkeit. Also sollte sie mit diesen Witzfiguren ja im Handumdrehen fertig werden. Sie holte tief Luft – doch heute brachte sie kein Wort heraus.
Ungläubig starrte sie auf die Matrone, schüttelte den Kopf und schob die Tür zu. Der Stiefel des Polizisten mit Brille verhinderte ihr Vorhaben.
Von diesem Zeitpunkt an entwickelte sich die Situation völlig dynamisch, sodass Mona erst später begriff, was eigentlich mit ihr geschehen war.
Sie erklärten ihr den Tatbestand im Wohnzimmer.
Mona lag auf der Couch, trank einen Whiskey. In der Erregung hatte sie sich vom fünfundzwanzigjährigen Macallen eingeschenkt, ihn mit Eiswürfeln verdorben und achtlos wie billigen Prosecco hinuntergeschüttet.
Sie solle nicht trinken, mahnte das blaue Kostüm und setzte zu einem Exkurs über ayurvedischen Yogi-Tee an. Ihr Begleiter pochte hüstelnd mit dem Finger auf die Aktenmappe, worauf die Beamtin nickte. Unzählige Dienstjahre hatten ihre Mundwinkel scharf nach unten gezogen, die auch blieben, als sie zu reden anfing.
Frau Mona Menn sei leider unter tragischen Umständen verschieden …
Mona glaubte nicht recht zu hören. Die Stimme kam aus weiter Ferne, völlig unwirklich. Sie muss den Verstand verloren haben, dachte sie im ersten Augenblick, während die Stimme fortfuhr.
In solchen Fällen würde polizeiseitig die Wohnung versiegelt, bis das Amt bereit sei, das Steuerinventar aufzunehmen, betonte die Beamtin rechthaberisch. Sie habe diese dienstliche Anordnung mutwillig hintergangen, um sich heimlich am Erbe zu bereichern. Das sei strafbar.
»Das ist Erbschleicherei und Steuerhinterziehung«, entrüstete sich der blaue Drachen, und der Kränkliche zuckte bedauernd die Achseln.
Einer der Polizisten füllte am Esstisch unbeholfen ein Formular aus, der andere, das Zimmer abschreitend, gaffte in alles hinein, was ihn nichts anging. Mona begriff schnell, dass Argumente hier sinnlos waren. Die Beamten hatten ihren Fall, von dem sie so wenig abließen wie der Hund vom Knochen.
»Seid ihr eigentlich noch bei Trost? Ich lebe«, hauchte sie fassungslos und fügte bestimmter hinzu: »Sie verwechseln mich. Jemand sieht mir wohl ähnlich!«
Sie hatte diese Bemerkung nur hingeworfen, ohne zu ahnen, wie nahe sie der Wahrheit kam, und wühlte in ihrer Handtasche: »Ich zeige Ihnen meinen Pass, dann ist alles klar!«
Sie gingen nicht darauf ein. »Später«, befand die Polizei, dann zeigten sie ihr stumm den amtlichen Totenschein.
Ihren Totenschein!
Plötzlich brach sie in raues Gelächter aus. Die Polizisten schauten sich gegenseitig vielsagend an, sofern ihre Gesichter überhaupt etwas sagten, und der am Tisch mit der Brille hob in einer Gebärde der Hoffnungslosigkeit die Brauen.
»Wissen Sie, wo sich ihr Sohn aufhält?«, fragte der Drache in einem Tonfall, als schliefe Marco verwahrlost auf der Gasse.
Mona erschrak. Marco war, wie immer, wenn sie ins Ausland ging, bei Benno und konnte jeden Moment hereinplatzen. Sie schaute auf die Uhr.
»Er ist minderjährig«, raunte die Frau mit dem Haarknoten ihrem blassen Adlaten zu, der einen Schreibblock aus dem Mäppchen zauberte, um die Information zu notieren, bevor sie ihm wieder aus dem Sinn entschwand.
Langsam fühlte Mona ihre Kampfeslust zurückströmen. »Was geht Sie mein Sohn an? Machen Sie, dass Sie endlich rauskommen.« Der Polizist mit dem Ohrring aus Falschgold stand vom Tisch auf und sagte nach einer Weile: »Frau, uh, ich hoffe, dass Sie uns nicht noch einmal sagen, was wir zu tun haben. Wir gehen, wenn alles erledigt ist, und wann das der Fall ist, werden Sie rechtzeitig erfahren.«
Es tönte so gekünstelt, als hätte er die Rede vorher ein paar Mal eingepaukt.
»Ist Marco beim Vater?«, fragte die Beamtin mit dem Charme eines Taschenrechners.
Mona schäumte vor Wut. Marcos Vater war schon lange vor der Geburt spurlos von der Bildfläche verschwunden. Sollte sie die Beamten reizen und auf seine spezielle Brusttätowierung als untrügliches Fahndungsmerkmal hinweisen?
Mona schielte berechnend zum so genannten Gesetzeshüter hinüber, der gerade ihr Eigentum hütete, indem er einen indischen Tantra-Bildband inspizierte und sich in die besonders pikanten Stellungen der phantasievoll verschlungenen Liebespaare vergafft hatte.
Die Überraschung müsste gelingen, rasten ihre Gedanken. Die Pistole hing dem Voyeur auf Hüfthöhe im Halfter – auf ihrer Seite, nur mit einer Aufreißschlaufe gesichert. Mona sah es auf einen Blick. Sie ging im Geist die Handgriffe durch, die sie im Krav-Maga-Training in Tel Aviv gelernt hatte. Mit der Waffe in beiden Händen würde sie zurückspringen und die Polizisten in Schach halten. Dumm wäre nur, wenn der mit dem Ohrring auf die Idee käme, ebenfalls seinen Colt zu ziehen.
Nun, alles konnte sie nicht vorausplanen. Sie durfte nur nicht zögern. Unsicherheit würden die beiden Profis sofort erbarmungslos zu ihrem Nachteil ausnutzen. Doch halt! Die Männer waren ihr gewiss haushoch überlegen. Sie würden sie vermutlich mit einem Trick ablenken, dann in einer Zangenbewegung gleichzeitig angreifen. Um mit solchen Situationen fertig zu werden, war die Polizei schließlich ausgebildet.
Sie sah bekümmert ein, dass ihr Versuch sinnlos wäre. In der Aufregung würde sie alles verpatzen. Nicht zu reden von den üblen Konsequenzen. Verhaftung. Buße. Knast wegen Gewalt gegen Beamte. Ihr Anwalt würde ihr gehörig die Leviten lesen. Also, es war wirklich vernünftiger, die Sache in aller Ruhe auszusitzen. Lange konnte dieser Schwank ja nicht mehr währen.
Spöttisch sagte Mona: »Marcos Vater ist unbekannt. Aber für Sie ist es ein Leichtes, ihn zu finden! Er hat eine seltsame, einmalige Tätowierung auf der Brust. Ein Fingerschnippen für die Polente!«
Die Eindringlinge wechselten irritierte Blicke.
Genau in diesem Augenblick wirbelte Mona blitzschnell herum, überrumpelte den in eine Fellatio-Darstellung vertieften Polizeimann, hielt in Sekundenschnelle seine schwere Waffe in beiden Fäusten, duckte sich, als wäre sie im Combat-Schießen hart trainiert – was nicht ganz abwegig war –, zielte den Männern auf den Bauch, dorthin, wo die empfindlichste Polizeiweichstelle Potenz-Albträume auslöst, wenn ein Lauf darauf gerichtet ist.
Der Drache und ihr Begleiter stürzten schreiend auf den Flur. Die Uniformierten erstarrten in gespreizter Beinstellung.
Es gibt für einen Polizisten nichts Schlimmeres, als die Waffe zu verlieren – und dann auch noch an eine attraktive Vertreterin des schwachen Geschlechts! Eine Schmach. Hohn und Spott des ganzen Korps waren dem armen Teufel sicher.
Doch Mona Menn ließ ihren Gegnern keine Atempause. Nicht eine Sekunde schenkte sie ihnen für den Gedanken an Abwehr. Sie starrten entsetzt in Monas wutentbranntes Gesicht und vergaßen augenblicklich jeden Plan, die Scharte auszuwetzen. Sie bewegte sich behände wie eine Löwin, lud jäh mit einer schnellen, eingeübten Bewegung die Waffe durch. Die Neunmillimeterkugel steckte im Lauf, ihr Finger krümmte sich um den Abzug.
»Los, komm«, blies der mit dem Ohrring zum Rückzug, der andere zögerte.
Es war ein starkes Gefühl, mit der Waffe in der Faust unter der eigenen Haustür das Blatt zu wenden. Die städtische Delegation zottelte mit eingezogenem Schwanz ab.
»Wir kommen wieder«, drohte von den unteren Stufen der Drache.
»Steuerinventar«, kam des Adlaten Stimme um die Ecke.
»Der Bube sollte dann auch da sein!«, rief die Beamtin im Hinuntergehen. Es war kein Vorschlag, es war ein Befehl. Und der Satz saß. Er war die Bemerkung, die Mona am stärksten unter die Haut fuhr: Der Junge … Marco!
Wütend warf sie die Waffe hinunter ins Treppenhaus.
»Das wird ein Nachspiel haben«, hörte sie noch, bevor die Tür ins Schloss fiel.
»Natürlich«, nickte Mona, obschon ihr rein gar nichts natürlich schien.
Ein Nachspiel, das konnte sie nicht wissen, würde es bestimmt nicht geben. Es sei denn, der übertölpelte Polizist wollte unbedingt unter dem Hohngelächter der Stadt als Witzfigur in den Archivdienst versetzt werden.
Zürich, in der Eissporthalle
Eine halbe Stunde später hielt Mona Menn in der großen Eissporthalle nervös nach Marco Ausschau. Knirschen, Stimmen, Schreie und harte Aufschläge brandeten ihr entgegen.
Seine Altersgruppe spielte im hinteren Teil des Feldes ein Match. Das letzte Training vor den Sommerferien. Sie atmete auf, als sie entdeckte, wie die Nummer 12 dem Puck nachjagte und vor dem Verteidiger zum Schuss kam.
Von Benno hingegen keine Spur. Eigentlich müsste der Trainer an der Bande stehen.
Mona hatte Benno Jattaris in der Redaktion kennen gelernt und sich gleich in ihn verliebt. Von den New York Rangers, wo er zwei Saisons gespielt hatte, kam der Schweizer NHL-Star zu den Lions zurück und verhalf dem Club zum dritten Meistertitel in sechs Jahren. Kurz vor dem Siegespfiff im letzten Drittel des Playoff-Finales knallte ein zwei Meter hoher Kanadier Benno von hinten brutal an die Bande, brach ihm den Halswirbel und damit jede weitere Hoffnung auf Fortsetzung seiner Spitzensportkarriere. Seither kommentierte Benno die Eishockeyspiele der Nationalliga A von der Pressekabine aus und nahm sich der Nachwuchsspieler an.
Ohne Benno wäre sie die ganze Zeit nicht klar gekommen, das wusste sie. Als die Swiss Tribune Mona auf einen Auslandsposten versetzte, fiel sie in ein abgrundtiefes Dilemma.
Wer würde sich um Marco sorgen? Müsse sie seinetwegen die Karriere an den Nagel hängen?, hatte sie sich gequält.
»Ich kümmere mich um Marco, mach dir keine Sorgen«, bot Benno ihr an und hatte nicht zu viel versprochen. Er reduzierte sein Pensum in der Redaktion, was er wegen seiner Invalidenrente ohnehin sollte, und kümmerte sich um Marco, als wäre er sein eigener Sohn. Benno war wirklich ein guter Kerl.
Sie spürte Wärme in ihrer Brust aufsteigen, als ein Knirps in voller Montur an die Bande prallte. »Wo ist Benno?«, rief sie ihm zu, als er wieder auf den Kufen stand und sich den Helm festzurrte.
»In der Kabine, Tommy schaut nach uns«, rang der Knirps nach Atem.
»Danke.«
»Easy«, lachte die Nachwuchshoffnung und stürzte sich ins Getümmel.
Mona steuerte auf die roten Türen zu, hinter denen die Coachs ihre eigenen Garderoben hatten.
Benno wäre sicher einverstanden, Marco für eine kurze Weile zu sich zu nehmen, bis der Amtsschimmel sich ausgewiehert hatte. Mona fürchtete nicht so sehr den makabren bürokratischen Megapfusch, der sie für mausetot erklärte, sondern die Komplikationen daraus. Ihr angeblicher Todesfall war inzwischen sicher geklärt, doch die Beamten würden sich schwer tun, den geschossenen Bock zuzugeben, sondern versuchen, sie mit einem Verfahren wegen Vernachlässigung der Erziehungspflichten zu schikanieren und so vom eigenen Skandal abzulenken.
Sie hatte Angst vor dem Übereifer der Beamten. Wäre ja möglich, dass die Behörden ihr als Vergeltung des heutigen Vorfalls das Sorgerecht für Marco entziehen wollten.
Sie sind nicht fähig, das Sorgerecht wahrzunehmen, dröhnte eine imaginäre Funktionärsstimme durch ihren Kopf. Im Kindesinteresse sind wir verpflichtet, eine externe Betreuung zu verfügen. Sie hatte das Schreckensbild eines niedersausenden, das Schicksal von Marco endgültig besiegelnden Stempels vor Augen: Bäng! Vormundschaft!
Ein Abfallcontainerdeckel knallte zu. Mona erschrak und sah in die Richtung des Lärms. TRAINER, informierte ein Schild. Die Tür zum Coachzimmer war nur angelehnt. Vorsichtig stieß Mona sie zögernd einen Spalt breit auf und linste hinein. Sie wollte das uralte lustige Spiel: an Benno von hinten heranschleichen, ihm die Hände vor die Augen legen und dann gemeinsam über die geglückte Überraschung kichern.
Doch Benno sorgte für baffe Sprachlosigkeit, wobei sein nackter Rücken zunächst die schockierende Szene verdeckte. Als Mona nämlich auf leisen Sohlen das Coachzimmer betrat, schob die Asiatin gerade ihren prallen Schenkel zwischen Bennos Beine und küsste ihn voller Leidenschaft. Mona wich entsetzt zurück, stand wie erschossen da, ertappt als Voyeurin.
Die Frau rutschte langsam an Benno hinunter auf die Knie und nestelte an seinem Hosenbund. Da erfasste Mona eine wilde Wut. Sie hatte schließlich die Trainergarderobe einer öffentlichen Eissporthalle betreten und kein intimes Bordellhinterzimmer.
»Hallo, störe ich etwa?«, fragte sie mit eisiger Kälte.
Wie von der Tarantel gestochen sprang die Liebhaberin auf. Hätte Monas Blick töten können, wäre sie augenblicklich umgefallen. Bennos Kopf wirbelte erschrocken herum, seine Hände zogen hastig seinen Gürtel straff, dann blickte er wie ein begossener Pudel auf. Langsam hob er beide Hände zu einer abwehrenden Gebärde, als erwarte er ein vernichtendes Trommelfeuer aus Monas zornentbranntem Antlitz.
»Wer ist diese Schlampe?«
»Mona, ich kann dir alles erklären, es ist nicht, wie du glaubst.« Wie im Film. Die ewige Erklärung des ertappten Liebhabers.
Mona lachte grell. »Wahrhaftig? Ist es wirklich nicht, wie ich sehe und glaube? Verstehe. Sie hat dir bloß einen Knopf am Hosenlatz festgemacht, stimmt’s? Raus!«
Die Asiatin hielt schuldbewusst die Hand vor den Mund, nahm ihre Sachen und schlich mit roten Ohren stumm hinaus.
»Hör mir doch zu, Mona, diese Frau, sie ist …«
»Hör auf, Benno. Kein Wort! Es ist aus.«
Mona schmiss ihm die kleine Proseccoflasche, die sie unterwegs im Supermarkt gekauft hatte, vor die Füße und machte wortlos auf dem Absatz kehrt.
Draußen musste sie sich beherrschen, nicht heulend zusammenzubrechen. Alles schien schief zu laufen. Warum musste ihr das passieren? Was hatte diese Schlampe, das sie nicht hatte?
Das Match der großen Jungs war fertig. Verschwitzt stelzten sie über die Gummimatten zu den Garderoben.
»Mama, nimmst du mich mit?« Marco gab ihr einen flüchtigen Kuss auf die Wange. »Wir haben gewonnen«, strahlte er.
Ein Lichtblick. Mona atmete durch. Ihren Sohn konnte ihr niemand nehmen. Nie und nimmer. Als sie ihm liebevoll nachschaute, kam ihr eine Idee: Rita, ihre Schwester! Das war die Lösung. Nein, ein Coup! Ferien auf dem Bauernhof. Weg mit Marco von dieser Beamtenbrut, bevor die ihr den Sohn entriss.
Als Marco endlich aus der Garderobe auftauchte, fühlte sich Mona wieder besser. Tatendrang beseelte sie. Sie würde Marco im Auto alles erzählen, und wenn alles klappte, würde sie morgen ihren Schachzug machen.
»Weißt du, eigentlich bin ich seit zwei Tagen tot«, sagte sie verschmitzt, als sie im Wagen saßen. Marco schnitt eine drollige Grimasse, als hätte er einen schlechten Witz zum zehnten Mal gehört.
»Ich meine es ernst. Du bekommst jetzt eine unglaubliche Geschichte zu hören, Marco.«
Im Kurhaus von Jammeribodenloch, Montag, 28. Juli
Betrat man vom Entree des Kurhauses über die fünf ausgetretenen Stufen der breiten Eichenholztreppe den Saal, fiel der Blick sogleich auf das Glitzern des grandiosen Kristalllüsters. Er warf einen matten Schein auf den Granit des Kamins, ebenfalls auf das kräftig gemalte Porträt darüber.
Die Halle duftete nach Lavendel. Ausgetäfelte Eichenwände hellten das kaffeebraune Parkett auf, über den sich ein großer, alter rot-schwarzer Perser ausbreitete, der in den hundert Jahren, die über ihn ergangen waren, kaum Schaden genommen hatte. Das Gemälde über dem Kamin zeigte eine reife Dame mit einem stillen, schönen Gesicht, das Eingeweihte der früheren Eigentümerin Dora Zweibach zuordneten. Gegenüber, über dem rubinroten Sofa, hing ein Bild, das einen Bergsturz darstellte und wohl vom alten Zweibach selbst gemalt worden war.
In dem hübsch ausgestatteten Raum stand in einer Ecke auch ein Piano neben rot und grün überzogenen Möbeln. Die Halle bildete ein großes Sechseck, das nach oben in den Turm des Hauses überging. Es war von Dora Zweibachs Mutter gebaut worden, die 1905 geheiratet hatte. Als Hochzeitsgeschenk brachte der Lebemann Zweibach ein Bild aus Paris mit, ungefähr hundert auf achtzig Zentimeter, das ihn sehr angenehm, aber etwas zu poetisch als Pfeifenraucher darstellte.
Picasso, der ihn porträtiert habe, sei der letzte Schrei, ein heiliges Monster, hatte er erklärt, als er das Bild neben der Rezeption aufhängte.
Wann der »Knabe mit der Pfeife« abgehängt und durch das Bild mit den Köpfen der Armeeführer der Schweizer Armee im Zweiten Weltkrieg ersetzt wurde, konnte die spätere Kurhausbesitzerin Dora Zweibach auch nicht mehr ermitteln.
Vom Kamin weg liefen die Eichenholzregale der Bücherwand, die unter dem Gewicht der verstaubten, seit Jahrzehnten nicht mehr aufgeschlagenen Bände schwer durchhingen: Geschichte, Shakespeare, Schiller, Das Tierleben, Das Grosse Weltgeschehen und endlos die Brockhausbände, dann das Schweizer Lexikon, Zeitschriften, zweiunddreißig Bände Kulturgeschichte der Menschheit, vergilbte Zeitungen und am Fuß eine ganze Länge gelber National Geographic Magazines.
Die Bibliotheksecke hatte offensichtlich magnetische Anziehungskraft, anders war die ausgetretene Spur, die wie ein Trampelpfad über den Perser zum Lesetisch führte, nicht zu erklären. Die Möbel schauten stumm auf die Bücher, als erschiene in den nächsten Minuten ein Vorleser. Die Leselampen richteten kooperativ den gebündelten Strahl auf die Kaffeetischchen aus bestem Teak.
Einzig der Rollstuhl passte nicht ins Bild. Sein blankes Metall und die blitzenden Chromkugeln an den Gelenken wirkten kalt. Der alte Mann, der darin zusammengesunken lag, hielt eine Zigarre im Mundwinkel. Sie war olivgrün, das Mundstück zerbissen und pappig. Rauch gab es nicht, weil sie nicht brannte.
Der Alte schien vergessen worden zu sein wie irgendein Relikt aus dem vorigen Jahrhundert. Er zupfte an seiner zerschlissenen Pferdedecke und blickte auf, als hätte er Schritte gehört.
Der Rabbiner
Die Kronzeuginnen in Bentleys Empirischer Phänomenologie waren zwei sagenumwitterte Frauen: Dora Zweibach und die Bodengrittli.
Die Dorfbewohner waren für Spiritismus, Hellseherei und andere eigenartige Phänomene ebenso empfänglich wie für Quacksalberei. Doktor Becher, mit einer so übersinnlichen Aura wie eine Rolle Verbandsstoff, kämpfte auf verlorenem Posten gegen die geheimnisvollen Salben, Kräuter, Tinkturen, Hundefett und andere Naturmittel, deren unglaubliche Krebsheilwirkung die Schulmedizin so vehement bekämpfte wie der Papst die Empfängnisverhütung. Becher hielt das ganze Teufelstheater für töricht, ergötzte sich aber am Aufruhr, den Bentleys Thesen auslösten.
Bodengrittli war nach der ausschmückenden Überlieferung die, die mit dem Teufel tanzte, während Dora Zweibach vom Fürsten der Finsternis geschwängert worden war und ihm Zwillinge geboren hatte. Mit ihrer Teufelsbrut stürzte sie sich, wie man im Tal munkelte, aus lauter Verzweiflung in die Fluten des Rossbachs. Die Leute waren von der Legende fasziniert, Becher allerdings hielt sie für töricht.
Die Teufelsverehrung des Rabbiners Edgar Bentley Rosenstock, die er in der Sage des Jammeribodenlochs empirisch bestätigt fand, spaltete die Landeskirche. Der Gotthelf-Flügel erblickte in Bentley die willkommene Wiederkehr des Bösen, wie die schwarze Spinne, und ließ von der Kanzel wider den Teufel predigen. Die Gläubigen erschauderten und gelobten, den Versuchungen Satans tapfer zu trotzen.
Der Flügel der Sozialdevoten verbündete sich mit der Schweizerischen Gesellschaft für Sagenforschung und bezeichnete die Legende der Zweibach, die in der Schutzhütte auf dem eisigen Ochsengrindpass dem wollüstigen Geschlechtsverkehr mit dem Fürsten der Finsternis gefrönt haben soll, als dummes Kokettieren mit dem Bösen. Der Rabbiner verkaufe den armen Seelen den Teufel gegen gutes Geld, das die Irregeführten besser dem Zentrum der Sozialdevoten in Gwatt für ihre Hilfswerke in Afrika gäben.
Becher fand, die Sozialdevoten hätten Recht. Die Leute im Tal hingegen hingen an den Lippen des Rabbiners ebenso süchtig, wie sie Bodengrittlis Tinkturen und Salben gierig hamsterten.
Bentley war in seinem langen Leben zu allen Weltreligionen konvertiert, um schließlich im Jammeribodenloch seine Berufung zur Satanologie zu entdecken.
Als Neunzehnjähriger hatte sich Bentley in Amerika beinahe das Genick gebrochen, nachdem er mit Freunden in eine wilde Superbowl-Party geraten war. Ein Kerl fing prompt eine Schlägerei an, packte Bentley und warf ihn über das Geländer des Decks auf den Steinplatz hinunter. Seine Freunde waren ihm zwar zu Hilfe geeilt, doch der Kerl war schneller und hatte dem Wehrlosen auch noch die Faust heftig ins Gesicht gedrückt.
Wie Bentley nachher erzählte, hörte er das Knacken seines Nackens. Die Freunde trugen ihn ins Haus, sein Hals war verdreht wie der eines Huhns, dem man den Kopf umdreht. Edgar Bentley Rosenstock war zum Quadriplegiker geworden. Mit eisernem Willen begann er, sich durch Rugby fit zu halten, und nahm später sogar an den Paralympics teil. Vier Querschnittsgelähmte der gleichen Kategorie spielten gegeneinander und machten Punkte, wenn sie den Ball über die Grundlinie des Gegners brachten.
Bentleys Hände und Arme erstarkten, sein Oberkörper bekam eine beneidenswerte Form, während er von der Hüfte an nach unten gefühllos blieb. Sein Genickbruch veränderte seinen Geist. Das Böse müsse eine korrumpierende, verführerische und belohnende Macht mit ungeheuerlicher Kraft sein, schrieb Bentley.
Wo trieb sich, als das unsäglich grausame Verbrechen an mir verübt wurde, der angeblich allmächtige gütige Gott herum? Wieso hat er diese Teufelei, die mich zum elenden Krüppel machte, zugelassen? Wo Verbrechen ungesühnt bleiben, sei alles egal – außer der Macht.
Sollte er von jetzt an dem Bösen dienen oder diesem abschwören?, lautete Bentleys philosophische Lebensfrage; sie stellte den Theologenstreit über Sünde und Vergebung noch in den Schatten. Das Maß aller Dinge sei das Volumen, im physikalischen und metaphysischen Sinn, postulierte er in Psyche des Volumens. Ein Verlag in New York machte die Schrift in dreiundzwanzig Sprachen zum Welterfolg. Bentley hatte das theologisch-philosophische Dilemma nahezu gelöst, als er an diesem Abend Schritte hörte.
Kurarzt Becher trat in die Halle, setzte sich, zündete eine Zigarette an und betrachtete sein Gegenüber im Rollstuhl. Bentleys Haare waren ganz weiß, die Augenbrauen aber immer noch schwarz, sein Gesicht gerötet, was Becher, der den Rauch theatralisch zur Decke blies, dem Cognacgenuss zuschrieb.
»Das Volumen hat als physikalischer Begriff keine Psyche, Bentley«, eröffnete der Kurarzt den Diskurs.
»Du verstehst das nicht, Becher«, antwortete Bentley. »Die Frage ist, ob Dämonen wie der Teufel existieren. Der Beweis kann nur empirisch geführt werden.«
»Empirisch heißt, dass die Beweisführung auf Erfahrung beruht. Wenn Dora Zweibach vom Leibhaftigen geschwängert wurde, wären ihre Zwillinge der lebende Beweis für die Existenz des Teufels«, räumte Becher ein.
»Richtig. Wie geht es übrigens unserem zweiten Zwilling?«
»Dem anderen? Arztgeheimnis, mein Lieber«, antwortete Becher und goss sich aus der Flasche auf dem Schachtisch einen Whiskey ein.
»Man munkelt, er habe eine hohe Position im Staat«, versuchte es Bentley.
»Munkeln ist wie Oralsex, Bentley, ein bisschen Kitzel, aber kein Durchbruch in die Tiefe.«
Darauf schwiegen sie. Bentley nickte ein und schnarchte. Becher sinnierte über den Prominenten, dem er ans Licht der Welt verholfen hatte. Inter faeces et urinam. Jetzt saß er einsam in Bern, saugte sich voll mit Macht und würde eines Tages platzen. Dora Zweibach war eine außergewöhnliche Frau gewesen. Die Magie des Ortes sei für die Geburt entscheidend, hatte sie ihm damals in der stürmischen Novembernacht erklärt, hier in dieser Hotelhalle, und ihre Geschichte erzählt.
Was Dora Zweibach erzählte …
Der Wind biss ihr ins Gesicht, als Dora Zweibach mühsam zum Pass hochstieg und schon bald in den Schnee kam. Sie verschnaufte unter der Wettertanne und blickte auf ihr Kurhaus hinunter, das seit Generationen den Zweibachs gehörte. Das Geschäft lief, auch im Krieg, alles wäre schön gewesen, hätte sie nur einen schönen, treuen Mann. Sie sah ihn oft in ihren phantastischen Träumen, erst letzte Nacht wieder. Er war im offenen Hemd gekommen, das pechschwarze Haar aufgebauscht. Er sah gut aus, wie ein Mann von Welt. Und wie seine schwarzen Augen listig funkelten! Und wie gescheit er redete …
Das Grundböse existiere nicht in ihren innerseelischen Abgründen, sondern außerhalb, mahnte er sie sanft. Sie möge sich mit ihm verbinden, um die Feindschaft im Tal zu überwinden. Darauf legte er sich neben sie und streichelte sie zärtlich zwischen ihren nackten Beinen. Als sie am Morgen aufwachte, wusste sie glasklar, dass er sie oben auf dem Pass erwartete. Aber Dora Zweibach zögerte. Die Morgenstunde ist der Kühnheit Feind. Der Weg zum Pass war beschwerlich, und schließlich: Waren Träume nicht bloß Schäume?
Sie wirkte ein wenig verfallen – wie ein Haus nach langer Herrenlosigkeit. Ihre Hagerkeit mochte das Ergebnis des zehrenden Feuers im Innern sein, das man aus ihren lebhaften, dunklen Augen lodern sah. Mit Bitterkeit dachte sie an die vielen Männer, an die vielen Fehlgeburten, die sie hatte wie andere Frauen Geburtstage. Es machte keinen Sinn. Ihr Leben war verpfuscht, nie fände sie den Mann ihrer Träume. Sie beschloss, alles zu vergessen.
Als sie eine Stunde später den Schutz der Tanne verließ und den steilen Aufstieg fortsetzte, wunderte sie sich. Woher rührte der plötzliche Sinneswandel? Sie mochte sich schlicht nicht erinnern, wann sie das Kurhaus verlassen hatte, wie es kam, dass sie gut ausgerüstet unterwegs war. Plötzlich war sie aus ihrer Trance aufgeschreckt und sah sich am Berg stehen. Ein Adler hob schwerelos ab und schwang zur Passhöhe hoch. Kräftig ging Dora voran – bergauf.
Die Hütte lag im kahlen Einschnitt des Passes, die rote Tür weit offen. Sie hielt den Atem an, trat ein.
Da stand er. Schön und stark und charmant wie im Traum. Die Zeit stand still. Die Schwerkraft ließ nach.
Federleicht schwebte sie über die Wolke der Glückseligkeit. Unwirklich. Wunderschön. Willig gab sie sich dem geheimnisvollen, schönen Mann hin, lustvoll, wild, berauscht, ließ sie alles mit sich geschehen, taumelte von einer sprühenden Vulkaneruption zur nächsten. Sie badete in reinster Wonne, überall verzückten seine Küsse.
Als sie glückselig aus der Betäubung erwachte, war der herrliche Mann verschwunden, das Zimmer kalt. Sie fröstelte und sah das Blatt auf dem Tisch. Rot die Schrift. Mit seinem Blut hatte er geschrieben: Nenne ihn Nika, lass ihn meine Weste tragen und verlasse das Tal.
Nika! Welch seltsamer Name. Zitternd nahm sie die Weste vom Stuhl, strich über den feinen seidenen, schwarzen Stoff und zog sie über. Kraft durchströmte sie, und voller Energie machte sie sich auf den Heimweg. Kalter Regen fegte waagrecht über den Pass. Ein Blitz flammte herab, der Donner grollte dumpf.
Am nächsten Tag suchte sie hinten im schattigen Kessel Bodengrittli auf. Die verrunzelte Bucklige war eine Spiritistin, die behauptete, dass ihr Dora Zweibachs Vater, der sich von Picasso hatte malen lassen, als Geist erscheine.
»Du hast mit ihm einen Pakt geschlossen, Dora. Ich habe das Glühen über dem Ochsengrindpass gesehen«, sagte Bodengrittli ohne Umschweif, als hätte ihr der Teufel die ganze Geschichte längst erzählt.
Dora Zweibach erschrak. »Einen Pakt? Mit wem?«
Grittli nahm sie in die Arme. »Du musst jetzt stark sein, Dora. Es war der Einflüsterer, der dich geschwängert hat.«
Was sie denn tun soll, fragte Dora, und legte eine Hand auf ihren Schoß. Sie würde schon sehen, der Weg sei jetzt vorgezeichnet, meinte Bodengrittli geheimnisvoll, alles komme, wie es kommen müsse.
»Sprich mit keinem darüber.« Dann fühlte sie Doras Stirne, strich mit einer Hand vorne über den Bauch, mit der anderen den Rücken entlang, nickte mehrmals.
»Was ist, bin ich krank?«
»Du wirst Zwillinge haben«, lächelte Bodengrittli verklärt.
Von der Geburt der Zwillinge
Acht Monate später eilte Bodengrittli ins Kurhaus. Becher, der junge Kurarzt mit der vernarbten Wange, gerade noch rechtzeitig aus der Kantonshauptstadt angereist, hatte schon Tücher und Instrumente bereitgelegt.
Rabbiner Bentley Rosenstock dirigierte krächzend aus dem Rollstuhl einen untersetzten Mönch, der vor seinem Schmerbauch ein Becken hertrug und nicht wusste, wo er es hinstellen sollte.
»Er ist exkommuniziert, darum weiß er Bescheid«, erklärte Bentley.
Becher wirkte ruhig, sprach nicht viel. Die Wehen setzten kräftig ein, Dora gebar leicht, die Zwillinge schlüpften nur so heraus. Bentley tauchte den Erstgeborenen unter Bechers Protesten in das Becken mit der Tunke aus Lammgedärmen und Ochsenblut, darauf wickelte er ihn in ein zerknülltes Stück Stoff ein, das ihm Dora mit matter Hand reichte. Der Stoff entpuppte sich als schwarze Weste, die sich sogleich bis in die hinterste Faser rot verfärbte.
»Zwei Söhne. Gratuliere. Wie sollen sie heißen?«, fragte Becher, als er das zweite Baby hochhielt.
»Der Erste Nika, der Zweite Abel«, antwortete Dora Zweibach mit glücklichem Gesicht.
»Der hat einen leichten Buckel, sonderbar …«, bemerkte Becher und starrte fassungslos in die Augen des Winzlings.
»Das ist Nika«, sagte Dora unmissverständlich.
Ende Juli, als der Unmut über die Zweibach im Dorf gärte, kam Bodengrittli und sagte: »Es ist Zeit. Gehen wir.« Ein heftiges Gewitter ging nieder, der Rossbach schwoll gefährlich an, als Dora Zweibach mit ihren Zwillingen heimlich aus dem Tal flüchtete. In der Kantonshauptstadt klopften sie an die Tür von Becher, dem gute Verbindungen zu süditalienischen Kreisen nachgesagt wurden.
Der Arzt nahm Mutter und Zwillinge schon am nächsten Tag mit nach Palermo.
Nike und Abel
Abel, der um Sekunden jüngere Zwilling, war schwächlich, aber hübsch. Schon früh verließ er an der Hand einer kinderlosen Reiseleiterin Palermo, kam in der Schweiz in ein alpines Gymnasium und durch Adoption unter die elterliche Gewalt der in ihn vernarrten Tourismusfrau.
Nika dagegen wuchs wie ein Sizilianer kräftig heran, besuchte mit neunzehn Jahren die medizinische Fakultät der Universität Palermo und ging auf Anraten von Becher, der um dessen erstaunliche Talente wusste, zum Nachstudium nach Chicago, wo die Leute des Carmorina-Clans ihn am Flughafen erwarteten. Haifisch-Charly, der Pate des Clans, war Becher zu einigem Dank verpflichtet, seitdem der Dottore ihm vor Jahren nachts in der Waschküche seiner sizilianischen Küstenvilla acht Kugeln aus dem Bauch operiert und ihn vor dem sicheren Tod gerettet hatte.
Haifisch-Charly kontrollierte die meisten Schutzgeldgangs und damit die Finanzunterwelt von Chicago. Er nahm Nike wie seinen eigenen Sohn auf und staunte schon bald über die hellseherischen Fähigkeiten des Jungen.
Ohne Nike hätte Weihnachten 1960 die tödliche Falle zugeschnappt, als die Cipriano-Familie die Bosse der anderen Syndikate zu einem Friedensgespräch eingeladen hatte. Nike beharrte darauf, dass Carlo Carmorina statt seiner selbst eine Puppe mit seinem Gesicht in den Wagen setzte. Auf dem Weg zum Geheimtreffen gerieten alle drei Bosse prompt in den tödlichen Kugelhagel der Ciprianos. Maschinenpistolensalven zerfetzten die Haifisch-Charly-Puppe. Nike stieg darauf zum geachteten Consigliere auf.
Und am 20. November 1963 sagte er seinem Paten, der richtige Zeitpunkt für den geplanten Bankraub sei ein Uhr mittags am übernächsten Tag. Das sei unmöglich in der Innenstadt, in der geschäftigsten Zeit, warnte der narbengesichtige Comandante, aber Haifisch-Charly faszinierte die tollkühne Idee, es am helllichten Tag zu versuchen, umso mehr, als Nike die volle Verantwortung übernahm.
Am 22. November, um zwölf Uhr dreißig, traf in Dallas die Mörderkugel den Hinterkopf des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy. Um ein Uhr mittags war die Nation gelähmt, die Menschen hingen an den Radioapparaten und Fernsehern. In den Restaurants, auf den Polizeiposten, an den Bankschaltern – nichts bewegte sich mehr.
Carmorinas Überfall auf die First Third Union Bank glückte wie ein gemütlicher Sonntagsspaziergang am Ufer des Lake Michigan, und Haifisch-Charlys Leute hegten für Nikes visionäres Gespür eine Ehrfurcht wie sonst nur für die Jungfrau Maria.
Der Trick mit der Charly-Puppe hatte Nike dann auf die entscheidende Vision seines Lebens gebracht: für exponierte Personen perfekte Doppelgänger zu schaffen. Die Idee an sich war nicht neu, doch Nike schwebte eine totale Verdoppelung der Persönlichkeit vor: gleiches äußeres Erscheinungsbild, identische Charaktereigenschaften, übereinstimmende Schwächen und Neigungen.
An seinem dreißigsten Geburtstag und vor der Abreise nach Yale, wo Nike eine Professur für Mikrobiologie antrat, hatte er über zehn Millionen Dollar auf dem Bankkonto. Das meiste davon stammte aus Haifisch-Charlys Fischzügen.
In einem wissenschaftlichen Thesenpapier bezeichnete Nike seine Doppelgänger als Klone und löste damit ein Echo aus, als hätte er überraschend bewiesen, dass drei mal drei eine Neun ergibt. Es war die Zeit, als die Wissenschaftler von der Doppelhelix berauscht waren. Doch Haifisch-Charly vertraute ihm und kaufte die Aktien kleiner biotechnischer Unternehmen, mit denen Nike an veränderten Mikroorganismen forschte.
Nike hielt aber die Augen für Geschäftsgelegenheiten anderer Art offen. So kaufte er einem Turnschuhfabrikanten seine kränkelnde Firma ab, taufte sie auf Nike um, stellte ein Dutzend Schuhdesigner an und produzierte für die New York Yankees einen neuen Baseballschuh.
Nach einem Spiel, das die Yankees gegen die Pittsburgh Pirates knapp verloren, strandete Nike im Norden Manhattans mit einem platten Reifen auf dem Pannenstreifen des Major Degan Highway. Nike stieg aus und steckte abwartend die Hände in die Taschen seiner blutroten Weste. Ein weißes Cabriolet hielt an.
Warum er sich einmische, wollte Nike vom Fahrer wissen, der ihm Hilfe anbot.
Das sei üblich dort, wo er herkomme, antwortete der Mann, der sich grinsend als Coffee-Jack vorstellte. So wurde Hans Lombach gerufen, seit er in einer Tankstelle an der Westküste eine Cafeteria eingerichtet hatte und neben Cappuccino auch einen starken Kaffee mit Schnaps und Zucker als Swissmix verkaufte. Bald hatte er weitere Kaffeebars eröffnet und warb mit dem griffigen Slogan Your Buck is the Star. Den Amerikanern gefiel es, wenn der Dollar König war, und so strömten sie in Scharen in seine Kaffeebars.
Nike besuchte Coffee-Jack bei einem der nächsten Playoff-Spiele, fand den Kaffee, der ihn an seine goldene Zeit in Haifisch-Charlys Villa erinnerte, köstlich und bot ihm eine Partnerschaft unter dem Namen Buckstars an.
In den achtziger Jahren fegte eine Europäisierungswelle über die Städte Nordamerikas. 1982 stellte Coffee-Jack einen gewissen Hubert Scholtz an und schickte den dynamischen Manager über Zürich und Lugano nach Italien, wo der Amerikaner von der Popularität der Espressobars in Mailand hingerissen war. Er sah ein großes Potenzial, in Seattle eine ähnliche Kaffeebarkultur aufzubauen. 1984 eröffneten Lombach und Schultz im Zentrum eine italienische Cafeteria und boten Espresso an. Das Konzept war so erfolgreich, dass sie eine Gesellschaft gründeten und von Lombach-Nike-Partnership namens Buckstars die Kaffeebohnen kauften. Ein noch nie erlebtes, kräftiges Kaffeearoma strich den Yuppies, die sich an die Theken drängten, von nun an in ihre hochnäsigen Gesichter. Zwei Jahre später, es war 1987, verkaufte Nike das blühende Geschäft gegen Aktien der neuen Buckstars Corporation. Lombach alias Coffee-Jack zog sich von den operativen Funktionen zurück, verzichtete auf das Ehrenpräsidium, blieb aber mit einem Geheimvertrag Berater auf Lebenszeit. Buckstars hatte zu diesem Zeitpunkt siebzehn Geschäfte in Seattle, Vancouver und Chicago. 1992 brachten Lombach und Nike das Erfolgsmodell an die Börse und verdienten über Nacht dreihundert Millionen Dollar, während Buckstars die hundertfünfundsechzigste Kaffeebar eröffnete.
Der Tod von Dora Zweibach
1992 starb Dora Zweibach. Becher war an diesem verhängnisvollen 23. Mai in der Innenstadt von Palermo beschäftigt. Dora hatte ihn unterwegs noch angerufen. Später wusste der Dottore nicht mehr, ob sie ihm am Telefon sagte: »Bring Rosen mir« oder »Bring Dosenbier«. Jedenfalls kaufte er einen Arm voll Rosen, das konnte nie schief gehen, dann suchte er einen Laden, fand keinen Parkplatz und machte schließlich für einen Sechserpack Bier den dummen Umweg zum Supermarkt.
Währenddessen fuhr Dora Zweibach auf der Autobahn A 29 westlich von Palermo ahnungslos der Stadt entgegen, als in der Nähe von Capaci auf der anderen Fahrbahn eine gewaltige Sprengladung explodierte, den Dienstwagen von Giovanni Falcone zerfetzte und den Staatsanwalt, seine Frau und drei Detektive auf der Stelle tötete. Ein Splitter der furchtbaren Bombe traf Nikes Mutter am Hals, sie konnte eben noch ihr Auto anhalten. Doch Sanitäter, Polizei und Rettungskräfte rasten zum Wrack des Mafia-Jägers Falcone, und keiner bemerkte, dass Dora Zweibach nebenan auf dem Pannenstreifen an ihrer Verletzung verblutete.
Becher verfiel in eine Depression, da er glaubte, dass er den Unfall hätte verhindern können, wenn er nicht nach den ordinären Bierdosen gesucht, sondern den direkten Weg nach Hause genommen, Dora noch angetroffen und einige entscheidende Minuten aufgehalten hätte.
In Kalifornien unterbrach Nike die Schlussverhandlung mit den neun Anwälten von New Universal Pictures über die freundliche Übernahme der Filmstudios und flog in seinem Privatjet nach Palermo. Die Bestattungsfeier fand unter den golden schimmernden Mosaiken der Cappella Palatina im Normannenpalast Roger des Zweiten statt.
Becher wirkte gebrochen, die Ehrenwerte Gesellschaft sandte ihre Erste Delegation und der Syndikatchef entschuldigte sich bei Nike für das tragische Malheur mit einer Mehrheitsbeteiligung am Milchkonzern Parmalat. Nike schlug ein, setzte für den Dottore eine lebenslängliche Rente aus und flog ins sonnenüberflutete Los Angeles zurück, um den heißen Deal mit New Universal zu unterzeichnen.
Alle mochten Nike. Seine Verschlagenheit – er war schlau und durchtrieben – und seine bucklige Figur waren Legende. Und alle wunderten sich, dass er stets dieselbe rote Weste trug. Kugelsicher, wurde gemunkelt, Erbstück seiner Mutter, ein Talisman, rätselten andere. Hinter vorgehaltener Hand nannte man Nike seines Buckels wegen Beelzebub, und Nike, als er dahinterkam, nahm es ihnen nicht übel.
Mit dem Teufel war eben gut Kirschen essen. Nur eines blieb sonderbar: Über seine Weste redete er selbst nie. Sie war ihm auf den Leib geschnitten, angewachsen wie eine zweite Haut.
Hiobs Bestimmung
Weil er am traditionellen Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest als Schwingerkönig oben aufgeschwungen hatte, rangierte Hiob Ruchti in der Dorfhierarchie noch vor Gemeindepräsident Sturni. In der Achtung der Talschaft vermutlich auch noch vor dem Bundespräsidenten, der jeweils als Ehrengast die Schwingerei verfolgte und seinen ausländischen Staatsgästen die tiefe Verwurzelung des Landes im republikanischen Geist damit erklärte, dass das Volk dem Hang zu monarchischem Glanz einzig dann nachgebe, wenn es dem besten Schwinger des Landes den raren Titel eines Königs verleihe.