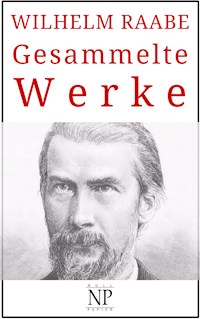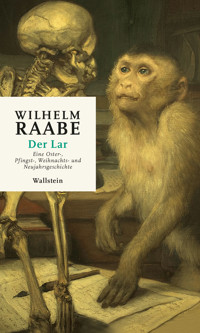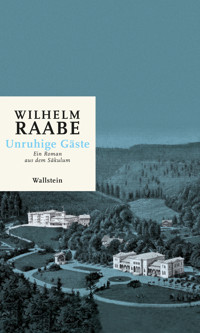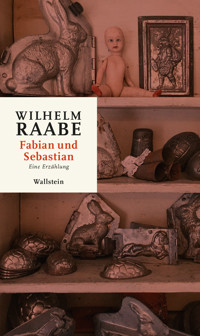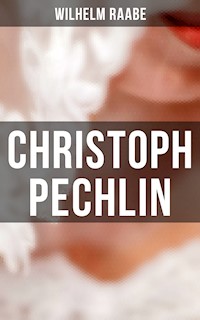
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wilhelm Raabes Werk 'Christoph Pechlin' entführt den Leser in die schaurige Welt des 17. Jahrhunderts, inmitten von Hexenjagden und Aberglauben. Das Buch folgt dem Protagonisten Christoph Pechlin, einem armen Schriftsteller, der gefangen ist zwischen den Wirren der Gesellschaft und seinen eigenen moralischen Konflikten. Raabe nutzt eine präzise und detailreiche Sprache, um die düstere Atmosphäre der Zeit einzufangen und die psychologischen Abgründe seiner Charaktere zu erforschen. Das Werk wird in die Kategorie des historischen Romans eingeordnet, aber zeigt auch klare Bezüge zur realen historischen und gesellschaftlichen Situation seiner Zeit. Wilhelm Raabe, ein deutscher Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, war bekannt für seine realistische Darstellung der gesellschaftlichen Verhältnisse seiner Zeit. Raabe selbst war ein Zeitzeuge der politischen und sozialen Umwälzungen des 19. Jahrhunderts und spiegelt diese Erfahrungen in seinen Werken wider. 'Christoph Pechlin' ist ein eindringliches Beispiel für Raabes kritischen Blick auf die Unrechtssysteme seiner Zeit und seine Fähigkeit, komplexe Charaktere zu schaffen, die mit moralischen Dilemmata konfrontiert sind. Für Leser, die an historischen Romanen mit tiefgründigen psychologischen Elementen interessiert sind, ist 'Christoph Pechlin' von Wilhelm Raabe ein absolutes Muss. Dieses Werk bietet nicht nur eine faszinierende Reise in die Vergangenheit, sondern regt auch zum Nachdenken über zeitlose Themen wie Moral, Schuld und Verantwortung an. Raabes Meisterwerk ist ein wahrer Schatz der deutschen Literatur, der es verdient hat, auch heute noch gelesen und geschätzt zu werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Christoph Pechlin
Inhaltsverzeichnis
Das erste Kapitel.
Der Mann, welcher sich der schweren und furchtbar verantwortungsvollen Aufgabe unterzieht, seinen Landsgenossen Geschichten zu erzählen und sich dabei nur fort und fort vor Augen hält, daß er auf die abgelegten Hemden eben dieser Landsgenossen schreibt, wird selten etwas ganz und gar Nichtsnutziges, das heißt etwas ganz und gar seinem Vorteil und irdischem Wohlbehagen, oder noch kürzer gesagt, etwas dem guten Einvernehmen mit seinen Nachbarn Schadenbringendes auf dem weißen unschuldigen Papiere ablagern. Ich, der Schreiber dieses Buches, halte das mir fort und fort vor Augen, und so habe ich die – feine Wäsche meiner lieben Freunde und Freundinnen im Publikum nach dem doch etwas unheimlichen Wege von ihrem Leibe durch den Sack des Lumpensammlers auf meinem Schreibtische immer nur mit dem empfindlichsten Zartgefühl in die nötigen neuen Falten gelegt. Ich kann mir das Zeugnis ausstellen, daß ich meine Aufgabe stets sehr behutsam angefaßt habe. Heute aber erzähle ich eine internationale Geschichte und gehe mit erhöhtem Bangen an das Werk. –
In einer Frühlingsnacht, die sicher ebenso dunkel war, als jene Oktobernacht, in welcher der berühmte Schüler von Alcala, Don Cleophas Leandro Perez Zambullo, verfolgt von den drei Spadassins, aus dem Dachfenster stieg, in das ihn der zudringliche Sohn der Göttin von Cythere hineingelockt hatte – erscholl aus einer hochgelegenen Stube, nicht in Madrid, sondern in der Hauptstadt des Schwabenlandes, ein Gelächter, wie kein Student von Alcala oder Salamanca es je herzerfrischender und kräftiger ausgestoßen hatte.
Es lachte da ein Student von Tübingen, und zwar ein Studiosus der Theologie, ein Stiftler – und zwar ein Ex-Stiftler, ein verunglückter Studiosus der Theologie, und daß dergleichen Leute vor allen übrigen Menschenkindern dann und wann zu einem recht herzhaften Lachen aufgelegt sind, das ist bekannt durch das ganze Schwabenland, so wie man auch im übrigen deutschen Reiche einige Kenntnis allmählich davon genommen hat.
Die Nacht war wie gesagt dunkel. Eine schlechte Lampe suchte vergeblich das Zimmer in ein besseres Licht zu stellen, und es war ein großes Glück, daß der Herr »Doktor« Christoph Pechlin, gebürtig aus Waldenbuch im Schönbuch, Sohn des weiland Stadtpfarrers daselbst N. Christian Pechlin, durchaus nicht das Bedürfnis fühlte, in ein besseres Licht gestellt zu werden. Seiner Meinung nach ging ein ungemein glänzendes Licht von ihm selber aus, und er befand sich ganz behaglich in der festen Überzeugung, jeglichen Schein, welchen irgendeine Umgebung auf ihn werfen konnte, überwältigend zurückzudrücken. Da es mehr Erdenbürger gibt, welche an solchen meteorologischen Illusionen ihr Behagen finden, so wollen wir ihn nicht darin stören, sondern es jenen überlassen, seine Leuchtkraft zu berechnen, das heißt, sie an der ihrigen zu messen.
Augenblicklich saß Pechle in Hemdsärmeln, westenlos neben einem Tische, der anderthalb Fuß hoch mit statistischen Büchern aus der königlichen Bibliothek, mit Lokalblättern der Stadt und sämtlicher Oberämter des Königreichs bedeckt, und mit jedwedem Material zur Fixierung eigener Gedanken nach Notdurft versehen war. Er hielt die Arme über der breiten Brust gekreuzt, blies aus einer mächtigen Burschenpfeife, die er mit dem linken Oberarme an dieselbe Brust brückte, mächtige Rauchwolken einem nächtlichen Besucher zu und lachte – lachte – lachte, daß der städtische Wächter drunten in der Gasse stehen blieb, betroffen in die Höhe blickte, den Kopf schüttelte, um zuletzt der Ansteckung naturgemäß zu unterliegen und gleichfalls lachend weiter zu wandeln.
Der nächtliche Besucher stand. Er war stehen geblieben, obgleich Herr Christoph Pechlin ihn bereits mehrere Male aufgefordert hatte, sich zu setzen. Der nächtliche Besucher trug einen eleganten Schlafrock, den eine rote Schnur um die schmächtige Mitte des Leibes zusammenhielt. Er trug eine fast noch elegantere Hausmütze, geziert mit einem goldenen Quast, und er hielt die Hände vor dem Unterleibe gefaltet und lachte durchaus nicht. Im Gegenteil schien er dem Weinen viel näher zu sein als dem Lachen, und hätte der städtische Wächter ihn gesehen, so würde ihm schon sein Amtseid nicht gestattet haben, jener obenerwähnten Ansteckung zu unterliegen. Eine Verantwortung vor dem Herrn Oberbürgermeister würde ihm sicherlich recht schwer geworden sein. –
Nachdem wir vernommen haben, daß der Lacher die tränenden Augen endlich abwischend gesagt hatte: »O Barönle, o Rippgen, Rippgen, du dauerst mich, aber – nimm es mir nicht übel – du erheiterscht mich sehr!« müssen wir vor allen Dingen jetzt mitteilen, was diesem nächtlichen Besuche des eleganten Schlafrockträgers bei dem burschikosen Ex-Stiftler Christoph Pechlin voranging, und was diesen Besuch bedingte.
Es war ungefähr acht Tage her, seit die Ereignisse eintraten, welche die gegenwärtige Stunde möglich machten, und die Wichtigkeit unserer Aufgabe erfordert die unerbittlichste Strenge gegen unsere Phantasie und unsern Enthusiasmus. Wir bezähmen unsern keuchenden, zitternden Eifer und erzählen ruhig und der Reihe nach.
Vor ungefähr acht Tagen, an einem schönen sonnigen Morgen lag Pechle – natürlich mit der Pfeife im Munde, im Fenster und sah an seinem Hause hinunter und in die Gasse hinab. Es war wenig in der Gasse zu sehen; aber der Doktor Pechlin sah doch aus dem Fenster, und nachdem er länger als eine Stunde aus dem Fenster gesehen hatte, erblickte er etwas, was seine Ausdauer im Gaffen vollständig belohnte.
Eine Droschke rasselte um die Ecke und hielt vor dem Hause. Auf dem Kutschbock nahm ein eleganter Reisekoffer den Platz neben dem Kutscher ein, und was den Wagen selber einnahm, das fing und fesselte sofort Pechlins sämtliche überschüssige Aufmerksamkeit, deren er freilich zu allen Zeiten im Überfluß hatte, und gab sie nicht eher wieder frei, als bis die Familie Rippgen aus Dresden ausgestiegen und das letzte Gepäckstück im Hause verschwunden war.
Wie aber stieg die Familie Rippgen aus Dresden aus?
Natürlich zuerst der Baron, ein schmächtiger, dünnbärtiger, hochblonder Herr mit etwas geröteten Augenlidern, einem an einem schwarzen Bande baumelnden Augenglase und in einem allermodernsten Frühlingskostüm von englischem Schnitt und Material. Sodann die gnädige Frau, eine schwarzlockige, sehr korpulente Dame, von imperatorischen Gesten und Mienen, die von Rechts wegen dem Gatten hätte behilflich sein müssen, den festen Boden zu gewinnen. Sie war das aber durchaus nicht, sondern stützte sich mit vollstem Gewicht auf die Schulter des Barons und drückte ihn nieder, als ob sie einen ausgewachsenen melancholischen Alraun in seine Vexierschachtel zurückdrücken wolle. Ja, Schachtel! – Schachteln und wieder Schachteln folgten dem Ehepaar, und zum Schluß sprang leichtfüßig, mit der letzten Schachtel im Arm, die Kammerjungfer der Frau Baronin aus dem Wagen, und Pechle oben in seiner olympischen Höhe sagte:
»Sein Wunder kann jeder Mensch erleben; aber was zu viel ist, das ist zu viel! Ei Herr Je–le, das Sechserle mit Familiche! Ha, das wird mer noch in die schpäteschte Tag a Wiederfinde nenne! O, komm du mir ‘rauf und begegne mir auf d’r Stiege! Herr mein Gott, da erlebt man doch endlich einmal wieder was in dieser lumpigen Welt! O Zeus, Vater der Götter, und du, Sohn der Nacht, Momus, da freu’ ich mich wirklich drauf, wenn ich dem zum ersten Mal auf der Treppe begegne. Der wird sich wundern!«
Und der Einzug der Familie Rippgen begann – mit Möbelwagen und Packträgern, mit Pianinos und Spiegeln in Barockrahmen, mit rotsammetnen Zimmergarnituren und seidenen Vorhängen, mit Stutzuhren und Wiener Regulatoren, sowie mit allem übrigen, was zu einem noblen Hausstand und Haushalt unbedingt nötig ist. Pechle aber leitete ihn von oben herab mit großem Vergnügen, hatte sein Wunder und seine gänzlich neidlose Lust an dem Luxus, der sich da unten entfaltete, und konsumierte zweitausend Stück Schwefelhölzer dabei. Es war aber nicht zum Verwundern, daß ihm die Pfeife sehr häufig während dieser großen Tage ausging: die Maultrommel während dieser Tage zu spielen war ganz unmöglich.
Die beiden – Christoph Pechlin aus Waldenbuch und Ferdinand, Freiherr von Rippgen aus Dresden hatten zusammen in Tübingen studiert. Der Schwabe, wie wir bereits wissen, Gottesgelahrtheit und die Maultrommel im Stift und der Sachse Jurisprudenz und die Flöte draußen im Saeculo. Und sie hatten ein eigen Wohlgefallen aneinander gefunden durch zwei Semester, bis der sächsische Baron am hellen Tage nach Leipzig ging, um daselbst seine Studien zu vollenden, und der schwäbische Pfarrerssohn nächtlicherweile aus dem Stift ausbrach und relegiert wurde, um sich auf der Stelle der schönen Literatur und der unschönen Publizistik in die verlorenen Pfarrerssöhnen und andern verlorenen Söhnen stets weitgeöffneten Arme zu werfen.
Geschrieben hatten sich die beiden guten Freunde nach ihrer Trennung nicht. Wahrscheinlicherweise hatte jeder von beiden während der seit dieser Trennung verflossenen Jahre täglich und stündlich auf einen Brief des andern geharrt, und nun fanden sie sich so wieder.
Das heißt, fürs erste fand nur Pechle seinen Baron wieder und sprach am zweiten Tage des Einzugs, melancholisch in seinem Fenster das Haupt schüttelnd:
»Der Bursche spielte sich in seinem kleinen Stil immer auf den Großartigen hinaus; aber dies ischt zu arg! Weiß Gott, dies ischt zu arg; – wenn in dem Lehnsiuhl ein Mensch nicht apoplektisch wird, so laß ich all meine physiologischen Erfahrungen im Bürgerhöfle öffentlich versteigern, Donner und Blitz, es soll mich nur wundern, wen er geheiratet hat, der arme Tropf! Na, na, hat der sich seine Suppen geschmälzt! Uih, o Sechserle, Sechserle, Sechserle!«
Es ist eine Art, die Dinge an sich herankommen zu lassen, welche man im Stift zu Tübingen in ausgebildeter Vollkommenheit erlernt. Pechle konnte warten, und er wartete und wiederholte noch Tage lang:
»O, komm du mir ‘rauf!« und spielte nachts schmelzend sein Leibinstrument, ohne außerdem der Erfüllung seines Wunsches den kleinsten Schritt entgegen zu tun. »Komm du mir ‘rauf!« sagte Pechle noch längere Zeit fort und fort, nachdem der neue Hausgenosse und frühere Kneipbruder schon manch liebes Mal heraufgekommen war, das heißt natürlich nur bis zur Tür seiner eigenen Wohnung im Hauptgeschoß des von den zwei Freunden bewohnten Hauses.
In dem Hauptgeschoß war längst an der Vorsaaltür neben dem Glockenzuge die elegante Metalltafel mit dem Namen:
Ferdinand, Baron von Rippgen
angenagelt worden, und Pechle hatte wohl zwanzigmal und zu jeder Stunde des Tages und der Nacht kopfschüttelnd die Inschrift gelesen, ehe er die Glocke zog. Endlich zog er sie einmal und zwar eine Stunde nach Mitternacht. Er zog sie mit einem diabolischen Ruck, und schlüpfte seltsamerweise eiligst und auf den Zehen die Treppe hinauf zu seiner eigenen Wohnung, ohne das Öffnen der Tür in der Beletage abzuwarten.
»Wir kommen uns so doch wenigstens allmählich näher,« sagte er grinsend in seiner Höhe, während er auf das da unten dem unmotivierten Schellengeläut folgende Rumoren und das Schimpfen und Belfern der sächsischen Kammerjungfer und der schwäbischen Hausmaid horchte.
Das war im April, wenn auch nicht am schalkhaften Ersten des Monats, und der Monat ging vorüber, ohne daß sich die beiden Freunde so nahe kamen, als wir es zuletzt doch wohl wünschen müssen. Nur, bei geöffnetem Fenster, ein eigentümliches, dumpfes, melodisches Summen in warmer Stille der Nächte kam dem Baron sonderbar bekannt vor, und er horchte jedesmal angestrengt darauf, sobald es über seinem Haupte anhub; allein das glückhafte Zusammentreffen war dem Wonnemond aufgehoben, und endlich – endlich fand es statt, und zwar an einem Nachmittage, als das Thermometer bereits achtundzwanzig Grad im Schatten zeigte, ganz eine Temperatur für ein liebend, wonnetrunkenes, freudig aufjauchzendes Aneinanderstürzen von Herz an Herz, von Busen an Busen! Die beiden Freunde begegneten einander einfach auf der Treppe des von ihnen seit einiger Zeit gemeinschaftlich bewohnten Hauses.
Der Schwab stieg schwitzend herab, der Sachs, aufgelöst durch den südlichen Frühling, keuchend herauf, und so trafen sie vor der Metalltafel aufeinander, starrten sich eine Weile an, um sodann ihre Verwunderung gegenseitig auszutauschen.
»Pechl–in! Pechle?!«
»Rippgen?! O Sechserle, bist du mir endlich doch heraufgekommen?!«
»Aber bist du es denn, Pechle?«
»Na, wer sollte es sonst sein? Und was würde es mir helfen, wenn ich mich aufs Leugnen legen würde? Alterle, ich bin’s, und da du es, beim Hymenaios und bei Aphrogeneia der Meerschaumgöttin, ebenfalls bist, so ersuche ich dich, mich sofort deiner Frau Gemahlin vorzustellen.«
Meiner Frau? Mein Gott, was weißt du denn von meiner Frau?«
»Nun, wenn man in Einem Hause wohnt –«
»In Einem Hause? Pechle?!«
»Jawohl, seit du eingezogen bist. Und weischt du, wir Schwabe sind eine neugierige Menschensorte. Ich gucke immer noch gern durch die Schlüssellöcher.«
»Pechle?! Ist es denn möglich? Warst du es denn, was mir während der letzten Nächte in alle meine Träume hineingesummt hat?«
»Ei freilich–natürlich, als Geischtererscheinung mit dem alten Geischterinstrument, und, Potz Blitz, nun laß uns hier auf der Stiege nicht Wurzel schlagen. Komm mit mir herauf auf meine Bude, oder nimm mich mit dir in deine Gemächer und präsentiere mich deiner Gattin!«
Der Freiherr sah mit verlegenem Lächeln und höchst nervös die Hände reibend auf den Studiengenossen.
»Mit gro–ßem Ver–gnü–gen – sogleich – willst du die Gü–te –haben – einzu–tre–ten. Aber, lieber Freund« – und er sah ihn kläglich genug an, und Christoph sah ihn an und sah an sich selber hinunter, packte plötzlich den Baron an beiden Schultern, schüttelte ihn derb und sprach:
»Na, ich sehe schon. Wir sehen uns wohl noch einmal! Behüt dich Gott, Bruder, und mach’s so gut als möglich.«
»Schönsten guten Morgen, bester Pechlin!« rief Ferdinand, krampfig dem Ex-Stiftler beide Hände schüttelnd, und so stieg für dieses Mal jeder weiter: der Baron hinein zu seiner Frau, der andere, mit hochgezogenen Augenbrauen und einem sehr lebendigen und vergnügten Muskelspiel um die Nasenflügel, die Treppe hinunter:
»Dir werd’ i aufschpiele!«
Das zweite Kapitel
Es war also Nacht, eine dunkle Nacht und die zweite Nacht nach jener ersten Begegnung der zwei Universitätsfreunde auf der Treppe. Am Morgen hatte Herr Christoph Pechlin durch die Stadtpost ein ganz verstohlen von dem Baron in den Briefkasten geworfenes Billett erhalten, folgenden Inhalts:
»Lieber Freund!
Miß Christabel Eddish wartet auf der Durchreise nach München seit gestern in Heidelberg auf ihre Busenfreundin, meine Lucia. Meine Lucia fährt heute mittag mit dem Schnellzuge nach Heidelberg zu Miß Christabel Eddish und nimmt natürlicherweise unsere – ihre Kammerjungfer Charlotte mit sich. Teuerer Pechlin, ich möchte mit Dir reden, ich muß mit Dir sprechen, ich bedarf eines Menschen, eines Freundes, dem ich an den Busen fallen kann. Sei mir dieser Freund und bleibe heute abend zu Hause! Unserer Katharine hoffe ich, ohne auffällig zu werden, entgehen zu können und werde gegen zehn Uhr – meine Gattin habe ich natürlich vorher erst bis Bruchsal zu geleiten – an Deine Tür pochen. Bleibe zu Hause, bester Christoph, in der Erinnerung früherer schöner und freierer Tage und Nächte. In aller Eile
Dein Ferdinand.«
Mit welchem Behagen Pechle dieses Billett dreimal übergelesen und mit welchem innigen Vergnügen er dem herzblutüberströmten Wunsche des Barons Folge gegeben hatte und zu Hause geblieben war, mag sich ein jeglicher selber ausmalen. Er blieb den ganzen Tag zu Hause, still sich freuend, wenn es wieder dunkel würde sein, und ließ sich seinen Bedarf an Getränken und sonstigen Lebensbedürfnissen auf die Stube holen. Ohne im geringsten ungeduldig zu werden, wartete er ruhig, friedlich und lächelnd ab, daß der schwäbische Heerbann die Kathrine aus ihrer Küche abhole, und er hatte wirklich bis gegen zehn Uhr zu warten. Um diese Zeit erschien endlich der Gefreite im ersten Infanterieregiment, Königin Olga – Eberhard Ruckgabele und entführte die holdanlächelnde Maid nach einem Tanzlokal an der neuen Weinsteige – fünf Minuten später klopfte Sachsen, oder vielmehr Meißen an die Tür Pechlins, und konnte derselbe nun endlich mit seiner tiefsten Bruststimme:
» Nur herein!« rufen.
Nie hatte sich Pechles Pforte leiser geöffnet und behutsamer geschlossen, als jetzt vor und hinter dem Freiherrn Ferdinand von Rippgen, königlich sächsischem Assessor außer Dienst aus Dresden. Nie, wenigstens seit langen Jahren nicht, war der Freiherr so kräftig an den Schultern gefaßt und unter solchem barbarischen Geschrei so derb abgeschüttelt worden, als jetzt durch den Ex-Stiftler Christoph Pechle aus dem Schönbuch. Wie gewöhnlich Dialekt und Büchersprache je nach dem Steigen und Fallen der Stimmung und Leidenschaft anmutig durcheinander spielen lassend, donnerte der schwäbische Freund:
»Hurra! Hie gut Württemberg alleweg! Zieh den Rock aus – den Schlafrock mein’ ich. Willscht du eine Pfeife, oder hascht du dir eine Zigarre mitgebracht! Du dankst? Weshalb dankst du? Da, setze dich, Alterle; ich freue mich unmenschlich, dich wieder zu sehen. Sechserle, du jammerst mich; offen gesagt, je länger ich dich nun auch in der Nähe begutachte, desto mehr tust du mir leid; weißt du, und ich bin immer ein guter Mensch gewesen, und es zuckt mir in allen zehn Fingern, dich auch wieder zu einem Menschen zu machen.«
»Ei ja, du bist ja noch immer so grob wie in Tübingen. Du hast dich wenig verändert in den Jahren unserer Trennung; aber jetzt bitte ich dich inständig, laß mich ein wenig zu Atem kommen. Lieber Pechlin, man hat zu steigen, um zu dir hinauf, zu gelangen!«
»Hat man, du Schmeichler? Aber du hast recht, Rippgen, es ist immer mein Bestreben gewesen, mich auf den Höhen des Daseins zu erhalten, und bis jetzt ist das mir so ziemlich gelungen. Willst du dich wirklich nicht setzen?«
»Doch, doch! Nachher, wenn du es erlaubst. Jetzt laß mich noch ein wenig vor dir stehen und dich so betrachten.«
»Nach Belieben. Stelle dir nur recht lebhaft vor, du seiest nach Loschwitz in die Baumblüte gezogen, und Sachsens schönster Kirschenbaum schüttle seine lieblichste Frühlingspracht auf dich hernieder!« sprach Pechle trocken, sah aber seinen nächtlich-verstohlenen Besucher ebenfalls von neuem an und brach in jenes langhallende, unerschöpfliche, donnerartige Gelächter aus, mit welchem wir unser erstes Kapitel und also seine, Christoph Pechlins, Geschichte eröffneten. Das Waschen der schmutzigen Wäsche nahm dann auch sofort seinen Anfang; denn nachdem der Schwabe endlich doch ausgelacht hatte, setzte sich der Sachse, das heißt, er fiel dem Freunde gegenüber auf einen Stuhl und seufzte aus tiefster, gepreßtester Brust: »Pechlin, ich bin nicht glücklich!«
Pechlin, ich bin nicht glücklich, hatte der Baron gesagt, und Pechle zeigte jetzt, daß er in der Tat ein guter Mensch war. Statt dem Freunde von neuem hell in das Gesicht hineinzulachen, stieß er oberhalb des Tisches nur einen dumpfen Seufzer aus, bückte sich schnell unter den Tisch, ließ während mehrerer Sekunden ein mit allen Kräften unterdrücktes, unheimlich heiteres Gurgeln und Schnaufen vernehmen, tastete dabei in einem Handkorbe, fuhr hochrot wieder empor und stellte mit Nachdruck einige Flaschen und zwei Gläser zwischen sich und dem lebensmüden Hausgenossen auf den Tisch.
»Da! … Also du bischt nicht glücklich?«
Der Baron schüttelte trübselig den Kopf, und Pechle, die erste seiner Flaschen bedachtsam entkorkend, fuhr fort:
»So wirst du mir in dieser Nacht deine Geschichte erzählen. Sieh, dort in jenem Tischkasten liegt meine Übersetzung des Platon; – nur gute, das Vertrauen ihrer Mitbürger verdienende Menschen übersetzen den Platon, und du weißt doch noch, daß ich schon in Tübingen anfing, mich daran zu machen! – und nun rücke heran und probiere diesen hier, es ist ein recht angenehmer und leichter Weinsberger, von der gütigen Vorsehung eigens für deine Zustände erzeugt. Da – und jetzt schütte deine Lebensqual aus in meinen Busen! Es wird dich erleichtern; – Kindle hast du ja wohl nicht?«
Der Gast schüttelte wiederum mit dem Kopfe, und der Freund rückte ihm näher, stieß ihm mit biederer Vertraulichkeit den Ellenbogen in die Seite und flüsterte:
»Gut! Ich habe dergleichen Impedimenta auch nicht unter deinem neulich ins Haus geschafften Hausrat bemerkt, und das ist mir augenblicklich ganz lieb, denn da brauchen wir keine Rücksichten auf sie zu nehmen. Auf das Wohl deiner Frau wollen wir erst nach angehörter Relation deines Lebenslaufes anstoßen. Nun heiter heraus damit; was hast du mit dir angefangen?«
Der Freiherr Ferdinand von Rippgen, welcher nächtlicherweile und ohne das Vorwissen seiner Gattin die Treppe hinaufgeschlichen war, um seine Geschichte von seiner Seele an die fühlende Seele eines andern loszuwerden, konnte nach solchem freundlichen Entgegenkommen und unter diesen dringenden Aufforderungen des anderen wahrlich nicht umhin, seine Geschichte zu erzählen. Er erzählte sie, und es kam eine ganz alte Historie heraus, die kaum des Erzählens wert war.
Ferdinand von Rippgen hatte seine Studien auf der Universität Leipzig vollendet, war nach Hause gekommen und hatte seine Examina, wie sich das nicht anders erwarten ließ, mit höchstem Lobe bestanden. Man hatte ihn angestellt im Staatsdienst, und er hatte dem Staat gedient. Anfangs ohne Gehalt, sodann für einen unzureichenden. In Loschwitz besaß H.K. Flathe, der große zurückgezogene Seidenhändler sein Landhaus, und in Loschwitz lernte Ferdinand, der daselbst im Sommer 186– eine Milchkur gebrauchen mußte, die einzige Tochter des großen Seidenhändlers, Fräulein Lucie Flathe kennen und wurde auf der Stelle von ihr sowohl als Baron wie als Mensch richtig taxiert.
Wie nennt man doch gleich einen Menschen, der das Glück, welches ihm vor die Füße fällt, nicht aufzunehmen versieht? Ach, geben wir uns keine Mühe: Ferdinand ergriff sein Glück mit beiden Händen. Ein Jahr nach dem Tode ihres Vaters versprach Lucie dem Assessor, nur ihm allein angehören zu wollen, und ein halbes Jahr nach der Hochzeit war der Freiherr ein Assessor außer Dienst, das heißt, er hatte den Staatsdienst quittiert, um seiner Frau ganz allein anzugehören, das heißt, um sich gänzlich dem Dienste des Weibes widmen zu können. Lucie hatte die Sklaverei des Staates für unelegant und unerträglich erklärt, und der König Johann, der jedenfalls aus seinen Dante-Studien wußte, was es bedeute, eine fiera moglie im Hause zu haben, hatte den Baron auf sein Gesuch in Gnaden entlassen. Den Amtstitel ließ Seine Majestät dem armen guten Menschen, und darauf, sowie auf seinen Titel als Freiherr und das Vermögen seiner Frau war Ferdinand von jetzt an allein angewiesen, Lucie war drei Jahre älter als ihr Gatte, und das junge Paar reiste, wahrscheinlicherweise, um sich auf der Reise gegenseitig genauer kennen zu lernen und sich inniger ineinander hineinzuleben. Das Resultat war natürlich den Voraussetzungen entsprechend: der Baron lernte seine Gattin fast unheimlich genau kennen und sie ihn. Lucia von Rippgen besaß ein bedeutendes Vermögen, Ferdinand befaß nichts als seinen Namen und seine Manneswürde, und die letztere verbrauchte sich mit erschreckender Raschheit der stattlichen, imperatorischen Gattin gegenüber. Nachdem die Baronin sich in Rom, Neapel und Paris im Verlauf zweier Jahre recht Wohl befunden und ganz angenehm unterhalten hatte, führte sie ihren melancholischen Freiherrn nach Deutschland zurück. Sie hatte sich des untern Teiles seiner Garderobe geradeso bemächtigt, wie vorher seines Herzens. Wenn andere Huldinnen leise, unmerklich, – wie es der Zartheit des Weibes angemessen sein soll und wie es nach der Meinung nicht weniger Leute alles Glück, allen Frieden und alle Seligkeit des Erdenlebens bedingt, – sich einschleichen, einschmeicheln, so drängte sie sich resolut in alles ein, was sein eigenstes Dasein ausmachte und verdrängte ihn vollständig daraus. Sie wußte es besser, was das Glück, den Frieden und die Seligkeit des irdischen Lebens ausmacht; heiter lächelte sie der konventionellen Lüge über den Beruf der Damen ins Gesicht und ließ sich nieder. Breit setzte sie sich hin und sagte: »Ferdinand, ich bin du, und du bist der beneidenswerteste und undankbarste Sterbliche, den je eine schöne und verständige Frauenseele beglückt hat. Ferdinand, du bist in deinem Egoismus mein täglicher herzzerreißender Gram und wirst mein Tod sein und wirst erst auf meinem Grabhügel erkennen, was du an mir gehabt und verloren hast.«
Daß sie dabei von Tag zu Tag wohlbeleibter, oder roh ausgedrückt, dicker wurde, und daß Ferdinand in einem wahrhaft tragikomisch genauen Verhältnis abmagerte und immer hohlwangiger, dünnstimmiger und spindelbeiniger sich in die ihm angewiesenen Winkel drückte, kam dabei nicht in Betracht und braucht auch von uns nicht in Betrachtung gezogen zu werden.
Wir wollen uns aber unsere behagliche Stimmung und unsere, uns von unsern Vorfahren treulich überlieferte konventionelle Weltanschauung auch nicht verderben lassen. Einfach und historisch stellen wir das Faktum unserem Publikum vor das Auge und vertrauen auf seinen unbefangenen Blick.
»Wir bewohnten nach unserer Rücklehr von der großen Reise noch anderthalb Jahre lang unser Landhaus im Schweizerstil an der Elbe,« erzählte der Baron, das Taschentuch an die Stirn drückend, weiter. »Wer unter unseren Fenstern durchzog und den Blick zu unserer Besitzung emporhob, rief gewißlich: ›O, Himmel, welche Idylle!‹« Aber das war es gar nicht. Unser Verkehr war der nobelste, und Miß Christabel Eddish war längere Zeit unser lieber Gast. Wir trieben Englisch mit Miß Christabel, denn wir sind überhaupt sehr literarisch und ästhetisch gebildet, und sobald die Bedingungen gegeben sind, und die nötige Bequemlichkeit nicht mangelt, stimmt uns die Welt in allen ihren Farben und Tönen höchst romantisch. Aber die Bedingungen müssen vorhanden sein, und als wir eines Morgens erfuhren, daß meines seligen Schwiegervaters reicherer Nachbar, der berühmte Schneidermeister Joachim Hellsitzer, das an unser Besitztum grenzende Grundstück gekauft habe und auf demselbigen freundnachbarschaftlichst ebenfalls eine Villa bauen werde, sanken wir sofort aus unserer romantischen Höhe in den trivialsten Verdruß des Alltags hinunter. Leider war noch dazu der Nachbar Hellsitzer ein Mann von unstreitbarer Tatkraft, und er führte seinen Plan mit wahrhaft wunderbarer Rapidität ans. Ehe wir es für möglich gehalten hatten, wuchsen seine Gerüste empor und versperrten uns die Aussicht auf die Sächsische Schweiz und die böhmischen Berge. Hellsitzersruhe nahm mir die meinige vollständig. Die Villa Asola stellte die Villa Coconia ganz und gar in den Schatten, und je höher und prachtvoller ihr Gemäuer im rein gotischen Stil sich auftürmte, desto unerträglicher wurde meiner Lucie der Aufenthalt ln unserem bescheiden idyllischen Chalet. Nicht nur daß uns der entsetzliche Schneider durch seine gotische Burg die Aussicht auf die böhmischen Berge verbaute, er verbaute uns auch ethisch die Aussicht, indem er uns den letzten Rest unseres Glaubens an das Schicklichkeitsgefühl des Plebejertums im Busen vernichtete. Es war unerträglich, lieber Pechlin, und das Weib und die Töchter des kleiderkünstlerischen Raubritters taten das Ihrige und spickten die Mauern, welche er uns vor die Nase setzte, höhnisch und schadenfroh mit den spitzesten Nägeln und den schärfsten Glasscherben: sie grüßten nämlich meine Gattin über diese Mauern und sie wagten es sogar, Miß Christabel Eddish über diese Mauern zu grüßen. Noch eine Sommersaison hindurch versuchten wir es, statt nach der Sächsischen Schweiz hinüber, nur in uns hineinzusehen und uns, jenem reichgewordenen rohen Pöbel gegenüber, durch den Hinblick auf unsern eingeborenen, unveräußerlichen, unveränderlichen Wert zu stärken und aufrecht zu erhalten; aber es ging nicht. Im Herbste des vorigen Jahres hat meine Frau das Chalet an einen opulenten, zu feist und zu unbeholfen gewordenen Professor der Prestidigitatrie und höhern Magie verkauft, und wir haben in Genf in einer Pension ein halbes Jahr unbehaglich gelebt. Im letzten Winter waren wir in Brüssel, wo Miß Christabel wieder zu uns stieß, ehe sie in Familienangelegenheiten von Morges nach London ging. Jetzt sind wir hier und werden jedenfalls den Winter über hier verweilen, doch kommt es auch, was das anbetrifft, wiederum sehr darauf an, was Miß Christabel Eddish, die augenblicklich nach Florenz geht, darüber beschließen wird. O, Pechlin, o, Pechle, Pechle, wie fangen wir es an, daß du Miß Christabel kennen lernst, und daß meine Lucia dich ohne Widerwillen bei sich empfängt?!«
»Daß mich deine Lucia ohne Widerwillen bei sich empfängt?!« wiederholte Pechle und fügte hinzu: »Na, na, Rippgen, daß ihr Sachsen höchst gemütliche Leute seid, das weiß die Welt; aber weißt du denn wohl, daß du soeben doch ein wenig zu gemütlich wirst? Ferdinand, auch wir Schwaben sind ein äußerst gemütlicher Menschenschlag und können im gegebenen Fall überraschend ungemütlich werden.«
»Ich weiß alles, liebster, bester Freund. Du wirst doch in diesen seelenlösenden Momenten nicht ein Wort auf die Wagschale legen? Christoph, ich weiß, daß du mich erkennst, mich bemitleidest, mich auslachst und mir deinen Rat und Trost nicht vorenthalten wirst. Ich habe die Überzeugung, daß du dich meiner Frau vorstellen lassen und dich ihr von deiner besten Seite zeigen und zeigen lassen wirst. O, und Miß Christabel mußt du – mußt du ebenfalls kennen lernen!«
»Natürlich, alter Kerle; ich werde mit ungemeinem Vergnügen mein Möglichstes tun, auf den Zehen in deinem Gynäceum aufzutreten. Da, feuchte dir noch einmal die Kehle an, du hast lange genug gesprochen. Weibertreue heißt die Etikett und i wiedherhole dir, es ischt ein ziemlich reingehaltener, recht angenehmer Weinsberger;–das nämliche Gewächs, bei welchem der alte Justinus Kerner seine Gespenster sah. Sechserle, ich sehe zum erstenmal seit unserm Zusammentreffen wieder Geischt in deinem Auge. Weißt du, der Triarier Ruckgabele hat nicht nur deine Köchin Katharine, sondern auch deinen Hausschlüssel im Besitz und Genuß; aber ich habe den meinigen und wir gehn jetzt noch auf einen Schoppen aus dem Hause. Hoffentlich verspürst auch du ein gewisses Bedürfnis, von meinem Leben seit unsern holden Tübinger Jugendtagen zu erfahren; aber das paßt mir hier in der Einsamkeit nicht so recht, wir reden davon am besten in größerer Gesellschaft –«
»O, Pechle! Wie kann –«
»Sei mir still, du kannscht!! Ich weiß, was dir gut tut, und für diese Nacht gehörst du mir mit Haut und Haar, du unglückliches, verlassenes Waisenbüble. Daß die Kathrin nicht ausschwatzt, das laß meine Sorge sein. Gelt du, Alterle, du hast doch den Schlüssel zu deinem Kleiderschrank?«
»Ei ja, Pechle! … Pechle, ja, ich gehe mit dir. Wenn du die Güte haben willst, mit mir in meine Wohnung herunterzugehen, werde ich Toilette machen. O lieber, guter Pechlin, mir ist recht wunderlich zumute!«
»Ei Herrcheses, ja! Herrgottssakrament, jawohl, das glaube ich dir. An deiner Stelle würde mir vielleicht auch ein wenig sonderbar zumute sein,« sprach Pechle.
Das dritte Kapitel.
Pünktlich am Morgen schon war Miß Christabel Eddish mit einem Straßburger Zuge in Heidelberg eingetroffen; ohne alle Fährlichkeiten hatte dann auch Lucie von Rippgen die heitere Stadt am blauen Neckar erreicht und das zärtlichste Wiedersehen hatte stattgefunden. Dasselbe Hotel nahm natürlich die beiden Freundinnen auf; nach überwundenen Tränen und Küssen speisten sie zusammen auf dem Zimmer, und am Spätnachmittag unternahmen sie, begleitet von ihren Kammerjungfern, Charlotte und Virginy, einen Spazierritt zu Esel auf das Schloß, um daselbst den Kaffee einzunehmen.
Außer dem Kaffee genossen sie auf dem Schlosse auch noch den Sonnenuntergang und blickten still und verklärt in die Holdseligkeit der Natur hinein, bis die letztere ihnen zu kühl wurde. Trunken von Freundschaft und Naturgenuß ritten sie auf ihren Eseln wieder bergab, allen ihnen begegnenden lustigen Studenten gleichfalls ein Naturgenuß. Daß Miß Virginys Reittier gerade an der Ecke des Karlsplatzes bockte und die lautaufkreischende Reiterin sanft über Bug, Hals und Kopf zur Erde gleiten ließ, wurde von den beiden Herrinnen ohne alle Aufregung erlebt und von Christabel nur als ein bemerkenswertes Intermezzo für das Tagebuch notiert:
Virginy cast off by the donkey – shocking accident; – dreadful conduct of the Heidelberghian mob – shrieking and screaming – Lucy’s sublime and unaffected behaviour – went on to the hotel and supped.Sublimity of mind – true greatness of soul etc. Das heißt, die beiden Damen ließen ihre beiden Jungfern selber dafür sorgen, wie sie sich am besten der fröhlichen Schaulust und zudringlichen Hülfsleistung der Jugend und der Bummlerschaft des Karlsplatzes entzogen. Lucie und Christabel entzogen sich vermittelst einer Droschke denselben.
Sie speisten zu Abend, und sie saßen bis spät in die Nacht hinein im lieblichen Wechselgespräch; ach, und die Baronin hatte nicht die geringste Ahnung davon, welch einem Dämon sie währenddem freie Hand gegeben hatte, welch eine behaarte Tatze sich krallend auf ihr häusliches Glück legte – kurz, wie der Baron diese holden Stunden ausnutzte. Wem er sein häusliches Glück mit den buntesten Farben ausmalte und in wessen Gesellschaft er dolose die Nacht verbrachte.
Mit welchem Schrei würde Lucia aufgefahren sein, wenn ihr ein anderer Dämon ein Wort davon ins Ohr geflüstert hätte! Was würde Miß Christabel Eddish gesagt haben, wenn jemand sie jetzt schon auf die Konsequenzen dieser Nacht aufmerksam gemacht hätte. O, bekümmern wir uns nicht darum, genießen wir fröhlich die heitere Gegenwart: die Zukunft wird schon ganz von selber an uns herankommen! –
Freundschaft, Naturgenuß und europäische Modenkritik waren abgetan, mit leise anplätschernder Flut spielte und spülte das Gespräch an den Charakter Ferdinands von Rippgen heran und – zu Ende war das reizende Spiel und Getändel durchsichtiger Wellen. Lautbrandend schlugen die Wogen empor, Schaumkronen auf den gewölbten Rücken tragend, Schlamm und Sand führend, keinen Widerstand – sowie auch keine Widerlegung duldend in ihrer Energie. Wenn der Baron von Rippgen wirklich aus Granit bestanden hätte, würde das Tosen der Brandung der natürlichste Naturlaut des Universums gewesen sein. Beide Damen waren vollständig einig über den Charakter und die Lebensführung des Barons; und die Art und Weise, wie ein solches Wesen von der bessern Hälfte des menschlichen Geschlechtes zu behandeln sei, unterlag ihnen auch nicht dem mindesten Zweifel. Strenge, unbeugsame aber lächelnde Strenge war nötig, um diesen Freiherrn auf dem richtigen Wege zu erhalten, und die Baronin war sich bewußt, daß sie es immer an solcher hatte fehlen lassen; – Miß Christabel Eddish schien sogar ein kleines Übergewicht des Lebensballastes nach der Seite der Grausamkeit hin nicht zu mißbilligen.
Da aber die reizenden Gestade der schönen Elbe kaum von dem Charakter Ferdinands zu trennen waren, so gerieten die zwei Freundinnen an dieselben und kamen sachgemäß in heftigster, schärfster und bitterster Weise auf die Villa Hellsitzer zu reden. Wie es möglich gewesen sei, daß ein wirklicher Ritter, Baron und Mann das Aufwachsen dieser lächerlichen Raubburg vor ihren – der beiden Damm Augen habe dulden können, war ihnen noch immer unbegreiflich, und jedes Wort, das sie zur Lösung des Rätsels gaben, machte ihnen das Faktum noch unbegreiflicher. Das Gute allein hatte das neue Gesprächsthema, daß es beide in einbohrendster Weise auf den Freiherrn zurückbrachte; Miß Christabel Eddish versprach, von der Aufregung der Busenfreundin hingerissen, im Anfang des Monats Oktober ihren Aufenthalt am Nesenbache zu nehmen, und, wie an der Elbe, mit allen ihren Kräften dem unglücklichen Weibe des Freiherrn von Rippgen gegen eben diesen Freiherrn beizustehen. Leider schwor in dem nämlichen Moment am Nesenbach Herr Christoph Pechlin dasselbe oder doch etwas ganz Ähnliches seinem Freunde Ferdinand von Rippgen, und zwar nicht im vertrauten, herzlösend-innigen Verkehr von Herz zu Herz, von Auge zu Auge, sondern in einer überfüllten, grenzenlos gemeinen Bierwirtschaft, und an einem Tische, an welchem nur zu viele gänzlich herzlose Gesellen saßen, die den Schwur sämtlich vernahmen und späterhin bezeugen konnten.
Um diese Zeit der Nacht war Pechle fast ebenso gerührt und bewegt, wie Miß Christabel Eddish!
Er hatte sein Wort gehalten, und dem Universitätsfreunde seinerseits seine Lebensgeschichte vorgetragen. Von außergewöhnlicher Bedeutung kam nichts darin vor, und wir können leicht darüber hinweggleiten. Wie es mit der Übersetzung der Werke Platos stand, blieb dunkel. Vollständig klar ist nur, daß der ehemalige Stiftler als Journalist und Berichterstatter für zwanzig bis dreißig schwäbische Lokalblätter von Heilbronn über Ulm bis Friedrichshafen sich ziemlich ehrlich und gottesfürchtig-demokratisch ernährte, und daß er mit seinem Lose nicht unzufrieden war. Ferdinand von Rippgen hatte während der Erzählung wohl mehrere Male das Haupt geschüttelt; jedoch stets nur seiner selbst und nicht ein einziges Mal des Jugendgenossen wegen.
Aber jetzt fing Pechle aus Waldenbuch an zu predigen, und das ist immer ein bedenkliches Zeichen bei einem verdorbenen Pfarrer, dessen Vater sich schon einen Bruch redete. Doch ehe das Phänomen sich zu seiner ganzen Wirkung entwickelt hatte, erhob sich am oberen Rande des Tisches ein nicht nur sehr anständig, sondern auch sehr gescheit aussehender Mensch, beugte sich, auf beide Hände sich stützend, vor und sprach im reinsten Frankfurter Deutsch:
»Nu heret, jetzt hab ich’s aber satt, euch Ochse inkognito gegeiwwer zu sitze; – ‘s kommt euch was, ihr Herre!«
Und beide Freunde starrten den unhöflich-freundlichen Fremdling an, starrten und fanden bald in ihrer Erinnerung, was sie mit Aufbietung aller Kräfte so schnell als möglich zu finden suchten.
»Schmolke!« riefen sie wie aus einem Munde, und der Fremdling lächelte und nickte holdselig und bestätigend über den Rand seines Kruges: er war es, ohne sich seines Daseins zu schämen, Dr. Leopold Schmolke – nicht etwa der fromme Verfasser von Schmolkes Morgen-und Abendandachten, sondern Dr. Leopold Schmolke aus Frankfurt am Main, ein Advokat und gleichfalls früherer Tübinger Studiosus, und gerade nicht frommer, als die damalige Verfassung seiner Vaterstadt unbedingt verlangte. –
»Ja, Schmolke!« krächzte Schmolke. »Schmolke, der euch seit einer Stunde mit Erstaunen zuhört, eure Naivetät bewundert, und sich merkwürdig freut, euch so gesund, vergnügt, heiter und abgeschmackt-sentimental wiederzusehen. Sie, Herr Kanzleirat, tu’ Se merr den Gefalle und rücke Se um a Stuhl weiter; wisse Se, Herr Rat, daß Se merr lieb sind, wisse Se; aber was hier augenblicklich vorgeht, das nennt ma bei uns in Frankfort a rihrendes Wiederfinde, und davon verstehe Se gar nichts, Herr Rat. Also bitte, Kanzleirätle, rücke Se zu, und lasse Se mich an die beide Herre da driwwe ran, – wolle Se?!«
»Mit Vergnige, Herr Doktor!« brummte der Kanzleirat, fügte jedoch hinzu: »Des muß i sage; wenn wir ei’mal grob sind, so mache wir des doch mit mehr Manier ab, als diese Ausländer! Rebublikanische Einfachheit nennt man das – wahrscheinlich.«
»Steigt Ihnen was, Herr Kanzleirat,« sprach der Doktor Schmolke im untadelhaften Hochdeutsch, »bitte, kommen Sie nur endlich einmal, wie Sie mir so häufig versprochen haben, nach Frankfurt. Sie sollen überzeugt werden, daß wir es auch nicht übelnehmen, wenn Sie uns an unseren berechtigten Eigentümlichkeiten kitzeln.«
Halb lachend, halb ärgerlich machte der alte würdige Herr dem Advokaten Platz, und es fand nunmehr in der Tat das statt, was das Frankforter Bergerskind vorhin »a rihrend Wiederfinde« nannte. Tränen flossen zwar nicht dabei, aber sie traten dem Mann ans dem Stifte doch in die Augen, und der Freiherr gebärdete sich sehr aufgeregt. Als jedoch die nötigen Äußerlichkeiten abgetan waren, und ein jeglicher dem andern die Hand geschüttelt und ihn auf den Rücken geklopft hatte, sagte Schmolke aus Frankfurt:
»Leute, ich wiederhole es, ich habe euch eben mit Vergnügen zugehört. Daß der Pechle ein armer Sünder vor dem Herrn ist, und dann und wann le vin tendre hat, das hab’ ich längst gewußt; aber daß der Rippgen da es durchaus nicht lassen konnte, ein Mädchen glücklich machen mußte, und jetzt von seiner Göttin nach Gebühr in guter Zucht und Ordnung gehalten wird, das war mir neu, und erlaube ich mir, bestens zu aller Süßigkeit des Zustandes zu gratulieren. Nun aber sagt, ihr Herren, wer von euch beiden erwähnte vorhin die Existenz und den Namen von Miß Christabel Eddish?«
Der Baron und sein Hausgenoß sahen sich einen Augenblick in die Augen, um sich darauf beide die Stirnen zu reiben. Dann sagte der Baron:
»Ich glaube, Schmolke, wir haben den Namen wohl alle beide an diesem Abend einige Male ausgesprochen –«
»Und mit eigentümlicher Betonung,« warf der Frankfurter Advokat ein.
»Ei Je ja, jawohl!« seufzte der Freiherr, und Pechle klopfte von neuem dem Doktor Schmolke zwischen die Schulterblätter und sprach treuherzig aufklärend:
»Sieschst du. Schmolke, die beiden Weiber sitzen in diesem feierlichen Moment zu Heidelberg in Schrieders Hotel – wahrscheinlich. Also und deshalb hab i das Lamm hier, das Sechserle, heut abend aus der Dornhecke herausgewickelt und hab’s in die frische Luft und in diese anständige Gesellschaft geführt, Schmolke. Daß wir dich auch in diesem Lokale treffen würden, das konnten wir freilich nicht wissen.«
»Ich muß auch sogleich fort. Ich hab’ noch einen Termin morgen um eilf Uhr auf dem Römer; aber es war sehr nett, – wahrhaftig recht nett von euch, mir hier in die Arme zu fallen. Daß aber die Tugend immer ihren Lohn findet, das will ich dir jetzt beweisen, Rippgen. Höre, Ferdinand, wenn es einmal gar nicht anders gehen will, so besuche mich vertrauensvoll auf meinem Bureau in Frankfurt. Deine Hausfreundin, die Miß – Miß Christabel – Miß Christabel Eddish hat’ ich nämlich auch in meinen Akten, und wenn du abends kommst, findest du mich auch stets. Jedoch leichter nach vorausgegangener Konferenz mit meiner Haushälterin. Und wenn der Pechle da mit dir kommt, so wird’s mir stets sehr angenehm sein, und nun – Herr Kanzleirat, reiche Se merr doch gefälligst noch emal Ihre Dose riwwer.«