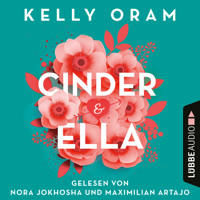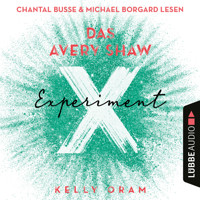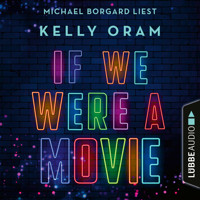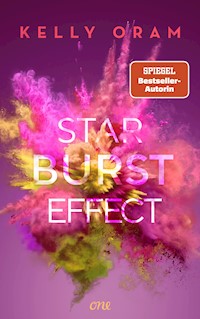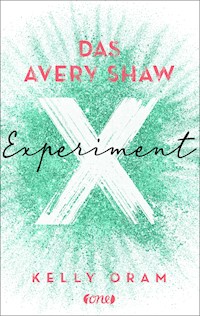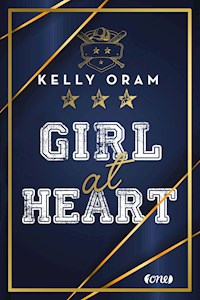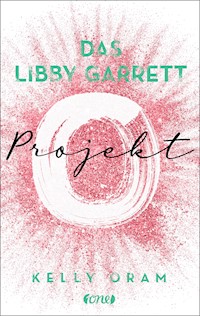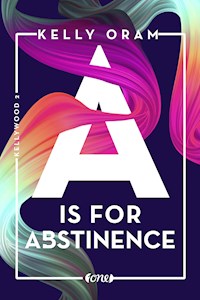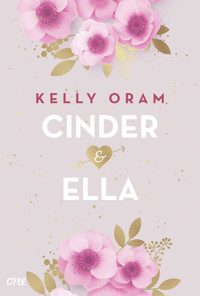
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ONE
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Cinder & Ella
- Sprache: Deutsch
Vorhang auf für einen der größten Selfpublisher-Erfolge aus den USA! Kelly Oram ist mit "Cinder und Ella" der Durchbruch gelungen. Millionenfach wurde ihr Roman geklickt, über 50.000 gedruckte Bücher hat sie verkauft. Sagenhafte 2.200 Kundenrezensionen auf Amazon mit durchschnittlich 4,8 Sternen spiegeln diesen Erfolg wider. Und nun endlich erscheint die deutsche Ausgabe bei ONE.
Ella hat ein hartes Jahr hinter sich. Ihre Mutter starb bei einem Autounfall, den sie selbst nur knapp überlebte. Nach etlichen Klinikaufenthalten zieht sie nun zu ihrem Vater und dessen neuer Familie. Dabei will Ella nur eins: Alles soll so sein wie früher. Sie vermisst ihre Mom, ihren heißgeliebten Bücher-Blog - und Cinder, ihren Chatfreund.
Brian Oliver ist der neue Star am Hollywoodhimmel. Doch der Ruhm hat seine Schattenseiten, echte Freunde sind selten geworden. Vor allem vermisst er seine Chatfreundin Ella, mit der er unter seinem Nickname Cinder stundenlang gechattet hat. Als die sich nach einem Jahr Funkstille plötzlich wieder meldet, ist Brian überglücklich. Langsam wird ihm klar, dass er mehr will als nur Freundschaft. Doch Ella hat keine Ahnung, wer er in Wirklichkeit ist ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Vorhang auf für einen der größten Selfpublisher-Erfolge aus den USA! Kelly Oram ist mit »Cinder und Ella« der Durchbruch gelungen. Millionenfach wurde ihr Roman geklickt, über 50.000 gedruckte Bücher hat sie verkauft. Sagenhafte 2.200 Kundenrezensionen auf Amazon mit durchschnittlich 4,8 Sternen spiegeln diesen Erfolg wider. Und nun endlich erscheint die deutsche Ausgabe bei ONE. Ella hat ein hartes Jahr hinter sich. Ihre Mutter starb bei einem Autounfall, den sie selbst nur knapp überlebte. Nach etlichen Klinikaufenthalten zieht sie nun zu ihrem Vater und dessen neuer Familie. Dabei will Ella nur eins: Alles soll so sein wie früher. Sie vermisst ihre Mom, ihren heißgeliebten Bücher-Blog – und Cinder, ihren Chatfreund. Brian Oliver ist der neue Star am Hollywoodhimmel. Doch der Ruhm hat seine Schattenseiten, echte Freunde sind selten geworden. Vor allem vermisst er seine Chatfreundin Ella, mit der er unter seinem Nickname Cinder stundenlang gechattet hat. Als die sich nach einem Jahr Funkstille plötzlich wieder meldet, ist Brian überglücklich. Langsam wird ihm klar, dass er mehr will als nur Freundschaft. Doch Ella hat keine Ahnung, wer er in Wirklichkeit ist …
Über die Autorin
Kelly Oram schrieb mit 15 Jahren ihre erste Kurzgeschichte – Fan Fiction über ihre Lieblingsband, die Backstreet Boys, womit ihre Familie sie heute noch aufzieht. Sie ist süchtig nach Büchern, redet gern und viel und liebt Zuckerguss. Sie lebt mit ihrem Mann, vier Kindern und einer Katze am Rande von Phoenix, Arizona.
KELLY ORAM
Übersetzung aus dem amerikanischen Englischvon Fabienne Pfeiffer
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»Cinder & Ella«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2014 by Kelly Oram
Published by arrangement with Bookcase Literary Agency
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2018/2024 by Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Manuela Städele-Monverde unter Verwendung eines Motivs von © FinePic / shutterstock
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-6162-9
luebbe.de
lesejury.de
Für meine Tochter Jackie.
Weil jedes Mädchen sein eigenes Märchen verdient.
Prolog
Das Problem mit Märchen ist, dass die meisten mit einem tragischen Schicksalsschlag beginnen. Ich verstehe schon, was dahintersteckt: Niemand mag eine verhätschelte Heldin. Eine großartige Figur muss Hürden überwinden – Erfahrungen, die ihr Tiefe verleihen, sie verletzlich und sympathisch machen und einem die Möglichkeit geben, sich mit ihr zu identifizieren. Gelungene Figuren müssen Not und Entbehrung erleiden, um daran wachsen zu können und stark zu werden. In der Theorie ergibt das Sinn, aber für die Heldin selbst ist es trotzdem Mist.
Mein Leben war nie besonders märchenhaft verlaufen. Keine magischen Wünsche, die in Erfüllung gegangen wären, aber auch keine echten Tragödien. Mein Dad hatte eine Affäre und hatte Mom und mich verlassen, als ich acht war, aber ansonsten habe ich es ziemlich gut getroffen.
Ich bin recht hübsch – meine langen, gewellten schwarzen Haare und die glatte goldbraune Haut verdanke ich den chilenischen Vorfahren meiner Mutter. Die großen blauen Augen habe ich von meinem Vater. In der Schule bin ich ziemlich gut, wobei ich nie besonders viel lernen muss. Und ich bin relativ beliebt – nicht unbedingt die Ballkönigin des nächsten Abschlussballs, aber ich stehe auch nie samstagabends ohne meine Freunde oder ein Date da.
Mag sein, dass ich ohne Vater aufgewachsen bin, aber meine Mom war meine beste Freundin, und für mich war das gut genug. Das Leben im Allgemeinen war gut genug. Dann hatte meine Mom letzten November beschlossen, mich zum Geburtstag mit einem Skiwochenende in Vermont zu überraschen, und ich habe meine erste Dosis charakterbildender Tragödie bekommen.
»Ich hab uns das volle Verwöhnprogramm gebucht: Wir können uns im Whirlpool auftauen und uns danach massieren lassen, wenn uns nach einem langen Tag auf Skiern alle Knochen wehtun«, gestand Mom, als wir Boston für die nächsten vier Tage hinter uns ließen.
»Wow, Mom! Nicht dass ich dafür nicht dankbar wäre – aber können wir uns das leisten?«
Meine Mutter lachte nur. Ich liebte ihr Lachen. Es klang federleicht, wie ein Flügelschlag, und gab mir das Gefühl, darauf davonschweben zu können. Sie lachte immer. Sie war der ausgelassenste Mensch, den ich je gekannt hatte. In ihren Augen hätte das Leben einfach nicht besser sein können.
»Hör dich mal an, Ella. Du wirst achtzehn, nicht vierzig.«
Ich grinste. »So wie du nächsten Monat?«
»Cállate! Das ist unser Geheimnis. Falls jemand fragt – ich bin für den Rest meines Lebens neununddreißig.«
»Klar doch. Moment mal … sind das … Krähenfüße?«
»Ellamara Valentina Rodriguez!«, rief meine Mutter. »Das sind Lachfältchen, und auf die bin ich ausgesprochen stolz.«
Sie sah mich an, und in den Winkeln ihrer strahlenden Augen blühten Lachfältchen auf. »Mit dir als Tochter habe ich mich sehr anstrengen müssen, um Lachfältchen statt grauer Haare zu bekommen.«
Ich schnaubte und griff nach meinem Handy, das gerade vibrierte.
»Sei lieb zu deiner Mom, sonst blamiere ich dich dieses Wochenende ganz fürchterlich vor all den süßen Jungs.«
Mir lag schon eine schlagfertige Antwort auf der Zunge, doch als ich die Nachricht auf meinem Handy sah, war sie wie weggeblasen.
Cinder458: Bald steht dein Blogiläum an, oder?
Cinder458 – oder nur Cinder, wie ich ihn nenne – ist neben Mom mein bester Freund auf der ganzen Welt, obwohl ich ihn noch nie getroffen habe. Ich habe noch nicht einmal mit ihm telefoniert. Wir schreiben pausenlos Mails, seit er vor zwei Jahren über meinen Blog, Ellamaras Worte der Weisheit, gestolpert ist.
Auf meinem Blog bespreche ich Bücher und Filme. Begonnen habe ich damit, als ich fünfzehn war, und entsprechend beging ich demnächst tatsächlich mein drittes Blogiläum.
Den Namen Ellamara habe ich zu Ehren meiner Lieblingsfigur aus meiner Lieblingsbuchreihe – Die Aschenchroniken – gewählt. Diese Fantasyreihe aus den Siebzigern ist inzwischen eine der populärsten Geschichten der Gegenwartsliteratur. Das hat endlich auch Hollywood erkannt, und das erste Buch, Der Druidenprinz, wird demnächst verfilmt.
Außerdem heiße ich Ellamara. Meine Mutter hat die Bücher als Kind gelesen und so sehr geliebt, dass sie mich nach der geheimnisvollen Druidenpriesterin benannt hat. Ich war stolz auf den Namen und auf meine Mutter – dafür, dass sie Ellamara am liebsten mochte und nicht wie alle anderen die Kriegerprinzessin Ratana. Ellamara war eine viel bessere Figur.
Klar, dass Cinder ebenfalls Fan der Serie ist. Durch den Namen Ellamara und meinen Post darüber, warum sie die am meisten unterschätzte Figur im Buch ist, hat Cinder ja überhaupt erst zu meinem Blog gefunden. Er liebt die Bücher ebenso sehr wie ich, also mochte ich ihn sofort – obwohl er mir beim ersten Mal nur schrieb, um zu behaupten, dass Prinzessin Ratana besser zu Prinz Cinder passen würde. Seitdem hatte er den meisten meiner Rezensionen widersprochen.
EllaTheRealHero: Wissen deine Freunde in Hollywood, dass du Wörter wie Blogiläum verwendest?
Cinder458: Natürlich nicht. Ich brauch deine Adresse. Hab ein Blogiläumsgeschenk für dich.
Cinder hatte ein Geschenk für mich besorgt?
Mein Herz machte einen Salto.
Nicht dass ich in meinen besten Internetfreund verliebt wäre oder so. Das wäre ja total albern. Der Kerl war stur und rotzfrech und widersprach allem, was ich schrieb, nur um mich zu ärgern. Außerdem hatte er jede Menge Geld, ging mit Models aus – was bedeutete, dass er heiß sein musste – und las gern heimlich im stillen Kämmerlein.
Witzig, reich, heiß, selbstbewusst, Buchliebhaber. Eindeutig nicht mein Typ. Nope. Ganz und gar nicht.
Ja, okay, schön, er war schon allein deshalb nicht mein Typ, weil er in Kalifornien lebte und ich in Massachusetts. Wie auch immer.
Cinder458: Hallo? Ella?? Adresse??
EllaTheRealHero: Ich gebe meine Adresse keinem gruseligen Internetstalker.
Cinder458: Dann schätze ich mal, du hast gar kein Interesse an der signierten gebundenen Erstausgabe von Der Druidenprinz. Schade. Ich hab sie Ellamara widmen lassen, als ich L. P. Morgan letzte Woche bei der FantasyCon getroffen habe, also kann ich damit kein anderes Mädchen mehr beeindrucken.
Erst, als das Auto schlingerte, wurde mir bewusst, dass ich losgequietscht hatte.
»Por el amor de todo lo sagrado, Ellamara! Jag deiner armen Mom nicht so einen Schrecken ein. Wir stecken mitten in einem Schneesturm. Die Straßen sind schon gefährlich genug, ohne dass du kreischst wie eine Todesfee.«
»Tut mir leid, Mom. Aber Cinder hat geschrieben …«
»Híjole muñeca, nicht schon wieder dieser Junge.« Die müde Tonlage kannte ich schon. Mir stand eine der Lieblingspredigten meiner Mutter bevor. »Dir ist schon bewusst, dass er ein völlig Fremder ist, oder?«
Ich schüttelte den Kopf. »Ist er nicht. Ich kenne ihn besser als sonst irgendjemanden.«
»Du hast ihn noch nie persönlich getroffen. Alles, was er sagt, könnte gelogen sein – wie willst du das wissen?«
Ich gebe zu, dass ich mich genau das auch gefragt hatte, weil Cinders Leben ein wenig nach dem eines Rockstars klang, aber inzwischen kannte ich ihn lange genug, um überzeugt zu sein, dass er kein Lügner war. »Das glaube ich wirklich nicht, Mom. Kann schon sein, dass er manchmal ein bisschen übertreibt, aber wer tut das nicht? Und was macht das schon? Er ist bloß ein Internetfreund. Er lebt in Kalifornien.«
»Ganz genau. Warum also verschwendest du so viel Zeit mit ihm?«
»Weil ich ihn mag. Mit ihm kann ich reden. Er ist mein bester Freund.«
Mom seufzte noch einmal, aber sie warf mir ein Lächeln zu, und ihre Stimme wurde weicher. »Ich mache mir bloß Sorgen, dass du dich in ihn verliebst, muñeca, und was dann?«
Das war eine gute Frage. Und genau deshalb war Cinder nicht mein Typ.
Nicht mein Typ.
Nicht. Mein. Typ.
Cinder458: Adresse. Name, Wohnort, Straße und Hausnummer. Die Daten, mit denen man einer Person auf dem Postweg etwas schicken kann (zum Beispiel ein großartiges Geschenk).
EllaTheRealHero: Hat dein Auto dir das gesagt?
Cinder fährt einen Ferrari 458. Das hat er mir mal erzählt, als ich ihn gefragt habe, wofür die Zahlen in seinem Nickname stehen. Ich habe das Auto gegoogelt. Es kostet mehr, als meine Mutter in fünf Jahren verdient. Ich ziehe ihn gern mit seinem pompösen Lebensstil auf. Und ja, das Auto spricht tatsächlich mit ihm.
Cinder458: Ich bin gerade nicht im Auto unterwegs, also hab ich’s aus dem Handy. Adresse, Madam. Jetzt! Sonst verrat ich dir nicht, wer gerade für Cinders Rolle in der Verfilmung unterschrieben hat.
Beinahe hätte ich wieder gekreischt. Die Verfilmung war offiziell bestätigt, die Besetzung aber noch nicht bekannt gegeben worden. Cinders Dad ist irgendein hohes Tier in der Filmindustrie, deshalb weiß Cinder solche Sachen immer im Voraus.
EllaTheRealHero: Neeeeiin! Sag’s mir! Ich sterbe!!!
Ich sollte nie herausfinden, welcher Schauspieler einem der beliebtesten Romanhelden aller Zeiten zu ewigem Leinwandruhm verhelfen würde, weil ein Langholztransporter auf einen Straßenabschnitt mit Blitzeis geriet und quer über die zweispurige Fahrbahn direkt in Mom und mich hineinrutschte. Ich hatte den Blick auf mein Handy gerichtet, als es passierte, und sah den Laster überhaupt nicht kommen. Ich erinnere mich nur noch daran, dass ich meine Mutter schreien hörte und in meinen Gurt geschleudert wurde, als direkt vor meinem Gesicht der Airbag explodierte. Ein kurzer Schmerzmoment, so heftig, dass er mir buchstäblich die Luft nahm, und dann nichts mehr.
Wieder zu mir kam ich drei Wochen später in einer Verbrennungsklinik in Boston, als die Ärzte mich aus dem künstlichen Koma holten. Ich hatte Verbrennungen zweiten und dritten Grades, die siebzig Prozent meiner Körperoberfläche bedeckten.
Meine Mutter war tot.
1.
An viele konkrete Details des Unfalls kann ich mich nicht erinnern, aber die Furcht, die ich an diesem Tag gespürt habe, ist in meiner Erinnerung noch immer kristallklar. Ich habe ständig die gleichen Albträume – ein paar unscharfe Bilder und ein Durcheinander etlicher Geräusche, aber ich bin vor Angst so gelähmt, dass ich nicht atmen kann, bis ich schreiend aufwache. Im Mittelpunkt der Träume steht immer die Panik selbst.
Wenn mir die Sonne nicht so unverschämt ins Gesicht geschienen und mein Körper nach dem fünfeinhalbstündigen Flug aus Boston nicht derart geschmerzt hätte, hätte ich fast glauben können, ich befände mich wieder in meinem Traum. Genau diese Panik fühlte ich nämlich, während ich im Auto in der Einfahrt saß und zu meinem zukünftigen Zuhause hinaufsah.
Zuvor hatte ich nur Blicke auf die Landschaft zwischen dem Flughafen und dem Haus meines Vaters in den gewundenen Hügeln über Los Angeles erhascht. Das hatte gereicht, um schnell festzustellen, dass Los Angeles ganz anders war als Boston – auch wenn der Verkehr auf der Schnellstraße mir das Gegenteil vorgaukelte.
Wenn es doch nur der Ortswechsel gewesen wäre, der mir Angst gemacht hätte. Ich hatte acht Wochen auf der Intensivstation verbracht und danach weitere sechs Monate in einer Rehaklinik. Insgesamt acht Monate im Krankenhaus, und nun sollte ich zu einem Mann ziehen, der sich vor zehn Jahren aus meinem Leben verabschiedet hatte – und zu der Frau, für die er mich verlassen hatte, sowie deren beiden Töchtern, die meinen Platz eingenommen hatten.
»Ich sollte dich wohl besser warnen, dass Jennifer sich vermutlich irgendeine Willkommensüberraschung für dich ausgedacht hat.«
»Keine Party, oder?« Ich keuchte, und meine Panik steigerte sich zu etwas, das mich vielleicht doch noch umbringen konnte. Ich hätte nie gedacht, dass ich eine Hölle durchstehen würde, die sich die meisten Menschen nicht einmal vorstellen konnten – nur um dann am ersten Tag nach meiner Entlassung aus dem Krankenhaus von einer Gruppe Wildfremder umgenietet zu werden, die mich bei sich zu Hause willkommen heißen wollten.
»Nein, natürlich nicht«, beruhigte mich mein Vater. »Nichts in der Art. Dein neues Rehateam hat letzte Woche vorbeigeschaut und die ganze Familie ein bisschen vorbereitet und eingewiesen. Jennifer weiß, dass es dich erst mal überfordern wird, viele neue Leute auf einmal kennenzulernen. Ich bin mir sicher, dass nur sie und die Mädchen da sind, aber wahrscheinlich wartet ein nettes Abendessen auf uns, dazu ein paar Willkommensgeschenke und vielleicht Deko. Sie freut sich sehr darauf, dich kennenzulernen.«
Das konnte ich von mir nicht behaupten.
Als ich nicht antwortete, warf mir mein Vater einen dieser hilflosen Blicke zu, mit denen er mich immer wieder bedacht hatte, seit ich aus dem Koma erwacht war und ihn neben meinem Krankenbett vorgefunden hatte. In diesen Blicken lagen siebzig Prozent Mitleid, zwanzig Prozent Angst und zehn Prozent Unbehaglichkeit. So, als hätte er keine Ahnung, was er sagen oder wie er sich mir gegenüber verhalten sollte – wahrscheinlich, weil er mich weder gesehen noch mit mir gesprochen hatte, seit ich acht war.
Er räusperte sich. »Bereit, Kleines?«
Bereit würde ich nie sein.
»Nenn mich bitte nicht so«, flüsterte ich. Ich musste mich anstrengen, die Worte um den Kloß herumzubugsieren, der mir mit einem Mal im Hals saß.
Er stieß einen langen Atemzug aus und versuchte ein Lächeln. »Dafür bist du inzwischen zu alt, was?«
»So in etwa.«
In Wirklichkeit hasste ich den Spitznamen, weil er mich an Mom erinnerte. Sie hatte mich immer ihre kleine muñeca – ihre Babypuppe – genannt. Als ich ungefähr sechs war, fing Dad an, mich Kleines zu rufen. Er meinte, ich bräuchte auch einen amerikanischen Spitznamen, aber ich glaube, er war eher eifersüchtig auf die enge Beziehung, die ich damals schon zu meiner Mutter hatte.
»Tut mir leid«, sagte Dad.
»Schon gut.«
Ich öffnete die Autotür, bevor wir an unserem Unbehagen ersticken konnten. Dad kam um den Wagen herum, um mir beim Aussteigen zu helfen, aber ich wehrte ihn ab. »Das soll ich allein machen.«
»Klar, tut mir leid. Hier.«
Während ich meine Beine nacheinander aus dem Auto hievte, reichte er mir meinen Gehstock und wartete dann, bis ich mich langsam daran hochgezogen hatte und aufrecht stand.
Es war anstrengend und nicht besonders elegant, aber endlich konnte ich wieder ohne fremde Hilfe gehen. Darauf war ich stolz. Die Ärzte hatten das am Anfang nicht für möglich gehalten, aber ich hatte mich durch den Schmerz gekämpft und einen Großteil meiner Bewegungsfreiheit zurückgewonnen. Die Narben allein waren übel genug. Ich wollte nicht auch noch für den Rest meines Lebens an einen Rollstuhl gefesselt sein.
Ich war froh, dass wir für die kurze Strecke die Einfahrt hinauf eine Weile brauchten. So hatte ich die nötige Zeit, mich für das zu wappnen, was mich drinnen erwartete.
Dad deutete mit ausladender Geste zum Haus hin. »Ich weiß, von außen macht es nicht allzu viel her, aber es ist größer, als es wirkt, und die Aussicht von der Rückseite ist spektakulär.«
Es machte nicht allzu viel her? Was sollte ich seiner Erwartung nach denn von dem zweistöckigen, postmodernen, mehrere Millionen Dollar schweren Haus vor meiner Nase halten? Er hatte die kleine Zweizimmerwohnung gesehen, in der Mom und ich in Boston gelebt hatten. Er war es gewesen, der sie nach Moms Beerdigung ausgeräumt hatte.
Ich zuckte bloß mit den Schultern und wusste nicht, was ich erwidern sollte.
»Wir haben für dich ein Zimmer im Erdgeschoss eingerichtet, damit du keine Treppen steigen musst, außer um ins Wohnzimmer zu gelangen, aber das sind nur ein paar Stufen nach unten. Du hast auch dein eigenes Badezimmer, das haben wir behindertengerecht umgebaut. Alles sollte bereit für dich sein, aber wenn du feststellst, dass du im Haus nicht zurechtkommst … Jennifer und ich haben uns auch schon darüber unterhalten, uns etwas Neues zu suchen, vielleicht den Hügel hinunter in Bel-Air, da könnten wir eine hübsche Ranch oder so bekommen.«
Ich schloss die Augen und atmete tief durch, um ihn nicht wütend anzufunkeln oder etwas Unhöfliches zu sagen. Er redete so, als würde ich für immer hierbleiben. Dabei würde ich sofort verschwinden, sobald ich nur durfte.
Einmal, an einem Tiefpunkt während meiner Reha, hatte es einen schwachen Moment gegeben. Ich hatte versucht, mir das Leben zu nehmen. Damals hatte ich schon drei Monate im Krankenhaus verbracht, und kein Ende war in Sicht. Ich konnte mich noch immer kaum bewegen, hatte gerade meine siebzehnte Operation hinter mir. Man sagte mir, dass ich nie wieder würde gehen können, ich vermisste meine Mutter und hatte so starke körperliche Schmerzen, dass ich mir einfach nur wünschte, alles wäre endlich vorbei.
Niemand machte mir Vorwürfe für das, was ich getan hatte, aber gleichzeitig glaubte anschließend auch niemand mehr, dass ich keine Bedrohung für mich selbst sei. Ich hatte vorgehabt, in Boston zu bleiben, den versäumten Schulabschluss online nachzuholen und dann ein Studium an der Boston University zu beginnen, sobald ich bereit dazu war. Ich war achtzehn und hatte genügend Geld gespart, aber als meinem Vater klar wurde, was ich plante, ließ er mich gerichtlich für psychisch labil erklären und zwang mich, zu ihm nach Kalifornien zu ziehen.
Höflich zu diesem Mann zu sein, fiel mir nicht leicht. »Ich bin mir sicher, das Haus ist absolut in Ordnung«, knurrte ich. »Können wir das Ganze bitte einfach hinter uns bringen, damit ich ins Bett gehen kann? Ich bin müde, und mir tut alles weh, nachdem wir den ganzen Tag unterwegs waren.«
Als ich die Enttäuschung in seinen Augen aufflackern sah, tat es mir leid, dass ich ihm gegenüber so schroff gewesen war. Ich schätzte, er hatte gehofft, mich zu beeindrucken, aber er verstand nicht, dass ich nie viel Geld gehabt und auch nicht gebraucht hatte. Ich war zufrieden mit dem bescheidenen Leben, das ich mit Mom geführt hatte. Die Schecks, die er jeden Monat geschickt hatte, hatte ich nicht einmal angerührt. Mama hatte sie jahrelang für mich auf ein Konto eingezahlt. Darauf war mittlerweile genug, um mein Studium zu bezahlen – ein weiterer Beleg dafür, dass ich wunderbar allein zurechtgekommen wäre.
»Natürlich, Süße …« Er hielt inne und verzog schmerzvoll das Gesicht. »Tut mir leid. Ich schätze mal, so darf ich dich auch nicht nennen, oder?«
Ich schnitt eine Grimasse. »Vielleicht könnten wir einfach bei Ella bleiben?«
Im Inneren war das Haus ebenso tadellos steril wie die Verbrennungsklinik. Wahrscheinlich gab es Warnmelder, die Alarm schlugen, sobald irgendwo ein Staubkorn landete. Mein Rehateam würde begeistert sein. Die Einrichtung war schick, und die Möbel sahen allesamt extrem ungemütlich aus. Niemals würde sich dieses Haus wie ein Zuhause anfühlen.
Die neue Mrs Coleman stand in einer gigantischen Küche und richtete auf einer Arbeitsfläche aus Granit eine Platte mit Früchten und Dessertsoßen an, als wir um die Ecke kamen. Gut möglich, dass die Platte aus echtem Silber war. Als sie uns bemerkte, breitete sich auf ihrem Gesicht das größte, strahlendste Lächeln aus, das ich je bei einem Menschen gesehen hatte. »Ellamara! Willkommen in unserem Zuhause, Schätzchen!«
Jennifer Coleman musste die schönste Frau in ganz Los Angeles sein. Haare so golden wie die Sonne, Augen blau wie der Himmel und Wimpern, die sich bis zum Mond erstreckten. Sie hatte lange Beine, eine winzige Taille, und ihre riesigen Brüste waren rund, drall und perfekt. Granate war alles, was mir zu ihr einfiel.
Ich weiß nicht, warum ihre Schönheit mich überraschte. Ich wusste, dass sie professionell modelte – keine Laufstege, sondern für Zeitschriften und Werbefilme. Sie war in Anzeigen für Shampoo oder Hautcreme zu sehen und sah darum tatsächlich gesund aus und nicht etwa knochiger als eine Drogensüchtige.
Der Größe ihres Hauses nach zu urteilen, musste sie damit ziemlich gut verdienen, denn auch, wenn mein Dad als Anwalt große Namen vertrat, warf dieser Beruf in den USA keine Millionengehälter ab. Früher, als er noch bei uns gelebt hatte, besaßen wir ein Mittelklassehaus in einem Vorort, fuhren aber ganz sicher keinen Mercedes oder wohnten an einem Hügel auf einem eingezäunten Anwesen.
Jennifer tat einen Schritt nach vorn, schloss mich vorsichtig in die Arme und machte Kussgeräusche neben meinen Wangen. »Es ist so aufregend, dich endlich hier bei uns zu haben. Rich erzählt schon so lange so viel von dir, dass es sich anfühlt, als wärst du längst Teil der Familie. Es muss eine große Erleichterung für dich sein, endlich wieder ein richtiges Zuhause zu haben.«
Genau genommen war das Verlassen der Rehaklinik eines der beängstigendsten Dinge gewesen, die ich je hatte tun müssen, und hier zu sein war alles andere als eine Erleichterung. Das sagte ich aber natürlich nicht. Ich suchte stattdessen nach Worten, die wahr und zugleich nicht allzu verletzend waren. »Es ist eine Erleichterung, endlich aus dem Flugzeug raus zu sein.«
Jennifers Lächeln wurde mitleidig. »Du musst unheimlich müde sein, du armes Ding.«
Ich schluckte meine Verärgerung hinunter und zwang mich zu einem Lächeln. Mitleidig behandelt zu werden hasste ich genauso wie starrende Blicke, wenn nicht noch mehr. Bevor ich mir eine Erwiderung überlegen musste, kamen meine beiden neuen Stiefschwestern durch die Haustür gestürmt.
»Mädels, ihr seid spät dran.« Jennifer klang gereizt, hatte aber wieder ihr breites, unechtes Lächeln aufgesetzt. »Schaut nur, wer endlich zu Hause ist!«
Die beiden Schwestern blieben so abrupt stehen, dass sie ineinanderrasselten. Sie waren Zwillinge. Keine eineiigen, schien es mir, aber sie sahen einander so ähnlich, dass ich sie mit Sicherheit dennoch verwechselt hätte, hätten sie die Haare nicht unterschiedlich getragen. Von den Fotos, die Dad mir gezeigt hatte, wusste ich, dass Juliette die Blonde war, deren lange Locken ihr in seidigen Wellen bis zur Taille reichten. Anastasia dagegen trug einen glatten, angeschrägten Bob, der ihr ins Gesicht fiel und scharfkantig an ihrem Kinn endete. Er war so perfekt frisiert, dass sie aussah, als sei sie gerade einer Frisurenzeitschrift entstiegen.
Beide Mädchen waren ebenso wunderhübsch wie ihre Mutter – das gleiche blonde Haar, die gleichen blauen Augen, die gleiche makellose Figur. Und sie waren beide so groß! Ich bin bescheidene ein Meter siebzig, und beide überragten mich. Natürlich trugen sie auch beide Schuhe mit Absätzen, die ihnen zehn zusätzliche Zentimeter verliehen, aber ich nahm an, auch ohne Schuhe maß jede wohl beinahe einen Meter achtzig. Sie waren mehr als ein Jahr jünger als ich, hätten aber mühelos für einundzwanzig durchgehen können.
Statt sich mit einer Begrüßung aufzuhalten, schlug Anastasia sich die Hand vor die Brust. »Oh Mann, ich bin so froh, dass dein Gesicht nicht entstellt ist.«
Juliette nickte mit großen Augen. »Absolut. Wir haben Bilder von Brandopfern gegoogelt, und die hatten quasi alle solche grässlichen Narben im Gesicht. Das war so widerlich.«
Mein Dad und Jennifer stießen beide ein nervöses Lachen aus und stellten sich neben die Zwillinge. »Mädels«, tadelte Jennifer mild, »es gehört sich nicht, so über die Entstellungen anderer Leute zu reden.«
Der Begriff ließ mich zusammenzucken. Das also dachte sie von mir? Dass ich entstellt war? Mein Gesicht mochte unbeschadet davongekommen sein, aber meine rechte Körperhälfte von der Schulter abwärts sowie alles unterhalb meiner Taille war übersät mit dickem, rauem, gerötetem Narbengewebe, das sich deutlich von meinem normalen Teint abhob.
Mein Dad zog beide Mädchen dicht an sich heran, nahm eine in jeden Arm. Mit ihren Absätzen waren sie beinahe so groß wie er. Ich hatte ihn als recht ansehnlichen Mann in Erinnerung gehabt, aber wie er so neben seiner bildschönen Familie stand, wirkte auch er wirklich attraktiv. Er hatte noch immer dichtes braunes Haar und natürlich die gleichen strahlend blauen Augen wie ich. »Süße, das sind meine Töchter Anastasia und Juliette. Mädels, das ist eure neue Stiefschwester, Ellamara.«
Er grinste stolz, ließ sein perfektes Anwaltslächeln aufblitzen und drückte dabei beide Mädchen an sich. Die Fältchen um seine Augen taten mir im Herzen weh. Lachfältchen. Er hatte offenbar viel gelacht in seinem Leben. Mir entging auch nicht, dass er die Zwillinge als seine Töchter bezeichnet hatte. Nicht Stieftöchter.
Ich unterdrückte mein plötzliches Bedürfnis, mich zu einer Kugel zusammenzurollen und loszuheulen, und streckte den Schwestern stattdessen eine Hand hin. »Einfach nur Ella. Ella Rodriguez.«
Keines der Mädchen erwiderte die Geste. »Rodriguez?«, schnaubte Juliette. »Nicht eher Coleman?«
Ich ließ den ausgestreckten Arm wieder fallen und zuckte mit den Schultern. »Ich hab den Mädchennamen meiner Mutter angenommen, als ich zwölf war.«
»Warum?«
»Weil ich eine Rodriguez bin.«
Meine beiden Stiefschwestern machten Gesichter, als hätte ich sie irgendwie beleidigt. Ich musste die Zähne zusammenbeißen, um ihnen keine spanischen Beleidigungen entgegenzuschleudern. Mein wütender Blick schwenkte zu meinem Vater. »Wo ist meine Tasche? Ich muss meine Medikamente nehmen und mich dann ausruhen. Meine Beine fühlen sich geschwollen an.«
Während mein Vater mich durchs Erdgeschoss zu meinem Zimmer führte, hörte ich Jennifer in erhitztem Flüsterton mit ihren Töchtern diskutieren. Mir war es egal, dass sie meinetwegen stritten. Ich war einfach froh, die Vorstellungsrunde hinter mich gebracht zu haben. Von nun an würde ich ihnen hoffentlich so weit wie möglich aus dem Weg gehen können.
Ich ließ mich auf mein Bett sinken, das sich wie ein Krankenhausbett am Kopf- und Fußende anheben und absenken ließ, und schluckte einige Tabletten, bevor ich mich in meinem neuen Zimmer umsah. Die Wände waren in einem zarten Gelbton gestrichen – zweifellos mit Hintergedanken, da irgendein Arzt meinem Vater erzählt hatte, Gelb sei eine beruhigende, aufheiternde Farbe. Ehrlich gesagt gefiel es mir sogar ganz gut, aber die schrecklichen verschnörkelten weißen Möbel gaben mir das Gefühl, wieder sechs Jahre alt zu sein. Sie waren abgrundtief hässlich.
»Gefällt es dir?«, fragte Jennifer hoffnungsvoll. Sie war ins Zimmer gekommen und hatte sich neben meinen Vater gestellt. Er legte ihr den Arm um die Taille und gab ihr einen Kuss auf die Wange. Ich musste mich mächtig zusammenreißen, um nicht zu erschaudern.
Wieder wählte ich meine Worte mit Bedacht: »So was Schickes hatte ich noch nie.«
Dad nahm eine Art Fernbedienung mit Touchscreen zur Hand. »Das Beste kommt erst noch.« Er grinste und drückte ein paar Knöpfe. »Ich zeig dir später, wie es funktioniert. Damit kannst du den Fernseher, die Stereoanlage, das Licht, den Ventilator und die Fenster bedienen und steuern.«
»Die Fenster?« Meine Fenster ließen sich per Fernbedienung öffnen und schließen?
Dad lächelte stolz, und mit einem letzten Tippen auf die Bedienoberfläche glitten die vom Boden bis zu Decke reichenden reinweißen Vorhänge auf der gegenüberliegenden Zimmerseite auseinander und gaben den Blick auf eine ganze Fensterfront mit Schiebetür in der Mitte frei. Dann, mit einem weiteren Tastenbefehl, hoben sich die Jalousien sämtlicher Fenster, und Licht flutete den Raum.
Dad öffnete die Tür und trat in den Sonnenuntergang hinaus auf einen hölzernen Balkon, der, so weit das Auge reichte, ganz Los Angeles überblickte. Jenseits des Balkons fiel der Boden so dramatisch ab, dass er nicht mehr auszumachen war. Offenbar thronte das Haus auf einem Klippenvorsprung.
»Du hast den besten Ausblick im ganzen Haus. Du musst mal nach Einbruch der Dunkelheit hier rauskommen und dir all die Lichter ansehen. Das ist wirklich ein Schauspiel.«
Angesichts der Tatsache, dass Kalifornien Erdbebengebiet war, fand ich den Gedanken, auf diesem Balkon zu stehen, eher verstörend.
Dad kam wieder ins Zimmer und wandte sich mit hoffnungsvoller Miene zu mir um, sobald Sonnenschutz und Vorhänge wieder an Ort und Stelle hingen. Er ertappte mich dabei, wie ich beklommen zu dem Laptop auf meinem Schreibtisch hinüberspähte. Er war silbern und schmal wie ein Pfannkuchen. Immer hatte ich mir einen solchen gewünscht, aber jetzt erschien er mir irgendwie nicht mehr so verlockend.
Dad ging hinüber und klappte den Laptop auf. »Ich hoffe, du hast nichts gegen ein bisschen Veränderung. Der Computer in eurer Wohnung war so veraltet. Ich dachte mir, der hier würde dir sicher besser gefallen. Ich habe eine Sicherungskopie von eurer Festplatte machen lassen, bevor ich den alten Computer entsorgt habe. Außerdem habe ich dir ein neues Handy besorgt, weil deins verbrannt ist.« Er nahm etwas von der Tischplatte, das wie ein iPhone mit knallig pinkfarbener Schutzhülle aussah, und reichte es mir. »Wir haben dich mit in den Familientarif aufgenommen – unbegrenztes Guthaben für alles, du kannst also bedenkenlos deine Freunde in Massachusetts anrufen. Gar kein Problem.«
Ich wandte mich ab. Seit dem Unfall hatte ich zu keinem meiner alten Freunde Kontakt aufgenommen. Als ich erstmals wieder in der Lage gewesen wäre, jemanden anzurufen, war bereits so viel Zeit vergangen, dass ich mir dachte, sie hätten sicher längst das Interesse an mir verloren. Ich würde zu meinem Dad ziehen und nicht zurückkommen, also schien es sinnlos, den Kontakt zu ihnen aufrechtzuerhalten. Nun da ich Tausende von Kilometern von ihnen entfernt war, kam es mir erst recht unsinnig vor.
Meinem Dad musste das auch klar geworden sein, denn er zwang sich zu einem brüchigen Lächeln und rieb sich den Nacken, als fühle er sich plötzlich extrem unbehaglich.
»Danke«, sagte ich. »Also dann, ähm, wo sind meine ganzen Sachen?«
Dads Gesicht entspannte sich, da ich offenbar eine leichte Frage zu einem viel ungefährlicheren Thema gestellt hatte. »Alles aus deinem Schlafzimmer – bis auf die Möbel natürlich – ist in den Kisten in deinem Schrank verstaut.«
In meinem Schrank? »Wie groß ist denn der Schrank?«
Eine Frage, die Jennifer amüsierte. »Nicht so groß wie meiner, aber ich bezweifle auch, dass du einen genauso großen Schuhtick hast wie ich.«
Ich hatte keine Lust, ihr zu sagen, dass meine Mutter und ich gleichermaßen einen Schuhtick hatten. Wir trugen dieselbe Größe und besaßen gemeinsam wohl eine LKW-Ladung an Schuhen. Nicht dass ich irgendwelche davon jemals wieder würde tragen können. Nicht die zehenfreien Sandalen und auch keine Absätze jeglicher Art – nur noch Sonderanfertigungen, die meine verbrannten Füße therapeutisch unterstützten und nach Schuhwerk für Großmütter aussahen. Die Ärzte hatten meine Hand wieder hinbekommen, sodass ich sie gut genug bewegen konnte, um wieder schreiben zu können – einigermaßen. Ich arbeitete noch daran, zu einer leserlichen Handschrift zurückzufinden. Meine Zehen aber waren nicht vollständig zu retten gewesen.
»Wir haben alles in den Kisten gelassen, weil wir dachten, du würdest lieber alles selbst ausräumen und ordnen«, sagte Dad. »Aber wenn du Hilfe möchtest, packen wir gern mit an, wo immer du uns brauchst.«
»Nein. Das schaffe ich schon. Was ist mit Moms Sachen und dem Rest aus unserer Wohnung?«
»Ich habe alles eingepackt, was mir wichtig schien – Bilder und solchen Kram, und ein paar Dinge von deiner Mutter, von denen ich dachte, du würdest sie vielleicht gern behalten wollen. Das war nicht viel, nur ein paar Kisten voll. Sie stehen bei deinen Sachen. Alles andere habe ich entsorgt.«
»Was ist mit den Büchern?« Mein Herz begann in meiner Brust zu hämmern. Hier im Zimmer gab es keine Bücherregale, und ich bezweifelte ernsthaft, dass ich im Schrank welche finden würde. »Was hast du mit meinen ganzen Büchern gemacht?«
»Mit all den Büchern aus dem Wohnzimmer? Die habe ich gespendet.«
»Du hast was?«
Mein Schreien ließ Dad zusammenzucken, und wieder trat dieser panische Blick in seine Augen. »Tut mir leid, Liebling. Mir war nicht klar …«
»Du hast all meine Bücher weggegeben?«
Vielleicht war es albern, deswegen auszurasten, aber nach all dem emotionalen Stress, den ich an diesem Tag durchgestanden hatte, ertrug ich den Gedanken einfach nicht, dass meine ganzen Bücher weg sein sollten. Ich hatte meine Sammlung über Jahre zusammengetragen.
Seit ich lesen konnte, hatte ich nichts mehr geliebt, als meine Bibliothek aufzustocken. Mom hatte mir schon so lange zum Geburtstag und zu Weihnachten – und manchmal einfach so, wenn sie Lust dazu hatte – Bücher geschenkt, dass eine echte Tradition daraus geworden war.
Ich war zu Autogrammstunden und Buchmessen im ganzen Nordosten gefahren und hatte mir Dutzende Bücher von all meinen Lieblingsautoren signieren lassen. Jedes Mal, wenn ich mit diesem besonderen Gesichtsausdruck zu Mom gekommen war, hatte sie gelacht und gesagt: »Wohin diesmal?« Bei jeder Signierstunde hatte ich jemanden gebeten, ein Foto von meiner Mutter und mir mit dem jeweiligen Autor zu machen, und später das Bild in den Innenumschlag des dazugehörigen Buchs geklebt.
Und nun waren all diese Bücher, die Bilder und Erinnerungen … all das war einfach nicht mehr da. So, wie Mom nicht mehr da war. Ich würde sie nie zurückbekommen, und nie würde ich das, was ich verloren hatte, ersetzen können. Es war, als würde sie mir noch einmal genommen.
Mein Herz zersprang in eine Million winziger Stücke, ein irreparables Scherbenmeer. Ich brach in unkontrollierbare Schluchzer aus, warf mich aufs Bett und rollte mich eng zu einer Kugel zusammen. Ich wünschte, irgendwie den Schmerz ausblenden zu können.
»Es tut mir leid, Ellamara. Ich hatte keine Ahnung. Du warst nicht wach, darum konnte ich dich nicht fragen. Ich kann dir aber neue Bücher besorgen. Wir fahren diese Woche zusammen los, und du kannst dir aussuchen, was immer du möchtest.«
Der Gedanke, dass er versuchen wollte, meine Sammlung zu ersetzen, machte mich noch wütender. »Du verstehst gar nichts!«, schrie ich. »Bitte, geh einfach.«
Ich hörte nicht, wie die Tür ins Schloss gezogen wurde, aber danach störte mich bis zum nächsten Morgen niemand mehr. Ich weinte noch stundenlang, bis ich vor Erschöpfung einschlief.
2.
Eines konnte ich für Kalifornien schon einmal definitiv festhalten: Jeder hier sah gut aus. Einerseits war das wirklich ätzend, weil meine Narben nur noch mehr herausstachen, wenn alle um mich herum immerzu derart perfekt wirkten. Andererseits aber genoss ich es genauso wie jedes andere Mädchen, Zeit mit süßen Jungs zu verbringen, und mein gesamtes neues Rehateam war hinreißend. Das machte die ganze Zeit, die ich mit jedem Einzelnen von ihnen verbringen musste, sehr viel angenehmer.
Mein Ernährungsberater und mein Krankenpfleger waren beide heiße Typen Anfang dreißig. Mein Ernährungsberater arbeitete außerdem noch als Personal Trainer. Ich hatte nie viel Sport getrieben, aber wenn ich den Kerl nur ansah, hätte ich mich am liebsten sofort im Fitnessstudio angemeldet. Mein Physiotherapeut war erst achtundzwanzig und ließ mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Im Ernst: Er sah aus, als gehörte er ins Fernsehen und nicht in mein Wohnzimmer, wo er mich zu Kräftigungsübungen zwang, bis mir zum Heulen zumute war. In den letzten beiden Wochen hatte ich mich beinahe auf meine Physiotherapiesitzungen gefreut. Beinahe.
Ich keuchte, als mich unerwartet eine Welle des Schmerzes durchzuckte, und hielt den Atem an, um nicht aufzuschreien.
»Na komm, Ella, nur einmal noch. Ich weiß, dass du das schaffst. Bis ganz runter zu den Schuhspitzen diesmal.«
Ich hätte am liebsten losgeweint, berührte aber noch einmal beinahe meine Zehen, weil Daniel mich mit so viel Zutrauen anlächelte, dass ich es nicht über mich brachte, ihn zu enttäuschen. Und ich schwöre, er klimperte mit den Wimpern. Ich streckte meine Finger Richtung Fußboden, dehnte meine neue Haut dort, wo sie am meisten spannte. Mir war klar, dass Physiotherapie anstrengend sein sollte – was einen nicht umbringt, macht einen stärker, im wahrsten Sinne des Wortes –, aber ich konnte meine Finger einfach nicht dazu bringen, bis zu meinen Schuhen zu reichen. Mein gesamter Körper brannte. Tränen stachen mir in den Augen, und ich richtete mich wieder auf. »Tut mir leid. Ich schaff’s nicht. Ich hab das Gefühl, dass mein Körper jede Sekunde auseinanderreißt.«
Daniel runzelte die Stirn – nicht aus Frust oder Enttäuschung, sondern aus Sorge um mich. Seine Mimik allein ließ mich ins Schwärmen geraten. »Du bist am Montag einmal bis zu den Schuhen gekommen. Machst du jeden Tag deine Übungen, so wie wir es besprochen haben?«
»Ja, aber ich glaube, meine Haut hasst das kalifornische Klima. Sie hat die ganze Woche gejuckt.«
»Lass mal sehen«, verlangte Daniel. Ich hob mein T-Shirt ein wenig an, sodass er meinen Rücken begutachten konnte, und schlug dann die Hosenbeine hoch, um ihm die Haut in meiner Kniekehle zu zeigen. »Warum hast du nicht früher was gesagt? Ich hätte dich nicht so hart rannehmen sollen. Du kratzt aber nicht daran herum, oder?«
»Ich gebe mir Mühe.«
»Und direktes Sonnenlicht? Du hast dich nicht auf der Veranda gesonnt, oder? Keine Ausflüge zum Strand?«
»Doch, klar«, spöttelte ich. »In aller Öffentlichkeit im Badeanzug herumzuflanieren steht ganz oben auf meiner To-do-Liste. Ich hab das Haus nicht verlassen, seit ich hier angekommen bin. Mittlerweile bin ich quasi Vampir.«
Daniel wandte den Blick von meiner Haut ab und runzelte wieder die Stirn. Diesmal würde ich Ärger bekommen. »Erstens ist der Strand großartig und du würdest ihn lieben. Nächsten Sommer, wenn deine Haut widerstandsfähiger ist, bringe ich dich persönlich hin.« Der süße Daniel, in nichts als Badeshorts? Dafür würde ich die starrenden Blicke auf meine Narben beinahe in Kauf nehmen. »Und zweitens: Wann kommt dein Pfleger?«
»Erst am Montag.«
»Das ist zu spät. Deine Haut ist viel zu trocken. Sie muss sich erst noch an das veränderte Klima gewöhnen. Kalifornien ist viel trockener als die Ostküste.«
»Da würde mein Haar dir zustimmen.«
Daniel lachte und kramte zielstrebig in seinem Rucksack. »Aha! Ich hab also doch welches dabei.« Er zog ein Fläschchen Mineralöl hervor und grinste. »Zieh dich um, dann reib ich dich damit ein. Deine Mom hat eine Massageliege, oder? Ich glaube, das hat sie erwähnt, als ich das letzte Mal hier war.«
Erst als das scherzhafte Lachen aus Daniels Gesicht wich, wurde mir klar, dass ich bei seinen Worten erstarrt war.
»Sie ist nicht meine Mom«, sagte ich, auch wenn das gar nicht der Grund dafür war, dass sich plötzlich all meine Eingeweide verknotet hatten. »Und ja, sie hat eine, aber du musst das nicht machen. Ich bin sicher, ich halte gut bis Montag durch.«
Er hatte meine Narben bereits gesehen, aber nur mal hier und da einen Arm oder ein Bein – das war etwas anderes, als auf einmal Zeuge des ganzen Ausmaßes zu werden.
Daniel sah mir direkt in die Augen, als wisse er genau, weshalb ich tatsächlich zögerte. »Ella.« Seine Stimme war sanft, aber eindringlich. »Bis Montag platzt dir die Haut auf, dass du blutest. Wir können nicht riskieren, dass deine Transplantate einreißen. Du willst doch nicht noch mal operiert werden müssen, oder?«
»Nein.« Meine Stimme zitterte, während ich versuchte, meine Gefühle unter Kontrolle zu bringen.
»Wenn du dich mit mir so unwohl fühlst, kann ich Cody anrufen, oder du kannst ein Elternteil bitten, es zu übernehmen, aber es muss heute gemacht werden.«
Als ob ich meinen Dad oder Jennifer das machen lassen würde.
Ich hatte es nicht weniger gehasst, meinem Pfleger die Narben zu zeigen, als ich es bei Daniel hassen würde, also war es unsinnig, ihn zu bitten, Cody anzurufen. Ich holte tief Luft und nickte. »Tut mir leid. Du hast recht. Ist schon gut. Ich geh mich umziehen.«
»Braves Mädchen.« Daniel lächelte mich mit so aufrichtigem Stolz an, dass es mir ein wenig ins Herz schnitt. »Du bist eine meiner tapfersten Patientinnen, weißt du das?«
Ich brachte ein Lachen heraus. »Ich wette, das sagst du zu allen.«
Daniel grinste. »Stimmt, aber bei dir meine ich es wirklich ernst.«
»Ich wette, das sagst du auch zu allen.« Ich verdrehte die Augen und ging in mein Zimmer, um den gefürchteten Bikini anzuziehen.
Bis ich endlich den Mut zusammengekratzt hatte, wieder herauszukommen, hatte Daniel bereits die Massageliege im Wohnzimmer aufgestellt. Ich hielt die Luft an, aber als er aufsah, lächelte er, als sei gar nichts anders. Kein Zögern, nicht eine Sekunde lang. Nicht einmal ein Zusammenzucken. Er klopfte einfach mit der Hand auf die Liege.
Genau deshalb liebte ich Ärzte. Das Pflegepersonal in der Verbrennungsklinik war ganz genauso gewesen wie Daniel: Für sie war ich einfach ein Mensch wie jeder andere. Während meiner Zeit dort hatte ich es sogar geschafft, mir selbst einzureden, das Leben, das vor mir lag, würde gar nicht so schlimm werden.
Auf meinem Flug von Boston nach L. A. hatte ich Schuhe, Hosen und ein langärmeliges Oberteil getragen. Die einzigen sichtbaren Narben waren die auf meiner rechten Hand gewesen, und natürlich war ich ein wenig gehumpelt. Die Leute hatten mich angestarrt wie eine Außerirdische mit drei Köpfen. Sie hatten geflüstert und auf mich gedeutet und waren zusammengezuckt. Ich wollte mir gar nicht ausmalen, wie es sein würde, wenn ich das Haus mit einem Tanktop und kurzer Hose verließe.
Ich nahm meinen Mut zusammen und ging zu Daniel hinüber, aber als ich ins Zimmer kam, sah mich Jennifer. Sie trug gerade ein paar volle Limonadengläser, und als ihr Blick auf all meine entblößten Narben fiel, schnappte sie nach Luft, und ihre Augen füllten sich mit Tränen. Sie musste die Gläser abstellen und sich setzen. »Tut mir leid«, flüsterte sie. »Rich hat erzählt, dass es schlimm ist, aber ich hatte keine Ahnung … es tut mir so leid, Ella.« Sie sah zu mir hoch und zuckte wieder zusammen. »Entschuldigt mich«, sagte sie und rannte dann geradezu die Treppe hinauf in ihr Zimmer.
Ich schloss die Augen und atmete tief durch. Daniel gab mir eine Minute Zeit, mich zu fassen, und nahm dann sanft meine Hand. »Soll ich dir hochhelfen?«
Normalerweise hätte ich es allein versucht, aber diesmal ließ ich mich von ihm auf die Liege heben. Ich legte mich zuerst auf den Bauch; ich fühlte mich noch nicht bereit, ihn wieder anzusehen. Nicht, nachdem meine Stiefmutter gerade vor mir aus dem Zimmer geflohen war.
»Keine Ahnung, warum mein Dad für Pflege zu Hause bezahlt«, grummelte ich, während Daniel damit begann, meine empfindliche Haut mit Mineralöl zu tränken. »So weit ist die Verbrennungsklinik nicht weg. Ich wäre viel lieber für diesen ganzen Kram dorthin gefahren.«
Daniel blieb einen Augenblick lang still und sagte dann: »Ich wünschte, ich könnte dir sagen, dass es besser wird. Es wird nie leicht sein, Ella. Die Leute werden immer auf dich reagieren – einige schlimmer als andere.«
»Zumindest sind die Stiefhexen nicht zu Hause. Jennifer ist vielleicht taktlos, aber sie versucht zumindest, nett zu sein. Hexe eins und Hexe zwei lassen den Teufel wie ein zahmes Hündchen wirken.«
Daniel seufzte. »Sieh es positiv: Du wirst immer schnell merken, wer deine echten Freunde sind. Wenn du dich eines Tages mal entschließt zu heiraten und eine Familie zu gründen, dann kannst du dir sicher sein, dass du als Ehemann nur die Crème de la Crème bekommen wirst.«
Ich schnaubte. Als ob ich auch nur die geringste Chance hätte, dass jetzt noch jemand mit mir ausgehen geschweige denn, mich für den Rest seines Lebens am Hals haben wollte.
»Wag es ja nicht, den Gedanken, dass jemand dich lieben könnte, als lächerlich abzutun, Ella. Umdrehen«, forderte er. Als ich mich auf den Rücken rollte, bemühte er sich, ein wütendes Gesicht zu ziehen. Es gelang ihm nicht besonders gut. »Du bist clever, witzig und stark. Und du bist wunderschön.«
»Noch mal: Du bist mein Therapeut. Du musst das sagen.«
Daniel lachte nicht. Er sah so direkt und ernst auf mich hinunter, wie ich ihn noch nie erlebt hatte. »Atemberaubend schön«, sagte er mit Nachdruck. »Du hast Augen, die einen Mann in seine Träume verfolgen könnten.«
Ich wollte einen Scherz machen, aber etwas in Daniels Gesicht hielt mich entschieden zurück, sodass ich nur ein »Danke« flüsterte und tiefrot anlief.
»Es gibt Menschen da draußen, die über deine Narben hinwegsehen und das Mädchen im Inneren erkennen werden«, sagte Daniel, »aber die findest du nicht, wenn du dich den ganzen Tag lang hier im Haus versteckst. Denk bloß nicht, dass ich das vergessen hätte, Missy. Ich warne dich jetzt: Ich verpetze dich bei Dr. Parish, verlass dich drauf.«
Ich stöhnte. Die Sitzungen bei meiner Psychologin waren beinahe schmerzhafter als meine Physiotherapie.
»Schau mich nicht so an. Das ist nur zu deinem Besten. Du solltest nicht von morgens bis abends hier im Haus herumsitzen, und das weißt du. So kann es passieren, dass du Rückschritte machst, Ella. Du willst doch nicht, dass deine ganze Arbeit der letzten Monate umsonst gewesen ist.«
»Aber ich mache jeden Tag meine Übungen. Ehrlich, ich schwör’s.«
»Das ist nicht das Gleiche. Du musst aktiv sein. Du brauchst Abwechslung in deinen Bewegungsabläufen. Du musst all die Dinge tun, die du vorher getan hast, ohne auch nur darüber nachzudenken. Außerdem wirst du hier drinnen depressiv, und dann strengst du dich nicht mehr so an. Das lässt mich schlecht dastehen, und am Ende feuert mich dein Dad. Mag sein, dass du mich loswerden willst, aber ich verspreche dir, dass jeder Ersatztherapeut, den dein Dad für mich findet, dich genauso quälen wird – bloß wird er dabei nicht so großartig sein wie ich.«
Da hatte er wohl recht. Wenn doch alle anderen nur halb so cool wären wie Daniel.
In diesem Moment kam mein Vater ins Zimmer und nahm stillschweigend meine Haut in Augenschein, während Daniel die letzten Stellen einrieb. Seine Brauen senkten sich tief über seine Augen, und er machte eine deutende Handbewegung.
»Warum sieht sie so aus?« Er hatte während meiner Zeit im Krankenhaus in Boston schon oft zugesehen, wenn ich eingeschmiert wurde, deshalb fiel ihm der Unterschied auf.
Mein Vater sah Daniel an, also überließ ich es ihm zu antworten. »Sie ist das feuchtere Klima in Boston gewohnt. Vielleicht sollten Sie ihren Krankenpfleger häufiger kommen lassen, bis ihr Körper genügend Zeit gehabt hat, sich an das Wetter hier anzupassen.«
Dad nickte. »Ich rufe Cody heute noch an. Kann sie in diesem Zustand aus dem Haus gehen? Ich muss mit ihr zur Schule fahren, um sie anzumelden.«
Grrr. Physiotherapie, eine zu Tränen entsetzte Stiefmutter, trockene Haut, zusätzliche Besuche meines Pflegers – und soeben war mein Tag auf wundersame Weise direkt noch um einiges schlimmer geworden. Großartig.
Daniel – einfühlsam genug, um zu bemerken, wie unhöflich es war, über Menschen zu reden, als seien sie nicht da, während sie in Wirklichkeit direkt neben einem standen – wandte sich zu mir um, als er meinem Vater antwortete. Er zwinkerte mir zu und sagte: »Die frische Luft wird dir guttun.«
Mein Vater meldete mich an derselben schicken Privatschule an, die auch die Zwillinge besuchten. Mein ganzes bisheriges Wissen über Privatschulen stammte aus Teeniefilmen, die ich im Fernsehen gesehen hatte. Die Schule rühmte sich ihrer achtundneunzigprozentigen Erfolgsquote bei der Studienplatzvermittlung. An meiner Highschool in Boston gab es Metalldetektoren am Eingang, und man war stolz darauf, dass gut die Hälfte der Schüler ihren Abschluss schaffte.
Als wäre das nicht schlimm genug gewesen, verlangte die neue Schule auch noch Schuluniformen. Sie bestanden aus den traditionellen weißen Poloshirts – oder Rollkragenpullovern im Winter – und dunkelblauen Faltenröcken. Den ganzen Sommer über hatte ich mich im Haus verkrochen, und bei den wenigen Gelegenheiten, zu denen mein Dad und Jennifer mich gezwungen hatten, nach draußen zu gehen, von Kopf bis Fuß verhüllt. Und jetzt erwarteten sie von mir, in einem kurzärmeligen Oberteil und knielangen Rock zur Schule zu gehen? Hatten sie keine Ahnung, wie fies Teenager sein konnten?
Mein Vater strahlte übers ganze Gesicht, als wir nach unserem Gespräch mit dem Schulleiter wieder ins Auto stiegen. »Und?«, fragte er. »Was meinst du? Bist du schon aufgeregt? Hübsche Schule, oder?«
Sie war zu hübsch. Die Schule thronte abgeschirmt hinter gigantischen Eisentoren und einem Wachhäuschen auf einer riesigen ausladenden Rasenfläche. Sie bestand aus einer Reihe kleinerer Gebäude, die durch überdachte Bogengänge miteinander verbunden waren und mich an alte Klöster erinnerten. Kaum vorstellbar, dass darin eine Highschool untergebracht war.
Während Dad vom Parkplatz fuhr, begann mein Herz zu rasen – so, wie ich es inzwischen bereits als Vorzeichen meiner Panikattacken kannte. Ich drehte mich im Sitz komplett zur Seite und packte ihn am Arm. »Dad, bitte zwing mich nicht, dorthin zu gehen.«
Meine plötzliche Eindringlichkeit überrumpelte ihn. »Warum, was ist denn los?«
»Überhaupt zur Schule zu gehen wird schon schlimm genug werden. Bitte, bitte, bitte mach es nicht noch schlimmer für mich. Das hier – das ist Wahnsinn. An einer öffentlichen Schule weiß ich zumindest, was auf mich zukommt – andere Schule, gleicher Mist. Die Ärzte haben gesagt, ›Vertrautes‹ würde mir guttun. Und das …«, ich gestikulierte in Richtung der Schule hinter uns, »… ist nicht ›vertraut‹. Das schaffe ich nicht. Zwing mich nicht, dorthin zu gehen.«
Meine Panik war zu einhundert Prozent echt, aber mein Dad besaß tatsächlich die Dreistigkeit, über mich zu lachen. Er tat meine Angst ab, als sei sie völlig aus der Luft gegriffen. »Sei nicht albern. Das wird prima dort, du wirst schon sehen.«
»Warum kann ich keinen Onlineunterricht nehmen? So könnte ich wahrscheinlich die Zeit aufholen, die ich versäumt habe, und innerhalb von ein paar Wochen meinen Abschluss machen, statt mein komplettes letztes Schuljahr zu wiederholen.«
»Du weißt, warum du nicht online lernen kannst. All deine Ärzte haben dir erklärt, wie wichtig es ist, dass du so schnell wie möglich wieder in einen geregelten Alltag zurückfindest. Je länger du dich einigelst, desto schwieriger wird es für dich, je wieder ein normales Leben zu führen.«
Das entlockte mir ein Schnauben. »Du glaubst, ich werde je wieder ein normales Leben führen?«
»Was soll ich deiner Meinung nach tun, Ella? Ich versuche nur mich an die Empfehlungen der Ärzte zu halten. Ich versuche das zu tun, was für dich am besten ist.«
Ich hätte am liebsten geschrien. Er hatte nicht die geringste Ahnung, was für mich am besten war. »Schön. Kann ich dann wenigstens auf eine öffentliche Schule gehen?«
Dieser Vorschlag schien meinen Dad zutiefst zu entsetzen. »Warum um alles in der Welt willst du auf eine öffentliche Schule gehen?«
»Ähm … erstens: keine Uniformen. Und weil die Schüler sich dort entfalten und sie selbst sein dürfen, als eigenständige Individuen. Dort gibt es viel mehr Freaks. Ich hätte viel bessere Chancen, mich einzufügen.«
»Du bist kein Freak.«
Ich warf meinem Dad einen ungläubigen Blick zu, in dem eine Herausforderung lag: Sag das noch mal. Er tat es nicht.
»Selbst, wenn ich nicht verkrüppelt und vernarbt wäre, würde ich nicht auf diese Schule gehen wollen. Ich bin nicht wie Jennifers Töchter. Ich gehöre nicht an eine großkotzige, überprivilegierte, schicke Reichensprösslingsschule.«
»Du bist sehr voreingenommen, Ella. Versuch es wenigstens, bevor du dich entschließt, die Schule zu hassen.«
»Aber …«
»Außerdem schicke ich keine meiner Töchter auf eine öffentliche Schule, wenn ich es mir leisten kann, ihr eine bessere Ausbildung zu bieten.«
Das fand ich zutiefst kränkend, zumal ich bisher ausschließlich auf öffentliche Schulen gegangen war. »Letztes Jahr hat dich das anscheinend noch nicht gestört«, fauchte ich. »Andererseits: Ich schätze, letztes Jahr war ich auch nicht wirklich deine Tochter, oder? Genauso wenig wie in all den Jahren davor, in denen ich auf öffentliche Schulen gegangen bin.«
Mein Dad erstarrte, und seine Miene wurde absolut undurchschaubar. Daraus konnte ich nur schließen, dass ich ihn entweder richtig fuchsteufelswild gemacht oder ernsthaft verletzt hatte. Wahrscheinlich beides, aber in diesem Moment war mir das egal. Ich war zu wütend, ich hatte Panik, und ich vermisste meine Mom zu sehr, um mich darum zu scheren, was jener Mann dachte, der uns im Stich gelassen hatte.
»Du bist bereits angemeldet. Ich schicke dich nicht auf eine öffentliche Schule. Ende der Diskussion.«
Ich klappte den Mund zu, warf mich in meinem Sitz nach hinten und zog es auf der restlichen Heimfahrt vor, stumm aus dem Fenster zu starren. Ende der Diskussion? Schön. Meinetwegen. Ende der letzten Diskussion, die wir je geführt hatten.
3.
Brian
Ich ließ mich in meinem Stuhl zurückfallen und stöpselte die Kopfhörer in mein Handy. Vielleicht würde Katy Perrys neuestes Album mich davor bewahren, vor Langeweile zu sterben. Ich hasste diese Meetings.
Sobald die Musik meine Ohren füllte, stieß ich einen kleinen Seufzer aus. Viel besser. Nichts beruhigte mich mehr als Katys sexy Stimme. Und sie war so wunderschön. Ich schloss träge die Augen und stellte mir vor, sie sänge nur für mich allein. Vielleicht würde sie sogar mit mir ausgehen. Einer der Idioten in diesem Raum musste doch wissen, wie man mit ihrem Team Kontakt aufnehmen konnte. Wenn sie endlich aufhörten zu reden – falls sie je aufhörten –, würde ich fragen. Hoffentlich könnte sich dann einmal jemand von ihnen wirklich nützlich machen.
Ein Finger tippte mir auf die Schulter, aber ich ignorierte es.
»Brian!«
Seufzend riss ich mir die Stöpsel aus den Ohren. Diese kurzen Atempausen dauerten nie lange genug. Ich öffnete die Augen und stellte fest, dass der größte Teil meines Managementteams mich wütend anfunkelte. Mein Vater, der berühmte Filmregisseur Max Oliver, saß mir am langen Konferenztisch direkt gegenüber und sah aus, als wolle er mich am liebsten strangulieren. Gut.
Es würde das letzte Mal sein, dass ich je mit meinem Vater zusammenarbeitete. Wenn es nicht um Die Aschenchroniken gegangen wäre, hätte ich für die Rolle überhaupt nicht zugesagt. Man sollte Arbeit und Familie nie miteinander vermischen – ganz besonders dann nicht, wenn es sich um meine verkorkste Familie handelte.
Mein neuer Assistent, Scott, legte ein Blatt Papier vor mich hin und langte dann um mich herum, um den Stapel an meine Filmpartnerin Kaylee Summers weiterzureichen. Ich stöhnte über die Reihe an Terminen, die auf dem Zettel aufgelistet waren, knüllte ihn zu einer kleinen Kugel zusammen, lehnte mich weit im Stuhl zurück, zielte und schoss. Der provisorische Basketball landete auf der anderen Seite des Raumes im Papierkorb, ohne auch nur dessen Seiten zu berühren – wuuusch. »Ha! Zwei Punkte!«
Ich drehte mich zu Kaylee und hielt ihr die Hand zum Abklatschen hin. »Hast du das gesehen? Vielleicht hab ich zu früh im Leben meine Berufung gefunden. Ich denke, ich mache nächste Saison mal ein Testspiel für die Lakers.«
Kaylee warf mir ihren üblichen herablassenden Blick zu und ließ meine Geste unerwidert in der Luft hängen. Und wenn schon. Von Scott würde ich einen High five bekommen. Ihm wandte ich mich als Nächstes zu. Er warf einen nervösen Blick durch den Raum, hatte letztlich aber zu viel Schiss, um meine Aufforderung zu ignorieren, und klatschte ab.
Ich lachte. »Entspann dich, Scotty. Ich bin der Einzige hier im Zimmer, der dich feuern kann, also umschmeichle im Zweifelsfall mich, nicht die anderen. Die werden’s dir schon nicht übel nehmen.«
»Hast du jetzt lang genug unsere Zeit verschwendet?«, fauchte mein Dad.
Eine Woge des Zorns durchfuhr mich, wie so oft, wenn mein Vater in der Nähe war. Ich schnappte mir Scottys Kopie des Terminplans und wedelte sie durch die Luft. »Dieses bescheuerte Meeting verschwendet jedermanns Zeit.«
Mein gesamtes Managementteam nahm mir diese Bemerkung ausgesprochen übel, aber mein Agent Joseph war es, der den Mund aufmachte: »Das ist der Zeitplan für die Werbetour zu Der Druidenprinz. Den solltest du dir besser einprägen.«
»Warum? Dafür hab ich Scotty.« Ich legte meinem Assistenten den Arm über die Schulter. »Dieser Typ hier ist ein krasses Organisationstalent – deshalb hab ich ihn engagiert. Wahrscheinlich hat er bereits acht verschiedene Kopien dieser Liste irgendwo für Notfälle deponiert. Er würde mich niemals ein Meeting versäumen lassen. Glaubt mir, ich hab mein Bestes gegeben, dieses hier zu verpassen.«
Joseph seufzte. »Du bist hier, weil dein Assistent den Plan nicht für dich abzeichnen kann.«
»Ihr braucht meine Zustimmung?«, spöttelte ich. »Als hätte ich bei dem Ganzen irgendwas mitzureden?«
»Natürlich hast du das.«
Ich hätte am liebsten gelacht, bloß war es eigentlich nicht witzig. Seit meinem ersten megaerfolgreichen Teeniefilm hatte ich bei gar nichts mehr mitreden dürfen. Agenten, Manager, Pressesprecher, Anwälte, Imageberater, Personal Trainer, eine Million andere … Sie alle kontrollierten inzwischen mein Leben – was ich anziehen durfte oder nicht, was ich essen durfte oder nicht, zu welchen Veranstaltungen ich gehen sollte oder nicht, was ich sagen konnte und was eben nicht. Himmel, sie hatten diese ganze Werbetour geplant, ohne mich auch nur ein einziges Mal mit einzubeziehen. Was ich jetzt in die Hand gedrückt bekommen hatte, war eine Marschroute, die längst in Stein gemeißelt war.
Ich überflog die Liste und sah Wochen voller Interviews, Fototermine, öffentlicher Auftritte, Filmpremieren, Gastauftritte in Radio und Fernsehtalkshows auf mich zukommen. L. A., New York, Chicago …
Ich blickte Joseph direkt in die Augen und hob herausfordernd eine Augenbraue. »Ich bin mir sicher, ihr habt längst die Flüge und Hotelzimmer gebucht. Was zur Hölle macht es also für einen Unterschied, ob ich auch nur mit irgendetwas davon einverstanden bin oder nicht? Was, wenn mir das alles nicht passt? Die Kenneth Long Show? Der Typ ist ein totaler Trottel. Damit bin ich ganz sicher nicht einverstanden.«
Joseph zog eine Grimasse, fand dann aber zu einer Miene grimmiger Entschlossenheit. »Die Kenneth Long Show wird zur besten Sendezeit ausgestrahlt. Sie ist die derzeit beliebteste Talkshow überhaupt. Mit Millionen von Zuschauern. Ein Interview mit Kenneth kannst du nicht einfach ausschlagen, bloß weil du ihn nicht leiden kannst.«
»Schön, aber was soll dieser Scheiß mit Celebrity Gossip? Das ist eine verdammte Klatschzeitschrift.«
Mein Pressesprecher – auch ein totaler Trottel – räusperte sich und sprang ein, um den Plan zu verteidigen. »Es ist die größte Boulevardzeitung der Welt. Wenn sie dich mögen, können sie dich zum berühmtesten Menschen auf Erden machen, und wenn nicht, verwandeln sie dich in die größte Lachnummer, die Hollywood je hervorgebracht hat.«
»Sie haben bereits ein Auge auf dich geworfen, Brian«, fügte mein Manager, Gary, mit finsterem Blick hinzu. »Besser, du kooperierst und stellst dich gut mit ihnen – sonst verbreiten sie solche Geschichten bald jede Woche in sämtlichen Medien.«
Gary warf die aktuelle Ausgabe von Celebrity Gossip auf den Tisch und schob sie zu mir herüber. Ich las die Schlagzeile und musste grinsen. Dass ich am vergangenen Wochenende Adrianna Pascal dazu gebracht hatte, mich nach Hause zu begleiten, war meine bisher lohnendste Errungenschaft in diesem Jahr.
»Du hast mit der Freundin des weltberühmten Rockstars Kyle Hamilton rumgemacht – auf dessen eigener Geburtstagsparty.«
Ha. Wir hatten in dieser Nacht viel mehr als nur rumgeknutscht. Ich blickte mit großen unschuldigen Augen im Raum umher. »Waren sie da noch zusammen?«
»Du hast ihre verdammte Hochzeit zum Platzen gebracht.«
Ich zuckte mit den Schultern. »Der Kerl ist ein selbstgefälliges Arschloch. Außerdem: Wenn sie ihn wirklich geliebt hätte, hätte sie sich nicht den ganzen Abend über an mich rangeschmissen.«
Nun rastete mein Vater endgültig aus. »Genau solche Presse kannst du im Moment nicht gebrauchen!«, brüllte er. »Meinst du, du wärst der erste Teenie-Shootingstar, der versucht ganz groß rauszukommen? Bist du nicht! In Hollywood tauchen jedes Jahr neue Arschlöcher wie du auf. Wenn du dich nicht zusammenreißt, findet dein nächster großer Auftritt in zwanzig Jahren in einer Realityshow statt, die verglühte Filmsternchen noch einmal aus der Versenkung zieht.«
Ich funkelte meinen Vater mit größerer Abscheu an, als selbst ich für möglich gehalten hatte. Mein Dad hatte mich nie respektiert, nie an mich geglaubt. Er machte sich über jeden Film lustig, den ich je gedreht hatte. Immer wieder sagte er mir, ich hätte nicht das Zeug dazu, »ganz oben mitzuspielen« – seit ich ihn hatte wissen lassen, dass ich im Filmgeschäft meinen eigenen Weg gehen und nicht immer nur in seinen Filmen mitspielen wollte. Nun wartete er nur darauf, dass ich scheiterte, damit er es mir unter die Nase reiben konnte.
»Ich hab die Schnauze voll von dieser Scheiße.« Ich schob meinen Stuhl vom Konferenztisch zurück und zerknüllte auch den zweiten Terminzettel zu einem Ball. Diesmal war ich zu wütend, um mich zu konzentrieren, und schoss am Papierkorb vorbei.
Bevor ich aus dem Meeting stürmen konnte, fing Lisa, die Produktionsleiterin des Films und neben Scott die einzige Person im Raum, die ich nicht verabscheute, mich an der Tür ab und versperrte mir den Weg.
»Brian«, sagte sie und nahm meine Hand. Ihr Lächeln war vollkommen gönnerhaft, und trotzdem klopfte sie mich damit ein bisschen weich. »Wir wissen, dass du frustriert bist. Du hattest im letzten Jahr ein bisschen Pech mit den Paparazzi, aber diese Werbetour ist wichtig.«
Ein bisschen Pech?