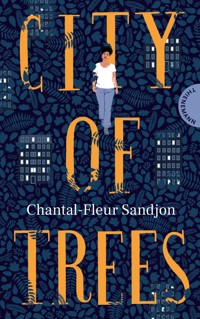
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Thienemann in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Zwei Jahre sind vergangen, seitdem Lindiwes Schwester Khanyi verschwunden ist. Im Wald am Stadtrand Berlins wurde Khanyi das letzte Mal gesehen, hierhin zieht es Lin immer wieder. Der Wald nimmt zunehmend Raum in ihrem Leben ein, Lin hat Blackouts und wacht unter Laubbergen auf, Moos beginnt auf ihrer Wange zu sprießen. Und sie hört immer häufiger die Stimme ihrer Schwester, wenn sie sich in der Natur verliert. Lin spürt, dass sie sich verändert, ohne es richtig greifen zu können – bis Zenzile in ihr Leben tritt. Zenzile, die junge Frau, die mit Lins Großmutter aus Südafrika zu Besuch kommt. Zenzile, die schon länger ähnliche Veränderungen an sich selbst bemerkt. Zenzile, deren Nähe Lin Wurzeln schenkt und nach der Weite des Himmels greifen lässt. Gemeinsam lüften die beiden das Geheimnis des Waldes und kommen Kahnyis Schicksal auf die Spur. Der neue Jugendroman der preisgekrönten Autorin von "Die Sonne, so strahlend und Schwarz" - fesselnd, sprachgewaltig und überraschend.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Das Buch
Im Wald wurde Lindiwes Schwester Khanyi zum letzten Mal gesehen. Deshalb zieht es Lin immer wieder dorthin. Hier hört sie Khanyis Stimme und kann doch nicht herausfinden, was mit ihr geschehen ist. Hat ihr Schicksal etwas mit den Veränderungen zu tun, die Lin selbst erfährt? Mit dem Moos, das auf ihrer Wange sprießt? Dann tritt Unathi in ihr Leben. Ihre Nähe schenkt Lin Wurzeln und lässt sie nach der Weite des Himmels greifen. Doch zu nah dürfen sie sich nicht kommen, denn Unathi ist Lins Cousine. Während Lin gegen ihre Gefühle kämpft, versuchen die beiden das Geheimnis von Khanyis Verschwinden zu lüften ...
Für „Die Sonne, so strahlend und Schwarz“ wurde Chantal-Fleur Sandjon 2023 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. In ihrem neuen Buch lässt sie sich von afrikanischer Mythologie inspirieren.
Die Autorin
© Shaheen Wacker
Chantal-Fleur Sandjon wurde 1984 in Berlin geboren, wo sie heute nach Stationen in Johannesburg, London und Frankfurt wieder lebt. Als afrodeutsche Autorin, Lektorin und Spoken-Word-Künstlerin gilt ihr Interesse besonders der vielschichtigen Darstellung Schwarzer Lebenswelten in Deutschland. Sie ist noch immer auf der Suche nach der perfekten Papaya und der schrägsten Metapher. Ihr erster Versroman, „Die Sonne, so strahlend und Schwarz“, wurde mehrfach ausgezeichnet, u. a. 2023 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis.
Der Verlag
Du liebst Geschichten? Wir bei Thienemann auch!
Wir wählen unsere Geschichten sorgfältig aus, überarbeiten sie gründlich mit Autor:innen und Übersetzer:innen, gestalten sie gemeinsam mit Illustrator:innen und produzieren sie als Bücher in bester Qualität für euch.
Deshalb sind alle Inhalte dieses E-Books urheberrechtlich geschützt. Du als Käufer erwirbst eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf deinen Lesegeräten. Unsere E-Books haben eine nicht direkt sichtbare technische Markierung, die die Bestellnummer enthält (digitales Wasserzeichen). Im Falle einer illegalen Verwendung kann diese zurückverfolgt werden.
Mehr über unsere Bücher und Autoren auf:
www.thienemann.de
Thienemann auf Instagram:
https://www.instagram.com/thienemann_booklove
Thienemann auf Tiktok:
https://www.tiktok.com/@thienemannverlage
Viel Spaß beim Lesen!
CITY OF TREES
Chantal-Fleur Sandjon
Thienemann
Teil1
Alles, was du berührst,
Veränderst du.
Alles, was du veränderst,
Verändert dich.
— Octavia E. Butler: Die Parabel vom Sämann
Die Bäume
haben einen Weg gefunden
um zu überleben.
Mit jedem Tag begrüßt mich
mehr Grün auf meinem Lauf
durch den Wald, obwohl
der Herbst bereits
in viele Blätterspitzen einzieht.
Die Welt zeigt sich
in ihren sattesten Farben
hält nichts zurück
bevor sie alles gibt
alles verliert.
Die Kiefer an der Wegkreuzung da vorne
ich könnte schwören, gestern
gab es sie hier noch nicht.
Aber bestimmt habe ich
mal wieder nur nicht richtig
aufgepasst. Bäume
erscheinen nicht wie Gespenster
bestimmt war ich zu beschäftigt
mit der Suche nach Khanyi
auch jetzt noch
drei Jahre später.
An der neuen Kiefer
jogge ich vorbei
schenke ihr einen Gruß
erhobene Faust in der Luft
und weiß nicht, warum.
Es ist 2025 und
die Bäume haben
einen Weg gefunden
um zu überleben, allein das
verdient meinen Respekt
denn genau das
ist Khanyi vielleicht
nicht gelungen.
Aber:
Nicht daran denken
bloß nicht daran denken
lieber laufen
hier sein
auf ihren Spuren
im Wald
laufen, schneller, springen
über Wurzeln, Äste, Steine
schneller, immer schneller
die Kraft meiner starken Beine nutzen
um vorwärtszupreschen, weil
er sich sonst wieder in mir breitmacht
der Gedanke an sie und die hunderttausend
Schicksale, die ihr begegnet sein könnten
schneller, immer schneller
den Pfad habe ich schon lange
hinter mir gelassen, ducke mich
unter niedrigen Blattdächern hindurch, renne
an Pilzen und moosbedeckten Stümpfen vorbei
schneller, immer schneller
bis ich
stol
pere
direkt vor mir ein Baum
und auch ohne sich zu bewegen
besiegt er meine schützenden Hände.
Mein Gesicht schrammt
über die raue Rinde
meine Stirn begegnet
dem harten Stamm
mit einem dumpfen Knall
und das Letzte, was ich
vor der Dunkelheit denke, ist:
So
sterbe
ich
nicht.
da ist sie
so nah
ein sehnen
in jedem
unserer blätter
nach füßen
nur ein letztes mal
um ihr entgegenzueilen
ohn eunsere wurzeln
der erde
zu entreißen
Lindiwe:
sie ist da
Und ja, so sterbe ich nicht.
Und doch
ist wieder etwas anders
als ich zu Bewusstsein komme
mein Sehen und Hören
noch ganz verschwommen.
In die Geräusche des Waldes
mischt sich eine vertraute Melodie.
Sie will von Käfern und Hoffnung singen
ihr IsiXhosa ins junge Laub mischen.
Und dann ist da
diese eine Stimme:
»Sisi, Sisi
wach auf.«
Mein Atmen ein Röcheln, denn
überall ist Laub, statt Luft
atme ich trockene Blätter ein, schon wieder
mein ganzer Mund ist voll von ihnen.
Hastig komme ich hoch, setze mich auf
und kratze mit meinen Fingern den Mund frei
muss dabei leicht würgen, weil ein Kastanienblatt
in meinem Rachen festsitzt.
Für einen Moment sehe ich
unsere Hütte mit der roten Plane
zwischen den Bäumen, dann wird sie
vom Braun und Grün des Waldes geschluckt.
Mein vierter Blackout im Wald
seit ihrem Verschwinden
gewöhnen kann ich mich
trotzdem nicht daran.
»Sisi, Sisi.«
Khanyi, noch immer.
Ich blicke in alle Richtungen
doch da ist niemand
nur der Baum direkt vor mir
gegen den ich im Sturz geprallt bin
eine große Eiche
mit breitem Stamm.
Und überall auf mir:
Laub in dicken Schichten, so als
hätte der Wald mich zugedeckt
ohne die Absicht
mich gehen zu lassen.
auch ohne augen
die wir schließen können
träumen wir
noch immer
von den frauen
sehen uns selbst
lächelnd
zwischen ihnen stehen
was wir jetzt wieder wissen
träume
bemerken es wenn
wir sie bemerken
sie wollen uns dinge sagen
für die uns sonst die ohren
fehlen um sie zu hören
immer sehen wir sie
Lindiwe
denn wir haben
auf sie gewartet
bis jetzt bis
jetzt bis
jetzt
»Sisi, Sisi.«
Ihrem Flüstern folgen, der verbotenen Melodie.
Vorbei an Vermisstenanzeigen
Marius wird vermisst und Waldo ebenso
der eine 16, der andere 6
zwei Beine und vier
Verzweiflung hält das Papier an den Bäumen
nicht allein die Reißzwecken, die in Rinde stechen.
Noch eine Weile schleppe ich meinen Körper
durch den Wald, doch nichts
keine Spur.
Die Musik zieht mich vorwärts
will mich tänzelnd aber
ich kann nur stolpern.
Sie sollte nicht hier sein
und ich auch nicht.
Auf einer Lichtung unter einem Ahornbaum
bleibe ich stehen, lehne mich gegen den Stamm
schließe die Augen und sehe
Khanyi vor mir:
Wie sie in den Wald geht
die Abenddämmerung lässt sie
in einem Himmelslodern aufgehen.
In meiner Vorstellung dreht sie sich
ein letztes Mal um
schaut in die Richtung
unseres Zuhauses
doch ich glaube
in Wirklichkeit
hat sie nie
zurückgeblickt.
Flugsamen des Ahorns
segeln um mich herum zu Boden
immerzu an mir vorbei.
Die Schürfwunden an meinem Arm
und meinen Händen haben aufgehört
zu bluten, die Beule an meinem Kopf
pocht weiter, weiter, weiter
ein Beat, der meinen Herzschlag begleitet.
Vor Jahren hat Khanyi mir gezeigt
wie ich meinen Puls fühlen kann.
»Dann weißt du immer
egal was gerade geschieht:
Du bist wirklich noch
am Leben.«
Sie war damals vielleicht 12
auf ewig drei Jahre älter als ich
und schon länger davon überzeugt
dass wir in Träumen
keinen Herzschlag besitzen.
Jede Nacht nahm sie sich vor, es
dieses Mal zu überprüfen
im Traum endlich
ihren Puls zu kontrollieren.
Sie hat es nie geschafft
sie hat so vieles
nicht mehr geschafft
hat nur Fragen hinterlassen
und keine Antworten
nicht einmal
für mich.
Ich trete aus dem Wald
lasse sie dort
die Erinnerungen an sie
ihre Melodie
ihre Stimme
kehre zurück in die Welt
fahrende Autos bellende Hunde ein Radfahrer streitet sich mit einer Rentnerin und das Leben greift nach mir greift nach meinen leeren Händen und der Weite zwischen meinen Rippen.
Unter der Dusche beeile ich mich.
Wir sind bereits viel zu spät dran, weil ich nicht aufhören konnte, ihrer Stimme und der Melodie zu folgen, um sie endlich wiederzufinden. Die Worte des Lieds plätschern aus meinem Mund und fließen mit dem Wasser den Abfluss hinab. Ich verstumme schnell, als es an der Tür klopft.
»Lindiwe, Turbo!« Baba ruft durch die geschlossene Tür. »Du weißt es seit Wochen, heute müssen wir echt mal pünktlich sein …«
»Askies!«, antworte ich als Entschuldigung.
Überall an mir klebt noch der Wald. Beim Einschäumen flattern goldgelbe, herzförmige Blätter und farnähnliches Grün aus meinen Achseln herab, werden vom Duschstrahl niedergedrückt, verlieren ihre Form im matschigen Gemenge zu meinen Füßen. Die Melodie streicht erneut über meine Lippen, noch bevor ich mich stoppen kann. Nicht das erste Mal, dass ich sie im Wald gehört habe. Auch nicht das erste Mal, dass ich sie mit nach Hause bringe, hinter Türen, die geschlossen sind. Es ist der Käfer, sagt das Lied. Er zeigt uns den Weg nach Hause. Er zeigt uns den Weg in die Zukunft.
Nach dem Duschen, ein schneller Blick in den Spiegel: Meine Haare sind mal wieder einen Fingerbreit über Nacht gewachsen. Ich schiebe sie etwas über die Beule an meiner Stirn und rasiere den Undercut nach, so wie ich es seit Wochen fast jeden Morgen tun muss. Mit einer kleinen Schere kürze ich auch den Flaum auf meiner Wange, schmiere etwas von Khanyis Concealer drüber, bis das Grün nicht mehr hervorscheint. Ich mache es nicht gerne, denn Geheimnisse sind wie Wunden, wenn du sie einfach verdeckst, anstatt sie zu reinigen, können sie nicht heilen. Sie brauchen Luft, Sonne, sie wollen gesehen werden. Aber dieses Geheimnis kann ich anderen nicht zumuten, meine Eltern tragen schon so viel, nicht das auch noch. Es wiegt schwer wie ein ganzer Wald, Khanyis letztes Vermächtnis an mich.
Mamas Pulli riecht nach Schweiß. Der Geruch schwappt mit jeder ihrer Bewegungen zu mir herüber, will ankern, direkt in meiner Nase. Ihre Haare hat sie auch seit zwei Wochen nicht mehr gewaschen. Bis jemand in der Tanzschule endlich mal etwas sagt, kann es nicht mehr lange dauern, auch Trauer besitzt ein Verfallsdatum als Entschuldigung.
Zu fünft stehen wir am Flughafen, ganz vorne bei der Ankunft. Meine Brüder, die Zwillinge Mandlenkosi und Bonginkosi, haben ein Schild gemalt
– SANIBONANI, GOGO! –
mit einem gespiegelten S und As, die Spagat üben. Zusammen, sagen sie, obwohl alle wissen: Mandla war’s alleine. Wer sonst kann mit fünf schon schreiben?
Mandla hat es sich vor ein paar Monaten mithilfe von Cornflakes-Packungen und Bildwörterbüchern selbst beigebracht. Baba ist sogar in den muffligen Keller gegangen, um unsere alten Schulbücher und Schreibhefte sowie Mamas verstaubte Zulu-Lernbücher hochzuholen.
Alle meine Geschwister sind Genies. Mandla, das Lese- und Schreibwunder. Bongi kann jedes Instrument spielen, das er in die Hände kriegt, seit über einem Jahr nimmt er Klavierunterricht bei Ntate Pitso. Khanyi gehörte schon immer das Tanzstudio. Und mir? Mir gehört nichts, außer etwa 30 bestickten Stück Stoff und dem Black-Futures-Regal in unserer Schulbibliothek, das ich selbst eingerichtet habe. Nichts davon ein Talent, zumindest in meiner Familie.
Heute am Flughafen ist unsere Familien-Reihenfolge von links nach rechts:
Ich Baba Mandla Bongi Mama
und in all den Zwischenräumen
anstelle von Luft zum Atmen:
siesiesiesie
Khanyi
so viel Platz einnehmend
als gäbe es zwei von ihr.
Sie hat uns alle immer verbunden, jetzt verbinden Baba und mich nur unsere Hände in den Hosentaschen, unsere festen Beine auf dem festen Boden, die leicht nach vorn gebeugte Haltung, als würden wir immerzu mit dem Wind kämpfen. Uns trennen ein halber Kopf an Größe, ein paar Jahrzehnte und unterschiedliche Hauttöne, die sich oft in unseren Erfahrungen widerspiegeln und in dem Platz, der uns in dieser Welt zugeschrieben wird. Mein Hellbraun irgendwo zwischen seiner dunklen Haut und Mamas heller zu Hause. Im Dazwischen und doch immer am Rand, ganz anders als Khanyi,
ich.
Neben Baba versuchen die Zwillinge einander auf die Füße zu treten, das Schild schwappt in ihren Händen. Mama zischt sie immer wieder an, aber mit so wenig Energie, dass ihre Worte von den Flughafengeräuschen geschluckt werden, noch bevor sie Mandla und Bongi erreichen.
Links von mir rempelt jemand vorbei, quetscht sich zwischen einem Betonpfeiler und mir hindurch. Alle haben es so eilig in Flughäfen, auch wenn sie schon sicher und gut angekommen sind, als würde die Bewegung des Flugs in ihrem Körper fortleben, ihn vorwärtsdrängen.
»Musste ich wirklich mitkommen?«, grummele ich Baba an.
»Natürlich, meine Liebe. Du weißt, wie viel du ihr bedeutest.«
Baba legt seinen Arm um mich, drückt gegen den blauen Fleck an meinem Oberarm, den er unter meinem schwarzen Hoodie nicht sehen kann. Ich will Gogo ja auch wiedersehen, aber nach diesem Morgen im Wald ist mir der Flughafen zu laut, zu voll, zu hektisch.
Und dann sind da auch noch die Polizist*innen. Waffen über rauem Stoff, von Haut weit entfernt und doch wird Haut nach ihnen greifen, wenn sie es als erforderlich betrachten, werden Körper auf Körper schießen, wenn es ihnen berechtigt erscheint. Wer lebt und wer stirbt, entscheiden oft zwei blasse Finger und ein Kopf, der aufgewachsen ist mit der Angst vorm Schwarzen Mann. Jetzt wimmeln sie nur über den Flughafen wie Kakerlaken, im Wissen, sie wollen uns alle überleben.
Ich bemerke ihre Blicke, die immer wieder bei uns fünf stotternd hängen bleiben und sie sagen sich selbst bestimmt, sie schauen nur zwei, drei, vier Mal hin, weil hier junge Menschen stehen und genau diese gerade das Problem sind. Aber wir sind schon so lange das Problem, dass wir die Wahrheit kennen.
Jede Bewegung um mich herum, jede Ansage, jeder hastige Schritt auf dem nackten Boden kratzt sich in mich hinein. Und doch stehe ich hier, bewege mich nicht vom Fleck, bis wir sie erblicken: Gogo. Eine der letzten, die durchs Gate kommen, mit nichts als einer Handtasche bei sich und einer Decke über den Schultern, als wäre sie das erste Mal in Deutschland und würde im Oktober jederzeit einen Schneesturm erwarten.
»Gogo, wo sind deine Koffer?«, rufe ich ihr auf IsiZulu zu, noch bevor sie bei uns angekommen ist, weil es jetzt meine Aufgabe ist, mich um sie zu kümmern, jetzt, wo ich die Älteste bin.
Gogo macht einen Schritt zur Seite, wartet, bis ich sie sehen kann: die Koffer auf einem Gepäckwagen, geschoben von einem Mädchen mit genauso dicken Braids und dunkelrotem, fast schwarzen Lippenstift, wie Khanyi ihn auch gerne getragen hat. Nur ist ihre Haut dunkler, eine tiefere Erdschicht kleidet ihr Fleisch, ihr Körper ist weicher, breiter, mehr Meer als Khanyis, ein Ozean unter einem flatternden Kleid, bereit, jederzeit Wellen zu schlagen und alles zu überschwemmen. Selbst das Tuch um ihren Hals hat fließende Enden, als es von einem Luftstoß erwischt wird.
»Hayi wena, this now how you greeting your grandmother?«, ermahnt mich Gogo mit einem Lächeln in einem Mix aus Englisch und IsiZulu, lenkt meinen Blick zurück zu sich. »Erst diese unsägliche Befragung der Polizei und jetzt das hier – mein Enkelkind hat seine Manieren verloren. Du warst wohl zu lange nicht mehr zu Hause.«
Zuhause nennt sie Südafrika, weil es ihr Zuhause ist, schon immer war und immer sein wird. Zuhause nennt sie Südafrika aber auch, wenn sie über mich spricht, über Baba, über meine Geschwister, so als wären wir alle hier in Deutschland genau wie sie immer nur zu Besuch.
Nachdem wir uns begrüßt haben, nachdem Gogo mein Gesicht in ihre warmen Hände genommen und mich für einen Kuss zu sich heruntergezogen hat, nachdem sie meinen Brüdern und mir selbst gemachte Amagwinya in die offenen Hände gelegt hat, köstliche, golden leuchtende Amagwinya, die zwölf Stunden Flug überstanden haben, nach alledem beantwortet Baba endlich die Frage, die ich nicht zu stellen wage. Die ganze Zeit kann ich meinen Blick nicht von diesem Mädchen abwenden, das bei uns allen steht, als würde es dazugehören.
»Das ist Unathi, eure Cousine«, sagt Baba auf Englisch zu mir und meinen Brüdern.
»Und?« Denn das ist noch nicht Antwort genug.
»Und sie begleitet Gogo, sie wird also auch bei uns wohnen.«
Ich wechsle ins Deutsche: »Wo soll sie denn schlafen? Jetzt wo Gogo da ist, wird’s ziemlich eng.«
Ich verschränke die Arme, das frittierte Hefebällchen noch in meiner Hand. Die Zwillinge haben ihre Amagwinya schon aufgegessen und Mama sucht nach Taschentüchern für die fettglänzenden Gesichter.
Baba spiegelt meine Haltung, legt Muskeln über Muskeln und macht den Rücken gerade gegen meinen Wind. »Du weißt, wo sie bleiben wird«, antwortet er mir, ebenfalls auf Deutsch. »Es ist ja auch nur für drei Wochen.«
Ein Zittern in meinen Beinen, als würde die Erde wackeln. Nein, denke ich nur. »Nein«, sage ich auch und es rüttelt durch meinen ganzen Körper.
Mal wieder, schon wieder, haben er und Mama Entscheidungen für mich getroffen anstatt mit mir. Wie sehr ich das hasse. Doch ich kann mich nicht darauf konzentrieren, nicht jetzt. Dieses Nein will aus mir hinaus, wegrennen und mich mit sich fortziehen, hinaus aus meinem Körper, weg von hier, von ihm und ihnen allen. Aber ich muss bleiben, und wenn es nur ist, um ihren Platz in meiner Welt zu verteidigen, damit die Erinnerungen an sie nicht zerstört werden
an sie
Sisi
Sisi
meine große Schwester
Nokukhanya.
Vertraut ist mein Fliehen aus dem eigenen Körper nicht nur mir selbst.
Baba nimmt meine Hände in seine, schenkt meinen herumhuschenden Augen mit seinem Blick Halt, senkt die Schultern und die Stimme: »Wir müssen sie alle ein bisschen loslassen, um weitermachen zu können. Nur ein kleines bisschen, damit für uns wieder mehr Platz ist.«
»Ich kann nicht, kann’s einfach nicht!«, stoße ich hervor. »Was hast du in der Gruppe gelernt, Lindiwe?« Seine Stimme ein Ast, an dem ich mich festhalten kann.
»Tief … durchatmen«, sage ich, »fünfmal weit in den Bauch hinein. Beim Ausatmen summen, aber shit, das ist so bekloppt.«
»Nicht bekloppter, als wenn du gleich so stark hyperventilierst, dass ich dir eine Tüte besorgen muss.«
Baba zieht mich an sich heran, bis mein Kopf auf seiner Schulter ankommt. Gogo redet auf Englisch mit Mama und die Zwillinge zeigen diesem neuen Mädchen etwas auf Mamas Smartphone. Quietschende Rollen, klackernde Absätze, surrende Durchsagen, untrennbares Stimmenrauschen um uns herum, aber auf Babas Schulter wohnt die Ruhe und lädt mich zu sich ins Haus hinein.
»Also, durchatmen«, er streicht mir über den Rücken, »und dann einen Satz dazu, wie es dir gerade geht. Vergiss das nicht.«
Wie könnte ich den Satz vergessen? Er ist wirklich das Bekloppteste daran. Der Gruppenleiter: ein gescheiterter Schriftsteller, der jetzt seine Tage nicht mit Worten auf Papier, sondern mit Worten an leicht gestörte Jugendliche wie mich verbrachte. Ein Satz. Der erste Satz in meinem Kopf dazu, wie es mir gerade geht, wenn meine Seele herausdrängt und mich zurücklässt, ankerlos, nur mit einem Körper, der nicht mehr mir gehört.
Ich schließe die Augen. Beim ersten tiefen Atemzug pulsiert um mich herum noch die Erde, das Leben, die Welt. Da ist so viel Lärm, der in mich eindringen will, so viele Energien, die sich unter meine Lider quetschen wollen. Aber dann kommt die Ruhe. Mit jedem Atemzug, mit jedem Weiten meines Brustkorbs und Ausdehnens meines Bauchs. Ich spüre die Luft, wie sie in mir strömt, bis in meine Zehen und meine Fingerspitzen. Als sie uns das im Kurs beigebracht haben, dem Atem nachzuspüren, in jeden Teil unseres Körpers hineinzufühlen, da habe ich sie ausgelacht, aber ja, es funktioniert. (Auch wenn ich das nie zugeben würde.)
Hier ist er, mein Satz:
Ich fühle mich wie ein ewiges Problem wie eine
Gleichung die nie aufgeht weil etwas fehlt weil
jemand fehlt weil ich allein nie genug bin egal auf
welcher Seite ich stehe.
Als ich die Augen wieder öffne, sehe ich sie alle um Baba und mich herum. Sie bilden einen Halbkreis, schirmen uns vom Flughafenchaos ab. Hinter einer Glasfront steigt ein Flugzeug in den Himmel empor. Trotz seines Gewichts lässt es sich von der Schwerkraft nicht aufhalten, hat ein klares Ziel, auf das es zustrebt. Und ich … ich bin mal wieder diejenige, die alle nur ausbremst. Die Schwerkraft in meiner Familie, diejenige, die sie zu Boden drückt, wenn sie doch fliegen wollen.
»Geht ruhig schon mal vor«, sagt Baba.
Dieses neue Mädchen steht ein wenig hinter Gogo, überragt sie um einen ganzen Kopf, genau wie Khanyi es immer getan hat. Den Wagen mit Gogos Koffern lässt sie nicht los. In mir noch immer das Nein, auch als sich die anderen langsam von uns fortbewegen und Baba und ich zurückbleiben. Mama dreht sich ein letztes Mal um, Baba schickt ihr einen Luftkuss. Menschen stoßen mich beim Vorbeigehen an, ich bin ihnen allen nur im Weg. Hier ist kein Platz für mich und kein Platz dafür, wie sich alles in mir beim Gedanken daran zusammenzieht, dass dieses fremde Mädchen, diese Cousine, von der ich noch nie gehört habe, die aus einem Leben stammen muss, über das in unserer Familie nicht gesprochen wird, nun mit mir in unserem Zimmer schlafen soll, im Bett meiner vermissten Schwester.
Wie soll ich Khanyi das erklären, wenn ich sie
endlich gefunden habe? Denn genau das
werde ich bald tun, nicht Baba, nicht
Mama, nur ich. Im Dazwischen
am Rand und doch nah
ganz nah bei
ihr
.
»Alles in Ordnung?«
Baba hält noch immer meine Fäuste fest, auch wenn sie schon geschmolzen sind. Gleichzeitig drehen wir uns zur Stimme um: ein Sturmgewehr, ein Schnurrbart, stahlblaue Augen.
»Natürlich«, antwortet Baba schnell, lässt mich los, aber rückt zugleich näher an mich heran. Er stellt sich mit seinen bergigen Muskeln vor mich, bildet eine Felslandschaft, undurchquerbar. »Ist nur die ganze Aufregung.«
»Ganz sicher? Wir können vorsichtshalber schnell die Temperatur messen.«
»Nicht nötig, das haben wir natürlich schon heute Morgen gemacht, wie jeden Morgen seit 48 Tagen.« Er geht einen Schritt nach vorne, nur einen kleinen, aber wächst dabei in die Breite und Höhe. Gestein. »Und wir beide wissen, noch können Sie uns nicht dazu zwingen. Noch nicht.«
Eine Vierteldrehung zu mir, eine Hand auf meiner Schulter. Ohne Gewehrschnurrbartstahlblau aus dem Blick zu lassen, dirigiert er unseren Abgang. Seine Hand zeichnet den Weg hinaus auf meine Haut, durch jede Schicht Stoff hindurch, direkt in mich hinein.
Erst als ich wenig später im Van neben diesem Mädchen auf der hintersten Bank sitze, traue ich mich, tief auszuatmen. Wir haben heute Morgen nicht meine Temperatur gemessen und genauso wenig die 47 Tage zuvor. Ich weiß nicht, wie Baba solche Lügen vor Gott rechtfertigt, vor seinem Gott. Vielleicht mit irgendwas aus dem 1. Timotheusbrief. Und damit, dass wir gewaschen sind, in the blood of Jesus, no weapon formed against us shall prosper. No virus either, oder so.
Das Mädchen will reden, über irgendwas reden, die Stille füllen, egal womit. Ich frage sie, warum sie so gut Deutsch kann, auch wenn ich die Frage selbst furchtbar finde. Sie geht seit Jahren auf die deutsche Schule in Johannesburg, Onkel Xolani bezahlt es. Gogo weigert sich noch immer, auch nur ein Wort auf Deutsch zu lernen, genau wie sie sich weigert, jemals wieder Afrikaans zu sprechen.
Ich betrachte das Mädchen, diese neue Cousine aus dem Augenwinkel, sie kommt mir bekannt vor. Aber vielleicht ist es nur der Lippenstift oder der Vollmond, der ihr seine Konturen geliehen hat, genau wie unzähligen anderen in Südafrika. Sie hat eine Narbe auf ihrer Schläfe, die einen Bruch in diesem fließenden Gesicht verursacht. Aber sie bricht ihr Gesicht nicht wirklich, sie vollendet es.
Das Mädchen macht mir Komplimente zu meinem Outfit, versucht es damit, dass ihr mein Hoodie gefällt, aber niemand mag meinen Hoodie, nicht mal ich selbst. Es ist nur ein Pullover, er war sauber, lag oben auf dem Wäscheberg, jetzt hängt er an mir anstatt an einem Kleiderbügel. Schwarz, wie alles in meinem Schrank. Aber so verblichen, dass es auch grau sein könnte, stonewashed oder so ein Scheiß. Khanyi hätte bestimmt dafür gesorgt, dass meine Sachen ihre Farbe behalten. Schwärze braucht selbst in der Waschmaschine Schutz, sonst wird sie weggespült. Khanyi hat früher auch immer Seifenstücke zwischen die Wäschestapel in unserem gemeinsamen Schrank gelegt, sodass meine Hosen nach Lavendel rochen, meine T-Shirts nach Rosen, selbst meine Unterhosen: Orangen. Jetzt riecht alles nur noch nach Mamas Ökowaschpulver, also nach gar nichts.
Mir gefällt das Tuch um den Hals des Mädchens, ein langes Stück Waxprint mit vielen gelben Kreisen und geometrischen Figuren auf türkisfarbenem Grund. Ich sage es ihr, um etwas zu erwidern, aber sie zieht es nur enger um ihren Hals und redet immer weiter. Vom Flug, vom Wetter, von Germany. Und dabei lächelt sie mich so an, als würden wir uns aus einem anderen Leben kennen. Ich habe nur das eine und das ist jetzt gerade auf einem Tiefpunkt. Ich könnte im Wald sein, stattdessen sitze ich hier, lege einen Panzer um mich, Schild für Schild, bis keine Stelle von mir mehr offenliegt.
Khanyi und ich haben uns immer ein Zimmer geteilt, seitdem ich eins war und sie vier. Wenn ich nachts aus Träumen voller Schlangen aufgewacht bin, war sie es, die mich in den Schlaf flüsterte. Sie nahm die Spieluhr von ihrem Nachttisch und kam zu meiner Seite des Zimmers herüber. Zog sie auf und sang leise vom Käfer. Immer wieder aufziehen, immer wieder Käfer. Dabei kuschelte sie sich ganz eng an mich, formte ihren Körper zu einem Mantel für meinen, auch wenn er so schmal war, als würde sie ihn ausfächern, zerteilen in seine vielen Schichten, damit er alles an mir bedeckte.
»Isʼ was?«, unterbreche ich das Mädchen. Autos rasen auf der Stadtbahn an uns vorbei, Baba fährt immer auf dem Mittelstreifen, nie auf der Überholspur.
»Alles easy«, antwortet sie nur.
Ihr Lächeln legt sich über ihr ganzes Gesicht. Gleichzeitig hört sie nicht auf, mich von der Seite aus anzustarren. Sie schaut nicht wie die meisten auf meine Arme, an denen meine Haut in Hell und Dunkel zerfällt. Nein, dieses Mädchen guckt immerzu auf meine Wange, genau auf die Stelle, an der sich unter Make-up der Ausschlag versteckt.
Shit, shit, shit.
Vielleicht ist der Concealer zu alt, immerhin ist er ja noch von Khanyi und eigentlich auch zu dunkel für meinen Hautton, aber ich habe mit der Zeit gelernt, wie ich ihn verreiben muss, damit er alles gut verdeckt. Und bisher hat niemand etwas wegen des Ausschlags gesagt, weder zu Hause noch auf der Straße oder in der Schule. Bis jetzt, bis zu ihrer Ankunft in meinem Leben. Sie, die nicht aufhört, mich anzustarren, so als würde sie durch jede Schicht hindurchblicken können. Als wäre alles an mir entblößt vor ihren Augen. Und mir gefällt das hier gerade gar nicht.
sie ist nicht
mehr allein
sie wird viele
es hat begonnen
und wir
werden ihnen allen
entgegenkommen
werden unsere blätter schicken
und unsere samen
was wir jetzt wieder wissen
verbundene bäume
kämpfen oftmals nicht
um lichtraum im wald
sie geben einander
raum zum wachsen
teilen sich die sonne und
nährstoffe über ihre wurzeln
leben zusammen
manchmal
sterben sie sogar zusammen
sie stehen und fallen gemeinsam
verbunden














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














