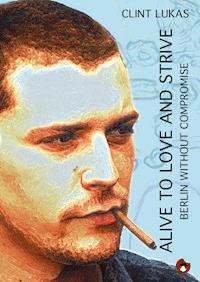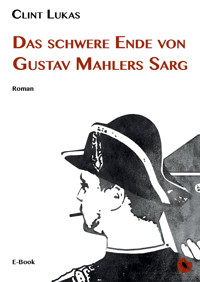Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GU Audiobook
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: GU Einzeltitel Partnerschaft & Familie
- Sprache: Deutsch
Einschlafbegleitung, Beikost, Buddelzeug - welche Eltern könnten kein Lied davon singen, wie anstrengend die Sache mit den lieben Kleinen werden kann? Clint Lukas ist da keine Ausnahme. Doch ein klassisches Vorbild ist er noch weniger: Fette Burger zum seichten Filmabend? Gern. Verkatert dem berechtigten Wunsch nach Topfschlagen nachgeben? Muss eben sein. Mit dem Kind zum Pferderennen, gar in die Bar? Auf das Wie kommt es an. Es gibt viele Wege, ein guter Vater zu sein. Der Kolumnist und Lebemann von Mit Vergnügen Berlin erzählt mit einem guten Schuss schwarzen Humors aus seinem Alltag zwischen Kneipe und Spielplatz, und es wird klar: Man kann sein Kind auch liebevoll großziehen, ohne sich verrückt zu machen.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Unsere eBooks werden auf kindle paperwhite, iBooks (iPad) und tolino vision 3 HD optimiert. Auf anderen Lesegeräten bzw. in anderen Lese-Softwares und -Apps kann es zu Verschiebungen in der Darstellung von Textelementen und Tabellen kommen, die leider nicht zu vermeiden sind. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Impressum
© eBook: 2023 GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, Postfach 860366, 81630 München
© Printausgabe: 2023 GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, Postfach 860366, 81630 München
Gräfe und Unzer ist eine eingetragene Marke der GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, www.gu.de
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Verbreitung durch Bild, Funk, Fernsehen und Internet, durch fotomechanische Wiedergabe, Tonträger und Datenverarbeitungssysteme jeder Art nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.
Projektleitung: Petra Bradatsch
Lektorat: Petra Müller, Berlin
Bildredaktion: Simone Hoffmann
Covergestaltung: ki36 Editorial Design, Petra Schmidt
eBook-Herstellung: Pia Schwarzmann
ISBN 978-3-8338-8927-1
01. Auflage 2023
Bildnachweis
Coverabbildung: privat
Illustrationen: The noun project; iStockphoto
Fotos: Norman Poznan (Autorenfoto)
Syndication: www.seasons.agency
GuU GuU 8-8927 04_2023_02
Unser E-Book enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Im Laufe der Zeit können die Adressen vereinzelt ungültig werden und/oder deren Inhalte sich ändern.
Die GU-Homepage finden Sie im Internet unter www.gu.de
www.facebook.com/gu.verlag
vorwort
Dieses Buch erzählt von meiner Entwicklung als Vater. Und versucht, Antworten zu finden. Es erzählt von meinem nervenaufreibenden Alltag mit Kind, und wie sich dieser verändert hat, seit ich für die Hälfte der Woche alleinerziehend bin. Denn selbstverständlich ändern sich ein paar Sachen.
»Mit einem Kind ändert sich alles«, haben sie mir gesagt. »Dein Leben wird nie wieder so sein, wie es war. Du wirst andere Freunde haben, neue Freunde, mit Kindern. Du wirst nur noch auf Spielplätzen rumhängen und abends um sieben todmüde ins Bett fallen.«
Die erste Frage, die sich mir dahingehend stellte, war: Wenn das alles so schlimm und anstrengend ist, warum sollte man dann überhaupt ein Kind kriegen? Man will doch Freude am Leben haben. Zumindest möchte ich das. Und käme jemand daher und würde sagen: »Ich hänge dir ab heute 24/7 an der Backe und nerve dich von früh bis spät!«, sähe ich keinen Grund, mich auf einen derart lausigen Deal einzulassen.
Allerdings reden die Leute ja immer viel, wenn der Tag lang ist. Deshalb wollte ich diesen Worten vor der Geburt meiner Tochter Wanda keinen Glauben schenken. Ich dachte mir: Ich habe eine tolle Frau an meiner Seite, die genauso gierig aufs Leben ist wie ich selbst. Es müsste doch zu schaffen sein, das Schicksal auszutricksen.
Mir war natürlich nicht entgangen, dass junge Eltern oft irgendwie seltsam sind. Dass sie mit ihrem Nachwuchs ganz anders reden, dabei ihre Stimme verstellen, als hätten sie Helium geschluckt, und von sich selbst in der dritten Person sprechen. »Soll die Mama dem Lasse einen Schluck Urmöhrensaft einschenken?«
Nein, Mama, lass mal stecken.
Schon damals fragte ich mich: Muss das sein? Steht irgendwo geschrieben, dass man mit seinem Kind so affektiert umgehen muss? Und warum wischen diese Eltern ununterbrochen mit Feuchttüchern an ihrer Brut herum? Ist es doch so, wie es in all den Ratgebern steht? Dass sich mit einem Kind alles ändert? Komplett? Oder waren die vorher schon so bescheuert?
Nora, die Mutter meiner Tochter, und ich waren so kühn, uns zu wünschen, dass nicht alles anders wird. Wir wünschten uns, dass wir auch mit Kind unsere alten Freunde behalten. Dass wir reisen können und auf Konzerte gehen. Dass wir uns trotz Kind verwirklichen können, oder noch besser: mit dem Kind.
Kleiner Spoiler-Alert: Anfangs lief alles ganz gut. Als Wanda drei war, haben Nora und ich uns getrennt. Seit fünf Jahren praktizieren wir ein Wechselmodell. Was jedoch nichts daran geändert hat, dass wir ein wildes, aufregendes Leben führen wollen. Ist das naiv? Egoistisch? Hat vielleicht genau diese Hybris zur Trennung geführt? Oder ist alles genauso, wie es sein soll?
Dieses Buch erzählt von meiner Entwicklung als Vater. Und versucht dabei, Antworten auf diese Fragen zu finden. Es erzählt von meinem nervenaufreibenden Alltag mit Kind, und wie sich dieser verändert hat, seit ich für die Hälfte der Woche alleinerziehend bin. Denn selbstverständlich ändern sich ein paar Sachen. Auch wenn man es nur zähneknirschend zugeben möchte. Man ist ausgeliefert und wird Tag für Tag mit den absurdesten Situationen konfrontiert. Ab einem gewissen Kindesalter ist zum Beispiel der tägliche Gang auf den Spielplatz unvermeidlich. Allerdings muss man sich nicht mitten rein stürzen in das Getümmel der Helikoptereltern. Und wenn die Kleinteile sich um das Buddelzeug streiten, muss niemand einen Stellvertreterkrieg führen.
»Kiiira … Hast du das Mädchen gefragt, ob du seine Schaufel nehmen darfst?«
»Annegret … Darf die Kira eine von deinen Schaufeln haben? Du spielst doch gar nicht damit. Nein, Annegret, nicht mit Sand werfen. ANNEGRET!«
Stattdessen kann man sich vornehm im Hintergrund halten. Ein finsterer Blick und ein aufgeschlagener Nietzsche-Band wirken Wunder. Oder man bringt gleich ein paar Freunde und ein Sixpack Bier mit.
Es ist nicht leicht, einen klaren Kopf zu behalten, wenn übereifrige Väter nicht aufhören Zwischenfragen zu stellen, und der Elternabend niemals zu enden droht. Man kann nur schwer seinen Gedanken nachhängen, wenn man in der U-Bahn laut hörbar gefragt wird: »Papa, warum ist der Mann schwarz? Ist der böse?« Man muss die Arschbacken zusammenkneifen, wenn man den schlimmsten Kater seines Lebens hat und das Kind berechtigterweise trotzdem Topfschlagen spielen will. Und vor allem erfordert es einen eisernen Willen, sich auch mit Kind selbst zu verwirklichen, ob in der Kunst oder in der Liebe. Cool trotz Kind erzählt von diesem Spagat.
Durch meine Kolumnen im Tagesspiegel und bei Mit Vergnügen Berlin, in denen ich mich als alleinerziehender, noch immer dem Laster zugeneigter Vater zur Schau stelle, weiß ich, wie es ist, unter der Beobachtung von Moralaposteln zu stehen und sich für erkämpfte Freiräume rechtfertigen zu müssen. Deshalb ist Cool trotz Kind nicht nur eine Antwort auf den Kontrollwahn spaßbefreiter Helikoptereltern, sondern ein Buch, das Mut machen soll. Mut dazu, die Interessen des Kindes nicht bedingungslos über die eigenen zu stellen.
Man darf sich nicht beirren lassen, wenn die Blicke der Leute sagen: »Muss der seinem Kind wirklich zumuten, ins Flugzeug zu steigen?« oder »Können die nicht zu Hause essen, der Kleinen wird doch total langweilig?« Auch als alleinerziehender Vater habe ich ein Recht darauf, in den Urlaub zu fliegen oder im Restaurant zu Abend zu essen. Es ist eben meine Aufgabe, meine Tochter miteinzubeziehen – indem ich mich mit ihr beschäftige. Gemeinsames Erleben verbindet nämlich, und schafft eine Beziehung auf Augenhöhe.
Bei alldem sollte vielleicht klargestellt werden, dass ich nicht davon ausgehe, die Wahrheit für mich gepachtet zu haben. Ich habe meist keine Ahnung davon, was ich tue. Und selbst wenn dieses Statement im Vorwort eines Ratgebers überraschen mag: Es ist mir schleierhaft, wie sich überhaupt irgendwer hinstellen und behaupten kann, er oder sie wüsste es. Hut ab vor so viel Selbstvertrauen!
Für mich gab es immer nur das Trial-and-Error-Prinzip. Ich hatte viele Erfolgsmomente mit meiner Tochter und bin noch öfter gescheitert, mit meinen Ansprüchen und meinen kläglich zusammengeschusterten Erziehungsmethoden. Aber Fehler sind nichts, wofür man sich schämen muss, schon gar nicht vor dem eigenen Kind.
Wer also professionelle Ratschläge sucht, sollte sich an einen der zahllosen klugen Menschen mit echter Expertise wenden. Und wer findet, dass ich einen an der Waffel habe oder mir anderweitig nicht folgen kann, darf auch am Schluss des Buchs im Glossar nachschlagen, was ich mir zu den einzelnen Themen so denke. Bis dahin kann ich nichts weiter tun, als mir alles frei von der Leber wegzuschreiben – in all meiner ungenügenden Glorie.
kinder wunsch, dies, das
Wenn man sich liebt, wenn man cool miteinander ist UND sich das Kinderkriegen grundsätzlich vorstellen kann, sollte man es lieber früh riskieren als spät.
Ich wollte kein Kind. Genauso wie ich nie ein Haustier wollte. Ich scheute mich sogar vor der Verantwortung, eine Topfpflanze zu besitzen. Wie soll das gehen, wenn man ständig in der Weltgeschichte unterwegs ist, gerne reist und den Wohnsitz wechselt? Man müsste dauernd jemanden nerven, dass er zum Gießen und Füttern kommt.
Ich habe mehrere Jahre in Folge als Stage-Manager bei einem Tour-Theater gearbeitet, war monatelang in Israel, Prag oder Wien. Auch als Autor fuhr ich oft durchs Land, trat bei Lesungen auf, übernachtete in Hotels oder bei flüchtigen Frauenbekanntschaften.
Wenn sich aus einem dieser Kontakte doch mal so was wie eine Beziehung entwickelte, waren meine Partnerinnen meist Frauen mit ähnlichem Lebensentwurf. Wild, frei und wunderbar sollte es zugehen. Grundsätzlich konnte ich mir zwar vorstellen, eines Tages mal Vater zu werden. Aber es schien mir auch nicht abwegig, kinderlos zu bleiben. Die Idee, dass man nur mit Nachwuchs ein vollständiger Mensch ist, war mir fremd. Dann kam Nora.
Drei Jahre lang führten wir eine turbulente On-off-Beziehung, es war ziemlich anstrengend. Zuerst war ich ihre Affäre, dann verließ sie meinetwegen ihren Freund. Sie arbeitete an einem Theater im Ruhrpott, während ich in Berlin die Stellung hielt. Wir spürten beide, dass wir zusammengehörten, aber der letzte Kick, sich ganz und gar aufeinander einzulassen, fehlte irgendwie immer. Als es zu einem ersten großen Zerwürfnis kam, dachte ich, das war’s jetzt. Wir trafen uns zwar bald wieder, aber es sah so aus, als würden wir fortan nur Freunde bleiben. In dieser Zeit fing Nora an, über Kinder zu reden. Also davon, dass sie sich vorstellen könnte, welche zu kriegen. Sie streute das ganz zwanglos in die Gespräche ein. Man muss dazu sagen, dass sie zu dem Zeitpunkt erst dreiundzwanzig war, aber sie meinte es ohne Zweifel ernst. Dafür kannte ich sie gut genug. Auch wenn es scherzhaft klang, schien sie entschlossen zu sein.
Für mich hieß das: Will ich der Mann sein, mit dem Nora ein Kind kriegt? Oder will ich es nicht? Falls nicht, würde sie früher oder später einen anderen finden. Es kam also zu dem absurden Moment, in dem ich sie auf einer Autofahrt einfach fragte: »Was hältst du davon, wenn wir ein Kind machen?«
Fast alle Freunde, denen ich von diesem Entschluss erzählte, schlugen die Hände über dem Kopf zusammen. Verständlicherweise, muss man sagen, schließlich kannten sie Nora und mich nur als Drama-Paar. Aber genau das stimmte mich zuversichtlich. Wir hatten schon so viel miteinander durchgemacht, dass wir uns besser kannten als sonst irgendwen. Ich war mir sicher, dass Nora eine tolle Mutter abgeben würde. Und ich fand es romantisch, dass wir auf die Art für immer etwas gemeinsam hätten – auch wenn wir irgendwann verschiedene Wege einschlagen sollten.
Obwohl mir also alle von dieser Schnapsidee abrieten, wuchs meine Begeisterung. Und meine Neugier auf ein solches Wagnis. Ich vertraute darauf, dass Nora und ich es hinkriegen würden. Und anscheinend war dies genau das Signal, dass sie brauchte, um sich endlich ganz auf mich einzulassen.
KIND ODER KEIN KIND?
Das ist jetzt natürlich ein sehr persönlicher Einstieg. Und ein bisschen liest sich das vermutlich so, als würde ich denken, ein Kind zu kriegen, wäre ein guter Weg, eine Beziehung zu retten. Das tue ich definitiv nicht. Bei Nora und mir fing die Beziehung eigentlich erst mit dem Kinderwunsch richtig an. Bis dahin waren wir jahrelang mit Herumeiern beschäftigt gewesen.
Um jetzt aber mal wieder allgemeiner zu werden: Ich schätze, die Frage, ob zwei Menschen ein Kind kriegen wollen, ist fast immer ein Schlüsselmoment der Beziehung. Egal, ob sie ungewollt von der Schwangerschaft überrumpelt wurden oder sie wie wir absichtlich herbeigeführt haben. Und da ist meine Empfehlung ganz klar: Wenn man sich liebt, wenn man cool miteinander ist UND sich das Kinderkriegen grundsätzlich vorstellen kann, sollte man es lieber früh riskieren als spät.
Das klang jetzt fast wie ein Ratschlag. Gar nicht so leicht, neutral zu bleiben. Ist mir natürlich vollkommen wurscht, zu welchem Zeitpunkt irgendwer Kinder kriegt. Aber aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen: Es fetzt total, jung Eltern zu werden. Allein schon wegen der Challenge. Aber auch, weil die Wegstrecke, die man gemeinsam zurücklegt, in der Regel viel länger ist und damit erlebnisreicher.
Gegenbeispiel: In Berlin-Mitte, und vor allem natürlich in Prenzlauer Berg, sieht man oft Ü40-Eltern, die neurotisch hinter ihren Kleinkindern herrennen. Gesetzte Persönlichkeiten mit angegrautem Haar, die im Sand herumkrabbeln und »dutzi, dutzi« machen. Zum Schießen! Ich vermute, dass sie sich erst mal viel Zeit für ihre Selbstverwirklichung oder ihre Karriere genommen haben. Da war einfach kein Platz für ein Kind. Und nun, da sie ihr Lebenswerk zwar nicht abgeschlossen, aber doch über den entscheidenden Punkt gebracht haben, widmen sie sich dem Projekt »Kind«. Und das mit der gleichen Effizienz, mit der sie sich vorher all den anderen Projekten gewidmet haben. Sie wollen es perfekt machen, denn so sind sie das aus ihrem Beruf gewohnt. Sie erfüllen mit dem Ehrgeiz eines Topmanagers ein Vater- oder Mutterbild, das sie irgendwo aufgeschnappt haben, und erzeugen damit diese ulkige, bisweilen auch traurige Diskrepanz.
Ich bin mit neunundzwanzig Jahren Vater geworden – auch nicht wirklich taufrisch – und hatte in Sachen Selbstverwirklichung schon einiges hinter mir. Trotzdem war ich noch mittendrin. Und bin es jetzt, während ich selbst auf die vierzig zugehe, immer noch. Der Unterschied ist, dass meine Tochter auf einem guten Stück des Weges dabei war. Sie hat es miterlebt. Natürlich ist ihre Vorstellung von meinem Beruf eher diffus, sie muss sich dafür auch nicht übermäßig interessieren. Trotzdem weiß sie schon, dass es toll ist, wenn ich einen Buchvertrag kriege. Weil wir dann kurzzeitig reich sind und auf die Pauke hauen können. Und sie weiß auch, dass ich dafür arbeiten muss, und in dieser Zeit vielleicht zerstreuter bin als sonst.
Was ich damit sagen will: Freundschaften entstehen nicht von heute auf morgen, sondern aus gemeinsamen Erlebnissen. Weil man sich dabei kennen- und lieben lernt. Man findet keine Freunde, indem man sich von einem Tag auf den anderen hinstellt und sagt: So, ich will jetzt eine Freundschaft schließen. Zumindest halte ich das für schwierig. Und genauso ist das mit Kindern. Je früher der gemeinsame Weg beginnt, desto länger und enger die Bindung. Ist doch vollkommen logisch.
Und ja, ich weiß, man hat nicht immer die Wahl. Hat nicht immer zum Wunschzeitpunkt den richtigen Partner oder die richtige Partnerin. Und was es eben sonst noch für einschlägige Hindernisse gibt. Aber wenn ihr die Wahl habt: Go for it!
SCHWANGERSCHAFT & ALKOHOL
Die erste Phase des Elterndaseins ist die Schwangerschaft. Das Kind ist schon da, aber irgendwie auch noch nicht. Ein gutes Testfeld, um sich auf die neue Situation vorzubereiten. Ich würde sagen, in dieser Zeit werden alle Weichen dafür gestellt, wie die beiden Eltern später miteinander umgehen werden. Wie viel Respekt sie voreinander haben, was sie sich gegenseitig zutrauen, und vor allem, was sie sich gegenseitig gönnen. Bestes Beispiel: Zigaretten und Alkohol. Eine schwangere Frau darf nicht rauchen und nicht trinken. Das ist gemein. Schöner wäre es, wenn sie nicht darauf verzichten müsste. Aber das geht nun mal nicht. Soll der Mann deshalb auch damit aufhören?
Ich für meinen Teil kann sagen, dass ich während der Schwangerschaft Experte für alkoholfreie Biersorten wurde, weil ich aus Solidarität mit Nora oft abstinent geblieben bin. Man muss schließlich nicht an jedem Tag trinken (kaum zu fassen, dass ich das jetzt wirklich geschrieben habe). Da ich außerdem Nichtraucher bin, musste ich mich dahingehend nicht mal umstellen. Der Punkt ist allerdings, dass Nora nie von mir verlangt hat, mit dem Trinken aufzuhören. Im Gegenteil, sie hat mich sogar dazu ermutigt. Was ich an manchen Abenden dankbar in Anspruch nahm. Ich zog mit Freunden um die Häuser oder trank auf der Bühne einen über den Durst. Damals musste ich noch jeden Mittwoch bei den Surfpoeten auftreten, was meistens feucht-fröhlich endete. Nora war fast immer dabei, saß mit der Einlasserin an der Kasse und hörte den Texten zu. Im Gegenzug begleitete ich sie manchmal zu den Proben in den Admiralspalast, wo sie als Regieassistentin bei einer Revue-Show arbeitete. Sie hatte außerdem eine kleine Rolle als Statistin und tanzte so lange als 20er-Jahre-It-Girl auf der Bühne, bis sie mit ihrem Bauch nicht mehr in das goldene Glitzerkleid passte.
Warsteiner Alkoholfrei Herb
Erdinger Alkoholfrei
Lammsbräu Alkoholfrei
Lübzer Alkoholfrei
Schöfferhofer Alkoholfrei
Für mich war so ein Modell natürlich sehr komfortabel. Nora wollte einfach keinen Mann, der plötzlich brav und angepasst wird, nur weil da ein Kind in der Pipeline wartet. Die Situation war wie in jeder Schwangerschaft schon angespannt genug, da konnte sie keinen aufgekratzten Abstinenzler um sich brauchen. Zumal die Fremdbestimmung mit der Geburt ohnehin massiv zunimmt. Da kann man doch die letzten Tage in Freiheit noch genießen. Alles andere wäre krank. Es wäre genau der Augenblick, in dem man anfängt, sich wegen des Kindes unnatürlich zu verhalten, sich selbst zu verbiegen. Und wenn man damit erst mal anfängt, gibt es kein Zurück mehr. Dann steuert man unweigerlich auf den Punkt zu, an dem die eigene Persönlichkeit auf die Funktion als Elternteil reduziert wird.
Es versteht sich hoffentlich von selbst, dass ich mit der Kulanz einer so famosen Partnerin verantwortungsvoll umgegangen bin. Ich habe es nicht übertrieben, war am nächsten Morgen wieder einsatzbereit, auch wenn ich verkatert war. Das nennt man Anstand. Funktioniert in einer Beziehung übrigens auch dann prima, wenn kein Kind im Spiel ist. Und ja, ich gebe es zu, ich habe mich auch um den Haushalt und die Erstausstattung gekümmert, habe Noras Bauch zweimal am Tag eingeölt. Verklagt mich doch.
PANIK AUF DEN LETZTEN METERN
»Alles ändert sich. Alles, alles wird sich ändern.« Je näher die Geburt rückte, desto öfter hörten wir diesen Satz. Als ob die Leute unbedingt ihre Schadenfreude darüber ausdrücken wollen, dass man sich in die Nesseln gesetzt hat. Wem soll denn damit geholfen sein? Es ist wie die penetrante Ankündigung »Jetzt geht der Ernst des Lebens los!«, mit der arglosen Sechsjährigen Angst vor der Schule eingejagt wird.
Die Umstände mögen sich im Leben hier und da ändern, doch deshalb verändert sich doch nicht gleich der eigene Charakter. Oder die eigene Haltung. Es mag Menschen geben, die sehnsüchtig auf ein Kind warten, um ihr farbloses Leben mit Inhalt zu füllen. Doch von ihren Hymnen muss man sich nicht einlullen lassen. »Ein Kind zu kriegen, ist der unglaublichste und großartigste Moment im Leben eines Menschen!«, werden sie nicht müde zu krähen. Und reagieren gleich muffig, wenn man zu bedenken gibt, dass man den letzten Besuch in der Kneipe auch ziemlich großartig fand.
Das alles sage ich natürlich im Rückblick, als Veteran mit acht Jahren Erfahrung im Feld. Damals, kurz vor der Geburt, war ich ziemlich nervös. Ich wusste ja nicht, ob sie recht hatten, die Alarmisten mit ihrem Getue. Vor lauter Panik kriegte ich Angina und eine Magen-Darm-Infektion, sodass unsicher war, ob ich überhaupt mit ins Krankenhaus zur Entbindung durfte. Kein Wunder angesichts dessen, wie verrückt man gemacht wird.
Bestes Beispiel: die Krankenhaustasche. Gott, was sind wir gequält worden! Von der Hebamme, von anderen Eltern. Es gibt ganze Ratgeber, die sich nur damit befassen, was man in diese verschissene Tasche packen soll, bevor man sich damit auf den Weg in den Kreißsaal macht. Herrschaftszeiten, möchte man rufen, die Leute haben früher im BUNKER ihr Kind gekriegt. Beim Beerenpflücken, während sie mit der anderen Hand ein Wolfsrudel auf Distanz halten mussten. Da wird man ja wohl eine Krankenhausgeburt schaffen können, ohne drei Monate vorher Hektik wegen einer blöden Tasche zu machen. Im Zweifelsfall kann man alles Nötige schnell an der Tankstelle kaufen. Oder beim Späti. Oder man schnorrt andere Eltern im Krankenhaus an. Die Streber haben bestimmt an alles gedacht.
Ja, es ist aufregend, wenn ein Kind unterwegs ist. Allein schon deshalb, weil man monatelang darauf warten muss. Was Nora und mir in dieser Zeit am meisten geholfen hat, waren ältere Freunde mit Kindern, die uns immer wieder einschärften: Bleibt entspannt, die Natur hat für alles gesorgt, ihr werdet das hinkriegen. Dieses Mantra kann ich uneingeschränkt weitergeben.
Und keine Sorge: Falls mir jemand von euch jemals etwas vorschwärmen sollte, wie »Ich habe auf dem Ku’damm zufällig King Charles getroffen, das war der beste Moment meines Lebens!«, würde ich niemals die Hände in die Hüften stemmen und rufen: »Und die Geburt deines Kindes?!«
Es ist zwei Uhr früh, als Nora von der Toilette kommt und meint, dass ihre Fruchtblase geplatzt sei. Ich bin schlagartig wach und springe auf. Während sie sich bereit macht, gehe ich zum Wäscheschrank und tue das, was mir im Halbschlaf am wichtigsten erscheint.
»Was machst’n du da?«, will Nora wissen, als sie fünf Minuten später ins Schlafzimmer kommt.
»Na«, sage ich, noch immer nicht richtig wach. »Ich beziehe das Bett neu. Wir kriegen doch gleich Besuch.«
ABGEBEN ODER BEHALTEN? DIE SACHE MIT DER KONTROLLE
Auf die eigenen Instinkte zu hören, halte ich grundsätzlich für eine vernünftige Strategie. Ich zweifle deshalb nicht an der Expertise von Fachleuten. Ich bin froh, dass es Fachleute gibt. Trotzdem ist ein eigenes Kind doch etwas sehr Persönliches, in der Regel verbringt man mit ihm mehr Zeit als irgendwer sonst. Es kann also irritieren, wenn man die Initiative in die Hände von Außenstehenden legen soll.
Ich habe im Krankenhaus beide Extreme erlebt. Sowohl den Moment, als ich die Kontrolle abgeben konnte, als auch Situationen, in denen ich mir wie ein hysterischer Helikoptervater vorkam.
Wir hatten eine Beleghebamme, deren berlinerisch-burschikose Art im Vorfeld viel Vertrauen spendete. So entschied sie die PDA-Frage gleich mit der Ansage an Nora: »Wenn de keene PDA willst, versuchen wa’t, ohne zu machen. Aber unterschreib trotzdem gleich ma den Wisch hier, weil wenn’s hart uff hart kommt, haste im Kreißsaal keene Lust, mit Formularen rumzuhantieren.«
Klingt vielleicht etwas hemdsärmelig, war für Nora und mich aber gut anzunehmen. Weil die Hebamme zwar manche Entscheidungen für uns traf, aber nie Zweifel daran aufkommen ließ, dass sie uns ernst nahm. Auch im Kreißsaal erwies sich ihre Herangehensweise als die richtige. Erst lief alles ganz unkompliziert, dann drehte das Kind sich im Becken. Plötzlich schwirrten Wörter wie »Notkaiserschnitt« durch den Raum. Eine Schwester brachte einen Rollwagen voller monströser Apparaturen, um dem Kind Blut am Kopf abzunehmen und den Sauerstoffgehalt zu messen. Ich war wie im Schock, sah die Leben meiner Liebsten in Gefahr.
»Ick würde ihr jetzt ma die PDA geben lassen«, sagte die Hebamme leise zu mir, weil Nora in ihren Presswehen nicht mehr ansprechbar war. Ich nickte, und fünfundvierzig Minuten später war Wanda geboren. Ein Hoch auf die Fachleute, die tolle Hebamme, die Ärztinnen im Kreißsaal, das Anästhesistenteam. Es war das Richtige, sie ungestört ihre Arbeit tun zu lassen und ihnen zu vertrauen.
Dann kamen wir in die Wöchnerinnenstation. Wanda wog nur zweieinhalb Kilo, weshalb sie zwei Tage beobachtet werden sollte, bevor wir mit ihr nach Hause durften. Da saßen wir nun, Nora mit dem Kind auf dem Arm, erleichtert und erschöpft. Plötzlich rauscht eine Schwester zur Tür herein:
»So, was haben wir denn da! Puh, ich reiß erst mal ein Fenster auf, hier ist ja ein Klima wie im Pumakäfig. HAHAHA!«
Die Schwester ist laut. Der kalte Luftzug, den sie erzeugt, riecht nach der Kippe, die sie gerade vorm Notausgang durchgezogen hat. Speckgürtel-Kurzhaarfrisur, schwarz gefärbt. Einhorn-Pins in den blassblauen Crocs.
»Hier sind die Formulare für das Neugeborenen-Screening«, schrie sie dann. »Die können Sie schon mal unterschreiben und … Oh, das kann da nicht stehen bleiben. Sie haben ja gar keine TASSE! Bin gleich wieder da. Und dann nehm ich Ihre Tochter kurz mit.«
Als wir endlich wieder allein waren, schaute Nora mich unglücklich an. Sie wollte nicht, dass dieser Drachen unser Kind mitnahm. Ich wollte das auch nicht. Deshalb beschloss ich, einfach mitzugehen.
»WAS wollen Sie?«, rief die Schwester empört.
»Ich würde Sie gern begleiten.«
»Aha, okay.« Sie schürzte beleidigt die Lippen. »Sie können uns hier schon vertrauen. Wir machen das nicht zum ersten Mal.«
»Wir aber.«
Es war eine absurde Situation. Und nicht angenehm. Die Schwester zeigte mir mit jeder Geste, wie verletzt sie von meinem Misstrauen war. Ich stand daneben, als sie meine Tochter abtastete, sie wog und ihre Größe maß. In der Tat keine weltbewegenden Eingriffe. Ich verspürte den Drang, mich zu rechtfertigen. Kam mir wie ein Kontrollfreak vor. Dabei hätte ich einfach gern die ersten Augenblicke mit meinem Kind ungestört genossen.
Rückblickend würde ich alles genauso tun. Und ich hätte überhaupt kein Problem mehr damit, den passiv-aggressiven Bullshit der Schwester von mir abperlen zu lassen. Wäre sie ein klein bisschen einfühlsamer gewesen, Nora und ich hätten mit Sicherheit ganz anders reagiert. Schon klar, Krankenhäuser sind riesige Betriebe, die Schwestern sind überarbeitet und unterbezahlt, ein strukturelles Problem. Das aber nicht von jungen Eltern und ihren Neugeborenen ausgebadet werden sollte. Da darf man ruhig egoistisch sein, finde ich. Und auch mal genauer hinschauen, wie die Dinge laufen.
Die Sache mit dem Kontrollverlust ist übrigens ein Thema, das hier noch öfter auftauchen wird. Damit meine ich nicht die Fremdbestimmung durch das Kind selbst, sondern alles drum herum. Zum Beispiel der Moment, wenn man die Leibesfrucht in die Hände von irgendwelchen fremden Menschen (auch Erzieher genannt) geben soll. Lieben heißt loslassen können? Dann probiert das mal aus, wenn ihr selbst betroffen seid.
essen, schlafen, pflegen
So gut wie alles an meinem … na ja, wollen wir es mal augenzwinkernd »Erziehungsstil« nennen, beruht auf Bequemlichkeit. Ich will, dass mein Kind glücklich ist. Ich will aber auch, dass ich glücklich bin.
»Iss deine Austern auf, sonst gibt’s keinen Kaviar!« – Es ist ein weiter Weg, bis man diesen Satz zu seinem Kind sagen kann. Aber ein Weg, der sich lohnt. Na gut, um ehrlich zu sein: Wanda mag gar keine Austern. Sie sind ihr zu salzig, selbst wenn man das Meerwasser vorher aus der Schale gießt. Dafür mag sie alle anderen Muscheln. Und frischen Oktopus. Sie saugt sogar den Shrimps die Köpfe aus, nachdem sie sie selbst zerlegt hat. Das mache nicht einmal ich.
Zugegeben, es ist vielleicht nicht jedermanns Sache, exotische Tiere zu essen. Von daher werden auch nicht alle Eltern anstreben, diese Vorliebe in ihren Kindern zu wecken. Ich persönlich bin froh, dass ich mit Wanda ins französische Restaurant gehen kann. Es erfüllt mich mit heimlichem Stolz, wenn Kellner und Gäste staunen, was mein Kind alles isst. Das mag damit zusammenhängen, dass ich von allem fasziniert bin, was mit der Gastronomie zu tun hat. Natürlich möchte ich das an mein Kind weitergeben. Aber von vorn.
Kinder haben Grundbedürfnisse. Genauso wie Menschen. Sie wollen essen und trinken und schlafen und kommunizieren. Wie sie diese Dinge tun, hängt in erster Linie davon ab, was sie von ihren Eltern gelernt haben. Ein Kind, das partout nichts essen will außer Pommes, das abends nicht ins Bett geht und nachts fünfzehn Mal im Zimmer der Eltern steht, kann man zwar trotzdem lieb haben. Aber noch schöner ist es, wenn man nicht dauernd mit anstrengenden Sonderwünschen beschäftigt ist.
So gut wie alles an meinem … na ja, wollen wir es mal augenzwinkernd »Erziehungsstil« nennen, beruht auf Bequemlichkeit. Ich will, dass mein Kind glücklich ist. Ich will aber auch, dass ich glücklich bin. Was ich nicht wäre, wenn sich von früh bis spät alles um das Kind drehen würde. Gut, in den ersten zwei Jahren braucht es die volle Zuwendung. Aber auch diese Aufgabe dürfen Eltern untereinander aufteilen, um sich Freiräume zu schaffen. Außerdem kann man bereits in dieser Zeit die Grundsteine dafür legen, dass man später zusammen mit dem Kind chillen kann, statt sich gegenseitig auf den Zünder zu gehen.
Welche Beikost kann man zum Stillen geben? Ab wann sollte das Kind im eigenen Bett schlafen? Wie kriegt man es dazu, am Abend endlich Ruhe zu geben? Wie redet man mit dem Kind, wenn es sich ausschließlich für Bagger interessiert oder in die berüchtigte Warum-Phase kommt? Sind Kinderwagen so schlimm, wie alle behaupten? Wie schon im Vorwort erwähnt: Auf all diese Fragen habe ich keine pädagogisch wertvollen Antworten. Ich kann nur erzählen, wie Nora und ich es gemacht haben. Trotzdem finde ich, wirkt das hier langsam ziemlich professionell. Vielleicht wird es doch ein Ratgeber.
BRING MIR ZWEI VON JEDER TIERART
Ich musste eine ganze Weile überlegen, wie das mit dem Essen und Wanda am Anfang war. Es scheint wirklich was dran zu sein an dem Mythos, dass sich die Stilldemenz auf den Vater übertragen kann. Vom ersten Halbjahr Elternschaft weiß ich echt nicht mehr viel. Und glaube, dass diese Gedächtnislücke ausnahmsweise mal nicht von den üblichen Drogenexzessen kommt.
Nora hat Wanda gestillt, so viel steht fest. Irgendwann, ich schätze so nach dem vierten oder fünften Monat, fing sie nebenbei an Milch abzupumpen, die wir dann eingefroren haben. Auf die Art konnte auch ich Wanda füttern, wenn Nora mal einen freien Abend brauchte. Sie hat dann außerdem bald einen Minijob angenommen und jeden Samstag Obst und Gemüse auf einem Wochenmarkt verkauft, damit ihr die Decke nicht auf den Kopf fiel. Ich erzähle das nur, um den roten Faden weiterzuspinnen, dass wir neben Wandas Bedürfnissen auch immer auf unsere eigenen gehört haben.
Jedenfalls war es an diesen Samstagen, dass ich damit begann, Brei für Wanda zu kochen. Die gleichen Mahlzeiten, die wir selbst aßen, nur eben ungewürzt und püriert. Nudeln mit Bolo, Kartoffeln mit Rind, Hühnchen und Reis. Oder irgendeine Gemüseplempe aus Zucchini und Pastinake und Sellerie. Was man eben so glaubt, seinem Kind einhelfen zu müssen.
Das Breikochen war in erster Linie ein Ritual für mich selbst. Ich dachte, das macht man so, und fühlte mich dabei sehr väterlich. Wanda zeigte für diese pedantisch befüllten und beschrifteten Gläschen nur wenig Interesse, sie hat vielleicht zwei- oder dreimal davon probiert, und das war’s dann. Wahrscheinlich, weil sie sah, dass wir auch nicht aus Gläschen essen. Stattdessen wechselte sie ziemlich übergangslos von Muttermilch zu fester Nahrung. Was wiederum an dem erfahrenen Elternpaar lag, das uns schon während der Schwangerschaft geraten hatte, entspannt zu bleiben.