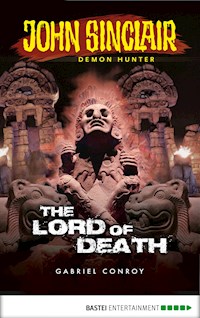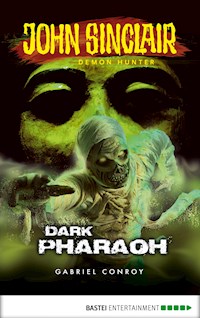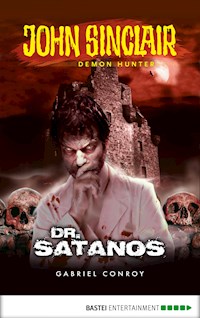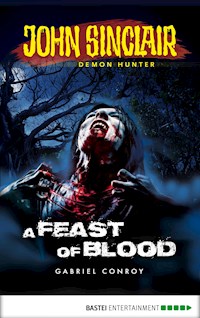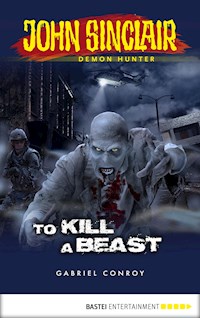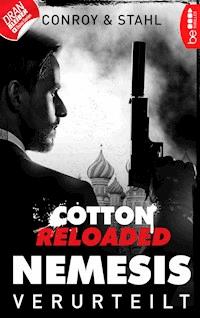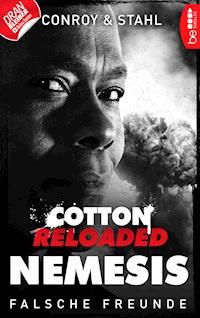2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Cotton Reloaded: Nemesis
- Sprache: Deutsch
Alles ist verloren. Philippa Decker wurde das tödliche Gift injiziert. Doch Cotton stiehlt ihren leblosen Körper und verhindert eine unehrenhafte Beerdigung. Oder hat er einen ganz anderen Plan? Was er auch tut: Ab jetzt ist Cotton ein gesuchter Verbrecher - und seine Jäger kennen ihn nur zu gut. Eine wilde Flucht quer durch New York ist erst der Anfang!
ÜBER DIE SERIE
COTTON RELOADED - NEMESIS: Der Beginn einer neuen Ära!
Das G-Team droht zu zerbrechen: Mr. High wurde suspendiert, Philippa Decker sitzt in der Todeszelle, und im Verborgenen lauert ein mächtiger Feind. Um zu überleben und sein Team zu retten, muss Cotton jede Regel brechen. Aber welchen Preis wird er dafür zahlen?
Härter, schneller, explosiver: So haben Sie Cotton noch nie gelesen!
COTTON RELOADED - NEMESIS besteht aus sechs Folgen. Die Serie erscheint als eBook und Audio-Download (ungekürztes Hörbuch). COTTON RELOADED ist das Remake der erfolgreichsten deutschen Romanserie JERRY COTTON.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Cotton Reloaded: NEMESIS – Die Serie
Über diese Folge
Das G-Team
Über die Autoren
Titel
Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
In der nächsten Folge
Cotton Reloaded: NEMESIS – Die Serie
Der Beginn einer neuen Ära!
Das G-Team droht zu zerbrechen: Mr. High wurde suspendiert, Philippa Decker sitzt in der Todeszelle, und im Verborgenen lauert ein mächtiger Feind. Um zu überleben und sein Team zu retten, muss Cotton jede Regel brechen. Aber welchen Preis wird er dafür zahlen?
Härter, schneller, explosiver: So haben Sie Cotton noch nie gelesen!
COTTON RELOADED – NEMESIS besteht aus sechs Folgen. Die Serie erscheint als eBook und Audio-Download (ungekürztes Hörbuch). COTTON RELOADED ist das Remake der erfolgreichsten deutschen Romanserie JERRY COTTON.
Über diese Folge
Alles ist verloren. Philippa Decker wurde das tödliche Gift injiziert. Doch Cotton stiehlt ihren leblosen Körper und verhindert eine unehrenhafte Beerdigung. Oder hat er einen ganz anderen Plan? Was er auch tut: Ab jetzt ist Cotton ein gesuchter Verbrecher – und seine Jäger kennen ihn nur zu gut. Eine wilde Flucht quer durch New York ist erst der Anfang!
Das G-Team
Das G-Team ist eine Spezialeinheit des FBI, die bei besonders schwierigen Fällen eingesetzt wird. Offiziell existiert die Einheit nicht. Sollte einer der Agenten gefangen oder getötet werden, werden FBI und Regierung jegliche Kenntnis bestreiten.
Die wichtigsten Mitglieder des G-Teams:
Jeremiah Cotton ist Mitte dreißig und stammt aus einem Kaff namens Grinnell, Iowa. Als er seine Familie bei den Anschlägen am 11. September 2001 im World Trade Center verliert, entschließt er sich, Polizist zu werden. Er fängt als Streifenpolizist beim NYPD an, doch schon bald wird er als Quereinsteiger ins G-Team berufen – was nicht allen gefällt.
Philippa Decker ist Cottons Senior-Partnerin und in vielem sein genaues Gegenteil. Sie ist etwas älter als Cotton, kühler und berechnender als er. Ihr Vater ist der schwerreiche Rüstungsunternehmer Graham Decker, doch man sollte nicht den Fehler begehen, Philippa für ein verwöhntes Töchterchen zu halten.
John D. High ist der ehemalige Special Agent in Charge (SAC) und Chef des G-Teams. In Folge 50 (»Tödliches Finale«) wird er suspendiert, als sein Team der mächtigen Geheimorganisation »Die Hand Gottes« zu nahe kommt.
Deborah Kleinman: Die neue Special Agent in Charge des G-Teams. Eine eiskalte Karrieristin – was nicht heißt, dass sie ihren Job nicht gut macht.
Steve Dillagio ist Agent des G-Teams. Ein raubeiniger Ex-Soldat – schlagfertig, manchmal gewalttätig, doch stets loyal seinem Team gegenüber.
Zeerookah: Der ehemalige Hacker mit indianischen Wurzeln ist der IT-Spezialist des G-Teams.
Joe Brandenburg ist kein Mitglied des G-Teams, sondern Detective beim NYPD. Dort war er Cottons erster Partner als Streifenpolizist.
Über die Autoren
Gabriel Conroy ist das Pseudonym eines in Los Angeles lebenden Autors. Er studierte in Kalifornien Film und Journalismus und arbeitete lange in der Filmbranche. Unter seinem echten Namen schreibt er Romane und Artikel, übersetzt Bücher und unterrichtet Deutsch. Als Gabriel Conroy lebt er seine Vorliebe für Pulp, Thriller, Horror und Heftroman-Stories aus.
Timothy Stahl, in den USA geboren, wuchs in Deutschland auf, wo er beruflich als Redakteur für Tageszeitungen und als Chefredakteur eines Wochenmagazins tätig war. 1999 kehrte er in die USA zurück und arbeitet seitdem als Autor und Übersetzer. Timothy Stahl lebt mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in Las Vegas, Nevada.
Folge 2: Auf der Flucht
Gabriel Conroy & Timothy Stahl
beTHRILLED
Digitale Originalausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Uwe Voehl
Lektorat/Projektmanagement: Lukas Weidenbach
Covergestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de unter Verwendung von Motiven von © shutterstock: hxdbzxy | Miloje | faestock | Dumy67
eBook-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-3895-9
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
1
West-Berlin, 5:08 Uhr. Juni 1987.
David Benton hatte jede Nacht denselben Traum. Jede verdammte Nacht, und immer wachte er vor Angst schweißgebadet auf.
Er befand sich in einem Gefängnis. Er ging einen Gang entlang, sah die grünen Metalltüren der Zellen an beiden Seiten. Er atmete schwer. Es schien ihm, als würde er schwimmen. Dabei kam er kaum vorwärts, der Gang streckte sich immer weiter vor ihm aus.
Endlich gelangte er in den Raum, in dem der Galgen stand. Das Innere eines Turms aus dunklen Ziegelsteinen. Benton fühlte sich an eine riesige Kuppel erinnert. Die runden Wände führten weit nach oben, dort sah er entferntes Tageslicht zwischen den Holzbalken.
Und er sah sie.
Man hatte ihr einen schwarzen Sack über den Kopf gestülpt. Zwei uniformierte Männer führten die Frau fast zärtlich zum Galgen hinauf. Das Knarren der Stufen sägte an der Stille. Die Kälte in dem kargen, runden Raum war nahezu unerträglich.
Oben wartete der Henker. Er war ein unscheinbarer Mann in einem dunklen Anzug, dessen Gesicht Benton nicht ausmachen konnte. Und das nicht nur wegen der Distanz. Es lag auch nicht an der Düsternis in dem Raum, zumindest nicht nur. Nein, es kam ihm vor, als hätte der Henker gar kein Gesicht. So wenig wie die beiden Männer, von denen er die Frau in Empfang nahm. Die Verbrecherin, die angebliche.
Ofelia …
Ihr Gesicht konnte er zwar nicht sehen, aber er konnte es sich lebhaft vorstellen. Trotz des schwarzen Sacks über ihrem Kopf. Das dunkle Haar, die hellen Augen. Er sah ihr Gesicht überall. Und er würde es nie vergessen. Am liebsten hätte er die Augen geschlossen. Aber er konnte nicht, er musste hinsehen. Wenn ihr Blick unter den Zuschauern nach dem seinen suchte, sollte sie ihn finden.
Mit einer nahezu hämischen Behutsamkeit geleitete der Henker die Frau zur Mitte des Podests. Vorsichtig, als traute sie ihm nicht, setzte sie einen Fuß vor den anderen. Bis sie die in den Boden eingelassene Falltür erreichte und der Henker ihr bedeutete, stehen zu bleiben.
Der Henker zog der Frau die Kapuze vom Kopf.
Ofelia blinzelte, als träfe grelles Licht ihre Augen, nicht diese Kellertrübe, die alle Anwesenden zu Schatten werden ließ. Ihr Atem ging laut und rasselnd. Ansonsten war nichts zu hören.
Nur den Blick nicht von ihr wenden! Denn jetzt war jede Sekunde ein Geschenk, so unwiederbringlich wie ihre Schönheit, die es nur noch für Sekunden geben würde.
Ihre Blicke fanden einander in dem Moment, da der Henker ihr die Schlinge über den Kopf hielt wie eine obszöne Krone. Ein winziges Lächeln kräuselte kurz ihre feinen Lippen, als sie ihn entdeckte. Dann glitt ein Schatten über ihr Gesicht, als der Henker die Schlinge darüberstreifte. Er zurrte den Knoten fest und prüfte den richtigen Sitz im Nacken. Damit er ihr gleich das Genick brechen und die Schlinge ihr nicht die Luft abschnüren und sie qualvoll ersticken würde.
Der Rest ihres Lächelns zerbrach. Und auch in ihm zerbrach etwas. Als wäre dieser Augenblick schon schlimmer als der eigentliche, in dem sie wirklich sterben würde …
Ihre Lippen zitterten. Er versuchte von ihnen zu lesen, ob sie ihm etwas sagen wollte. Ihr Blick klammerte sich so fest an ihm, dass er ihn spüren konnte. Wie etwas, das in ihn hineinreichte. Auch aus seinem Mund drang kein Ton, obwohl ihm Worte auf der Zunge lagen. Aber sie hätten nichts bewirkt. Niemand würde Gnade walten lassen. Das Urteil war gefällt, seine Vollstreckung unausweichlich: Tod durch den Strang für die Verräterin.
Der Henker trat neben den Hebel, der die Verriegelung der Falltür im Boden lösen würde. Und plötzlich hatte der Mann ein Gesicht. Ein asketisch schmales Gesicht, schwarz und starr wie aus Ebenholz geschnitzt.
»John High …«, keuchte Benton.
Die Hand des Mannes legte sich um den Hebel, im Zwielicht fast unsichtbar. Nur die Knöchel traten hervor. Und er sah diese Hand auf einmal so groß und deutlich, als stünde er nicht mehr hier unten, sondern dort oben am Galgen neben John High.
David Benton verlor das Gleichgewicht und hatte das Gefühl zu stürzen.
Und als er Ofelias Schrei hörte, da tat sich der Boden unter ihm selbst auf, als stünde er an ihrer Stelle. Im Nacken ein furchtbarer, harter Druck, der in einen Schmerz überging; eine rot glühende oder eiskalte Nadel, die ihm zwischen die Halswirbel und hinein ins Rückenmark stach, und dieser brennende und frostige Schmerz durchraste ihn, von Kopf bis Fuß …
David Benton wachte schreiend auf. Sein Herz raste. Das Bettzeug war nass vom Angstschweiß. Draußen hörte er das ferne Rauschen der Autos. Es waren nur wenige, es war noch früh. Durch die Jalousien warfen die Scheinwerfer helle Schatten an die Decke.
Auf seinem Wecker stand in roter Schrift die Uhrzeit. Und das Datum. Bald würde es so weit sein.
Bald würde Ofelia sterben.
2
Rikers Island, 5:49 Uhr. Jetzt.
Philippa Decker war tot. Sie lag in einem offenen Sarg. Die Augen geschlossen, die Hände gefaltet, die Haut leichenblass. All die Anspannung der letzten Wochen war von ihrem Gesicht gewichen. Als hätte sie erst jetzt den Frieden gefunden, der ihr im Leben nicht vergönnt gewesen war.
Walter Rodensky ging einen Schritt zurück und schaute sich die Tote vorsichtig an. Sie wirkte, als würde sie schlafen. Sie trug jetzt nicht mehr den orangefarbenen Gefängnisoverall, sondern einen erlesenen schwarzen Hosenanzug und eine weiße Bluse. Die Kleider hatte Graham Decker, der Vater der Verstorbenen, gestern noch persönlich vorbeigebracht. In der Tasche des Jacketts hatte Walter eine kleine »Aufwandsentschädigung« gefunden.
Jetzt trat Walter wieder an sie heran und entfernte eine Haarsträhne von ihrem Gesicht. Ein letztes Detail. Walter hatte schon früh gelernt, respektvoll mit den Verstorbenen umzugehen. Als hätte er es mit Lebenden zu tun. So wurde es seit Generationen gehandhabt bei Rodensky & Sons. Der Name stand in geschwungener Serifenschrift auf der Flanke des schwarzen Überführungswagens, der im geräumigen Ladebereich parkte, ein Cadillac nicht mehr ganz neuen Baujahrs. Der Sarg stand auf der ausfahrbaren Schienenvorrichtung, die aus dem Heck des Cadillacs ragte. Sie befanden sich unter dem Todestrakt des Gefängnisses. Etwas abseits von dem Überführungswagen wartete ein bewaffneter Gefängnismitarbeiter und schaute unbeteiligt zu.
Eine offene Ausfahrt führte hinaus. Ein kalter Wind strich herein, die gerade aufgegangene Sonne schickte ein paar Strahlen hinterher. Ein klarer, aber eisiger Januartag kündigte sich an.
»Wollen wir?«, fragte Walters Sohn, Jack. In seiner Stimme schwang ein Hauch von Ungeduld mit.
»Moment noch«, sagte Walter. Er wollte sichergehen, dass alles stimmte, dass er nichts vergessen hatte.
Walter winkelte die Arme der Toten ein wenig an. Ihre Gelenke waren geschmeidig, die Haut weich, fast samtig. Schließlich hatte sie bis vor – er schielte auf seine Uhr – vor nicht einmal ganz fünfundzwanzig Minuten noch gelebt. Hinrichtungen fanden vor Sonnenaufgang statt, als wollte man diesen Job lieber schnell noch im letzten Dunkel der Nacht verrichten. Danach hatte man es eilig, die Toten loszuwerden. Als ob man sich schämte.
»Jetzt den Deckel drauf?«, fragte der Junior dann.
Jack wurde nächsten Monat neunzehn. Seinen Vater überragte der »Junge« schon, seit er fünfzehn gewesen war, und inzwischen war er mindestens einen halben Kopf größer. Aber auch insgesamt war Jack viel kräftiger gebaut als Walter. Kein Wunder, schließlich hatte er schon in der Highschool Football gespielt, war Quarterback bei den »Queens Cougars« gewesen.
Walter nickte seinem Sohn zu und trat um den Sarg herum zu ihm. Gemeinsam griffen sie nach dem Sargdeckel, der seitlich am Überführungswagen lehnte, um ihn aufzulegen und zu befestigen.
»Brauchen Sie Hilfe?«, fragte der Gefängnismitarbeiter. Walter kannte ihn, sie hatten in der Vergangenheit auch das eine oder andere Schwätzchen gehalten. Walter war schon öfter auf Rikers Island gewesen, es war schließlich nicht das erste Mal, dass er das Opfer einer Hinrichtung in die Arme der Familie zurückführte. Die Gefängnisleitung arbeitete nur mit einer Handvoll von Bestattern zusammen, denen man vertraute, weil man sie gründlich überprüft hatte. Aber an den Namen des Mannes konnte sich Walter nicht erinnern. Er hätte ihn überall wiedererkannt, aber ein Namensgedächtnis hatte Walter einfach nicht.
»Geht schon«, sagte er mit einem Lächeln.
Plötzlich hielt er inne.
Die Aufzugstür öffnete sich mit einem Klappern, heraus traten eine Frau von Anfang fünfzig und ein deutlich jüngerer Mann in schwarzem Anzug.
Das war ungewöhnlich, und Walter sah, wie der Uniformierte, fast reflexhaft, die Hand auf den Griff der Pistole legte, die an seinem Gürtel im Holster steckte.
Die Frau, die ihr dunkelrotes Haar zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hatte, kam näher. Der Mann im Anzug hob dabei die Hände ein wenig an. Walter kannte die beiden nicht, vermutete in ihr aber eine Ärztin. Wegen des weißen Kittels, den sie trug. Er sah auch, wie der Uniformierte sich entspannte – immerhin hatte er keine Gefangene mehr zu überwachen, sondern nur den ordnungsgemäßen Abtransport einer Hingerichteten.
»Dr. McTaggart?«, fragte er. »Was tun Sie denn hier …?«
Die Frau schien antworten zu wollen, doch der jüngere Mann kam ihr zuvor.
»Ich wollte …«, begann er zögerlich, »ich wollte fragen, ob es wohl möglich wäre, dass ich noch einen Blick auf die … auf Miss Decker werfen dürfte. Um … na ja, um Abschied zu nehmen. Allein. Oder«, er streifte alle Anwesenden mit seinem Blick, »wenigstens in kleinerer Runde.«
Die Brauen des Uniformierten rutschten ein wenig hoch. »Ach, Sie sind doch …«
Der Mann aus dem Fahrstuhl nickte. »Ja, genau. Ihr Partner.«
Der rotbäckige Uniformierte nickte, dabei verschwand sein Kinn fast in einer wulstigen Falte, die sein Hals über dem Hemdkragen bildete. »Na gut, meinetwegen. Ich versteh Sie ja.« Das Band zwischen Polizisten war ein ganz besonderes, und es bestand nicht nur über den Tod hinaus, es gab in aller Regel gar nichts, was es trennen konnte. Rodensky & Sons hatten schon etliche Polizisten zur letzten Ruhe begleitet, und Walter fand, dass diese Trauerfeiern zu den ergreifendsten überhaupt zählten.
»Trotzdem, machen Sie’s kurz, ja?«, sagte der Uniformierte.
»Natürlich.« Der Mann aus dem Fahrstuhl kam näher, die Ärztin immer noch an seiner Seite. Walter fiel auf, wie der Mann sich umschaute. Als suchte er etwas, an den Wänden oder an der Decke. Aber vielleicht fühlte er sich auch einfach nur unbehaglich. Walter verstand nicht, was vorging. Fragend sah er den Uniformierten an, der dem Paar ohne besondere Eile folgte. Er fing den Blick des Bestatters auf und wies auf den Mann im schwarzen Anzug.
»Das ist Special Agent … äh …« Er schnippte mit den Fingern. Offenbar hatte auch er kein besonders gutes Namensgedächtnis.
»Cotton«, sagte der andere Mann. Aus der Nähe sah Walter nun, dass der schwarze Anzug einige Knitterfalten aufwies. Das hieß, dass der Mann ihn falsch aufbewahrte und vermutlich eher selten trug. Dazu passte auch das Gesicht des Mannes: Er sah aus, als sei er unlängst in eine Schlägerei geraten, aus der er wohl nur als zweiter Sieger hervorgegangen war. Wenn man genau hinschaute, schien der Mann sogar ein wenig zu humpeln, was er allerdings zu kaschieren versuchte.
Er bedeutete Jack, ein wenig zurückzugehen, damit der Special Agent einen Moment lang Abschied nehmen konnte von seiner Partnerin. Wer weiß, was die beiden alles zusammen erlebt hatten. Und überlebt. Bevor Philippa Decker …
Diesen Gedanken verfolgte Walter nicht weiter. Natürlich wusste er, weswegen die Frau angeklagt und verurteilt worden war. Sie hatte ein Kaufhaus an der Fifth Avenue in die Luft gesprengt. Es hatte Tote und Verletzte gegeben. Zwei Jahre war das her, und zwei Jahre lang hatten die Medien den Fall immer wieder aufgekocht.
Jetzt beugte der Special Agent sich vor, fasste zaghaft nach dem Gesicht der Toten und ließ zwei Finger einen Moment lang auf ihrer Wange liegen. Eine letzte Berührung, solange noch ein Hauch ihrer Wärme spürbar war.
Walter musste schlucken.
Dann drehte der Mann sich zu dem Uniformierten um und sagte: »Es tut mir leid.«
Walter war verwirrt. Der Uniformierte auch. »Was meinen Sie …«, fing er an, doch er sollte den Satz nicht mehr beenden.
Denn der Mann in dem schwarzen Anzug kam einen Schritt auf ihn zu, stellte den rechten Fuß angewinkelt hin und scherte elegant mit der linken Faust aus. Er traf dem Uniformierten genau in den fleischigen Bauch. Der Mann keuchte vor Schmerz auf und beugte sich vor. Gleichzeitig trat der Mann einen weiteren Schritt näher, bis er neben ihm war, und rammte ihm dann den Ellbogen an die Schläfe. Jetzt sackte der Uniformierte auf die Knie. Der FBI-Mann fasste ihm unter die Arme und sorgte dafür, dass er nicht haltlos und schwer wie ein Sack zu Boden fiel. Mit einer flüssigen Bewegung zog der Mann die Pistole des Uniformierten aus dem Gürtelholster und kreiselte auf der Stelle herum, die Waffe im Anschlag.
Walter hob die Hände. Die Mündung, in die er schaute, kam ihm vor wie ein riesiger, schwarzer Tunnel.
»Keine falsche Bewegung«, warnte der Mann im schwarzen Anzug.
*
Queens, Hunters Point, 5:57 Uhr. Jetzt.
Zeerookah saß am Steuer des weißen Minivans und starrte in das klare Licht des frühen Morgens hinaus. Die alten Gebäude entlang der 45th Avenue warfen im Schein der tief stehenden Sonne lange Schatten, die wie schwarze Abgründe über der Straße lagen. Für gewöhnlich gefiel ihm dieser historische Distrikt an der South Side von Long Island City. Heute nicht.
Seine Augen brannten. Er hatte die ganze Nacht nicht geschlafen. Wahrscheinlich hätte er das auch dann nicht getan, wenn Cotton ihn nicht noch weit nach Mitternacht angerufen hätte. Denn heute wurde Philippa Decker hingerichtet.
Er schielte mit trübem Blick zur Uhr im Armaturenbrett und korrigierte sich: Heute war Philippa Decker hingerichtet worden.
Cotton hatte sich am Telefon sehr bedeckt gehalten, sein Anliegen aber eindeutig dringend gemacht. Aber es war vielleicht besser so. Auch im G-Team verfuhr man oft nach dem »Need-to-know«-Prinzip. Je weniger Zeerookah wusste, desto besser war es. Dann würde man ihm kaum einen Strick daraus drehen können. Schließlich tat er nichts anderes, als einen Minivan irgendwo abzustellen und seiner Wege zu gehen. Ein paar Straßen weiter würde er dann in die Subway steigen und nach Hause fahren. Fertig. Obwohl er ahnte, dass es nur um eine Person gehen konnte: Philippa Decker.
Oder um ihre Leiche.
Behutsam gab Zeerookah Gas. Der Minivan setzte sich in Bewegung und rollte um die Ecke.
»Joe kann nicht mehr«, hatte Cotton gestern Abend fast ohne Vorrede gesagt. Die Hintergrundgeräusche hatten verraten, dass er von einem Münztelefon an irgendeiner Straße anrief.
»Joe? Joe Brandenburg? Er kann nicht mehr? Wie kann ich ihm da helfen, Cotton? Ich bin doch kein Urologe.«
»Du sollst nicht ihm helfen, sondern mir. Das hätte eigentlich Joe tun sollen. Aber er wurde erwischt.«
»Erwischt?«, hatte Zeerookah gefragt. »Wobei denn ›erwischt‹? Und was …«
Zeerookah brach mitten im Wort ab. Ihm wurde plötzlich klar, dass er es gar nicht so genau wissen wollte. »Glaubhafte Bestreitbarkeit« nannte man das. Und plötzlich wünschte er sich, er hätte den Anruf nicht entgegengenommen. Im Grunde hätte er sich einen ruhigen Abend machen können. Er hatte schon eine Tiefkühlpizza im Ofen gehabt und überlegt, ob er noch eine Runde Immortal Defender IV spielen oder lieber noch auf einem Forum posten sollte. Er war gerade im Begriff, über den TOR-Browser und mittels einer gefälschten IP-Adresse eine künstliche Identität aufzubauen, mit der er hoffte, in den nächsten Monaten eine russische Trollfarm in den Uralbergen zu infiltrieren.
Aber im Grunde hatte er gar nichts auf die Reihe gebracht. Er war in Gedanken bei Philippa Decker gewesen.
Und dann hatte das Telefon geklingelt. Cotton hatte unklare Andeutungen gemacht, dass Brandenburg wegen der »Sache mit dem Streifenwagen« Ärger mit seinem Chef hatte und ein paar Tage den Ball flach halten musste. Weswegen Cotton sich jetzt an ihn wendete. Den lieben, guten, alten Zeery. Einen seiner allerbesten Freunde auf der ganzen Welt.
»Cotton, wovon redest du eigentlich? Hast du getrunken, geht’s dir nicht gut? Soll ich zu dir kommen?«
»Nein. Es ist besser, wenn uns niemand zusammen sieht.« Cotton räusperte sich, bevor er fortfuhr: »Sag mal … also, könntest du ein Auto für mich klauen?«
»Ein Auto …?«
»Am besten einen Minivan oder so was.«
»Ach? Und soll’s auch ’ne bestimmte Farbe sein?«, hatte Zeerookah sarkastisch gefragt.
»Auf keinen Fall Rot. Fällt zu sehr auf.«
»Aha.«
»Und es wäre gut, wenn du die Nummernschilder von einem anderen Wagen abschraubst.«