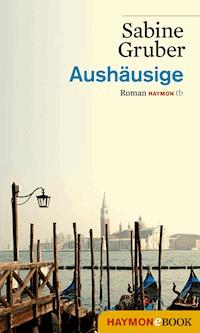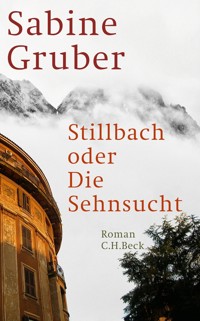10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Bruno Daldossi ist ein erfolgreicher Fotograf, der sich auf die Arbeit in Krisen- und Kriegsgebieten spezialisiert hat. Nach vielen Jahren, in denen er für das Hamburger Magazin "Estero" in Tschetschenien oder im Irak, im Sudan oder in Afghanistan fotografiert hat, geht er mit Anfang Sechzig nur noch sporadisch auf seine gefährlichen Missionen. Als ihn aber seine langjährige Gefährtin Marlis, eine Zoologin, mit der er in Wien zusammenlebt, wegen eines anderen Mannes verlässt, verliert der so gehärtete Mann völlig den Halt. In seine Trauer um den Liebesverlust mischt sich immer stärker die Frage, wie mit dem Leid der Welt, das er in seinen Bildern festhält, zu leben und wie damit umzugehen ist. Wie viel Wahrheit halten wir aus? Wie viel Einfühlung, wie viel Nähe sind uns möglich? Daldossi freundet sich mit der Journalistin Johanna Schultheiß an, die aus Lampedusa berichten soll, und reist ihr nach. Und er versucht, Marlis zurückzugewinnen und Verantwortung zu übernehmen für wenigstens eins der Schicksale, die seinen Weg gekreuzt haben.
In diesem kühnen Roman erzählt Sabine Gruber dicht, genau, schön und spannend von journalistischer Wahrheitsfindung, Krieg, Krisen und von einer großen Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Sabine Gruber
Daldossioder Das Leben des Augenblicks
Roman
C.H.Beck
Über das Buch
Bruno Daldossi ist ein erfolgreicher Photograph, der sich auf die Arbeit in Krisen- und Kriegsgebieten spezialisiert hat. Nach vielen Jahren, in denen er für das Hamburger Magazin «Estero» in Tschetschenien oder im Irak, im Sudan oder in Afghanistan photographiert hat, geht er mit Anfang Sechzig nur noch sporadisch auf seine gefährlichen Missionen. Als ihn aber seine langjährige Gefährtin Marlis, eine Zoologin, mit der er in Wien zusammenlebt, wegen eines anderen Mannes verläßt, verliert der so gehärtete Mann völlig den Halt. In seine Trauer um den Liebesverlust mischt sich immer stärker die Frage, wie mit dem Leid der Welt, das er in seinen Bildern festhält, zu leben und wie damit umzugehen ist. Wie viel Wahrheit halten wir aus? Wie viel Einfühlung, wie viel Nähe sind uns möglich? Daldossi freundet sich mit der Journalistin Johanna Schultheiß an, die aus Lampedusa berichten soll, und reist ihr nach. Und er versucht, Marlis zurückzugewinnen und Verantwortung zu übernehmen für wenigstens eins der Schicksale, die seinen Weg gekreuzt haben.
In diesem kühnen Roman erzählt Sabine Gruber dicht, genau, schön und spannend von journalistischer Wahrheitsfindung, Krieg, Krisen und von einer großen Liebe.
Über die Autorin
Sabine Gruber, geboren 1963 in Meran, lebt als freie Schriftstellerin in Wien. Für ihr Werk,
Erzählungen, Hörspiele und Theaterstücke sowie ihre Romane «Aushäusige», «Die Zumutung» (C.H.Beck, 2003), «Über Nacht» (C.H.Beck, 2007) und «Stillbach oder Die Sehnsucht» (C.H.Beck, 2011) und den Gedichtband «Fang oder Schweigen» erhielt sie zahlreiche Preise und Stipendien, u.a. den Priessnitz-Preis, den Förderungspreis zum österreichischen Staatspreis, das Elias-Canetti-Stipendium der Stadt Wien, den Anton Wildgans-Preis, das Robert Musil-Stipendium, den Veza Canetti-Preis der Stadt Wien und den Österreichischen Kunstpreis für Literatur 2016.
Inhalt
I
II
Danksagung
Für meine Freunde undfür Bonginkosi
Wir erinnern uns in Bildern. Wenn wir uns verbieten, Bilder anzusehen, wie sollen wir das Geschehene im Gedächtnis speichern? Woran wir uns nicht erinnern, das hat nicht stattgefunden.
Christoph Bangert
I
Die Vögel hatten wegen des Gefechtslärms die Bäume verlassen und waren davongeflogen.
Bruno Daldossi saß auf der Rückbank eines Kleinbusses, schaute aus dem Fenster. Sie fuhren auf das Dorf zu. Er versuchte zu verstehen, was in diesem Augenblick geschah oder was passieren könnte, war aber gleichzeitig abgelenkt. In zwei Tagen würde er wieder bei Marlis sein; er konnte selbst hier, auf dem Land, ihre Haut riechen, zerwühlte in Gedanken ihr Haar, küßte sie zwischen die Beine.
Am linken Straßenrand steckten rotbemalte Holzpfosten in der Erde. Danger hatte jemand auf ein Schild geschrieben.
Einmal hatte Daldossi in Bosnien die Straße verlassen müssen, um zu pinkeln. Während er den Schwanz zurück in die Hose gesteckt und den Reißverschluß zugezogen hatte, waren zwei Männer ein Stück weit auf ihn zugelaufen und hatten geschrien. Daldossi war so in Gedanken versunken gewesen, daß er nicht gleich verstanden hatte, was sie von ihm wollten, warum sie nicht näher kamen. Zwei Stunden hatte er dann bewegungslos im Feld ausgeharrt, bis der Minensuchtrupp gekommen war, um ihn aus dem gefährlichen Gelände zu befreien.
Wieder war das Knattern eines Maschinengewehrs zu hören. Er wandte den Kopf, konnte aber nichts erkennen. Der Widerhall kam von weit her. Scharfe Munition erzeugt nach dem Abfeuern einen zweiten Knall, manchmal einen dritten beim Einschlag.
Daldossi vermutete die Scharfschützen hinter dem bewaldeten Hügel. Dort war vor wenigen Minuten die Sonne untergegangen. Herbstkälte breitete sich aus.
Was wird das jetzt, fragte Henrik Schultheiß neben ihm.
Daldossi schaute schweigend in die Landschaft, sah einen Ausschnitt aus Himmel, Bäumen und Wiese in diffusem Licht. Er hatte immer schon photographiert. Auch damals, als er noch gar keine Kamera besessen hatte. Von klein auf hatte Daldossi mit den Daumen und Zeigefingern die Form eines Vierecks nachgebildet und durch den Fingerrahmen Gegenstände, Autos, Wälder und Gesichter betrachtet. Und wenn er lange genug stillgehalten hatte, war es ihm sogar gelungen, das fertige Photo vor sich zu sehen.
Mit zehn hatte er von seiner Mutter zu Weihnachten einen Photoapparat geschenkt bekommen. Ständig hatte ihm sein Vater Vorhaltungen gemacht, er verprasse zuviel Geld, verschieße zu viele Filme.
Schultheiß klopfte mit dem Zeigefinger auf Daldossis Oberarm.
Dieses Mal mußte Daldossi reagieren.
Sag schon, was wird das.
Ich weiß es nicht.
Das Auto fuhr die Straße hinunter. Rechter Hand auf der Wiese wuchs noch immer fettes Gras.
Schultheiß redete gerne, und er redete viel. Es war nicht das erste Mal, daß sie beide gemeinsam unterwegs waren. Aber jetzt war es besser, die Augen offenzuhalten. Es steckten noch immer Warnschilder im Boden, und es waren keine Menschen zu sehen.
Kein gutes Zeichen, dachte Daldossi. Die Leute kriegen in der Regel mit, wenn irgendwo eine Bombe in die Erde gelegt wird, sie verschwinden, bevor sie gezündet wird.
Ich weiß nicht, warum ich diesen Quatsch hier mitmache, sagte Schultheiß. Eigentlich will ich sowieso nicht mehr.
Es zwingt dich keiner. Steig einfach aus.
Jetzt? Schultheiß schüttelte den Kopf. Ich bin kein Selbstmörder. Hast du den starren Grashalm vorhin bemerkt? Der Oberfeldwebel meinte, es sei ein Minenzünder. Und das gelbe Spielzeugauto vor dem großen Stein?
Hab ich. Und du – hast du den dünnen grünen Faden gesehen?
Wo?
Er verlief entlang der Straße, man konnte ihn zwischen den Grasbüscheln nicht erkennen. Ich hatte zufällig die Brille auf, weil Marlis kurz vorher eine SMS geschickt hat. Sie ist sehr aufgeregt, sagte Daldossi, sie bekommt demnächst einen neuen Bären für ihr Gehege in Zwettlburg. Ein Jungtier, das von den Behörden beschlagnahmt worden ist.
Warum das denn? Schultheiß wippte mit den Beinen.
Man hatte es in einer winzigen Betongrube gehalten. Jetzt wird der Bär in den niederösterreichischen Wald übersiedelt. Marlis wird für seine Erholung sorgen.
Ein vernünftiger Beruf, sagte Schultheiß. – Der Typ fährt ein bißchen schnell, findest du nicht? Schultheiß beugte sich vor, um einen Blick auf den Tacho zu werfen oder um den Fahrer zu ermahnen. Der drehte sich in diesem Moment zu ihm nach hinten und verriß das Lenkrad. Er steuerte den Kleinbus in die Wiese.
Shit. Haben Sie keine Augen im Kopf?
Der Wagen kam drei Meter von der Straße entfernt zum Stehen.
Schultheiß griff nach dem Oberarm des Fahrers und schüttelte ihn.
Sie haben mich abgelenkt, sagte der Mann.
Ich hab gar nichts! Sie waren zu schnell unterwegs. Das hab ich kommen sehen. Jetzt stecken wir in der Scheiße.
Daldossi öffnete die Tür.
Schultheiß riß ihn zurück. Hast du die roten Pfosten nicht gesehen?
Doch.
Ja dann?
Ich suche nach der Reifenspur.
Warum das?
Ist vermutlich die einzige Möglichkeit, um heil auf die minenfreie Straße zu gelangen.
Und wenn du daneben trittst? Das sind die wirklich gefährlichen Seitensprünge, sagte Schultheiß und fing an zu lachen.
Werd jetzt nicht albern. Daldossi zog die Autotür wieder zu und kletterte nach hinten. Wir haben Glück.
Glück nennst du das? Schultheiß fuhr sich durchs Haar und zog den Reißverschluß seiner wattierten Jacke nach oben.
Wir könnten jetzt auch in einem kleineren Auto ohne Hintertür sitzen, sagte Daldossi.
Dann wäre ich aber selber gefahren, und wir wären nicht in dieser verseuchten Wiese gelandet.
Noch ist nichts passiert.
Es gibt auch Minen, die erst bei der zweiten Berührung hochgehen.
Zieh deinen Gürtel aus, sagte Daldossi.
Was willst du damit?
Oder hast du eine Mütze oder Wollhandschuhe dabei?
Nur einen Schal, sagte Schultheiß.
Gut. Trenn ihn auf.
Spinnst du? Den hat mir Johanna gestrickt.
Wir haben nicht viel Zeit zu verlieren. Das Gras richtet sich wieder auf, sagte Daldossi. Er kniete auf der schmalen Ladefläche und versuchte sich den genauen Verlauf der Reifenspuren einzuprägen. Dann setzte er sich hin, hielt die Beine hoch.
Schultheiß reichte ihm den Schal nach hinten.
Mit einem Farbspray wäre es einfacher, die sicheren Trittstellen einzuzeichnen, sie hatten aber keinen dabei.
Typisch, daß Schultheiß sitzen blieb und ihn die Arbeit machen ließ.
Versuchen wir es einmal so, sagte Daldossi und trat mit dem rechten Fuß in die Spur.
Ich weiß nicht, ob es klug ist, auf der Rückbank zu bleiben, sagte er zu Schultheiß.
Vorsichtig legte er den Schal aus, markierte damit den rechten Rand der Reifenspur, ihren weiteren Verlauf, dann setzte er den anderen Fuß ins Gras. Als Daldossi die Straße erreichte, pfiff der Oberfeldwebel die Übung ab.
Schultheiß stieg aus dem Auto und stellte sich zu den anderen Journalisten und Photographen dazu.
Ihr Kollege hatte recht, sagte der Oberfeldwebel zu Schultheiß, Sie hätten in Deckung gehen müssen, vorne beim Fahrer.
Es schien, als prallten die Strahlen am Wasser ab, als wäre seine Fläche aus einer festen und harten Materie, wie bei einem Sprung aus hundert Metern Höhe, wenn der menschliche Körper nicht mehr einzutauchen vermag, ohne sich zu verletzen. Auch an jenem Tag sah es aus, als zerschellte das Licht auf dem dunklen, stillen Meer. Das Glitzern und Gleißen blendete die Frauen und Männer im Fischerkahn, die eng aneinandergedrängt dasaßen und schwiegen. Von den neunundvierzig Passagieren war nur noch einem der älteren Männer etwas zu trinken übriggeblieben, die anderen hatten ihren Flüssigkeitsvorrat aufgebraucht und die leeren PET-Flaschen von Bord geworfen. Fast alle der unter dreißig Jahre alten Bootsinsassen dösten vor sich hin oder hielten mit zusammengekniffenen Augen Ausschau nach dem Küstenstreifen, lediglich die Männer, die hinten saßen, wandten immer wieder den Kopf und blickten auf das V-förmige Muster der Kielwelle.
Die Augen der Frauen und Männer waren von der salzigen Seeluft gerötet, die Haut brannte von den Stunden in der prallen Sonne.
Die Kälte, die sich nach dem Sonnenuntergang auszubreiten begann, erst kaum merkbar, weil die Haut sich noch an die Hitze des Mittags und die Wärme des späten Nachmittags erinnerte, kroch nach und nach in die dünnen Anoraks, T-Shirts, Hosen und langen Röcke, biß sich darin fest, so daß die zwei Frauen, die hinten saßen, mit den Zähnen zu klappern begannen, den Kopf auf die Brust sinken ließen und ihre Scheu vergessend, noch näher an ihre Nachbarn heranrückten.
Von den neunundvierzig Passagieren, die in Zuwara an Bord gegangen waren, konnten nur einige Männer und eine Frau schwimmen. Mit Schiffen vertraut war niemand, nicht einmal die zwei offiziellen Steuermänner hatten Erfahrungen auf See gesammelt. Die Ägypter hatten vorgegeben, sich auszukennen, in Wirklichkeit waren auch sie nie mit einem Boot aufs offene Meer hinausgefahren. Die beiden waren in den Augen der Fahrenden Wegweiser in der Weite des Meeres, Führer, denen alle vertrauten, weil sie für die Reise bezahlt und monatelang auf den – wie es hieß – idealen Tag der Überfahrt gewartet und dafür eine große Summe an Madame Ganat entrichtet hatten. Keiner erzählte, daß Madame das Geld zweimal, bei der Aufnahme in deren heruntergekommenes, überfülltes Haus und viele Monate später beim Aufbruch nach Lampedusa verlangt hatte, keiner sagte laut, daß man ihm sein letztes Erspartes, das für den Neuanfang in Italien gedacht gewesen war, abgenommen, daß er in der Aufregung der plötzlichen, seit Monaten herbeigesehnten, aber fast nicht mehr erwarteten Abreise widerstandslos die Dollarscheine an die Schlepper übergeben hatte. Andernfalls wäre sein Platz in dem randvoll besetzten Boot jemand anderem überlassen worden. Manche schwiegen, weil sie ohnehin niemand verstanden hätte oder weil die eigene Angst und die Ungewißheit über den Verlauf der Reise ihnen den Mund verschlossen.
Die zwei Ägypter hielten beide eine kurze Eisenstange in der Hand; vom älteren hieß es, er trüge noch eine andere Waffe bei sich. Sehr bald war allen klar, daß die Stangen keine der Bootsfahrt nützlichen Gegenstände waren, sondern als Waffe benutzt wurden, als Respekt verschaffende Schlaginstrumente, mit denen die Bootsinsassen ruhig gehalten wurden.
Marik war zweiundzwanzig, er war weniger brutal als Kamal, der nichts von sich preisgab, vermutlich weil er fürchtete, daß die anderen Frauen und Männer persönliche Äußerungen als Zeichen der Schwäche interpretieren könnten. Kamal schrie von Anfang an, Marik nur, wenn Kamal ihn dazu aufforderte. Beide reisten gratis, weil Steuermänner immer gratis übersetzen durften. Kamals Haut war von dünnen schwarzen Haaren bewachsen, selbst das Gesicht wies mit Ausnahme der Augen-, Nasen- und Mundpartie dunkle Haarschatten auf.
Die Stunden zuvor waren ruhig verlaufen. Am Abend wuchsen die Wellen zum ersten Mal, das Boot schaukelte heftig, es schien jedes Mal, als fiele es von einer hohen Welle in einen Abgrund. Wasser drang ein.
Nuruddin, der jüngste Somalier – er war fast fünfzehn –, hatte sich übergeben und es nicht rechtzeitig an die Bordkante geschafft. Der Geruch des Meeres war intensiv, egal woher die Winde kamen, als habe das Erbrochene die Duftwolkendecke verstärkt. Sie erinnerte an Fäulnis, an Schwefel, und die am Morgen über dem Boot kreisenden Seevögel bekräftigten die Vorstellung von verwesender Materie.
Nachdem die turbulente Nacht vorüber war, machte sich Erleichterung breit. Die meisten der Bootsinsassen waren eben erst eingeschlafen oder dösten, als das Tuckern des Motors abrupt aussetzte.
Viele dachten wohl, sie hätten den größten Teil der Strecke hinter sich gebracht, sie schliefen aus Erschöpfung über die durchwachten unruhigen Stunden, wähnten sich schon in Sicherheit, weil sie sich nach dem hohen Seegang keinen noch höheren vorzustellen vermochten, ihn sich nicht mehr vorstellen wollten. Sie sahen sich bereits an Land gehen, mit heilen Körpern und Zukunftsvorstellungen, die sie sich all die Jahre und Monate zuvor ausgemalt hatten, die ihnen geholfen hatten, die Strapazen und Entbehrungen auszuhalten.
Sogar die beiden Steuermänner reagierten nicht sofort, zeitversetzt hörte man sie fluchen, und die wacheren unter den Passagieren schrien alsbald wild durcheinander. Kamal hielt seine Eisenstange in die Höhe und drohte diejenigen zu schlagen, die nicht stillhielten, denn die lauten Stimmen wurden von wilden Gebärden Richtung Motor begleitet.
Die drei Syrer, zwei davon Brüder, hatten sich kurz erhoben, um sich einen Überblick zu verschaffen. Eine der beiden Frauen sprang ebenfalls auf, sagte aber kein Wort. Allzu heftige Bewegungen konnten das Boot zum Kippen bringen; Marik deutete mit der Hand, alle mögen sich setzen. Kamal griff mit der Rechten in seine Hosentasche, zog eine Pistole heraus.
Der ausgefallene Motor schien weniger Schrecken zu verbreiten als der Lauf der Schußwaffe. Die sichtbare Bedrohung zeigte sofortige Wirkung: Es herrschte Stille, angstvolles Staunen. Das unterdrückte Kreischen einer der beiden Frauen erinnerte an ferne Möwenschreie. Nuruddin zitterte wie im Fieber.
Die Steuermänner waren nicht in der Lage, den Motor zu reparieren. Nuruddin dämmerte vor sich hin. Eine der beiden Frauen hatte ihr Gesicht hinter den Händen versteckt und weinte tränenlos. Selbst das Beben ihres Körpers war kraftlos. Die drei Syrer warteten auf die Dunkelheit und darauf, daß Kamal geschwächt und übermüdet die Augen schließen würde. Sie überwältigten Marik und entwaffneten anschließend Kamal, um an den kaputten Motor heranzukommen. Tatsächlich schaffte es einer der Brüder, den gerissenen Riemen notdürftig zu flicken und das Boot in Bewegung zu setzen.
Die Ausrufe der Freude hörte Nuruddin nicht mehr, auch nicht die Kommentare zweier Landsmänner, Kamal solle man ins Wasser werfen, er tauge nicht als Steuermann. Nuruddin war ohnmächtig geworden, die junge Frau vor ihm rüttelte vergeblich an seinen Beinen. Sie hörte damit auf, als der Riemen des Motors neuerlich riß.
Das Schiff trieb auf offener See. Es vergingen mehrere Tage und Nächte. Die Niedergeschlagenheit und die körperliche Schwäche unter den Flüchtlingen waren inzwischen so groß, daß kaum einer der Bootsinsassen die Augen offenhalten konnte. Nuruddins Tod blieb eine Weile unbemerkt, bis die jüngere der beiden Frauen gegen seine Beine stieß.
Kamal durchforstete Nuruddins Kleidung, bevor er mit Hilfe zweier anderer die Leiche ins Meer warf. Wenig später hatte sich die junge Frau auf die Bordkante gesetzt und nach hinten fallen lassen. Sie war fast lautlos ins Wasser geglitten. Über eine Stunde hatten die am Rand sitzenden Bootsinsassen die tote Frau treiben gesehen.
So starben immer mehr Bootsinsassen an Erschöpfung und Austrocknung. Die Flüssigkeit entschwand über den Urin, den Stuhlgang, den Schweiß und die Atemluft aus ihren Körpern. Anfangs wurden die Toten noch mit Gebeten verabschiedet, später warfen die Flüchtlinge die leblosen Körper schweigend ins Wasser.
Als zum ersten Mal die fernen Lichter eines fremden Fischerboots zu sehen waren, schöpften einige Männer und Frauen Hoffnung.
Da sich das Boot kaum von der Stelle bewegte, hatte Kamal die Idee, zwei oder drei sollten zum Fischerboot schwimmen, um Hilfe zu holen. Von denen, die schwimmen konnten, waren bereits zwei Männer tot, einer litt an Durchfall und war viel zu schwach. Kamal, der mit Unterstützung von Marik wieder in den Besitz seiner Waffen gelangt war, zwang zwei Nichtschwimmer, ihn zu begleiten. Er schüttete den Rest des Benzins aus den Blechfässern ins Meer und befahl einem Syrer und einem Somalier, sich an den Benzinfässern festzuhalten und Richtung Boot zu strampeln. Kamal begab sich zu ihnen ins Wasser, doch die beiden Nichtschwimmer wurden von der Strömung abgetrieben. Mit letzter Kraft schwamm Kamal zum Flüchtlingsboot zurück. Er bat diejenigen, die im Fischerboot geblieben waren, ihn an Bord zu ziehen. Er solle die beiden anderen zurückholen, sagten die syrischen Brüder, die den Motor repariert hatten, dann würden sie ihm helfen. Kamal schwamm den beiden hinterher und ward nicht mehr gesehen.
Es überlebten nur jene, die mit ihren Kräften sparten und sich kaum bewegten. Einzelne deckten sich mit Leichen zu, weil es in der Nacht kalt geworden war, oder sie legten sich auf die Toten, um nicht mit den Exkrementen auf dem Schiffsboden in Berührung zu kommen.
Als das im Meer treibende Boot von zwei Fischern entdeckt wurde, glaubten die beiden Italiener, sie seien auf ein Totenschiff gestoßen; erst nachdem sie in die Nähe des Boots gekommen waren, hatten die Fischer leises Wimmern vernommen.
Der jüngere der syrischen Brüder war der einzige gewesen, der noch einen Arm hatte heben können. Die anderen Flüchtlinge waren so schwach gewesen, daß sie nicht imstande waren, die Wasserflaschen und das Brot, das ihnen die Fischer zuwarfen, sich zu nehmen.
Im Hafen von Lampedusa wurden die Toten in Säcke gesteckt und weggebracht.
Jemand bemerkte, daß sich der Körper einer jungen Frau, die man schon für tot gehalten hatte, bewegte.
Der Mann, der Djamila wieder aus dem Sack hervorholte, trug die Sonnenbrille in die Haare geschoben, obwohl tiefe Nacht war. Die Fünfzehnjährige war stark abgemagert, ihr Kopf schwankte. Sie sah kurz in das Gesicht des Mannes, schloß aber vor den sie anstrahlenden Taschenlampen und den Blitzlichtern sofort wieder die Augen.
II
Ein Mädchen mit einem Aluminiumteller in der Hand dreht sich mitten auf der Straße zwischen zwei bis auf die Grundmauern heruntergebrannten bombardierten Häuserzeilen nach dem Betrachter um. Es trägt einen dicken schwarzen Mantel und ein olivgrünes Kopftuch. Die zwei Bäume am Straßenrand sind verkohlt. Überall liegt Schutt. Der Teller in der Mitte des Bildes ist der einzige helle Gegenstand in der überwiegend schwarzgrauen, winterlichen Ruinenlandschaft.
Tschetschenisches Mädchen mit Teller, Farbphotographie, Grosny/Tschetschenien, Jänner 1995, veröffentlicht in Estero am 16.1.1996.
Bruno Daldossi war aufs Land gefahren, in das Waldhaus seines Freundes. Auf dem Weg dorthin hatte er beinahe einen Fuchs überrollt. Er konnte den Wagen rechtzeitig anhalten, hörte erst das Quietschen der Bremsen, unmittelbar danach einen dumpfen Knall und leises Klirren. Die Kartonschachtel im Kofferraum war umgefallen und aufgebrochen. Der Fuchs hatte überlebt, auch die Flaschen waren heil geblieben und lagen verstreut zwischen seiner Reisetasche und dem Verbandskasten. Zum Glück war niemand hinter ihm gewesen, keiner ihm entgegengekommen.
Immerhin – das Auto hatte Marlis ihm gelassen.
Rauhreif lag auf den Feldern, und Nebel hing über den Teichen und Wäldern. Was wollte er in der Natur. Abschalten, hatte Paul Vogel gesagt. Als könne man sich selbst abschalten. Er brauchte nur neue Aufträge. Das Laub hatte den Rasen vor dem Haus zugedeckt, unaufhörlich rieselte es von den Bäumen, selbst wenn der Wind aussetzte. Daldossi war auf die Terrasse getreten, um zu rauchen. Am frühen Morgen, als er in die Küche gegangen war, um Wasser zu trinken, hatte er vom Fenster aus ein Reh gesehen; es war den Maschendrahtzaun entlanggegangen und hatte zu ihm herübergeschaut. Jetzt hoffte er, es möge zurückkommen, aber er ahnte, daß sich dieser Wunsch nicht erfüllte. Es war eigentlich kein Wunsch, sondern eine Reaktion. Er mußte alles Auffällige festhalten, und um es festhalten zu können, mußte es sich wiederholen oder er mußte es inszenieren.
In letzter Zeit hatte die Konzentration abgenommen, er reagierte nicht mehr schnell genug. Es war auch schon vorgekommen, daß er die Kamera im Auto gelassen hatte, nicht, weil er sie vergessen hatte, sondern weil sie ihm in dem Augenblick, in dem er aus dem Wagen gestiegen war, gleichgültig gewesen war.
An diesem lichtlosen Tag erschienen ihm die knorrigen Obstbäume in Vogels Garten gestaltenhaft, als hätten sie ihr Pflanzenleben mit den Blättern abgelegt. Je länger Daldossi die Stämme und Äste betrachtete, desto undurchdringlicher kamen sie ihm vor, daran vermochten auch die Kleiber nichts zu ändern, welche die Stämme hinauf- und hinunterliefen.
Abschalten. Sein Freund wußte nicht, wovon er sprach.
Daldossis Gedankenschalter hatte die Angewohnheit, hartnäckig in seinem Zustand zu verharren, es war kein Standby möglich, die Bilder ließen sich nicht wegklicken, die Wörter nicht streichen, es sei denn, Daldossi hatte getrunken oder er war endlich, meist mit Hilfe von Beruhigungsmitteln, eingeschlafen.
Abschalten. Er schüttelte den Kopf. Der Wind fuhr in die Baumwipfel des Waldes, der hinter dem Zaun begann.
In den hohen Baumkronen hingen zwei Fallschirmjäger. Nein, sie hingen nicht dort. Doch Daldossi sah ihre herangezoomten, von Feindkugeln durchsiebten Körper, die in die Kronen gefallen waren; er dachte an das erfrorene Mädchen, das beim Klettern von Tschetniks getroffen worden war, an dessen dünne Beine, die von einem Apfelbaum hingen wie gepelzte Äste.
Er schloß die Lider, warf die Zigarette ins nachtnasse Laub und ging zurück ins Haus.
Das iPhone auf dem kleinen Küchentisch war dunkel. Er setzte sich und legte die Hände auf seine Oberschenkel, die Fingerspitzen zeigten nach innen; je länger er sie betrachtete, desto weniger erschienen sie ihm zugehörig. Die Hände berührten sich nicht, sie sahen aus, als stünden sie sich als Feindformationen gegenüber, als lauerten die einzelnen Finger auf einen Angriff.
Einmal, in Grosny, hatte er seinen in der Kälte unbeweglich gewordenen Zeigefinger kaum auf den Auslöser legen können.
In Stalingrad wärmten die Soldaten ihre Hände im Blut der Toten, um weiterschießen zu können.
Hör auf damit, hatte Marlis gesagt, als Daldossi ihr davon erzählt hatte.
Sie kennt nur den Schmerz, wenn man mit klammen Händen in die Zimmerwärme kommt.
Jetzt hatte sie einen neuen Mann gefunden, vielleicht war der Venezianer der erste, bei dem sie bleiben konnte.
Es war Teil ihrer gemeinsamen Vereinbarung gewesen, daß jeder seine Leidenschaften lebte, ohne den anderen damit zu belasten. Marlis’ neue Liebe war schwerwiegend und untragbar für sie beide.
Erst zehn Uhr. Um Öl zu sparen, sollte er den Kachelofen einheizen. Holz gab es genug. Durch den Nebelschleier drang etwas Sonnenlicht. Manche Stämme und Äste leuchteten grünlich.
Laß sie jetzt in Ruhe, hatte Vogel gesagt, du änderst ja doch nichts.
Sie hatten sich schon Jahre in Ruhe gelassen, Abstand genommen, und diesen Abstand für Reife gehalten. Der Venezianer war fünf Jahre jünger als Marlis.
Wie lange geht das schon, hatte Daldossi Marlis gefragt.
Willst du das wirklich wissen?
Er hatte nicht weitergefragt, stellte sich eine Zeit vor, die er nicht fassen konnte. Für einen seiner finanziell lukrativsten Aufträge hatte er vor Jahren mit Henrik Schultheiß in einem Zelt in der Wüste festgesessen. Sie hatten auf ein Interview mit Gaddafi gewartet, das ihnen versprochen worden war. Es vergingen Tage, Wochen. Schultheiß hatte Uwe Johnsons Jahrestage gelesen.
Was Daldossi selbst gelesen hatte, wußte er nicht mehr.
Es war ihm in der Einöde so vorgekommen, als stünden die Minuten Schlange, als weigerte sich wer, die Zeit abzurechnen; immer mehr Minuten kamen dazu. Am Ende waren es über dreißigtausend gewesen; als er die Zahl dem Kollegen genannt hatte, war dieser in Gelächter ausgebrochen. Er denke zu kleinteilig, hatte Schultheiß gesagt.
Das Display des iPhones war noch immer dunkel, nur die Birkenblätter vor dem Fenster leuchteten.
Daldossi stand auf und nahm einen Weißwein aus dem Kühlschrank. Das erste Glas trank er in einem Zug leer. Wenn schon abschalten, dann ganz, sagte er sich und griff nach dem Mobiltelephon. Aber anstatt es auszumachen, blätterte er in den Alben. Neunhundertneunundneunzig Photos, sechs Videos. Marlis’ dunkelrot angemalter Mund. Marlis im sommerlichen Trägerkleid, barfuß. Marlis, lesend auf dem Sofa. Die neuen Bilder würden ab jetzt auf einem italienischen Mobiltelephon gespeichert werden.
Er goß Wein nach. Die fürsorglichen Fragen nach dem Verlauf der Reise, die Marlis ihm stets in Form von SMS hinterhergeschickt hatte, erreichten ihn nun auch nicht mehr.
Als sie einander kennenlernten, schrieben sie sich noch Briefe mit der Hand. Das Echo auf die eigenen, unsicheren Zeilen ließ oft mehr als eine Woche auf sich warten. Marlis hatte manchmal Büttenpapier verwendet, getrockneten vierblättrigen Klee beigelegt oder mit ihrem Kußmund unterschrieben und den Lippenstift absichtlich auf dem Papier verwischt, so daß der Amorbogen und die Konturen der Unterlippe verlorengingen. Auflösung der Polarität hatte sie das genannt. Es gab nichts ohne Bedeutung in ihrem Handeln, das hatte ihn fasziniert. In den kleinsten Details versteckte sie Botschaften. Daldossi hatte immer nur das Versaute darin gesehen, ihre unbändige Lust.
Gestern war ihm aufgefallen, daß sie die Farbe des Lippenstiftes gewechselt hatte. Vielleicht war das schon länger so, und er bemerkte es erst jetzt, weil er Marlis nun mit den Augen des Venezianers betrachtete. Sie hatte ihm eine Aufnahme von dem Mann auf ihrem iPhone gezeigt, aber gleich weitergescrollt. Er war sich nicht sicher, ob sie es aus Rücksicht auf seine Gefühle getan hatte, oder ob die Rücksichtnahme nicht vielmehr ihr selbst galt, weil sie befürchtete, daß Daldossi über Domenico lästern würde. Den venezianischen Gymnasiallehrer hatte sie über Facebook kennengelernt. Er hatte Zwettlburg gelikt und Marlis anschließend persönlich angeschrieben. Bei der Klassenfahrt nach Wien und Oberösterreich planten Domenico und sein Kollege neben dem üblichen kultur- und kunsthistorischen Programm den Besuch einer Tierschutzorganisation. Die der Meeresbiologie und Meeresfauna überdrüssigen venezianischen Jugendlichen hatten für die Besichtigung altersschwacher Braunbären gestimmt. Sie war unmittelbar nach dem Besuch des Konzentrationslagers Mauthausen erfolgt. Mauthausen, Zwettlburg, Schönbrunn – das war die Reihenfolge gewesen.
Es fehle nur das Moulin Rouge in der Walfischgasse, hatte Daldossi gesagt.
Aber aus dem ist doch längst ein Pasta-Laden geworden, hatte Marlis gesagt und gelacht.
Domenico war Lektor am Institut für Lingue e scienze del linguaggio gewesen und hatte es nicht geschafft, die Hürden der universitären Hierarchie zu nehmen, was Marlis besonders für ihn einzunehmen schien.
Domenico liebe seine Schüler und seinen Beruf, er sei kein Bückling, sein Ehrgeiz diene der Sache und nicht dem eigenen Status. Sie hatte es mit Bestimmtheit formuliert und Daldossi fordernd angesehen. Er war nicht darauf eingegangen, obwohl er die indirekten Vorwürfe herauszuhören vermeinte.
Bis zum Mittag war die erste Zigarettenpackung leer, außerdem hatte Daldossi eineinhalb Flaschen Pinot Grigio getrunken.
Inzwischen war der Nebel undurchdringlich, der Wald verschwunden.
Als er ins Freie trat, um die Obstbäume abzuphotographieren, merkte er, daß er zitterte. Die Aktion erschien ihm lächerlich. Vor fünfunddreißig Jahren war er für seine Abschlußarbeit an der Universität für Angewandte Kunst in den Wienerwald gefahren, um Bäume zu photographieren, aber jetzt? Er hatte die Photos damals absichtlich etwas unterbelichtet und dann auf einem sehr harten Papier abgezogen, wodurch spezielle Grautöne entstanden waren. Daß er dieses Verfahren von Werner Bischof abgeschaut hatte, war niemandem aufgefallen. Bischof hatte zu Beginn seiner Laufbahn noch wilde Reben, Löwenzahn, Farnkraut und Kastanienwälder abgelichtet und war dann über die Modephotographie zur Reportage gelangt.
Er hatte die Schwarzweiß-Kompositionen von polierten Schneckenhäusern einfach weggelegt und sich für das Elend der Welt zu interessieren begonnen, war aus seinem beheizten Atelier direkt in die Kriegswelt gezogen.
Einen Moment lang glaubte Daldossi, im Nebel das Reh wiederzusehen; als er näher heranging, mußte er erkennen, daß er sich getäuscht hatte. Nachdem er ins Haus zurückgekehrt war, zog er seine Schuhe aus.
Er rief Sarah an, mit der er einmal einen Nachmittag im Hotel Orient verbracht hatte, aber sie ging nicht ans Telephon. Dann versuchte er es bei Stephanie.
Was machst du dort, mitten im Wald?
Daldossi hatte keine Lust auf Erklärungen, fragte sie, ob sie nicht ein paar Tage ausspannen wolle.
Du meinst, ob ich mit dir vögeln will? Ist Marlis im Ausland?
Er hörte sich lachen, aber es klang so, als käme sein Lachen aus dem Nebenzimmer. Das letzte Mal hatte er vor sechs Wochen eine Frau angefasst.
Stephanie war es nicht gewesen. Die war schon länger unabkömmlich, reiste mit ihren Photo-Vorträgen durch halb Europa.
Sie versprach, sich zu melden.
Stephanie rief nicht mehr an. Sarah antwortete auch nicht.
Er zog die Bettwäsche ab, packte seine Sachen zusammen.
Werner Bischof war neun Jahre alt gewesen, als dessen Mutter starb. Womöglich hatte der Schweizer seine behütete Photographenexistenz viele Jahre später abrupt beenden müssen, weil der frühe Tod der Mutter die Familienidylle zerstört hatte? Vielleicht war er eine Art Wiederholungstäter geworden, jemand, der immer wieder das Glück hinter sich lassen mußte, um die Enttäuschung über einen Verlust von vornherein klein zu halten?
Nachdem Daldossi zwei Espressi getrunken hatte, schaltete er die Heizung herunter und ging zum Parkplatz.
Nicht einmal einen ganzen Tag hatte er es in Vogels Waldhaus ausgehalten.
Du kannst das Auto in knapp zwei Stunden wiederhaben, schrieb er an Marlis.
Aber sie wollte das Auto nicht.
Wer braucht schon ein Auto in Venedig.
Marlis war abgereist. In dem Kabinett, dessen Fenster ins Stiegenhaus blickte, fehlten zwei Koffer, einer davon war sein eigener, den Daldossi für längere Aufenthalte im Ausland benutzt hatte.
Es war ein himmelblauer Hartschalenkoffer, der auf allen Flughäfen angekommen war, selbst in Palermo auf Sizilien.
Im Kabinett roch es nach Schuhen. Daldossi öffnete das Fenster und hob zwei Wäscheklammern vom Boden auf.
Marlis hatte sich nicht nur einen neuen Mann, sondern auch Daldossis Glückskoffer geschnappt.
Zuletzt hatte er mit ihr vor drei Monaten geschlafen. Sie waren vorher bei Freunden gewesen und um zwei Uhr morgens erschöpft und angetrunken nach Hause gekommen. Nicht erschöpft und nicht angetrunken genug. Sie hatte es mit sich geschehen lassen; Marlis’ Teilnahmslosigkeit hatte ihn einerseits erregt, andererseits hatte sich Daldossi erbärmlich gefühlt. Die Fremdheit, die er an ihr wahrgenommen hatte, war zuerst betörend gewesen, sie hatte ihn an ihre Anfangszeit erinnert, an die Unsicherheit und Unbeholfenheit, als sie sich noch zu begreifen versuchten, sich aneinander herangetastet hatten, dann war Daldossi durch Marlis’ beiläufige Bewegungen, denen mehr und mehr etwas Unkonzentriertes angehaftet hatte, auf seine eigene Gier zurückgeworfen worden.
Warum hab ich nicht aufgehört. Warum habe ich sie nicht zur Rede gestellt.
Er stieß mit seiner Schuhspitze an eine weitere federlose, halbe Wäscheklammer, ließ sie aber liegen.
Wenn ich sie damals angesprochen hätte, wäre es vielleicht noch möglich gewesen, sie umzustimmen, sie zurückzugewinnen.
Er rief Vogel an, um ihn zu fragen, wann und wo er ihm den Schlüssel für das Waldhaus zurückgeben könne, erreichte aber nur seinen Anrufbeantworter.
Marlis hatte nach den letzten Intimitäten, die sie ihm noch zugestanden hatte, gegen den Heizkörper gelehnt am Fenster gestanden – eine Angewohnheit, die sie auch im Sommer beibehielt –, sie hatte Daldossi den Rücken zugewandt und mit verschränkten Armen ins Freie hinausgesehen.
Er mochte es nicht, wenn sie in die Finsternis schaute, weil sie ihm einmal erzählt hatte, daß sie ihre Angst um ihn immer wieder mit dieser dunklen Unübersichtlichkeit auf dem Platz vor ihrem Mietshaus verbände, so als hätte die Angst eine Farbe und einen Wohnort, als gäbe es nicht noch andere Gefahren, die ihn tagsüber oder im normalen Leben hätten ereilen können.
Doch nach der letzten Liebesnacht, die nur für ihn eine solche gewesen war, nach dieser, in seinen Augen mißglückten Lustnacht, für die er sich im nachhinein allein verantwortlich fühlte, obwohl sie dabei gewesen war, hatte Marlis nicht aus Sorge um ihn aus dem Fenster gesehen, sondern um sich von ihm abzuwenden, um ihm nicht ins Gesicht sehen zu müssen, während sie sich angeschwiegen hatten.
Daldossi stellte sich nun genau dorthin, wo sich Marlis angeblich so oft aufgehalten hatte, als er noch im Ausland unterwegs gewesen war, und er starrte jetzt wie sie, die Knie gegen den lauwarmen Heizkörper gedrückt, aus dem Fenster und war wie sie gänzlich unabgelenkt. Aber er malte sich nicht aus, was ihr alles zustoßen könnte, und der in der Dunkelheit der Nacht verschwundene Platz vor ihrem Mietshaus schuf nicht – wie Marlis immer sagte – Platz für besorgniserregende Gedanken, die um seine, Daldossis, gefährliche Reisen kreisten. Die Leere des Platzes erinnerte ihn vielmehr daran, daß sie nicht zu Hause war, daß sie so schnell nicht mehr zurückkommen würde.
Jeder tote Photograph, jeder tote Journalist, von dessen Schicksal sie aus den Medien erfahre, lasse sein Sterben wahrscheinlicher werden, hatte sie ihn angeschrien, als er wieder einmal bereit zur Abreise gewesen war.
Nun saß er zwar nicht mehr auf gepackten Koffern, aber ihr Verhältnis hatte sich dadurch auch nicht gebessert.
Das meiste in ihrem Leben, hatte sie ihm vor drei Tagen gestanden, sei auf Ablenkung ausgerichtet gewesen, auf Ablenkung von ihm, weil sie mit ihm fast nur noch die Angst um sein Leben verbunden habe. Sie habe auch dann noch Kriegsbilder im Kopf gehabt, Vorstellungen von Granateinschlägen, von Minenexplosionen und Gewehrsalven, wenn er nur in irgendwelchen Flüchtlingslagern gewesen sei.
Eine Frau wie Marlis dürfe man nicht zu lange allein lassen, hatte Vogel Daldossi gewarnt. Das Alleinsein bekomme ihr nicht. Sie war es aber gewesen, die Daldossi nach dem Studium ermuntert hatte, die Stelle bei Estero anzunehmen, allerdings ohne zu bedenken, daß er auf seinen Reportagen für das Hochglanzmagazin nicht nur Friedensländer bereisen würde. Marlis, hatte Vogel gesagt, brauche immer wieder das Gefühl, daß man vor ihr den Teppich ausrolle. Dabei haßte sie Teppiche, dachte Daldossi, selbst den im Badezimmer hat sie nur aus Sicherheitsgründen ausgelegt, nachdem sie auf den Fliesen ausgerutscht war.
Daldossi strich sich mit den Fingerspitzen seiner Rechten über die Stirnfalten.
Die alte Frau mit dem dreibeinigen Hund verließ in diesem Augenblick das Nachbarhaus, sie zog den humpelnden Spitz über den Platz. Daldossi sah vom Fenster aus, daß sie mit dem Tier redete, ohne es anzuschauen.
Einmal war Daldossi zufällig hinter der Frau und ihrem Hund hergegangen. Sie waren an dem abgezäunten Hinterhofspielplatz vorbeigekommen, in dem ein paar Mädchen gejuchzt hatten. Ich hasse Kinder, hatte Daldossi die Frau zu ihrem Spitz sagen hören.
Daldossi war stehengeblieben und hatte den Mädchen zugesehen, die auf engem Raum Fangen spielten. Jedesmal, wenn ein Mädchen ein anderes erwischt hatte, riß es heftig an dessen T-Shirt oder Rock, so daß die Kleidung verrutschte. Je mehr Haut sichtbar wurde, desto lauter kreischten die Mädchen. Kinder des Friedens.
Als Marlis nach diesem endgültigen Streit gegangen war, hatte sie sich wie in Zeitlupe zur Tür bewegt, als habe sie insgeheim gehofft, daß er sie noch einmal zurückrufen würde. Seine Härte, die sie ihm vorgeworfen hatte, weil er sie nicht auf Knien angefleht hatte, zu bleiben, war in dem Moment nichts anderes als Gleichgültigkeit gewesen – er hatte sich die indifferenten Gefühle bei der Arbeit antrainiert, ruhig zu bleiben in schwierigen Situationen, nichts Voreiliges zu unternehmen – erst als Marlis schon mehrere Minuten fortgewesen war, hatte er sich zum Fenster begeben, um ihr hinterherzusehen, hatte sich sogar hinausgelehnt, aber da war sie schon um die Ecke gebogen.
Es ließ sich nichts mehr ändern, auch nicht telephonisch, Marlis hatte das Handy ausgeschaltet. Besser so, denn ihr Ärger hatte die Wörter angesteckt. Sie hallten noch durch das Zimmer. Ein verantwortungsloser Egoist sei er. Ein Verdrängungsakrobat, der nur einen halben Meter über der Erde auf dem Liebesseil turne.
Die abnehmende Himmelshelligkeit draußen und die Stille im Wohnzimmer erinnerten Daldossi an ein Wort, das Henrik Schultheiß erfunden hatte: Graurauschen. Er hatte in der Nacht im Zelt, als sie auf Gaddafi gewartet hatten, von seinem Leben zu erzählen begonnen. Für Schultheiß war Graurauschen ein Zustand, der überall eintreten konnte, hervorgerufen durch eine leergetrunkene Minibar, durch Rostflecken in einer fremden Badewanne oder Risse in der Duschtasse, ausgelöst durch säuerlich riechende Bettwäsche oder durch das Surrren der Klimaanlage. Graurauschen, hatte Schultheiß gesagt, sei das, was nach einem Seelenbrand übrigbleibe, innere Dämmerung und Abwesenheit von ablenkenden Geräuschen.
Kennst du das auch, hatte Schultheiß ihn gefragt.
Zuviel Poesie sei schädlich.
Bei einer seiner letzten größeren Photoreportagen in Peking, in einem Hotel an einer der verkehrsreichsten Kreuzungen der Stadt, waren es die vielen Autos und Menschen gewesen, die bei Daldossi ähnliche Empfindungen der Verlorenheit und Nichtigkeit ausgelöst hatten; die Menschen, die aus den U-Bahn-Aufgängen herauskamen oder in sie hineinströmten, sahen aus dem fünfunddreißigsten Stockwerk wie gesichtslose Organismen aus. Nichts würde Daldossi gegen die Anonymität ausrichten können.
Das Graurauschen hatte auch ihn überwältigt. Vielleicht war es aber auch nur der fehlende Sauerstoff gewesen, die von Millionen Autos und vielen Kohlekraftwerken verursachte Luftverschmutzung, welche seinen Blick getrübt hatte.
Chinesen, die es sich leisten konnten, hatten sich mit schwedischen Luftreinigern eingedeckt.
Ich brauche einen Seelenreiniger, dachte Daldossi. Farben. Blumen.
Blödsinn.
Er haßte Pflanzen. Sie sollten dort wachsen, wo sie keine Pflege brauchten.
Als das Telephon klingelte, hoffte Daldossi, es würde Marlis sein, doch es war Vogel, der ihn treffen wollte.
Ich hätte mir denken können, daß du es dort draußen nicht aushalten wirst, sagte der Freund.
Zu viele Tiere, sagte Daldossi.
Und keine Frau, sagte Vogel.
Bevor ich den ganzen Tag am Telephon hänge –
Oder an der Flasche –
Ja, sagte Daldossi.
Er dachte an den italienischen Soldaten der internationalen Friedenstruppe SFOR, den er 1997 in Sarajevo kennengelernt und portraitiert hatte. Mit seinem Einkommen hätte der Mann mehrere Geschwister und die Eltern in Kalabrien ernähren können, aber fast die Hälfte seines Gehalts hatte er verwendet, um seiner Freundin hinterherzutelephonieren. War sie nicht sofort zu erreichen gewesen, hatte er sich mit Sliwowitz betrunken. Wenn diese Männer ihren Dienst als Soldaten, Polizeiausbildner, Sanitäter oder sonstwas im Ausland abgeleistet hatten und endlich nach Hause zurückkehren durften, fanden sie nicht selten ihre Freundinnen, Verlobten oder Ehefrauen in den Armen der Nachbarn, Cousins oder Schulfreunde.
Marlis hatte immer auf Daldossi gewartet. Fünfzehn Jahre lang. Jetzt, wo sie nicht mehr warten müßte, hatte sie ihn verlassen.
Hehe, sagte Vogel, hörst du mir überhaupt zu? Zweiundzwanzig Uhr?
Gut, sagte Daldossi. Wo?
Bar Wien?
Gibt’s nicht mehr.
Ich bin zu oft in Rom, sagte Vogel.
Automat Welt?
Meinetwegen.
Nachdem er das Gespräch beendet hatte, ging das Licht auf dem Display des Anrufbeantworters aus. Daldossi drückte auf eine der Pfeiltasten, um zu sehen, mit wem Marlis in der letzten Zeit telephoniert hatte, aber die Anrufliste war gelöscht.
Wie viele Stimmen und Sätze hatte das Gerät doch im Laufe der Jahre gespeichert, und wie glücklich war Marlis gewesen, als sie zwei Stunden nach ihrem Bewerbungsgespräch bei der Organisation Zwettlburg vom Vereinsvorstand angerufen und um einen Rückruf gebeten worden war.
Ich hab die Stelle, ich hab die Stelle. Daldossi erinnerte sich, wie Marlis den Hörer geküßt hatte.
Ihm fiel auch ein, wie sie beide, nachdem Marlis bei ihm eingezogen war, seine alte Ansage gelöscht und durch eine neue, gemeinsame ersetzt hatten. Mindestens fünf Anläufe hatten sie genommen, weil sie immer wieder in Gelächter ausgebrochen waren. Einmal verpaßte Daldossi seinen Einsatz, dann zwickte und kitzelte er Marlis, so daß sie losprustete.
Hatte sie auch die Ansage gelöscht? Er wußte, wie man die Aufzeichnungen wiedergab, jedoch nicht mehr, welche Auswahltaste man drückte, um die Ansage abzufragen.
Ihm kam die Idee, den Anrufbeantworter einzuschalten und mit dem Mobiltelephon die eigene Festnetznummer anzuwählen. Als Daldossi Marlis’ Stimme vernahm, die das Gegenteil von rauh und brüchig war – manchmal hörte sie sich an, als habe Marlis an etwas Süßem gelutscht und dabei die Mundhöhle eingespeichelt –, legte er auf.
Auf dem Flughafen von Tripolis hatte Schultheiß damals Daldossi mitgeteilt, daß seine Frau wenige Wochen zuvor Schluß gemacht hatte. Es habe nichts auf das Ende hingedeutet. Bei ihrem letzten gemeinsamen Urlaub in Apulien hätten sie sich in der Ferie d’agosto-Nacht die kleine Barockstadt Martina Franca angesehen. Plötzlich habe er Johanna in einen Hauseingang gestoßen und sich auf sie geworfen, weil jemand Feuerwerksraketen in den Himmel geschossen hatte. Seine Frau habe sich dabei das linke Bein gebrochen, sie sei durch seine Schuld unglücklich gestürzt. Er habe erst nach einigen Sekunden gemerkt, daß sie sich in einer Friedensregion befanden.
Daldossi hatte sich nie gefragt, wie die anderen über die Runden kamen, weil sie in seinen Augen am Morgen im Hotelspeisesaal oder Frühstückszimmer ausgeglichener wirkten als er, frischer, als hätten sie dieses Graurauschen und die Trostlosigkeiten ihrer Existenz einfach weggeduscht. Johanna war wie Marlis irgendwann nicht mehr ans Telephon gegangen, sie hatte von einem Tag auf den anderen nicht mehr geantwortet.
Im Gegensatz zu ihm war Schultheiß damals Tausende Kilometer von seiner Frau entfernt gewesen und hatte keine Möglichkeit gehabt, schnell mal bei ihr vorbeizufahren, sie zur Rede zu stellen oder sie in die Arme zu nehmen.
Das äußere Krisengebiet, in dem er sich gerade aufgehalten hätte, habe sich auf sein Inneres ausgeweitet, hatte Schultheiß erzählt, er sei von Stunde zu Stunde gleichgültiger und damit unvorsichtig geworden.
Diese Frauen wüßten nicht, was sie anrichteten, sie träfen aus einem abgesicherten Leben heraus Entscheidungen und berücksichtigten nicht den Umstand, daß ihre Männer in der Schußlinie standen.
Hatte Marlis deswegen mit ihrer Mitteilung gewartet, bis er nach Wien zurückgekehrt war?
Vor einer von Gewehrsalven durchlöcherten Fassade, deren Fensterscheiben mit undurchsichtigen Plastikplanen ersetzt wurden, steht eine junge Frau mit eingefallenen Wangen. Sie trägt ihr langes, glattes Haar im Nacken zusammengebunden. Neben ihr liegen ein paar zerschnittene Teile eines Baumstammes. Am rechten Bildrand steht ein ausgebrannter Renault 4. Die Frau hält dem Betrachter eine Kamera entgegen.
Junge Frau mit Kamera bittet um einen Film, Schwarzweißphotographie, Dobrinja/Sarajevo/Bosnien-Herzegowina, Winter 1992, veröffentlicht 2010 in War and suffering, Katalog zur gleichnamigen Ausstellung in der Galerie Klick.